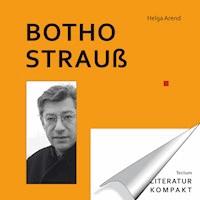
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Literatur kompakt
- Sprache: Deutsch
Helga Arend schafft mit diesem Literatur kompakt-Band einen breiten Überblick über Leben und Werk des zeitgenössischen Autors Botho Strauß, dessen Werk sowohl mit den höchsten deutschen Auszeichnungen versehen als auch aufs Heftigste verrissen wurde. Die Stücke des am häufigsten gespielten deutschsprachigen Dramatikers der Gegenwart werden weltweit von den bedeutendsten Regisseuren aufgeführt. Arend erläutert ausführlich, warum und inwiefern Botho Strauß' komplexes Werk aus dramatischen, epischen, lyrischen und essayistischen Texten ein Gesamtkunstwerk darstellt, das, Traditionen der Weltliteratur mit Mythen aus Antike und Christentum vernetzend, Zugänge zu einer neuen Welterkenntnis ermöglicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
LITERATUR KOMPAKT
Herausgegeben von Gunter E. Grimm
Helga Arend
BOTHOSTRAUß
Helga Arend, apl. Professorin, Dr. phil. habil., arbeitet als Literaturwissenschaftlerin am Institut für Germanistik der Universität Koblenz-Landau. Studium der Germanistik, Theologie und Pädagogik in Trier. Promotion 1993 zur Entwicklung der romantischen Liebeskonzeption bei Karl Eibl. Habilitation 2009 mit einer Arbeit zu Botho Strauß’ Werk von 1963 bis 1994. Weitere Publikationen zu Botho Strauß sowie Veröffentlichungen zu zahlreichen Themenbereichen: Märchen, Populäre Literatur und Kultur, Moderner Kurzfilm, Frauenbilder und Geschlechterrollen, Didaktik, Mediendidaktik, Kinder- und Jugendliteratur, Ingrid Nolls Kriminalromane, Karl May, Heinrich von Kleist, die Loreley, Rheinsagen, Leseförderung und Biographik.
Helga Arend
Botho Strauß
Literatur Kompakt – Bd. 8ISBN EPUB: 978-3-8288-5720-9ISBN MOBI: 978-3-8288-5721-6(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-3327-2 erschienen.)
© Tectum Verlag Marburg, 2014
Bildnachweis Cover: © Ruth Walz/Berlin, Abdruck mit freundlicher Genehmigung der UrheberinReihenkonzept und Herausgeberschaft: Gunter E. Grimm
Projektleitung Verlag: Christina SiegLayout: Sabine MankeLektorat: Volker Manz
Besuchen Sie uns im Internetwww.tectum-verlag.dewww.literatur-kompakt.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
INHALT
I. Bedeutung und Spektrum des Werkes
II. Zeittafel
III. Leben und Werk
Grafik: Strauß kompakt
Grafik: Wichtige Punkte
IV. Politische und ästhetische Ideale als Grundlagen des Werkes
1. Politische Einstellungen
2. Ästhetische Einstellungen
V. Dramen
1. Überblick über das dramatische Werk
2. Trilogie des Wiedersehens, 1977
3. Groß und klein. Szenen, 1978
4. Die Fremdenführerin, 1986
5. Schlußchor, 1991
6. Schändung. Nach dem Titus Andronicus von Shakespeare, 2005
7. Das blinde Geschehen, 2011
VI. Erzählwerk
1. Überblick über die Erzähltexte
2. Marlenes Schwester. Zwei Erzählungen, 1975
3. Der junge Mann, Roman, 1984
4. Die Unbeholfenen, Bewußtseinsnovelle, 2007
VII. Lyrik
1. Die Bedeutung der Lyrik
2. Unüberwindliche Nähe. Sieben Gedichte, 1976
3. Diese Erinnerung an einen, der nur einen Tag zu Gast war, 1985
VIII. Essays, Feuilletons und Fragmente
1. Überblick zu Kurzprosa, Essay und Fragment
2. Paare Passanten, 1981
3. Anschwellender Bocksgesang, 1993
4. Wohnen Dämmern Lügen, 1994
5. Die Fabeln von der Begegnung, 2013
6. Lichter des Toren. Der Idiot und seine Zeit, 2013
IX. Wirkung
X. Literatur
1. Werke von Botho Strauß
2. Andere Quellen
3. Bibliografien
4. Sammelbände
5. Forschungsliteratur zu Strauß
6. Weitere Forschungsliteratur
Glossar
Abbildungsverzeichnis
Caspar David Friedrich: Mönch am Meer, um 1810
I. Bedeutung und Spektrum des Werkes
Wegweiser einer modernen Dramatik
Botho Strauß gehört zu den bedeutendsten Autoren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. In den siebziger Jahren wurde er als Wegweiser einer modernen Dramatik gefeiert, dessen Stücke nicht nur in Deutschland zu den am meisten aufgeführten des avantgardistischen Theaters zählten; vor allem in Frankreich konnte er große Erfolge verbuchen. Seinen Werken wird immer wieder ein hohes ästhetisches Niveau attestiert, was nicht nur in zahlreichen Preisen, sondern auch in Aufführungen der besten Bühnen und Regisseure, wie zum Beispiel Peter Stein, Claus Peymann, Luc Bondy, Dieter Dorn und Matthias Hartmann, zum Ausdruck kommt. Die höchste Auszeichnung erhielt Strauß 1989 mit dem Georg-Büchner-Preis. 2006 wurden bei einer Umfrage unter Literaturkritikern Peter Handke und Botho Strauß als diejenigen deutschsprachigen noch lebenden Schriftsteller genannt, die die höchste Wertschätzung erfahren (vgl. Hage 2010, S. 92).
Bereits seine ersten Stücke erregten die Aufmerksamkeit sowohl des Publikums als auch der Kritiker. Ihm wurde nachgesagt, dass er die sozialen und politischen Probleme der siebziger Jahre kritisch und mit einem sehr genau beobachtenden Blick, der die prekäre Lage der Zeit durchschaue, darstellen könne. Nicht minder erfolgreich wie seine Dramen waren die Erzählungen und essayistischen Schriften, von denen man behauptete, sie fänden »kritische Formeln für den derzeitigen Menschheitszustand, die in ihrer Genauigkeit und bitteren Wahrhaftigkeit kaum zu übertreffen sind« (Blöcker 1981, S. 261). Nicht so stark ins Licht der Öffentlichkeit drangen hingegen seine Romane und seine Lyrik. Indem sie sich von der gesellschaftlichen Realität weit entfernten und mythische Elemente in den Mittelpunkt stellten, passten sie weniger in das Bild des Aufklärers und entlarvenden Kritikers, den man in Botho Strauß sah.
Der Eklat von 1993
Ein Artikel im Spiegel mit dem Titel Anschwellender Bocksgesang löste im Jahr 1993 einen allgemeinen Medieneklat aus. Linke Gesellschaftskritiker warfen Strauß vor, er vertrete darin rechtes bis braunes Gedankengut. Es gab fast keine Zeitung und keine politische Zeitschrift, die sich nicht in die über Monate hinziehende Debatte einmischte. Die Auseinandersetzung wurde dadurch erschwert, dass der Text sehr unterschiedliche Interpretationen zuließ und der Autor nichts zur Klärung der Diskussion beitrug, sondern sie durch ein gerichtliches Verfahren gegen die taz noch verschärfte. Verfolgt man die Entwicklung des Autors und seiner Texte, gelangt man unweigerlich zu der Frage, wie der linke Gesellschaftskritiker, der in den siebziger Jahren in seinen Stücken soziale Missstände aufdeckte, in den neunziger Jahren zu einem konservativen Ästheten werden konnte, dessen Formulierungen sich als rechtspopulistische Propaganda einordnen ließen.
Nach diesem allseits diskutierten Spiegel-Artikel zog sich Botho Strauß wieder aus der politischen Diskussion zurück und kehrte als Autor zu Stücken und Prosatexten zurück. Entsprechend wurde er zwar manchmal als konservativer Kulturkritiker eingestuft, aber seine literarischen Werke genossen im Großen und Ganzen wieder großes Ansehen, weil seine Dramen sowohl auf praktischen Theaterkenntnissen wie auch auf theoretischen Grundlagen aufbauen. Auch seine Essays und Erzählungen lassen auf einen sehr belesenen und äußerst gebildeten Autor schließen, der sich mit seinem Gegenstand bis in die tiefsten Dimensionen auseinandersetzt. Seine Texte verlieren auch nach Jahren nicht an Aktualität, sodass auch seine älteren Stücke erfolgreich aufgeführt werden.
Gesamtkunstwerk
Insgesamt ist das Werk von Botho Strauß überaus angesehen und sehr umfangreich; es hat viele Facetten und ruft immer wieder Diskussionen hervor. In fast allen Genres ist Strauß versiert und zeigt eine große Sicherheit, obwohl er seine Reputation in erster Linie den Dramen und Prosaskizzen verdankt. Seine Medienwirksamkeit hat er im Bereich des Zeitungsartikels bewiesen. Angesichts dessen möchte ich hier die These aufstellen, dass es sich bei seinem Œuvre nicht um ein divergierendes Changieren zwischen unterschiedlichen Idealen handelt, das von der linken Kritik bis zum rechten Ästhetizismus reicht. Vielmehr liegt ein bewusst gesetztes Gesamtkunstwerk vor, dessen Zentrum die Frage ist, inwieweit Kunst Erkenntnis möglich macht.
Themen
Die verschiedenen Genres erhalten unterschiedliche Gewichtungen im Rahmen des Lebenswerkes von Botho Strauß. In allen Gattungen geht es um ähnliche Fragen, die wesentliche Themen des Menschseins – wie Paarbeziehungen, Fremdheit in der Welt, Theorien der Wissenschaft und die Möglichkeit von Erkenntnis – umkreisen. Seine Texte stellen Ästhetik und die Tradition der Kunst eindeutig in den Mittelpunkt. Dies zeigt sich daran, dass sie wichtige Kunstwerke der Kulturgeschichte, seien es Texte, Bilder, Filme und Theaterkonzepte, thematisieren, aufgreifen und in einer Weise transformieren, dass sie in dem neu entstandenen Text aufgehen. Mythen und religiöse Überlieferungen aus allen Teilen der Erde gehören in das Repertoire, mit dem Strauß sich auseinandersetzt.
Strauß reiht sich mit seinen Texten in die Traditionen der ‚hohen‘ Kunst der abendländischen Kulturgeschichte ein, die nicht vom Publikumsgeschmack abhängig ist. Hier können Bezüge zu Theodor W. Adorno hergestellt werden, der die Kunst der Massen, die den Gesetzen des Kapitals unterliegen, von echter Kunst unterscheidet. Diese hat zwangsweise elitären Charakter. Anja Richter zieht Vergleiche zum gnostischen Gedankengut, das sowohl bei Adorno als auch bei Strauß deutlich werde (vgl. Richter 2010, S. 46ff.). In der Gnosis, einer sich in der nachchristlichen Antike herausbildenden religiösen Geheimlehre mit philosophisch-spekulativen Elementen, geht man ebenfalls davon aus, dass sie nur für wenige Auserwählte zugänglich sei. Bei Strauß bezieht sich dies aber auf die Kunst.
Sinnbild und Gründungsmythos des elitär-privilegierten Diskurses eines hochkulturellen »westlichen Abendlandes«: Raphaels Die Schule von Athen aus dem Jahr 1509, dessen Zentrum die Figuren von Platon und Aristoteles bilden. Das Fresko setzt zugleich die große Bedeutung des Dialogs für die Erkenntnissuche und damit auch das Ereignis von Sprache ins Bild.
Ringen mit der Sprache
So ist Strauß’ Literatur ein Ringen mit der Sprache und ihren Ausdrucksmöglichkeiten. Sie ist ein Versuch, alle ästhetischen Möglichkeiten, die Texte und Bühne bieten, auszuschöpfen, um zu wahren Erkenntnissen zu gelangen. Es geht nicht darum, Sprache als Mittel zu verwenden. Vielmehr ermöglicht Kunst wie die Ästhetik der Sprache eine Annäherung an Erkenntnisse, die nicht auf einer rationalen Ebene liegen. Innerhalb des Gesamtwerkes kann man eine Abstufung erkennen. Sie reicht von Zeitungstexten, die noch relativ nah an der begrifflichen alltagssprachlichen Funktion von Sprache liegen, über Essayistisches, Prosaskizzen und Dramen sowie über Erzählungen, die Novelle und den Roman bis hin zu den wenigen, schwer verständlichen Gedichten. Je weniger sich der Text auf Anhieb in ‚Normalsprache‘ übersetzen lässt, desto höher kann sein ästhetischer Reiz und seine erkenntnistheoretische Idee angesetzt werden.
Die Texte, die diesem Anliegen am ehesten entsprechen, gleichen den Briefen einer seiner Figuren, die folgendermaßen beschrieben werden: »Unlesbare Schönheiten. Freie, völlig entbundene Schrift. Ohne Linie, ohne Gesetz und Bedeutung. Ohne Adresse und doch eine einzige weitschweifige Anrede« (NA, 1990, 187). Literatur wird zu Ästhetik und Sprache zu Kunst. Damit rückt sie in die Nähe von Musik oder Malerei, weil Sprache nicht Medium oder Funktion ist, sondern selbst zum Mittelpunkt wird. Strauß drückt dies folgendermaßen aus: »Die Sprache ist ein großes kulturelles Feld, in das man sich versuchsweise hineinbewegt« (Hage 1987, S. 195). Die Sprache und die Gestaltung des literarischen Textes werden zu neuen Mitteln des Erkennens, sodass der künstlerische Ausdruck und nicht der Künstler selbst in den Blick der Betrachtung geraten. Seine Person, von der nur sehr wenig bekannt ist, versucht Botho Strauß aus dem Werk und dem öffentlichen Medieninteresse herauszuhalten.
Blick auf Strauß’ Geburtsstadt Naumburg, 1950
II. Zeittafel
1944
2. Dezember: Geburt in Naumburg an der Saale. Vater: Berater der pharmazeutischen Industrie (freiberuflich)
1950
Umzug (über Berlin) nach Remscheid (Volksschule)
1954
Umzug der Familie nach Bad Ems an der Lahn; Schule und Gymnasium in Bad Ems; ein Gymnasiallehrer vermittelte ihm die ersten Begegnungen mit dem Theater durch Ausflüge, wobei er Jutta Lampe am Wiesbadener Staatstheater auftreten sah
1963
Schützenehre. Erzählung. In: Prosa Alphabet. Hg. von Viktor Otto Stomps (als selbständige Erzählung 1974)
1964
Studium der Germanistik, Theatergeschichte und Soziologie in Köln und München (sechs Semester); Beginn einer Doktorarbeit über Thomas Mann und das Theater
Arbeit an den Münchner Kammerspielen als Statist
1967
Abbruch des Studiums
Assistenz bei August Everding für die Ruhrfestspiele in Recklinghausen
Bekanntschaft mit Henning Rischbieter
Redakteur und Theaterkritiker bei der Zeitschrift Theater heute (bis 1970)
1970
Dramaturgischer Mitarbeiter bei der Schaubühne am Halleschen Ufer in Berlin; Arbeit als freier Autor in Bad Ems (bis 1975)
1971
Zusammen mit Peter Stein Bearbeitung des Peer Gynt
1972
Bekannte Gesichter, gemischte Gefühle (UA 1972; erschienen 1979)
Die Hypochonder (UA 1972; erschienen 1979)
Zusammen mit Peter Stein Bearbeitung des Prinz Friedrich von Homburg
Gerda (unveröffentlichtes Drehbuch)
1973
Bearbeitung Das Sparschwein von Eugen Labiche
1974
Dramatikerpreis der Stadt Hannover
1975
Zusammen mit Peter Stein Bearbeitung Sommergäste (Drehbuch)
Marlenes Schwester / Theorie der Drohung. Zwei Erzählungen
1976
Trilogie des Wiedersehens. Theaterstück
Unüberwindliche Nähe. Sieben Gedichte
Stipendium der Villa Massimo in Rom
Altbauwohnung in Berlin (Wohngemeinschaft), Keithstraße 8; die Mitbewohner verlassen im Laufe der Zeit die Wohngemeinschaft und Strauß bleibt alleine in der Wohnung bis 1992
1977
Freier Schriftsteller
Die Widmung. Erzählung
Förderpreis des Schiller-Preises des Landes Baden-Württemberg
1978
Groß und klein. Szenen. Mit diesem Stück Durchbruch als anerkannter Dramatiker sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum
1980
Rumor. Roman
Fahrtland (Gedichte)
Deutscher Schallplattenpreis, Sparte Literatur
Anfang der achtziger Jahre einige Monate Job als Gärtnergehilfe in München
1981
Kalldewey, Farce (Stück)
Paare, Passanten (Prosa)
Großer Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste
1982
Mülheimer Dramatikerpreis für Kalldewey Farce
1983
Der Park. Schauspiel
1984
Jeaninne (Dialogskizzen zu Der Park)
Der junge Mann. Roman
1985
Diese Erinnerung an einen, der nur einen Tag zu Gast war. Gedicht
1986
Die Fremdenführerin. Stück in zwei Akten
1987
Niemand anderes (Prosa)
Molières Misanthrop (Bearbeitung für Luc Bondy)
Jean-Paul-Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste
1988
Besucher. Komödie
Die Zeit und das Zimmer (Stück)
Sieben Türen (Stück)
1989
Fragmente der Undeutlichkeit: Jeffers Akt; Sigé (Prosa)
Kongreß. Die Kette der Demütigungen. Roman
Isolationen (Notizen)
Verleihung des Büchner-Preises. Das Preisgeld stiftet Strauß, um das Werk Hans Henny Jahnns zu unterstützen
Die Erde ein Kopf (Büchnerpreisrede)
Jeffers-Akt (Hörspiel)
1990
Der Aufstand gegen die sekundäre Welt (Essay)
1991
Schlußchor. Drei Akte
Angelas Kleider. Nachtstück in zwei Teilen
Geburt eines Sohnes (Jahr nicht ganz sicher)
1992
Umzug in eine Wohnung am Kurfürstendamm
Beginnlosigkeit. Reflexionen über Fleck und Linie (Prosa)
1993
Anschwellender Bocksgesang (Essay) im Spiegel
Das Gleichgewicht. Stück in drei Akten
Berliner Theaterpreis der Stiftung Preußische Seehandlung
Haus in der Uckermark in Grünheide (NEG, 2001, 852)
1994
Wohnen Dämmern Lügen (Prosa)
1996
Ithaka. Schauspiel nach den Heimkehr-Gesängen der Odyssee
Der Pol (Bearbeitung nach Vladimir Nabokov)
1997
Die Fehler des Kopisten (Prosa)
1998
Jeffers-Akt I und II
Die Ähnlichen. Moral Interludes (Theaterstück)
Der Kuss des Vergessens (Theaterstück)
1999
Lotphantasie (Stück)
Der Gebärdensammler (Texte zum Theater)
2000
Das Partikular (Prosa)
2001
Der Narr und seine Frau heute abend in Pancomedia (Theaterstück)
Lessing-Preis
2002
Unerwartete Rückkehr (Theaterstück)
2003
Die Nacht mit Alice, als Julia ums Haus schlich (Prosa)
2004
Der Aufstand gegen die sekundäre Welt – Bemerkungen zu einer Ästhetik der Anwesenheit (Essaysammlung)
Peer Gynt (Neubearbeitung)
Der Untenstehende auf Zehenspitzen (Prosa)
2005
Die eine und die andere (Theaterstück)
Schändung. Nach dem »Titus Andronicus« von William Shakespeare (Theaterstück)
2006
Mikado (Prosa)
Der Mittler. Mit Lithographien von Neo Rauch
2007
Die Unbeholfenen. Bewußtseinsnovelle
Schiller-Gedächtnispreis des Landes Baden-Württemberg
2009
Vom Aufenthalt (Prosa)
Nationalgalerie. Bilder von Thomas Demand mit Texten von Botho Strauß
2011
Das blinde Geschehen (Stück)
Leichtes Spiel (Stück)
2012
Sie/Er. Erzählungen ausgewählt von Thomas Hürlimann
2012
Dramaturgie zu Harold Pinter: Die Heimkehr (Inszenierung von Luc Bondy in Paris)
2013
Die Fabeln von der Begegnung
Strauß lebt in der Uckermark im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin; außerdem Wohnung in Berlin-Charlottenburg (laut Spiegel 2013)
Lichter des Toren. Der Idiot und seine Zeit (Prosa)
2014
Herkunft (Prosa)
2. Dezember: Botho Strauß wird 70 Jahre
Impressionen aus dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
Aufnahme aus dem Landkreis Barnim, 2011 Werbellinsee bei Eberswalde, 2007
Lebensstationen der Kindheit und Jugend
Remscheid (hier: Bismarckstraße), 1955
Bad Ems, historische Ansicht
III. Leben und Werk
Kindheit und Jugend
Botho Strauß wurde am 2.12.1944 in Naumburg an der Saale (Thüringen) geboren; seine Familie zog 1950 nach Remscheid und 1954 nach Bad Ems, wo er das Gymnasium besuchte. Bereits in dieser Zeit wirkte er als Schauspieler bei Schultheateraufführungen mit. Sein Vater, der Berater der pharmazeutischen Industrie war, arbeitete freiberuflich, sodass er die meiste Zeit zu Hause am Schreibtisch verbrachte. Er war Herausgeber einer Zeitschrift und publizierte ein Buch über gesunde Lebensführung.
Studium
Nach dem Abitur studierte Strauß ab 1964 sechs Semester Germanistik, Theatergeschichte und Soziologie in Köln und München. Er begann eine Doktorarbeit über Thomas Mann, einen Lieblingsautor des Vaters, und Manns Beziehung zum Theater; die Arbeit wurde aber nicht abgeschlossen. Sein Interesse für die Bühne äußerte sich in Engagements als Schauspieler auf Laienbühnen, bei denen er praktische Theatererfahrungen sammeln konnte. Nach dem Studium wurde er Regieassistent bei August Everding in Recklinghausen und von 1967–1970 Redakteur und Kritiker bei der Zeitschrift Theater heute. Dessen Herausgeber, Henning Rischbieter, sieht Strauß als eine Art Lehrer an. In dieser Zeit entstanden sehr viele Rezensionen und Aufsätze über Theateraufführungen, die später in dem Band Versuch, politische und ästhetische Ereignisse zusammenzudenken noch einmal versammelt wurden.
Anfänge als Dramaturg und freier Schriftsteller
1970 wechselte Strauß zur Schaubühne am Halleschen Ufer in Berlin. Sie galt damals als Vorreiter des avantgardistischen Theaters in Deutschland, weil sie sich als ein Theater etablierte, das alle Mitarbeiter in die Planungen einbezog. Dieser demokratisierenden Tendenz entsprach allerdings weniger die Selbstinszenierung als elitäre soziale Gruppe, die sich als intellektuelle Theatermacher verstanden sehen wollte (vgl. Fiebach 1998, S. 268). Ein Angebot, im Direktorium mitzuarbeiten, lehnte Strauß ab. Stattdessen ging er wieder nach Bad Ems, um freier Schriftsteller zu werden. Peter Stein, der wichtigste Regisseur der Schaubühne, bat ihn, als freier Produktionsdramaturg bei ihm mitzuwirken. Stein, mit dem Strauß gemeinsam vier Inszenierungen gestaltete, wurde ihm ein wichtiges Vorbild. 1976 zog Strauß nach Berlin in eine riesige Altbauwohnung. Hier lebte er zuerst in einer Wohngemeinschaft, dann allein und zeitweise mit einer Frau zusammen (vgl. Hage 1987, S. 208).
Strauß’ langjährige Wohnstätte in Berlin, Keithstraße 8, 2014
Seit 1963 begann Strauß erste Prosatexte zu schreiben, von denen nur die Erzählung Schützenehre veröffentlicht wurde: »Zeitschriften wie Akzente schickten seine Arbeiten wieder zurück« (Hage 1987, S. 189). Aber sein dramatisches Werk wurde ab 1974 immer angesehener. So erhielt er in diesem Jahr für sein Stück Bekannte Gesichter, gemischte Gefühle den Dramatikerpreis der Stadt Hannover. 1976 bekam er das Stipendium der Villa Massimo in Rom. Als freier Schriftsteller konnte er ab 1977 mit Die Widmung erste Erfolge als Erzähler verzeichnen. Ein Durchbruch gelang ihm mit Groß und klein, das als eines der wichtigsten Stücke der siebziger Jahre gefeiert wurde. Als weitere Auszeichnungen sind zu nennen: der Förderpreis des Schiller-Preises des Landes Baden-Württemberg (1977), der Deutsche Schallplattenpreis, Sparte Literatur (1980), der Große Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste (1981), der Mülheimer Dramatikerpreis für Kalldewey, Farce (1982), der Jean-Paul-Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste (1987), der Berliner Theaterpreis der Stiftung Preußische Seehandlung (1993), der Lessing-Preis (2001) und der Schiller-Gedächtnispreis des Landes Baden-Württemberg (2007). Den bedeutendsten Literaturpreis im deutschsprachigen Raum, den Georg-Büchner-Preis, erhielt er im Jahr 1989.
Das Hauptgebäude der Villa Massimo in Rom, 2005
Einzelgänger Strauß
Nach der politischen Wende 1989 zog Strauß sich noch weiter zurück und baute sich zusätzlich zur Stadtwohnung in Berlin ein Haus in der Uckermark. Heute wohnt er im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin (Spiegel 2013), wo er die Möglichkeit hat, ausgiebig die einsame Seenlandschaft zu erwandern. Zeitweise war sein Sohn, der 1997 eingeschult wurde, bei ihm. Über Frauen in Botho Strauß’ Leben ist wenig bekannt. 2011 war er verheiratet (Die Presse, 3.2.2011). Seine Mutter, die in einem Altenheim in Bad Ems wohnte und im Frühjahr 2006 verstarb, besuchte ihn manchmal für einige Zeit in seinem Haus in der Uckermark. Wenn er sich in Berlin aufhält, hat er eine Wohnung in Charlottenburg.
Zu Strauß’ Biografie gibt es wenig Material, da er seine Person der Öffentlichkeit bis auf einige Ausnahmen vorenthält. Lesereisen unternimmt er nicht, zu den Uraufführungen seiner Stücke erscheint er nicht, und er gibt selten Interviews. Zu den Preisverleihungen erscheint Strauß nicht persönlich, außer wenn sie nicht öffentlich stattfinden; die Dankesrede zur Verleihung der höchsten Auszeichnung für deutschsprachige Literatur liest sein Freund Luc Bondy, der auch die Lobrede (Bondy 1989) hält. Volker Hage ist einer der wenigen Journalisten, die Strauß zu einem Interview oder Gespräch verleiten konnten. Es werden unterschiedliche Motive für diese Zurückhaltung des Autors genannt. Für Willi Winkler ist er ein gewiefter Medientheoretiker, der weiß, »daß auch der frömmste Anachoret keiner ist, solange er seine Einsiedelei nicht ins Bild gerückt hat« (Winkler 1997). Der Regisseur Luc Bondy, ein Freund von Botho Strauß, führt es hingegen auf seine Scheu zurück, dass er nicht zur Verleihung des Büchner-Preises 1989 gekommen sei (vgl. Bondy 1989). Strauß sagt von sich selbst, er empfinde es als persönliches Defizit, nicht in Gesellschaft von mehreren Menschen reden zu können: »Es gibt Menschen, die ein forensisches Talent haben. Sie sind in ihrer Intelligenz besser und klarer, wenn sie vor Menschen sprechen. Ich gehöre extrem zu der anderen Sorte« (Hage 1987, S. 190). Seine Zurückhaltung erlebt er selbst sogar in manchen Situationen als ein nicht überwindbares Handicap. So lehnte er eine Einladung nach China ab, obwohl er gerne hingefahren wäre, als er hörte, er solle dort als deutscher Autor auftreten. Seine Scheu stellt Hage zufolge eine »tiefe psychopathische Verwirrung, eine Behinderung« (Hage 1987, S. 208) dar. Auch eine Einladung zu Richard von Weizsäcker sei für ihn sehr problematisch gewesen, weil er dort zusammen mit Günter Grass, Wolf Biermann und Hans Magnus Enzensberger ein Gespräch führen sollte. Er »könne sich nur mit einer Person unterhalten, das sei seine Eigenart« (Oberender 2004, S. 176).
Luc Bondy, 2013
Rolle des Schriftstellers
Die Person Botho Strauß, die sehr zurückhaltend und eher bescheiden wirkt, tritt entschieden anders auf als der Schriftsteller, der mit klaren und selbstsicheren Beschreibungen die sozialen und politischen Zustände der siebziger Jahre einordnet, bewertet und kritisiert. Strauß geht aber noch weit darüber hinaus. Er weist dem Schriftsteller die Aufgabe zu, Erkenntnisse, die mit dem Verstand nicht greifbar sind, zu vermitteln, so wie sie in früheren Zeiten nur der Priester an das Volk weitergeben konnte. Strauß spricht vom Künstler als dem Versprengten und Ausgesonderten, der gegen die große Masse auftritt, um zu einer anderen Wahrheit als der der Medien und des Mainstreams zu gelangen. Der Dichter steht in einer herausgehobenen Position über den anderen Menschen, weil die Ästhetik eine Art Gegenwelt zur Alltagswelt darstellt. Diese andere Welt findet man im Mythos, in der Religion und in der Ästhetik. Sie kann laut Strauß nur der Künstler, der einen ästhetischen Fundamentalismus vertritt, richtig erkennen und vermitteln. Strauß selbst formuliert das in einem Interview folgendermaßen:
Der Künstler als ein weitblickender Einzelner inmitten von Symbolen der europäischen Kulturgeschichte: Johann H. W. Tischbeins »Goethe in der Campagna« (1787).
Alles, was heute ans Transzendente und Theologische rührt, verabscheut unsere kritische Spaßintelligenz. Dass der Gedankenreichtum, der über die Jahrhunderte hinweg in der Theologie versammelt ist, heute so gut wie nie in die intellektuelle Auseinandersetzung geholt wird, halte ich für ein großes Versäumnis. Nun bin ich ja kein Theologe. Ich präzisiere lediglich das Detail aus einer transzendenten Gestimmtheit (Greiner 2000).
Botho Strauß bedauert offensichtlich den allgemeinen Verzicht der Gesellschaft auf Mythos, Religion und Ästhetik, hat der doch dazu geführt, dass Riten, religiöse Handlungen und künstlerische Gestaltungsformen als unnötiges und überflüssiges Beiwerk gesehen werden.
Hier sieht sich Botho Strauß in der Position des Vereinzelten, der sich gegen die große Masse wenden muss. In seinem Werk erscheinen immer wieder in allen möglichen Facetten Eremiten und Sonderlinge. Mit ihnen identifiziert sich Strauß eher als mit denen, die das normale Leben verkörpern. Die Ausgesonderten sind immer diejenigen, die zu höheren Erkenntnissen fähig sind, während die meisten Menschen in seinen Texten als oberflächlich dargestellt werden. Diesen Grundgedanken findet man durchgehend in allen seinen Texten, von der Lyrik bis zum Zeitungsartikel. Er durchzieht Strauß’ Werk, das von einigen wenigen Grundthemen geprägt wird. Seit Beginn seines Schreibens konstatiert Strauß die Kommunikationslosigkeit bzw. das Nichtkommunizieren zwischen den Menschen. Sprache erscheint hier als ein Mittel des Missverstehens: Obwohl die Figuren in den Dramen häufig sehr viel reden, können sie sich nicht einander annähern, ihre Gespräche bleiben an der Oberfläche und sind für das Gegenüber nicht einzuordnen, weil die gesamte Welt, in der sie leben, eine Welt ohne Tiefe ist. Diese Scheinwelt steht einer anderen Welt gegenüber, die nur schwer fassbar und erkennbar ist und die nur in wenigen Situationen als wahre Welt erscheint. Hier versagt die Sprache, die dieses ‚Andere‘ formulierbar machen möchte. Der Künstler beziehungsweise Schriftsteller kann nur in den Formen der Traditionen, aus deren Scherbenhaufen er zitiert, die Welt so darstellen, wie sie ‚eigentlich‘ ist.
Die Schwierigkeiten der Kommunikation werden besonders in den Paarbeziehungen deutlich. In ihnen treten sie eklatant zutage, da hier die Hoffnung auf das gute Gelingen des gegenseitigen Einverständnisses besonders hoch ist. Aber auch Liebe ist nur in absoluten Ausnahmefällen möglich, und dies eher dann, wenn keine Gespräche oder Unterhaltungen zwischen den Partnern stattfinden, oder paradoxerweise erst dann, wenn die Beziehung längst beendet ist.
Gesamtkunstwerk
Kernthemen in seinen Texten sind – abgesehen von der Suche nach Erkenntnis durch die Sprache – andere Formen, zu wahren Erkenntnissen zu gelangen, zum Beispiel durch Liebe, durch Mythos oder durch Kunst. Das gesamte Werk von Botho Strauß kreist von Anfang an um die Möglichkeit der Erkenntnis durch Ästhetik. Das Gesamtwerk erscheint so als ein Versuch, immer neue Möglichkeiten des Ausdrucks zu finden, um das ‚Andere‘, das nicht durch ‚normale Sprache‘ darstellbar ist, aufzuzeigen. Zugleich wird aber deutlich, dass dieses ‚Andere‘ nicht festzuhalten ist, sondern letztlich nur durch das große Schweigen ausgedrückt werden kann. Es ist somit ein nie endender Versuch, der letztlich die Wahrheit umkreist. Der Schriftsteller greift dabei zurück auf eine lange Tradition von Kunstwerken, die das gleiche Ziel verfolgten. Wie Geum Hwan Choo anhand der Dramen nachgewiesen hat, ist es für Strauß ein zentrales Anliegen, seine Texte in ein Netz von Intertextualität einzubauen (vgl. Choo 2006, S. 3). So reiht sich die einzelne Szene oder der einzelne kleine Prosatext in einen Gesamttext, der wie eine Sammlung wirkt. Das einzelne Stück, das den immer gleichen Fragen nachgeht, passt in das Konzept des Gesamtkunstwerkes, das auf allen Ebenen des sprachlichen Ausdrucks versucht, den tieferen Erkenntnissen des Lebens zu folgen.
Ausschnitte aus Richard Wagners Das Kunstwerk der Zukunft, das im 19. Jahrhundert den Begriff des Gesamtkunstwerkes in der Kunsttheorie populär machte (Wagner 2005):
»Tanzkunst, Tonkunst und Dichtkunst sind vereinzelt jede beschränkt; in der Berührung ihrer Schranken fühlt jede sich unfrei, sobald sie an ihrem Gränzpunkte nicht der anderen entsprechenden Kunstart in unbedingt anerkennender Liebe die Hand reicht.Schon das Erfassen dieser Hand hebt sie über die Schranke hinweg«.(S. 69)
»Durch dieses aufrichtigste, gegenseitige Durchdringen, Erzeugen und Ergänzen aus sich selbst und durch einander, der einzelnen Künste […] wird das einige Kunstwerk der Lyrik geboren: in ihm ist jede [Kunst], was sie ihrer Natur nach sein kann; was sie nicht mehr zu sein vermag, entlehnt sie nicht egoistisch von der anderen, sondern die andere ist es selbst für sie. Im Drama, der vollendeten Gestaltung der Lyrik, entfaltet jede der einzelnen Künste aber ihre höchste Fähigkeit […]. Im Drama ist sich der Mensch nach seiner vollsten Würde künstlerischer Stoff und Gegenstand zugleich«. (S. 75)
Schon zu Beginn seiner dramatischen Arbeiten wurde die bildende Kunst als Ausdrucksmittel mit einbezogen. In den letzten Jahren werden seine Texte auch zusammen mit Bildern publiziert, sodass schon die einzelnen Bände Gesamtkunstwerke darstellen, wie zum Beispiel die Publikationen zusammen mit Gerhard Richter und Neo Rauch. Diese neue Publikationsform lässt sich gut in den Zusammenhang des übrigen Werkes von Strauß einordnen; auch hier haben wir den Versuch einer Antwort auf die Frage nach der Wahrheit, wie sie sich ganz allgemein stellt. »Das Konzept ‚Gesamtkunstwerk‘ steht für die […] Versuche Einzelner, den alten Traum der Darstellung eines ‚Ganzen‘ wachzuhalten« (Brock 1986, S. 59). Roger Fornoff hat den Begriff des Gesamtkunstwerkes definiert, indem er ihm vier Strukturelemente zuordnet. Diese vier Elemente passen jeweils auf das Werk von Strauß. Zum einen handelt es sich um
»das konkrete inter- oder multimediale, also unterschiedliche Künste oder ästhetisch-mediale Elemente vereinende bzw. neu legierende Kunstwerk. Dieses steht nicht nur für sich selbst, sondern weist über sich hinaus auf einen umfassenden Welt- oder Geschichtsentwurf« (Fornoff 2004, S. 20).
Da vieles in Strauß‘ Biografie unbekannt oder schwer datierbar ist, sind auch seine Aufenthalte an anderen Orten Deutschlands oder der Welt nicht lokalisierbar. Dass Strauß die hier grafisch vernebelten Teile der Welt nicht kennengelernt hat oder dass es nicht noch weitere Orte gibt, die eine biografische Bedeutsamkeit für ihn erworben haben, kann daraus natürlich nicht geschlossen werden.
Vereinigung der Künste
Bildende Kunst, Film oder Fotografie spielen in vielen Texten von Strauß eine zentrale Rolle – auch und gerade in Zusammenhang mit der Erkenntnis von Wahrheit als Ganzes. Den zweiten Punkt, den Fornoff als Merkmal nennt, betrifft »eine Theorie oder zumindest eine bestimmte Vorstellung von der idealen Vereinigung der Künste« (Fornoff 2004, S. 20). Gerade in seinen letzten Werken werden die verschiedenen Künste zusammen präsentiert und vereint. Zu Strauß’ Werk passt auch das dritte Kriterium:
»[…] ein in unterschiedlicher Weise, etwa gesellschaftstheoretisch, geschichtsphilosophisch oder metaphysisch-religiös akzentuiertes Bild vom Ganzen und damit verbunden eine durch die jeweiligen weltanschaulichen Prämissen gespeiste zumeist radikale Kultur- und Sozialkritik« (Fornoff 2004, S. 20).
Das Bild, das Strauß von der Realität zeichnet, ist eng verbunden mit einem zutiefst kulturpessimistischen Blick, der wiederum ergänzt wird durch
»eine in unterschiedlichem Maße konkretisierte ästhetisch-soziale oder ästhetisch-religiöse Utopie. Ihr liegt das Bestreben zugrunde, den als defizitär erkannten Welt- oder Gesellschaftszustand durch die Kraft der Kunst zu überwinden und einen neuen weltanschaulich-sozialen oder mystischreligiös bestimmten Einheitszusammenhang zu generieren […]. Anzumerken ist, daß eine Gesamtkunst-Utopie, auch wenn politische, soziale oder religiöse Elemente eine wesentliche Rolle spielen, immer explizit ästhetisch bleibt« (Fornoff 2004, S. 20f.).
Erlösung durch die Kunst
Ein solches Konzept liegt meines Erachtens auch Botho Strauß’ Werk zugrunde. Dies wird daran deutlich, dass seine Texte um die gleichen Urthemen kreisen, wobei die Kunst als eine Erlösungsmetapher im Zentrum steht. Strauß selbst sagt in einem Interview mit Volker Weidermann, er schreibe »im Grunde immer am selben Buch. Die neuen seien nur Verbesserungsversuche der schon geschriebenen (Weidermann 2004, S. 23). Auch Thomas Oberender stellt fest, dass die Motive und Grundhaltungen seines ästhetischen Denkens unverändert geblieben seien (vgl. Oberender 2004, S. 20).
Ein gutes Beispiel für dieses Konzept der Vermischung der Künste und den Bezug zu den immer gleichen Themen ist die Ausstellung Nationalgalerie von Thomas Demand und Botho Strauß. In ihr wurden Werke von Demand in Kombination mit kurzen Texten von Botho Strauß gezeigt. Demand benutzt hier seine typische Schaffensweise, indem er aus Pappmachee riesige, sehr realistisch erscheinende Orte aufbaut, die er fotografiert und danach wieder zerstört. Dadurch entstehen Bilder, die zwar realitätsbezogen wirken, aber eine gewisse Starrheit aufweisen, was ihnen wiederum einen magischen oder mythischen Charakter verleiht. Neben dem Bild Lichtung von Demand (2003, C-Print/Diasec, 192x495), das einen recht dunklen Laubwald mit hellen Strahlen, die durch das Laub scheinen, zeigt, steht folgender Text:
Es ist so, daß die meisten in der großen Höhle die Wand vollmalten mit scheinbaren Menschen und illusionären Gästen. Doch einer, der niemals malte, sondern tastete, fand irgendwann die einzige Stelle, an der man die Wand durchschreiten kann … und nun traten die Erschöpften allesamt hinaus in eine unvertraute aufgeräumte Welt (Demand 2009).
Sowohl im Bild als auch im Text spielt die Lichtmetapher eine große Rolle. Licht als Symbol verweist auf das Göttliche, auf das Immaterielle. In allen Religionen werden die Götter mit dem Licht in Verbindung gebracht. In der Spiritualität ist das Licht auch Grundlage des rechten Sehens und der Erkenntnis. Die Entstehung der Welt wird in vielen Mythen als Überwindung der Finsternis gesehen. Es gibt die Vorstellung des ewigen Kampfes zwischen Licht und Finsternis, der auch als Kampf zwischen Chaos und Ordnung umschrieben wird.





























