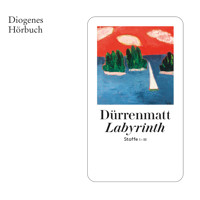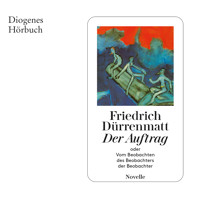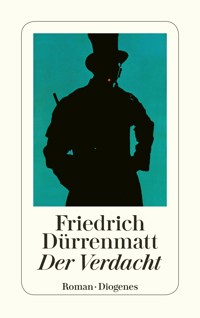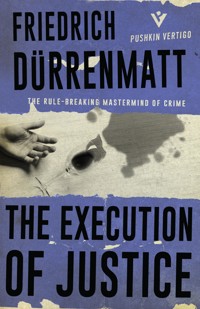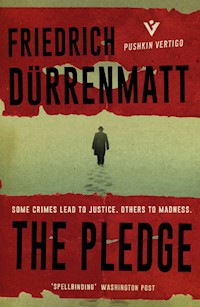9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Essays, Gedichte und Reden über Literatur und Kunst: Über Else Lasker-Schüler, über Lieblingsgedichte, über den Sinn der Dichtung in unserer Zeit, über die Schriftstellerei als Beruf, über den Film im Verhältnis zur Schriftstellerei, über Balzac, über Paul Flora, über Varlin, über Tomi Ungerer, über die eigenen Bilder und Zeichnungen und vieles mehr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Friedrich Dürrenmatt
Literatur und Kunst
Essays, Gedichte, Reden
Diogenes
Autobiographisches
Vom Anfang her
1957
Ich wurde am 5. Januar 1921 in Konolfingen (Kanton Bern) geboren. Mein Vater war Pfarrer, mein Großvater väterlicherseits Politiker und Dichter im großen Dorfe Herzogenbuchsee. Er verfaßte für jede Nummer seiner Zeitung ein Titelgedicht. Für ein solches Gedicht durfte er zehn Tage Gefängnis verbringen. »Zehn Tage für zehn Strophen, ich segne jeden Tag«, dichtete er darauf. Diese Ehre ist mir bis jetzt nicht widerfahren. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht ist die Zeit so auf den Hund gekommen, daß sie sich nicht einmal mehr beleidigt fühlt, wenn mit ihr aufs allerschärfste umgesprungen wird. Meine Mutter (der ich äußerlich gleiche) stammt aus einem schönen Dorfe nahe den Bergen. Ihr Vater war Gemeindepräsident und Patriarch. Das Dorf, in welchem ich geboren wurde und aufwuchs, ist nicht schön, ein Konglomerat von städtischen und dörflichen Gebäuden, doch die kleinen Dörfer, die es umgeben und die zur Gemeinde meines Vaters gehörten, waren echtes Emmental und wie von Jeremias Gotthelf beschworen (und so ist es noch heute). Es ist ein Land, in welchem die Milch die Hauptrolle spielt. Sie wird von den Bauern in großen Kesseln nach der Milchsiederei, einer großen Fabrik mitten im Dorfe, der Stalden AG, gebracht. In Konolfingen erlebte ich auch meine ersten künstlerischen Eindrücke. Meine Schwester und ich wurden vom Dorfmaler gemalt. Stundenlang malte und zeichnete ich von nun an im Atelier des Meisters. Die Motive Sintfluten und Schweizerschlachten. Ich war ein kriegerisches Kind. Oft rannte ich als Sechsjähriger im Garten herum, mit einer langen Bohnenstange bewaffnet, einen Pfannendeckel als Schild, um endlich meiner Mutter erschöpft zu melden, die Österreicher seien aus dem Garten gejagt. Wie sich meine kriegerischen Taten aufs Papier verzogen und immer grausamere Schlachten die geduldige Fläche bedeckten, wandte sich meine Mutter verängstigt an den Kunstmaler Cuno Amiet, der die blutrünstigen Blätter schweigend betrachtete, um endlich kurz und bündig zu urteilen: Der wird Oberst. Der Meister hat sich in diesem Fall geirrt: Ich brachte es in der schweizerischen Armee nur zum Hilfsdienst-Soldaten und im Leben nur zum Schriftsteller. Die weiteren Wege und Irrwege, die mich dazu führten, will ich hier nicht beschreiben. Doch habe ich in meine heutige Tätigkeit aus der Welt meiner Kindheit Wichtiges herübergerettet: Nicht nur die ersten Eindrücke, nicht nur das Modell zu meiner heutigen Welt, auch die ›Methode‹ meiner Kunst selbst. Wie mir im Atelier des Dorfkünstlers die Malerei als ein Handwerk gegenübertrat, als ein Hantieren mit Pinsel, Kohle und Feder usw., so ist mir heute die Schriftstellerei ein Beschäftigen und Experimentieren mit verschiedenen Materien geworden. Ich schlage mich mit Theater, Rundfunk, Romanen und Fernsehen herum, und vom Großvater her weiß ich, daß Schreiben eine Form des Kämpfens sein kann.
Dokument
1965 [ca. 1964]
Die Geschichte meiner Schriftstellerei ist die Geschichte meiner Stoffe, Stoffe jedoch sind verwandelte Eindrücke. Man schreibt als ganzer Mann, nicht als Literat oder gar als Grammatiker, alles hängt zusammen, weil alles in Beziehung gebracht wird, alles kann so wichtig werden, bestimmend, meistens nachträglich, unvermutet. Sterne sind Konzentrationen von interstellarer Materie, Schriftstellerei die Konzentration von Eindrücken. Keine Ausflucht ist möglich. Als Resultat seiner Umwelt hat man sich zur Umwelt zu bekennen, doch prägen sich die entscheidenden Eindrücke in der Jugend ein, das Grausen blieb, das mich erfaßte, wenn der Gemüsemann in seinem kleinen Laden unter dem Theatersaal mit seinem handlosen Arm einen Salatkopf auseinanderschob. Solche Eindrücke formen uns, was später kommt, trifft schon mit Vorgeformtem zusammen, wird schon nach einem vorbestimmten Schema verarbeitet, zu Vorhandenem einverleibt, und die Erzählungen, denen man als Kind lauschte, sind entscheidender als die Einflüsse der Literatur. Rückblickend wird es uns deutlich. Ich bin kein Dorfschriftsteller, aber das Dorf brachte mich hervor, und so bin ich immer noch ein Dörfler mit einer langsamen Sprache, kein Städter, am wenigsten ein Großstädter, auch wenn ich nicht mehr in einem Dorfe leben könnte.
Das Dorf selbst entstand, wo die Straßen Bern–Luzern und Burgdorf–Thun sich kreuzen; auf einer Hochebene, am Fuße eines großen Hügels und nicht weit vom Galgenhubel, wohin die vom Amtsgericht einst die Mörder und Aufwiegler gekarrt haben sollen. Durch die Ebene fließt ein Bach, und die kleinen Bauerndörfer und Weiler auf ihr brauchten einen Mittelpunkt, die Aristokraten ringsherum waren verarmt, ihre Sitze wandelten sich in Alters- oder Erholungsheime um. Zuerst war an der Straßenkreuzung wohl nur ein Wirtshaus, dann fand sich ihm schräg gegenüber die Schmiede ein, später belegten die beiden anderen Felder des Koordinatenkreuzes Konsum und Theatersaal, letzterer nicht unwichtig, wies doch das Dorf einen bekannten Dramatiker auf, den Lehrer Gribi, dessen Stücke von den dramatischen Vereinen des ganzen Emmentals gespielt wurden, und sogar einen Jodlerkönig, der Schmalz hieß. Der Thunstraße entlang siedelten sich der Drucker, der Textilhändler, der Metzger, der Bäcker und die Schule an, die freilich schon gegen das nächste Bauerndorf zu, dessen Burschen mich auf dem Schulweg verprügelten und dessen Hunde wir fürchteten, während das Pfarrhaus, die Kirche, der Friedhof und die Ersparniskasse auf einer kleinen Anhöhe zwischen der Thun- und der Bernstraße zu liegen kamen. Doch erst die große Milchsiederei, die Stalden AG, an der steil ansteigenden Burgdorfstraße errichtet, machte das Dorf zu einem ländlichen Zentrum, die Milch der ganzen Umgebung wurde hergeschleppt, auf schweren Lastwagen, die wir in Gruppen erwarteten, als wir später nach Großhöchstetten in die Sekundarschule mußten, an die wir uns hängten, um so auf unseren Velos die Burgdorfstraße hinaufgezogen zu werden, voller Furcht, jedoch nicht vor der Polizei, dem dicken Dorfpolizisten fühlten sich alle gewachsen, sondern vor dem Französisch- und Schreiblehrer, den wir Baggel nannten, vor dessen Lektionen wir zitterten, war er doch ein bösartiger Prügler, Klemmer und Haarzieher, der uns auch zwang, einander die Hände zu schütteln: Grüß Gott gelehrter Europäer, und aneinandergehängt hinter dem rasselnden Lastwagen mit den tanzenden, am Morgen leeren Milchkesseln, malten wir uns den Lehrer als einen riesigen Berg aus, den wir zu besteigen hatten, mit grotesken Ortsbezeichnungen und entsprechend schwierigen Kletterpartien. Doch das war schon kurz bevor ich in die Stadt zog, der Bahnhof ist in meiner Erinnerung wichtiger als die Milchsiederei mit ihrem Hochkamin, das mehr als der Kirchturm das Wahrzeichen des Dorfes war. Er hatte das Recht, sich Bahnhof zu nennen, weil er ein Eisenbahnknotenpunkt war, und wir vom Dorfe waren stolz darauf: Nur wenige Züge hatten den Mut, nicht anzuhalten, brausten vorbei nach dem fernen Luzern, nach dem näheren Bern, auf einer Bank vor dem Bahnhofgebäude sitzend, sah ich ihnen oft mit einer Mischung von Sehnsucht und Abscheu entgegen, dann dampften sie vorüber und davon. Aber noch weiter zurück gleitet die Erinnerung in die Unterführung, dank deren die Bahngeleise die Burgdorfstraße überbrücken und von der aus man auf einer Treppe geradewegs zum Bahnhof gelangt. Sie stellt sich mir als eine dunkle Höhle dar, in die ich als Dreijähriger geraten war, mitten auf der Straße, von zu Hause ins Dorf entwichen; am Ende der Höhle war Sonnenlicht, aus dem die dunklen Schatten der Autos und Fuhrwerke heranwuchsen, doch ist nicht mehr auszumachen, wohin ich eigentlich wollte, denn durch die Unterführung gelangte man nicht nur zur Milchsiederei und zum Bahnhof, auch die besseren Leute hatten sich am Steilhang des Ballenbühls angesiedelt, so meine Gotte, welche die Gattin des Dorfarztes war, der ich später meine nie befriedigenden Schulzeugnisse zur Einsicht bringen mußte, der Kirchgemeindepräsident und außerdem der Zahnarzt und der Zahntechniker. Die beiden betrieben das Zahnärztliche Institut, das noch heute weite Teile des Landes malträtiert und den Ort berühmt macht. Die beiden besaßen Automobile und waren schon deshalb privilegiert, und des Abends schütteten sie das mit Plombieren, Zahnziehen und Gebißverfertigen gewonnene Geld zusammen, um es mit bloßer Hand zu teilen, ohne noch genauer abzuzählen. Der Zahntechniker war klein und dick, mit Fragen der Volksgesundheit beschäftigt, ließ er ein Volksbrot verfertigen, vor dem einen das kalte Grauen überkam, der Zahnarzt jedoch war ein stattlicher Mann, dazu Welschschweizer, wohl Neuenburger. Er galt als der reichste Mann im ganzen Amtsbezirk; später sollte sich diese Meinung als tragischer Irrtum erweisen. Aber sicher war er der frömmste, redete er doch als Mitglied einer extremen Sekte noch während des Bohrens von Christus, und wurde er doch im Glaubenseifer nur noch von einer hageren Frau unbestimmten Alters erreicht, die sich stets schwarz kleidete, zu der freilich die Engel nach ihrer Behauptung niederstiegen, die noch während des Melkens die Bibel las und zu der ich nachts vom Pfarrhaus über die Ebene die Hausierer und Vaganten zum Übernachten bringen mußte, denn meine Eltern waren gastliche Pfarrsleute und wiesen niemanden ab und ließen mitessen, wer mitessen wollte, so die Kinder eines Zirkusunternehmens, welches das Dorf jährlich besuchte, und einmal fand sich auch ein Neger ein. Er war tiefschwarz, saß am Familientisch links neben meinem Vater und aß Reis mit Tomatensoße. Er war bekehrt, aber dennoch fürchtete ich mich. Überhaupt wurde im Dorfe viel bekehrt. Es wurden Zeltmissionen abgehalten, die Heilsarmee rückte auf, Sekten bildeten sich, Evangelisten predigten, aber am berühmtesten wurde der Ort in dieser Hinsicht durch die Mohammedaner-Mission, die in einem feudalen Chalet hoch über dem Dorfe residierte, gab sie doch eine Weltkarte heraus, auf der in Europa nur ein Ort zu finden war, das Dorf, eine missionarische Wichtigtuerei, die den Wahn erzeugte, sich einen Augenblick lang im Mittelpunkt der Welt angesiedelt zu fühlen und nicht in einem Emmentaler Kaff. Der Ausdruck ist nicht übertrieben. Das Dorf war häßlich, eine Anhäufung von Gebäuden im Kleinbürgerstil, wie man das überall im Mittelland findet, aber schön waren die umliegenden Bauerndörfer mit den großen Dächern und den sorgfältig geschichteten Misthaufen, geheimnisvoll die dunklen Tannenwälder ringsherum, und voller Abenteuer war die Ebene mit dem sauren Klee in den Wiesen und mit den großen Kornfeldern, in denen wir herumschlichen, tief innen unsere Nester bauend, während die Bauern an den Rändern standen und fluchend hineinspähten. Doch noch geheimnisvoller waren die dunklen Gänge im Heu, das die Bauern in ihren Tennen aufgeschichtet hatten, stundenlang krochen wir in der warmen, staubigen Finsternis herum und spähten von den Ausgängen in den Stall hinunter, wo in langen Reihen die Kühe standen. Der unheimlichste Ort jedoch war für mich der obere fensterlose Estrich im Elternhaus. Er war voll alter Zeitungen und Bücher, die weißlich im Dunkeln schimmerten. Auch erschrak ich einmal in der Waschküche, ein unheimliches Tier lag dort, ein Molch vielleicht, während der Friedhof ohne Schrecken war. In ihm spielten wir oft Verstecken, und war ein Grab ausgehoben, richtete ich mich darin häuslich ein, bis der herannahende Leichenzug, vom Glockengeläute angekündigt, mich vertrieb. Denn nicht nur mit dem Tode waren wir vertraut, auch mit dem Töten. Das Dorf kennt keine Geheimnisse, und der Mensch ist ein Raubtier mit manchmal humanen Ansätzen, beim Metzger müssen die fallengelassen werden. Wir schauten oft zu, wie die Schlächtergesellen töteten, wir sahen, wie das Blut aus den großen Tieren schoß, wir sahen, wie sie starben und wie sie zerlegt wurden. Wir Kinder schauten zu, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, und dann spielten wir wieder auf dem Gehsteig mit Marmeln.
Doch das genügt nicht. Ein Dorf ist nicht die Welt. Es mögen sich in ihm Lebensschicksale abspielen, Tragödien und Komödien, das Dorf wird von der Welt bestimmt, in Ruhe gelassen, vergessen oder vernichtet, und nicht umgekehrt. Das Dorf ist ein beliebiger Punkt im Weltganzen, nicht mehr, durch nichts bedeutend, zufällig, auszuwechseln. Die Welt ist größer als das Dorf. Über den Wäldern stehen die Sterne. Ich machte mit ihnen früh Bekanntschaft, zeichnete ihre Konstellationen: den unbeweglichen Polarstern, den kleinen und den großen Bären mit dem geringelten Drachen zwischen ihnen, ich lernte die helle Wega kennen, den funkelnden Atair, den nahen Sirius, die ferne Deneb, die Riesensonne Aldebaran, die noch gewaltigeren Beteigeuze und Antares, ich wußte, daß das Dorf zur Erde und die Erde zum Sonnensystem gehöre, daß die Sonne mit ihren Planeten sich um das Zentrum der Milchstraße bewege Richtung Herkules, und ich vernahm, daß der gerade noch von bloßem Auge erkennbare Andromedanebel eine Milchstraße sei wie die unsrige. Ich war nie ein Ptolemäer. Vom Dorfe aus kannte ich die nähere Umgebung, ferner die nahe Stadt, einen Ferienkurort auch in den nahen Bergen, darüber hinaus einige Kilometer Schulreisen, das war alles, doch nach oben, in den Raum hinein, baute sich ein Gerüst von ungeheuerlichen Entfernungen auf, und so war es auch mit der Zeit: Das Entfernte war wirksamer als das Unmittelbare. Das Unmittelbare wurde nur wahrgenommen, soweit es in das Erfaßbare dringen konnte, als das reale Leben des Dorfes; schon die Dorfpolitik war zu abstrakt, noch abstrakter die Politik des Landes, die sozialen Krisen, die Bankzusammenbrüche, bei denen die Eltern ihr Vermögen verloren, die Bemühungen um den Frieden, das Aufkommen der Nazis, zu unbestimmt, zu bildlos alles, aber die Sintflut, die war faßbar, ein plastisches Ereignis, Gottes Zorn und Wasserlassen, den ganzen Ozean kippte er über die Menschheit aus, nun schwimmt mal, und dann der mutige David, der prahlende Goliath, die Abenteuer des Herkules, des stärksten Mannes, den es je gab, der königliche Theseus, der Trojanische Krieg, die finsteren Nibelungen, der strahlende Dietrich von Bern, die tapferen Eidgenossen, die Österreicher zusammendreschend und bei St. Jakob an der Birs einer unermeßlichen Übermacht erliegend, alles zusammengehalten, der Mutterschoß des Dorfes und die wilde Welt des Draußen, der Geschichte und der Sagen, die gleich wirklich waren, aber auch die unermeßlichen Gestalten des Alls durch einen schemenhaften Lieben Gott, den man anbeten, um Verzeihung bitten mußte, von dem man aber auch das Gute, das Erhoffte und Gewünschte erwarten durfte als von einem rätselhaften Überonkel hinter den Wolken. Gut und Böse waren festgesetzt, man stand in einem ständigen Examen, für jede Tat gab es gleichsam Noten, und darum war die Schule auch so bitter: Sie setzte das himmlische System auf Erden fort, und für die Kinder waren die Erwachsenen Halbgötter. Schrecklich-schönes Kinderland: Die Welt der Erfahrung war klein, ein läppisches Dorf, nicht mehr, die Welt der Überlieferung war gewaltig, schwimmend in einem rätselhaften Kosmos, durchzogen von einer wilden Fabelwelt von Heldenkämpfen, durch nichts zu überprüfen. Man mußte diese Welt hinnehmen. Man war dem Glauben ausgeliefert, schutzlos und nackt.
Meere
Ich liebe das Haus zu verlassen
In einen Tag zu gehen, der sich gegen Abend neigt
Durch Meere roten Laubs zu waten
Gedichtband bei einer Mittagszigarre
Gott schuf die Welt ohne zu denken
Soso lala
Er machte sie aus dem Nichts, mit einer Geschwindigkeit ohne Gleichen
Soso lala
Darum (die Sonne steht immer noch hoch) dichte ich in sechzig Sekunden
Soso lala
eine ganze Welt voll. Zwischen zwei Uhr dreizehn und zwei Uhr vierzehn
Soso lala
Man muß es endlich einmal wagen hinüberzuspringen
bei einer Zigarre zu dichten, die dabei nur ein Weniges verrauchen darf
zu arbeiten, ohne sich zu korrigieren
die Worte einfach hinzusetzen, wie eine Mutter Kinder auf die Welt setzt
ohne sie wieder zurückzunehmen.
Das Zögern einer Sekunde verdirbt ein Gedicht.
Auch ist es nicht erlaubt, Worte zu wählen.
So schreibe ich denn, so springe ich denn an ein anderes Ufer.
Eines Tags (die Sonne stand hoch)
betrachtend die weiße Wäsche, die man hingehängt hatte
und darüber hin die Zweige der Bäume
weiß, grün vor dem blauen Himmel,
Alles vom Winde bewegt, von dem frischen, nördlichen Winde
überfiel mich die Ahnung einer höheren Leichtigkeit.
O Leichtigkeit des Gedankens, der zum Verbrechen wird, wenn man Arbeit an ihn wendet!
Wie der Wind die Zweige bewegt, die grünen die Wäsche, die weiße,
bewegt der Geist das mühsame Durcheinander von Blut und Fleisch meines Leibes,
mich treibend in seinem Spiel.
Du einziges Spiel, das immer noch erlaubt ist:
Gedichte, die in ein, zwei Minuten getan sind
im Traume eines Tags (die Sonne stand hoch)
Blitze, die irdische Finsternis erleuchten.
Literatur
Randnotizen zu Else Lasker-Schülers ›Dichtungen und Dokumente‹
1951
Die Stadt, in der sie geboren wurde, Elberfeld, und jene, die alte, heilige, in der sie starb, Jerusalem, kommentieren sie: Man nannte sie eine Kaffeehausliteratin und trieb sie in die Wüste. In Zürich, wo das Schauspielhaus (eine seiner großen Taten) ihr Stück Arthur Aronymus und seine Väter uraufführte, das nur zweimal gegeben werden konnte, lebte sie auch. Verflucht, in einer Zeit zu leben, die Philosophie treibt, wenn sie dichtet, und Wissenschaft, wenn sie mordet, nannte sie sich Jussuf, Prinz von Theben. Sie war ein so großer Phantast, daß sie aus der Wupper einen Nil machte, doch gerade so gewann sie auf eine geheimnisvolle Weise die Wirklichkeit, nicht jene freilich, die eine Schöpfung der Menschen ist, sondern jene höhere, welche die Schöpfung selbst ist: die Ursprünglichkeit dieses Planeten. Sie sah die Dinge wie zum erstenmal und sagte sie wie zum erstenmal. Dann fällt auf, wie oft sie Menschen zum Gegenstand ihrer Gedichte macht, die Erzväter, Saul, David und Jonathan, aber auch Menschen, die sie kannte, so Georg Trakl, den sie liebte, wie also immer Menschen für sie wichtig sind. Ihre Prosa – von der Das Hebräerland das Schönste ist – reichte bis zum Pamphlet. Ich räume auf! schrieb sie gegen ihre Verleger. Das herrliche Gedicht Ein alter Tibetteppich wurde vor allem von Karl Kraus bewundert, der einmal für sie Geld sammelte und sie die stärkste und unwegsamste lyrische Erscheinung des modernen Deutschland nannte. Eines ihrer schönsten Liebeslieder schrieb sie im Alter. Sie war Jüdin und eine Deutsche. Sie glaubte wie ein Kind, unbestimmter als Trakl, ohne dessen Verzweiflung, doch kann nur der das Wort verstehen, das sie über ihren Sohn schrieb: »Meine Liebe zu dir ist das Bildnis, das man sich von Gott machen darf«, der sie vom Religiösen und vom Jüdischen her sieht. Sie war so unbekümmert Dichterin, daß sie alles konnte, auch das Dramenschreiben, also etwas, das die heutigen Dramatiker lange nicht immer können, von dem sie sagte, es sei eine schreitende Lyrik. (Damit – wenn man das Wort richtig begreift, ebensoviel Wert auf das Schreiten wie auf die Lyrik legt, vor allem unter Lyrik das versteht, was Else Lasker-Schüler mit ihren Gedichten tat – ist etwas Wichtiges gesagt.) Sie wurde aus Deutschland ausgewiesen, doch aus der deutschen Sprache konnte man sie nicht ausweisen: Hier wies sie sich aus. Sie hatte so sehr Sprache, daß nichts, kein Unglück, keine Verfolgung diese Sprache zerstören konnte, immer wieder brach die Sprache mit ihr in Gebiete durch, von denen die Schulweisheit sich wirklich nichts träumen läßt. So heilte sie, was die Zeit schändete. Da die Deutschen die Juden verfolgten, rettete eine arme, vertriebene Jüdin mit wenigen anderen – o mit wie wenigen – die deutsche Sprache.
Wenn es auf den ersten Blick merkwürdig berührt, daß der öffentliche Literaturbetrieb bis jetzt von Else LaskerSchüler so wenig Notiz nahm (verglichen etwa mit der Papierflut, die Rilke hervorruft, um einen anderen bedeutenden Dichter zu nennen), so ist zu bemerken, daß eine Zeit in der Hauptsache nach jenen Dichtern greift, die sie nötig zu haben glaubt, und darum gerade die liegen läßt, die sie nötig hat. Unter anderem – vielem anderen – ist wohl die Unsicherheit der Philosophie daran schuld, die, soweit man in diese dunkle Sphäre Einblick erhält, nicht mehr recht sich selber traut und nun die Literatur als Stoff erfunden hat, als Ablenkung gleichsam, so daß man sich um jene philosophischen Reste balgt, die der Dichtung unter den Tisch fallen, besonders wenn ein Rilke dichtet. Einer solchen Zeit liegt daher notgedrungen eine so kompakte Erscheinung wie Else Lasker-Schüler nicht, die keinen Rest der Philosophie übrigläßt, nur unmittelbare Dichtung ist, bald nur Vision, bald nur Erinnerung, bald nur Liebe, bald nur Klage, alles ausschließlich, mit wilder Leidenschaft – oder dann bedeutungslos, verworren wird, wenn sie ohne Inspiration schrieb, was oft vorkam, bändeweise. So hatte Rilke mehr Hochplateau, durchaus angenehm zu kultivieren, geeignet für Sommergäste, Sommerkurse und literarische Fremdenführer. Er war lawinensicherer, hatte mehr Niveau als sie, die ein kühneres Gebirge war als er, vulkanischer Natur, mit steileren Abstürzen und größeren Höhen. Zwei Landschaften, die nichts miteinander zu tun haben. Ebensowenig konnte die Epoche etwas mit Karl Kraus anfangen, der alles mit ihr anfing, der, ein ungeheuerliches Kraftfeld an Sprache, gerade das und ausschließlich das tat, was die Zeit nicht wollte, das Absolute. Daher gehört Else Lasker-Schüler zu Karl Kraus, dem sie ihre schönsten Gedichte, die hebräischen Balladen, widmete, den sie den Kardinal nannte und dessen Schicksal, nicht populär, weiten Kreisen unbekannt zu sein, sie teilt – es gibt kein schöneres. Immer wieder aufs neue entdecken läßt sich nur, was nicht Mode werden kann.
So ist es auch natürlich, daß der Herausgeber und Auswähler der Gedichte, Prosa, Schauspiele und Briefe Else Lasker-Schülers, Ernst Ginsberg, gleich auf über 600 Seiten kam: Die Dichterin mußte vorgestellt werden, so sehr war sie in Deutschland in Vergessenheit geraten. Alles Wesentliche ist denn in diesem Bande zu finden. Dazu kommen einige Zeichnungen Else Lasker-Schülers und Photographien. Wesentliche Zeugnisse und Erinnerungen an die große Dichterin, an diese seltsame Frau mit dem oft so skurrilen Humor (so sagte sie zu Gerhart Hauptmann, er sehe aus wie die Großmutter von Goethe), schließen den sorgfältig hergestellten und mustergültig herausgegebenen Band.
Fingerübungen zur Gegenwart
1952
Meine Damen und Herren, Wenn man schon in einem so kleinen Lande wie dem unsrigen die Donquijoterie begeht, ein Schriftsteller deutscher Sprache zu sein und nichts anderes, nicht etwa noch zu drei Vierteln oder vier Fünfteln ein Redaktor, Lehrer oder Bauer, oder was es sonst noch bei uns für Berufe gibt, so muß man sich doch vielleicht langsam fragen, ob denn ein solches Unternehmen, das sich seiner Natur gemäß immer um den Bankrott dreht, ungefähr so, wie die Erde um die Sonne, absolut und unter allen Umständen notwendig sei. Es reden ja nicht einmal alle in unserem Lande deutsch, und sogar die, die es tun, stehen im allgemeinen dieser Sprache etwas fremd gegenüber, da sie ja Dialekt sprechen, wie es natürlich ist, und das Land, in welchem siebzig Millionen Deutsche leben, ist untergegangen und auseinandergebrochen. In dieser Zeit ein Schriftsteller sein zu wollen, heißt mit dem Kopf durch die Wand rennen. Meine Damen und Herren, das tue ich leidenschaftlich gern, und ich bin der Meinung, daß Wände gerade dazu erfunden sind. Ich bin daher in diesem Lande Schriftsteller geworden, gerade weil man da die Schriftstellerei nicht nötig hat. Ich bin es geworden, um den Leuten lästig zu fallen. Ob ich ein guter Schriftsteller bin, weiß ich nicht, und ich kümmere mich nicht sehr um diese müßige Frage; aber ich hoffe, daß man von mir sagen wird, ich sei ein unbequemer Schriftsteller gewesen. So fällt es mir dann gar nicht ein, mich in erster Linie an die Deutschen zu wenden, sondern ich wende mich vor allem an die Schweizer, vor allem, da Sie nun ja vor mir sitzen, an Sie, meine Damen und Herren. Man wird mir vorwerfen, die Schweiz sei eine Provinz und wer sich an eine Provinz wende, sei ein provinzieller Schriftsteller. Gesetzt, daß es noch Provinzen gibt, haben jene unrecht, die so sprechen. Man kann heute die Welt nur noch von Punkten aus beobachten, die hinter dem Mond liegen, zum Sehen gehört Distanz, und wie wollen die Leute denn sehen, wenn ihnen die Bilder, die sie beschreiben wollen, die Augen verkleben? Der Einwand wird aufgeworfen, es sei unerlaubt, das zu schildern, was man nicht selber erlebt habe, als ob Leiden eine Art Monopol zum Dichten schüfe, aber war Dante in der Hölle? Darum müssen Sie sich jetzt auch einen Schriftsteller wie mich gefallen lassen, der nicht von dem redet, was er mit den Augen, sondern von dem, was er mit dem Geiste gesehen hat, der nicht von dem redet, was einem gefällt, sondern von dem, was einen bedroht. Ich bin ein Protestant und protestiere. Ich verzweifle nicht, aber ich stelle die Verzweiflung dar. Ich bin verschont geblieben, aber ich beschreibe den Untergang; denn ich schreibe nicht, damit Sie auf mich schließen, sondern damit Sie auf die Welt schließen. Ich bin da, um zu warnen. Die Schiffer, meine Damen und Herren, sollen den Lotsen nicht mißachten. Er kennt zwar die Kunst des Steuerns nicht und kann die Schiffahrt nicht finanzieren, aber er kennt die Untiefen und die Strömungen. Noch ist das offene Meer, aber einmal werden die Klippen kommen, dann werden die Lotsen zu brauchen sein.
Lieblingsgedichte
1953
In die gestellte Falle, die drei schönsten Gedichte zu nennen, möchte ich nicht hineingehen. Die schönsten Gedichte sind einem auch die liebsten, und diese verraten, heißt nun doch zuviel verraten. Die liebsten Gedichte gesteht man, wenn überhaupt, nur wenigen Menschen. Vor allem nicht dem Leser.
Ein Gedicht will ich trotzdem nennen. Nicht mein liebstes also, auch nicht eines jener, die mir am wichtigsten sind oder gar am nützlichsten, aber doch eines jener Gedichte, die mich am meisten verwundern, am meisten in Erstaunen versetzen. Kenne ich doch keines, das so sehr Wortkunst, so sehr Filigran und dennoch so elementar sein dürfte: im höchsten Grade zivilisiert und im höchsten Grade Natur.
Den viergeteilten Chor meine ich, der den dritten Akt im zweiten Teil des Faust beschließt und dem zuliebe mir vieles, was nachher kommt, gestohlen werden kann: Die heiligen Anachoreten, die ekstatischen, profunden, seraphischen Patres, gebe ich willig her (einige Stellen, herrliche Stellen, ausgenommen) samt dem Doctor Marianus (in der höchsten, reinlichsten Zelle).
Nun, ich liebe lange Gedichte besonders, das sei zugegeben in diesem peinlichen Verhör, wenn auch lange nicht alle langen, und das längste (um ein zweites zu nennen) kann ich auswendig, Trakls Rondel:
Verflossen ist das Gold der Tage,
Des Abends braun und blaue Farben:
Des Hirten sanfte Flöten starben,
Des Abends blau und braune Farben;
Verflossen ist das Gold der Tage.
Wann vermöchte diese Dauer zu enden, wann die Nacht, die da angebrochen ist?
Schön sind diese zwei Gedichte vor allem in der Erinnerung, dunkle verschwenderische Ströme, Ahnung gewaltiger Rhythmen, die einzelne Wortgebilde heranschwemmen, doppelt rein, doppelt deutlich nun in dieser Flut:
»Faselnd mit dem jüngsten Faun«, »Donnerts, rollen unsre Donner in erschütterndem Verdoppeln, dreifach, zehnfach hintennach«, »Den durchaus bepflanzten Hügel« (die Landschaft, die ich liebe), und kaum vermöchte ich eine andere Stelle deutscher Sprache zu nennen, in der das Geschlechtliche, Zottige, Nächtliche so Wort und Bild geworden ist wie in jener: »Und dazwischen schreit unbändig grell Silenus’ öhrig Tier.« Gibt es einen unheimlicheren Vers?
Immer abwärts, immer tiefer wässern wir, mäandrisch wallend,
Jetzt die Wiese, dann die Matten, gleich den Garten um das Haus …
Diese Stelle scheint mir Goethe wie wenige seiner Verse zu enthalten, Goethe in seiner gebändigten Dämonie (immer abwärts, immer tiefer), in seiner leichten Vorliebe für klassizistische Schnörkel (mäandrisch wallend), in seiner Genialität für das Differenzierte (jetzt … dann … gleich …), Goethe in seiner phrasenlosen Humanität.
Der viergeteilte Chor aus ›Faust II‹ 3. Akt
EIN TEIL DES CHORS
Wir in dieser tausend Äste Flüsterzittern, Säuselschweben
Reizen tändelnd, locken leise wurzelauf des Lebens Quellen
Nach den Zweigen; bald mit Blättern, bald mit Blüten überschwenglich
Zieren wir die Flatterhaare frei zu luftigem Gedeihn.
Fällt die Frucht, sogleich versammeln lebenslustig Volk und Herden
Sich zum Greifen, sich zum Naschen, eilig kommend, emsig drängend;
Und wie vor den ersten Göttern bückt sich alles um uns her.
EIN ANDRER TEIL
Wir an dieser Felsenwände weithinleuchtend glattem Spiegel
Schmiegen wir, in sanften Wellen uns bewegend, schmeichelnd an;
Horchen, lauschen jedem Laute, Vogelsängen, Röhrigflöten,
Sei es Pans furchtbarer Stimme, Antwort ist sogleich bereit;
Säuselts, säuseln wir erwidernd, donnerts, rollen unsre Donner
In erschütterndem Verdoppeln, dreifach, zehnfach hintennach.
EIN DRITTER TEIL
Schwestern! Wir, bewegtern Sinnes, eilen mit den Bächen weiter;
Denn es reizen jener Ferne reichgeschmückte Hügelzüge.
Immer abwärts, immer tiefer wässern wir, mäandrisch wallend,
Jetzt die Wiese, dann die Matten, gleich den Garten um das Haus.
Dort bezeichnens der Zypressen schlanke Wipfel, über Landschaft,
Uferzug und Wellenspiegel nach dem Äther steigende.
EIN VIERTER TEIL
Wallt ihr andern, wo’s beliebet; wir umzingeln, wir umrauschen
Den durchaus bepflanzten Hügel, wo am Stab die Rebe grünt;
Dort zu aller Tage Stunden läßt die Leidenschaft des Winzers
Uns des liebevollsten Fleißes zweifelhaft Gelingen sehn.
Bald mit Hacke, bald mit Spaten, bald mit Häufeln, Schneiden, Binden,
Betet er zu allen Göttern, fördersamst zum Sonnengott.
Bacchus kümmert sich, der Weichling, wenig um den treuen Diener,
Ruht in Lauben, lehnt in Höhlen, faselnd mit dem jüngsten Faun.
Was zu seiner Träumereien halbem Rausch er je bedurfte,
Immer bleibt es ihm in Schläuchen, ihm in Krügen und Gefäßen,
Rechts und links der kühlen Grüfte, ew’ge Zeiten aufbewahrt.
Haben aber alle Götter, hat nun Helios vor allen,
Lüftend, feuchtend, wärmend, glutend, Beerenfüllhorn aufgehäuft,
Wo der stille Winzer wirkte, dort auf einmal wirds lebendig,
Und es rauscht in jedem Laube, raschelt um von Stock zu Stock.
Körbe knarren, Eimer klappern, Tragebutten ächzen hin,
Alles nach der großen Kufe zu der Keltrer kräftgem Tanz;
Und so wird die heil’ge Fülle reingeborner saft’ger Beeren
Frech zertreten; schäumend, sprühend mischt sich’s, widerlich zerquetscht.
Und nun gellt ins Ohr der Zimbeln mit der Becken Erzgetöne,
Denn es hat sich Dionysos aus Mysterien enthüllt;
Kommt hervor mit Ziegenfüßlern, schwenkend Ziegenfüßlerinnen,
Und dazwischen schreit unbändig grell Silenus’ öhrig Tier.
Nichts geschont! Gespaltne Klauen treten alle Sitte nieder,
Alle Sinne wirbeln taumlich, gräßlich übertäubt das Ohr.
Nach der Schale tappen Trunkne, überfüllt sind Kopf und Wänste,
Sorglich ist noch ein und andrer, doch vermehrt er die Tumulte,
Denn um neuen Most zu bergen, leert man rasch den alten Schlauch!
›Die Dritte Walpurgisnacht‹
1953
Karl Kraus’ Stellung zum Weltgeschehen ist aus seinen Buchtiteln herauszulesen. Nach dem Untergang der Welt durch schwarze Magie, worunter er die Presse verstand, nach den dadurch zwangsläufigen Letzten Tagen der Menschheit1914–1918 brach Die Dritte Walpurgisnacht, der Teufelstanz der Schemen und der verlorenen Seelen, mit Hitler an. Die Weltgeschichte wurde aufs neue zum Weltgericht. Die Katastrophe brach zum zweiten Male in diesem Jahrhundert über eine Menschheit herein, deren Schuld Gedankenlosigkeit und mangelnde Einbildungskraft war, wie er ihr immer wieder vorwarf, über eine Menschheit, »die nicht tötet, aber fähig ist, nicht zu glauben, was sie nicht erlebt«. Richteten Operettenfiguren die Menschheit im Ersten Weltkriege hin, so stieg nun mit Hitler ein Weltmetzger herauf. »Ein armes Volk hebt beschwörend die Rechte empor zu dem Gesicht, zu der Stirn, zu der Pechsträhne: Wie lange noch!« Diese Aspekte machen Karl Kraus bei vielen so unbeliebt. Die Welt braucht ihre Wunschträume, und daß die, welche regieren, schon wissen, was sie tun, träumt sie am hartnäckigsten. Wenn sich die Menschheit anschickt unterzugehen, soll sie es mit Tiefsinn tun, nichts Beleidigenderes als der Gedanke, sie könnte von Durchschnittsmenschen zugrunde gerichtet werden; auch im tiefsten Unglück hofft man immer noch, das Blutbad sei wenigstens von einem mythischen Oberförster angerichtet.
Dazu stellt sich ein Mißverständnis ein. Karl Kraus hat sich zeit seines Lebens mit Personen auseinandergesetzt. Auch Die Dritte Walpurgisnacht ist vorerst eine Auseinandersetzung mit Personen. Diese Kampfart, die stets auf Menschen zielte und höchst persönlich war, hat man Karl Kraus als Eitelkeit ausgelegt, ahnungslos, daß dies nur seine Methode war, genau zu sein. Über Gottfried Benn läßt sich schließlich bestimmter reden als über die Realisationen des Weltgeistes, über die Gottfried Benn damals redete. Karl Kraus umging den Menschen nie um einer Idee willen und so auch seine Gegner nicht. Dies macht ihn so unbequem, daß man ihm noch heute aus dem Wege geht: die Literatur wird bei ihm ungemütlich. Da der Geist für ihn etwas Konkretes war, die Sprache nämlich, war auch der Mensch für ihn etwas Konkretes. Mitleid war eine seiner stärksten Triebfedern. Er weigerte sich, ins Allgemeine Reißaus zu nehmen und über Vorgänge die Augen zuzudrücken, »gegen die es in Chicago Polizeischutz gibt«, wie dies allzu oft in der deutschen Literatur geschah. Für die Vergewaltigung des Menschen gab es keine Möglichkeit der Entschuldigung. Nicht nur die Kultur, die Menschheit war geschändet. »Der Journalismus, welcher den Raum der Lebenserscheinungen falsch dimensioniert, ahnt nicht, daß die letzte Privatexistenz als Gewaltopfer dem Geist näher steht als alles ruinierte Geistgeschäft.« So schaute er vor allem auf die Kriminalität des Geschehens.
Doch damit ist nur der Hintergrund gegeben. Daß Karl Kraus die Regierung Hitlers eine Diktatur nennt, die »alles beherrscht außer der Sprache«, charakterisiert erst Die Dritte Walpurgisnacht. Es ging ihm nicht darum, wie dies etwa Thomas Mann tat, über die Nazis zu schreiben, was doch auch nötig war (weshalb denn Kraus mit dem Satz beginnt: »Mir fällt zu Hitler nichts ein«), sondern darum, von der Sprache her, diesem durch Hitler nie zu erobernden Gebiet, zurückzuschlagen. Die Sprache rächt sich an Hitler, das Zitat verhaftet ihn, die Grammatik wird zur Guillotine. »Die Welt beim Wort zu nehmen« war seit jeher Karl Kraus’ Unterfangen, nun nimmt er Hitler beim Wort. Er stellt ihn in die Sprache, wie Shakespeare Mörder in die Szene stellt. Die Dinge werden absurd, indem sie das Medium der Sprache passieren, eine Komödie entsteht, die sich die Tragödie des deutschen Volkes selber schrieb, durch die Sprache wird eine Prognose der Hitlerzeit möglich, der die kommenden Jahre nur noch Quantitatives beifügen konnten.
Das Sprachkunstwerk der Dritten Walpurgisnacht,