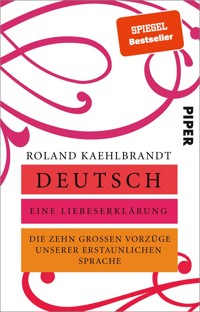12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vittorio Klostermann GmbH
- Sprache: Deutsch
Mark Twain hat die deutsche Sprache "awful" genannt; Roland Kaehlbrandt zeigt uns, wie reizvoll sie sein kann. Er hat den Gebrauch der deutschen Sprache über viele Jahre beobachtet. Sein Logbuch skizziert -- immer kurzweilig, manchmal sarkastisch -- die Sprachpraxis in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Kaehlbrandt zeigt, wie wir unsere Sprache beschädigen, wenn wir sie für moralische Zwecke instrumentalisieren oder durch den Gebrauch von Imponierwörtern aushöhlen. Wer das Logbuch gelesen hat, wird eine Reihe von Fehlern nicht mehr machen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Roland Kaehlbrandt
Logbuch Deutsch
Wie wir sprechen,
wie wir schreiben
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Originalausgabe
© Vittorio Klostermann GmbH · Frankfurt am Main · 2016
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2016
ISSN 1865-7095
ISBN 978-3-465-24255-0
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
Kapitel 1 Das Wunder Deutsch
Mühelose Wortbildung – Quengelware und fremdschämen – Leichter als im Französischen – Schöne Wortkombinationen – Flexible Wortstellung – Es lebe der lange Satz! – Genauigkeit im Raum – Ausdrucksstärke durch feine Abtönung – In einem Wort
Kapitel 2 Imponierdeutsch
Die Ursprünge – Von Wandel, Struktur und Strategie – Von Visionen, Innovationen und Zukunftsfähigkeit – Philosophie und Kultur – Jenseitiges und Diesseitiges – Wegwerfwörter – Semantischer Drahtverhau
Kapitel 3 Englisch im Deutschen, Englisch statt Deutsch
Greifen die Anglizismen unsere Sprache an? – Wortschöpfungen – Wortschrott – English only? – Domänenverlust und seine Folgen – Wozu verschiedene Sprachen? – Die feinen Unterschiede – Sprache und Persönlichkeit – Ist Kultur von Sprachen unabhängig?
Kapitel 4 Abgehoben und schwer verständlich – Wissenschaftsdeutsch
Der steinige Weg zur Wissenschaftssprache – Tradition der schweren Verständlichkeit – Internationalisierung – Nowhere Island – Exzellenz – Sprachlich verflochten – Bologna-Jargon – Was verloren geht – Gegenwind und Nachbesserung
Kapitel 5 Im Dienste der Moral – Sprachregulierung
Geschlechtergerechte Sprache – Lehrer/-innen und SuS – Das Geschlecht neutralisieren – von Studierenden und Kursteilnehmenden – Das Gott und die Apostelinnen – Die Sprache regulieren – die Menschen bevormunden
Kapitel 6 Zwanghafte Zwanglosigkeit – Lockerdeutsch
Abstreifen der Konventionen – Im Per-Du-Center – Sprachliche Umgangsformen in der Defensive – Hallo! Haalo! Aber hallo! – Norm unter Verdacht – Ich sag mal: „Kein Thema!“ – Zurück zu Sonja ins Hauptstadtstudio – Neue Mündlichkeit im Schriftlichen – Kiezdeutsch gerne, aber für alle?
Kapitel 7 Sprachliche Bildung
Deutsch als Bildungsgut – Wie viel Deutsch in der Schule? – Deutsch als Zweitsprache – Eklatante Lücken bei Studienanfängern – Sprachentwicklungsstörungen, eine Zivilisationskrankheit?
Kapitel 8 Sprache und Norm
Kurios: Staat und Sprachnorm in Deutschland – Allgemeine Verunsicherung: die Rechtschreibreform – Wer aber soll es richten? – Ebenfalls kurios: Sprache und Gesetz – Sprachnorm in Bewegung
Kapitel 9 Die deutsche Sprache in Europa
Sprachnationen und Kultursprachen – Europäische Regierungssprache? – Deutsch: Ein paar Zahlen – Sprachverbreitung – Deutsch in den Institutionen der Europäischen Union – Deutsche Reaktionen? – Wie kann es gehen?
Kapitel 10 Die Zukunft der deutschen Sprache
Errungenschaften – Sprachpflege aus der Mitte der Gesellschaft – Lebendige Sprachkritik – Institutionen verbinden und stärken – Sprachbildungspolitik – Zum Schluss
Dank
Literatur
Der Autor
Buchempfehlungen
Fußnoten
Vorwort
Das Deutsche zählt unter den rund 6.000 Sprachen der Welt zu den wenigen überregional gesprochenen Sprachen. Es wurde aus dem Freiheitsgeist von Späthumanismus und Aufklärung im Widerstand gegen die französisch sprechenden Fürstenhöfe und gegen die lateinisch dominierten Wissenschaften zu einer verständlichen Sprache für alle Bürger ausgebaut. Unsere heutige deutsche Sprache mit Grammatik, Hochlautung und einem reichen Wortschatz von rund fünf Millionen Wörtern verdankt diesen Zustand weder einer rein naturwüchsigen Entwicklung noch einer staatlichen Verordnung, sondern einer beherzten sprachkultivierenden Arbeit engagierter Vorkämpfer. Es war ein langer und steiniger Weg dahin, immer wieder behindert durch Geringschätzung vor der eigenen Haustür.
Diese Geringschätzung ist auch heute wieder am Werk. Sie führt dazu, dass das Deutsche inzwischen in seinem Gebrauch eingeschränkt, mehr noch, verdrängt wird:
– Entscheidende gesellschaftliche Bereiche wie Wissenschaft, Wirtschaft und europäische Politik werden aus eigener Initiative zunehmend ans Englische abgegeben.
– Und wo noch deutsch gesprochen wird, ist es oft nicht besser bestellt. Zum führenden Jargon unserer Zeit ist ein aufgeblähtes und schwer verständliches Imponierdeutsch aus dem Bereich des Managements aufgestiegen. Es ist gekennzeichnet durch zusammengezimmerte Wortschöpfungen wie Investmentphilosophie oder intermodulare Potenziale.
– Das sprachliche Handwerk der unermüdlichen Gerechtigkeitssemantiker überzieht den öffentlichen Sprachgebrauch mit einer Kunstsprache. Es gebiert Wortungetüme wie StaatsanwältInnen oder Testamentsvollstreckende.
– Auch die Hallogesellschaft ist nicht untätig. Sie hat die Sprache mit ihrer bemühten Lockerheit und Schnöseligkeit beschädigt. Ein langgezogenes okee! markiert in diesem Jargon der Tiefenentspannung das höchste der Gefühle. Die Ursachen dieser Entwicklung sind tief in der westlichen Zivilisation verankert; es ist der Drang nach wirtschaftlicher Effizienz durch kulturelle Vereinheitlichung und Vereinfachung, hin zu einer niedrigschwelligen Massengesellschaft. Er schlägt in Deutschland sprachlich unmittelbar durch. Denn anders als in europäischen Nachbarländern wirkt hierzulande kaum ein widerspenstiges sprachliches Selbstbewusstsein den vereinheitlichenden und nivellierenden Einflüssen entgegen.
Das hat auch drastische Folgen für die Sprachbeherrschung: Sie ist in einem jämmerlichen Zustand. Deutschland leistet sich eine beängstigend hohe Quote von Analphabeten. Die Rechtschreibfertigkeit geht seit Jahren dramatisch zurück. Ein differenzierter Wortschatz kann auch in gymnasialen Oberstufen nicht mehr vorausgesetzt werden. Immer mehr Studienanfänger haben zudem große Lücken in der Kenntnis der deutschen Grammatik. Sprachlicher Ausdruck wird immer häufiger als Nebensache abgetan. Eine weitverbreitete Skepsis gegenüber Normen aller Art behindert die Verankerung der Sprachnorm. Die Beeinflussung der Schreibgewohnheiten durch die Mündlichkeit digitaler Spontanmedien tut das Ihre. Und – auch nach Jahrzehnten der Einwanderung ist das Deutsche als Sprache der Integration weder unstrittig noch verankert.
Große Teile der Sprachgemeinschaft aber haben sich an diese Mängel gewöhnt. Es herrscht ein durch Gleichgültigkeit gekennzeichneter sprachlicher Dämmerzustand.
Das birgt Risiken für die künftige Einsatzfähigkeit der deutschen Sprache. Wenn sie von dynamischen und prägenden Bereichen wie Wissenschaft, Wirtschaft und Politik abgeschnitten wird, versiegen wichtige Quellen ihrer Weiterentwicklung. Die damit verbundene Funktionseinschränkung droht zu einer Gefahr für den Status der deutschen Sprache zu werden. Teile der Eliten sind im Begriff, diesen Prozess aktiv zu fördern.
Soll die deutsche Sprache auch in Zukunft als voll ausgebaute Kultursprache verwendet werden können, oder will sich die Sprachgemeinschaft über kurz oder lang mit einer Alltags- oder Haussprache Deutsch zufriedengeben? Einer Debatte über dieses Medium unserer alten Kultur sollten wir nicht ausweichen. Die Sprachgemeinschaft – von den Liebhabern der deutschen Sprache über die Gleichgültigen bis hin zu den Verächtern – täte dabei gut daran, sich der Ausdrucksmöglichkeiten ihrer Sprache bewusst zu werden, ihrer Elastizität in Wortschatz und Satzbau, ihrer kulturellen Hervorbringungen und auch ihrer immer noch relativ starken Verbreitung – mit den Vorteilen, die diese mit sich bringt.
Dazu möchte ich mit dem vorliegenden Buch beitragen.
Frankfurt am Main, November 2015
Kapitel 1 Das Wunder Deutsch
Mühelose Wortbildung – Quengelware und fremdschämen – Leichter als im Französischen – Schöne Wortkombinationen – Flexible Wortstellung – Es lebe der lange Satz! – Genauigkeit im Raum – Ausdrucksstärke durch feine Abtönung – In einem Wort
Mühelose Wortbildung
Beginnen möchte ich mit etwas Erfreulichem, mit einem Lob der deutschen Sprache. Ein großer Vorzug ist ihr Wortschatz. Bleiben wir einen Moment bei diesem Begriff, Wortschatz. Wir nennen unser Vokabular nicht umsonst so, auch wenn wir kaum an die eigentliche Bedeutung von Wortschatz denken. Die Metapher Schatz ist verblichen. Schade eigentlich. Der Romanist Hans-Martin Gauger führt sie uns vor Augen: „Zur Sprachkultur gehört auch und vor allem das ‚Gefühl‘ oder das erlebte Wissen, dass wir in unserer Sprache einen Reichtum vor oder eigentlich hinter uns, hinter unserem Sprechen nämlich, haben […].“1
Der deutsche Wortschatz ist sehr umfangreich. Bei den Standardwörterbüchern großer europäischer Sprachen liegt das Deutsche mit 200.000 Wörtern (im Großen Wörterbuch der deutschen Sprache des Duden) hinter dem Oxford English Dictionary mit 620.000 Wörtern (das allerdings die englische Sprache der letzten 1000 Jahre dokumentiert), aber vor dem französischen Grand Robert mit 100.000 Wörtern. Der Bericht zur Lage der deutschen Sprache aus dem Jahr 2013 ermittelte aus einem Korpus von Presseartikeln, Belletristik und wissenschaftlichen Texten eine deutlich höhere Zahl: 5,3 Millionen Wörter. Wenn man alle Sondersprachen und Wissenschaftssprachen hinzuzählt, dürften es noch einmal deutlich mehr sein; die Schätzungen gehen bis zu 30 Millionen.
Warum ist der deutsche Wortschatz so umfangreich? Wegen einer Besonderheit, die man nicht genug rühmen kann: die seiner fast unbegrenzten Kombinierbarkeit. Das Deutsche erlaubt es, ja lädt geradezu dazu ein, neue Wörter aus bestehenden zusammenzusetzen, und zwar so, dass man aus den zusammengesetzten Wörtern meist die neue Bedeutung gleich schon herauslesen kann. Man muss also nicht wie zum Beispiel im Spanischen erst einmal das aus dem Griechischen stammende Wort pediatra lernen, das keinerlei Beziehung zum romanischen Wortschatz hat, um zu wissen, dass es sich um einen Kinderarzt handelt; im Deutschen erkennt man aufgrund des Wissens um die Bedeutung von Arzt und Kind auf einen Blick die Bedeutung des neuen Begriffs Kinderarzt. Das mag dem einen oder anderen schlicht und naiv vorkommen. Die deutsche Wortbildung ist aber vor allem eines: leicht verständlich.
Und dann ist diese Mechanik des Kombinierens noch etwas anderes: leicht handhabbar und deshalb unglaublich produktiv. Hat man die Kombination von Kind und Arzt einmal gefunden, kann man alle anderen Bezeichnungen für die Arztberufe genauso konstruieren und verstehen: Frauenarzt, Zahnarzt, Tierarzt, ja sogar bis zum komplexenHals-, Nasen-, Ohrenarzt reicht die Spannweite. Durch Kombinationen kann der deutsche Wortschatz aus vertrauten Elementen beliebig erweitert werden.
Quengelware und fremdschämen
An den Kassen der Supermärkte hat man gezielt verführerische Waren auf der Augenhöhe von Kindern ausgestellt, damit diese sie sogleich erblicken und so lange quengeln, bis die Mutter oder der Vater sie ihnen kauft. Die in den Neunzigerjahren aufgekommene Bezeichnung dafür lautet denn auch kurz: Quengelware. Braucht man einen neuen Begriff für Leitungen, die riesige Datenmengen quer durchs Land transportieren können, so kombiniert man das Wort für diesen ebenfalls recht neuen Gegenstand mit zwei bestehenden: Datenautobahn.
Diese Fähigkeit der deutschen Sprache, mühelos Wörter zu kombinieren, macht sie wendig: Man kann zwei Substantive kombinieren wie in Autobahn. Man kann Adverb und Verb kombinieren wie in fremdschämen, das das bekannte Gefühl übersetzt, welches wir empfinden, wenn wir uns einer anderen Person schämen und nicht unserer selbst – eine gelungene Neuschöpfung der letzten Jahre. Zwar konnte man sich auch schon vorher für jemanden schämen, aber diese Empfindung konnte man nur in direktem Bezug auf eine Person äußern, nicht als Empfindung an sich. Nun aber kann man sich schämen und sich fremdschämen, und schon ist dieser Unterschied in einem Wort gemacht.
Durch Vor- oder Nachsilben können wir aus Substantiven jederzeit ein Adjektiv machen wie bei schnurlos. Und wir können durch diese Silben (Lexeme oder Phoneme) die Bedeutungen unserer Verben weiter präzisieren, wie bei dem in den Neunzigerjahren entstandenen andenken in Sätzen wie es ist angedacht, das Produkt erst später zu lancieren. Andenken heißt hier, dass wir uns auf etwas noch nicht festlegen wollen, sondern dass wir es zur Diskussion stellen. Eine ähnliche Wortschöpfung ist sich hineindenken: „Er hat sich in die Sache hineingedacht“, er hat begonnen, sich mit der Sache gedanklich vertraut zu machen.
Allerdings ist nicht jede dieser Kombinationen logisch abzuleiten, wie überhaupt die Wortfelder einer Sprache nicht den strikten Anforderungen einer Formelsprache genügen, und es kann deshalb auch immer wieder zu Missverständnissen kommen wie bei der wichtigen Frage, ob jemand den Mann umgefahren hat oder ob er ihn umfahren hat, was aus dem Verb in seiner ungebeugten Schriftform allein nicht zu erkennen ist (umfahren), sondern nur in der mündlichen Rede durch die Betonung (úmfahren oder umfáhren).
Es ist auch nicht zu bestreiten, dass die Leichtigkeit, mit der das Deutsche zur Wortschöpfung durch Kombination bestehender Wörter einlädt, zu Wortungetümen verführt wie beim Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz aus dem Jahre 2008, mit dessen Hilfe die Zahlungsfähigkeit der Kreditinstitute in Deutschland sichergestellt werden sollte. Immerhin wird in diesem Wortungetüm eine komplexe Information gebündelt – nicht schön, aber wenigstens genau. Für den Hausgebrauch reichen einfache Abkürzungen – natürlich auch wieder Wortkombinationen wie Rettungspaket, Rettungsfonds oder auch Rettungsschirm.
Eine weitere Quelle des reichen Wortschatzes im Deutschen sind die Ableitungen. Man hängt einfach eine Endsilbe an ein Substantiv, und schon hat man ein Adjektiv zur Hand: Gefühl wird zu gefühlvoll, gefühlsarm oder gefühlig. Oder umgekehrt: einsam wird zu Einsamkeit, Vereinsamung. Auf diese Weise entstehen ganze Wortfamilien aus einem einzigen Wort. Wer das Ausgangswort kennt, kann sich das Wortfeld erschließen.
Leichter als im Französischen
Bei der Kombination von Wörtern können andere Sprachen durchaus widerstrebend sein: Das Französische belässt Substantivkombinationen bevorzugt auseinandergefaltet wie papier de verre (Sandpapier), wobei das Zeichenpapier dann papier à dessin heißt, weil das Zeichnen der Zweck des Papiers ist, was durch à ausgedrückt wird (warum aber heißt der Minzesirup dann menthe à l’eau, wo doch das Wasser nicht der Zweck des Sirups ist?) Auch aus stilistischer Tradition heraus sucht man im Französischen oft eher einen eigenen Begriff, als bestehende zu kombinieren, wie dies an den vielen Fachbezeichnungen aus dem Griechischen und Lateinischen zu erkennen ist, die schon im 16. Jahrhundert als sogenannte gelehrte Wörter (mots savants) in großer Zahl ins Französische eingeführt wurden. Das Englische ist offener für Zusammensetzungen, hier aber steht der Lernende vor den Schwierigkeiten einer komplizierteren und oft nicht nachvollziehbaren unterschiedlichen Schreibweise (small talk, softdrink, well-being)2. Dazu kommt, dass das Englische keine Fugenelemente benutzt (vgl. hingegen deutsch „Arbeitsamt“). So entstehen Ungetüme aus der Management- und Wissenschaftssprache, deren Bestandteile sich erst nach mehrmaligem Lesen zuordnen lassen, wie z. B. Global Mindset Development in Leadership and Management Conference. Mark Twain hätte beim Phänomen der Wortungetüme auch in seiner eigenen Sprache fündig werden können.
Schöne Wortkombinationen
Nicht zu vergessen ist in der deutschen Wortbildung neben dem Vorzug ihrer Leichtigkeit die Schönheit vieler Wörter, die aus Kombinationen hervorgegangen sind und in ihrer Synthese oder Verschmelzung nicht nur eine Addition aus den Bedeutungsbestandteilen der beiden kombinierten Wörter bilden, sondern eine neue und sehr präzise Bedeutung schaffen. Meine beiden Lieblingswörter sind in ihrer Bedeutung gegensätzlich: anschmiegsam und unnahbar. Es sind regelrechte Sprachkunstwerke. Aus drei einfachen Wörtern ist anschmiegsam gebaut: im Wortkern das Verb sich anschmiegen, dann das Adjektivsuffix -sam, das es uns ermöglicht, ein Verb in ein Adjektiv umzuformen, und im Verb selbst die Vorsilbe -an, die die räumliche Nähe zwischen zwei Personen zusätzlich unterstreicht (im Gegensatz zu anderen denkbaren Vorsilben wie auf-, oder ab-). Anschmiegsam ist nicht nur in der Geste schön, die das Wort bezeichnet (bezeichnet ist hier nicht ganz richtig: Wir bezeichnen mit Wörtern eine geistige Vorstellung, nicht den Sachverhalt direkt), sondern auch im Klangbild. Und in dieser Parallelität wirkt das Wort besonders intensiv. Hinzu kommt die Abgrenzung in der Bedeutung gegenüber formverwandten Verben wie z. B. anlehnen). Anschmiegen ist eben nicht nur anlehnen, sondern es bringt eine größere Nähe, fast schon Intimität zum Ausdruck.
Das unscheinbare Wort unnahbar ist ein ebensolches Kunstwerk. Aus drei Elementen gebildet, bringt es uns eine ganze Vorstellungswelt vor Augen. Mit der Unnahbarkeit (das Substantiv ist im Deutschen auch gleich zur Hand) hat es eine schwierige Bewandtnis, denn einerseits will der Unnahbare nicht, dass sich ihm jemand nähert, und andererseits nimmt er sich selbst die Möglichkeit der Nähe anderer. Noch dazu kann es sein, dass der Betreffende nicht einmal willentlich unnahbar wirkt, sondern unwillkürlich und unabsichtlich. Ein so komplizierter Charakterzug steckt allein in jenen drei harmlosen Elementen, aus denen das Wort gebaut ist.
Es sind Zusammensetzungen dieser Art, die es im Deutschen möglich machen, so viele feine Unterschiede zu benennen und damit letztlich auch zu schaffen. Es sind sprachlich-geistige Schöpfungen, die wir in der Wortbildung hervorbringen. Sie sind keineswegs trivial, auch wenn sie uns so leicht fallen. Die Wortbildung ist ein elementarer Vorgang. Denn in den Wörtern erfahren wir die Welt, in ihnen bestimmen wir unsere Welt, und mit ihnen sprechen wir über unsere Welt.
Flexible Wortstellung
Zu den Vorzügen unserer Sprache rechne ich auch den Satzbau. Das mag manchen Leser überraschen, wird doch gerade der deutsche Satz von Kritikern als Zumutung empfunden. Natürlich gibt es sie, die Bandwurmsätze, bei denen sich erst am Ende mehrerer voneinander abhängiger Nebensätze durch das Verb erschließt, was ihre Gesamtbedeutung ist. Aber auch das muss nicht immer ein Nachteil sein, wie wir sehen werden.
Der Satzbau im Deutschen ist sehr flexibel – eine Folge des von Mark Twain so ungeliebten ausgeprägten deutschen Kasussystems.3 Es ist einleuchtend, dass eine Sprache mit ausgeprägtem Kasussystem in der Wortstellung mehr Freiheit geben kann. Den Vorteil einer leicht zu bildenden Wortgruppe ohne Kasusmarkierung bezahlt der Sprecher des Französischen mit einer Einschränkung in der Wortstellung. Man kann eben nicht alles haben. Im Deutschen kann man den Satz Ich habe ihm das Buch geschenkt mehrfach drehen und wenden und ihn damit in einer immer wieder anderen Bedeutung verwenden: Ihm habe ich das Buch geschenkt; wenn es darum geht, den Empfänger stark zu betonen. Ich habe das Buch ihm geschenkt, hier wird der Empfänger etwas schwächer betont als im Satz zuvor, weil er sich die Aufmerksamkeit des Hörers mit dem Buch teilen muss. Das Buch habe ich ihm geschenkt, wenn das Geschenk selbst betont werden soll; Geschenkt habe ich ihm das Buch, wenn man verdeutlichen will, dass man das Buch nicht verkauft oder verliehen hat. Nur die Wortstellung Ich ihm habe das Buch geschenkt wird im Deutschen nicht akzeptiert.4
Wenn man nun noch Umstandsbestimmungen der Zeit, des Ortes oder etwa des Grundes oder der Art und Weise hinzufügt (Heute Morgen, im Restaurant, wegen seiner Mithilfe, mit großer Freude), ergeben sich noch mehr Möglichkeiten der Wortstellung und ebenso viele Nuancen, im Satzinhalt eine andere Betonung des Wichtigen vorzunehmen.5 Elastizität und Nuancenreichtum, das sind Vorzüge des deutschen Satzbaus.
Eine weitere Besonderheit des deutschen Satzbaus rührt von der Teilung des Prädikats her, von der Verb- oder Satzklammer. Sie betrifft einmal die Hilfs- und Modalverben, die ein Hauptverb in seiner Bedeutung spezifizieren wie in dem Satz: Paul hat Gaby auch am letzten Abend gegen 19.00 Uhr auf dem Bahnsteig von Köln-Ehrenfeld nicht gesehen. Die Klammer wird hier von hat bis nicht gesehen gebildet, und mancher Nicht-Muttersprachler stöhnt über die lange Strecke, die er zurücklegen muss, bis er den wahren Sinn des Satzes verstanden hat, denn dieser erschließt sich ja erst ganz am Ende.6 Ebenso hört man Klagen von Nicht-Muttersprachlern, die einen Satz in korrekter Satzklammer formulieren wollen und dabei den Überblick verlieren (wobei dies den Muttersprachlern ja auch häufig widerfährt). Man kann aber die Satzklammer umgehen.7 Den obigen Satz kann man problemlos so umformen, dass die möglicherweise wichtigste Nachricht am Anfang des Satzes steht und der Rest in einen Nebensatz ausgelagert wird: Paul hat Gaby nicht gesehen, als er am letzten Abend gegen 19.00 Uhr auf dem Bahnsteig von Köln-Ehrenfeld war. Man kann sogar das Gesehen-Haben noch stärker betonen, indem man es an den Anfang des Satzes stellt: Gesehen hat er sie nicht …
Aber die Verbklammer hat auch ihr Gutes. Nehmen wir den Satz: Sie gibt ihre anspruchsvolle und interessante Tätigkeit auf. Am Ende könnte es auch heißen: … nicht auf. Oder: … an eine Kollegin ab. Oder: … nicht an eine Bekannte, sondern an einen neuen Kollegen ab. Dadurch dass die Inhalte des Satzes erst am Ende durch den Verbbestandteil (auf ab) richtig eingeordnet werden, bekommen wir eine synthetische Vorstellung der Lage: Der Satzinhalt wird zu einer Vorstellung zusammengedrängt. Die Bedeutung des Satzes ist so lange in der Schwebe, bis wir ihn ganz gehört haben, und erst am Ende verstehen wir ihn richtig. Man muss durch die Verbklammer alle Bestandteile des Satzes im Gedächtnis behalten, um am Ende des Satzes mithilfe des Verbs oder seiner Vorsilbe oder auch seiner Verneinung die Bedeutung richtig interpretieren zu können. Das kann in Satzgefügen oder auch in einfachen Sätzen mit komplexen Substantivgruppen eine anspruchsvolle Übung sein, und für den Nicht-Muttersprachler, der dies nicht gewohnt ist, muss eine solche Wortstellung sowohl beim Hören als auch beim Sprechen anfangs recht schwierig erscheinen. Aber im Gegenzug bildet der deutsche Satz mit seiner Eigenart der Verbklammer eben jene synthetische Vorstellung, die es einem ermöglicht, alle Elemente des Satzes in ihrer gegenseitigen Beziehung zueinander als ein Ganzes zu erfassen. Ein weiterer Vorzug der Verbklammer ist ihre Gliederungsfunktion in einem Satzgefüge. Sie markiert nämlich unmissverständlich das Ende eines Satzes, an das nun ein Nebensatz angeschlossen werden kann: Sie gibt ihre anspruchsvolle und interessante Tätigkeit auf, weil sie ein Erbe antreten kann.
Einige Sprachwissenschaftler aus dem romanischen Sprachraum deuten den Satzbau der französischen Sprache als das Gegenteil der sogenannten „regressiven“ (= rückwärtsgewandten oder rückbezüglichen) Wortstellung des Deutschen. Der französische Satz, so ihre These, gehorche einer natürlichen Wortstellung („ordre naturel“ oder „ordre direct“), indem er alles stets der Abfolge Subjekt, Prädikat, Objekt unterwerfe;8 im Deutschen sei diese Ordnung auf den Kopf gestellt; das gelte auch für Wortgruppen wie zum Beispiel ein zwei Meter langer Tisch oder ein auf den Stuhl gelegter Mantel; das Französische stelle hier ganz logisch das Substantiv an den Anfang, gefolgt von den Wörtern, die es weiter bestimmen (une table longue de deux mètres; un manteau posé sur une chaise); der Leser oder Hörer könne bequem der Ordnung der Wörter folgen, weil sie sich eins nach dem andern und vom Wichtigsten ausgehend erschlössen; im Deutschen könne der Sprecher nach Belieben alles umstellen und hin- und herrücken, ohne sich beim Sprechen um die natürliche Ordnung der Dinge zu kümmern; im Französischen werde er hingegen zur sachlich richtigen Wortstellung gezwungen; das Deutsche sei eine Sprache für Sprecher, das Französische eine für Hörer.9
Aber was ist eine „natürliche“ Wortstellung? Für die Franzosen der Aufklärung war es die Folge Subjekt – Verb – Objekt, an die sie selbst sich so wenig hielten wie andere Sprachgemeinschaften. Noch schwerer sind mentalitätsbezogene Weltbildthesen zu beurteilen, die aus den genannten sprachlichen Unterschieden abgeleitet worden sind (Rationalität im Gegensatz zum Gefühl, Objektivität im Gegensatz zur Subjektivität).
Es gibt immerhin einiges, was für die im Deutschen mögliche vorangestellte Attribuierung (ein auf den Stuhl gelegter Mantel) spricht. Denn das Deutsche eröffnet dadurch die Ausbaufähigkeit des Nomens nach beiden Seiten, nämlich durch vorangestellte Attribute und durch nachfolgenden Relativsatz (ein auf den Stuhl gelegter Mantel, den ich beim Hinausgehen vergessen hatte).10 Auf diese Weise können auch komplexe Informationen gut aufgeteilt werden. Das vorangestellte Attribut ist weniger hervorgehoben als ein Relativsatz. Dadurch gelingt eine differenzierte „Perspektivierung“, also eine feine Dosierung der Gewichte, die man den präzisierenden Satzteilen oder Sätzen zuweist. Und wenn man bedenkt, was sonst noch möglich ist, beispielsweise auch in der Nachstellung des Adjektivs, kann man von der großen Elastizität der Wortstellung nur beeindruckt sein: Röslein rot, Forelle blau, Henkell trocken oder auch diese nachgestellte Konstruktion: Salat kauft er nur frischen.11
Zurück zum Sprachvergleich zwischen dem Deutschen und dem Französischen, der erhellend ist, weil er zeigt, dass die beiden Sprachen in ihrem System und in ihren Stilidealen die Aufmerksamkeit auf verschiedene Weise „steuern und fixieren“, so der Kölner Romanist Peter Blumenthal in einer scharfsinnigen Arbeit zu diesem Thema.12 Hier die Aufmerksamkeit sozusagen Schritt für Schritt und Stück für Stück, da die Aufmerksamkeit in einer Gesamtsicht.
Bei aller Faszination für sprachliche Unterschiede ist anzumerken, dass das Deutsche auch den geradlinigen Satz mit Subjekt, Prädikat und Objekt kennt: Er gibt ihr das Buch. Erst in den Sätzen mit zusammengesetzten Prädikaten und in Nebensätzen werden Satzklammern gebildet. Und schließlich muss das Deutsche auch in Substantivgruppen eine Ansammlung von bestimmenden Wörtern nicht voranstellen, sondern kann sie durch einen Relativsatz oder eine Apposition nach dem Substantiv gruppieren: Wem die Wortgruppe ein im Wohnzimmer zwischen dem Kamin und dem Fenster stehender Schrank zu schwierig ist, der kann ebenso gut sagen: ein Schrank, der im Wohnzimmer zwischen dem Kamin und dem Fenster steht oder ein Schrank im Wohnzimmer, zwischen dem Kamin und dem Fenster.13 Es gibt sprachliche Zwänge, aber es gibt auch Auswege aus ihnen.
Es lebe der lange Satz!
Ich möchte eine Lanze brechen für den langen Satz, ja sogar für den Schachtelsatz, den das Deutsche ermöglicht, der aber gern als Überforderung des Lesers und Hörers missbilligt wird. Gerade im langen Schachtelsatz zeigen sich die wunderbaren Stellungsfreiheiten des deutschen Satzbaus – allerdings nur dann, wenn jemand mit diesen Freiheiten vernünftig umzugehen versteht. Wenige konnten damit so virtuos umgehen wie Thomas Mann. Der Bau des langen, dabei gut verständlichen Satzes, ist eine seiner Sprachkünste. Wenn man sich dem Rhythmus seiner Sätze anvertraut und sich von ihnen in die Gedankenwelt des Autors einführen lässt, stellt sich ein Hochgenuss ein: ein Sprach- und Denkkunstwerk zugleich.
Der Doktor Faustus beginnt mit einem solchen Satz, mit dem der Erzähler Gelehrsamkeit, Bescheidenheit und Vornehmheit vermittelt: „Mit aller Bestimmtheit will ich versichern, dass es keineswegs aus dem Wunsche geschieht, meine Person in den Vordergrund zu schieben, wenn ich diesen Mitteilungen über das Leben des verewigten Adrian Leverkühn, dieser ersten und gewiß sehr vorläufigen Biographie des teuren, vom Schicksal so furchtbar heimgesuchten, erhobenen und gestürzten Mannes und genialen Musikers einige Worte über mich selbst und meine Bewandtnisse vorausschicke.“
Erst am Ende des Satzes erfährt man, was der Autor ankündigen will: dass er zunächst einiges über sich selbst berichten wird. Aber durch die eingefügten Nebensätze entsteht gerade jener langsame, fast schon zögerliche Rhythmus, der die bedächtige Wesensart des Erzählers, eines zurückgezogen lebenden Gelehrten, erkennbar werden lässt. Dieser lange Satz lenkt unsere Aufmerksamkeit in einem Wurf und Guss auf den Erzähler und auf die dramatische Persönlichkeit des Tonsetzers Adrian Leverkühn, dessen Schicksal sogleich angedeutet wird. Die Anfänge eines Romans sind ja stets besonders wichtig, denn hier muss der Autor den Leser packen. Dieser Romananfang führt uns vor Augen, was uns erwartet: eine dramatische Erzählung, vorgetragen von einem glaubwürdigen, besonnenen, aber auch aufgewühlten Zeugen.
Der Doktor Faustus ist ein großes Zeugnis deutscher Sprachkunst, und man kann nur hoffen, aber auch erwarten, ja einfordern, dass unsere Schulen nicht unter der Maxime einer sich anbiedernden „Niedrigschwelligkeit“ lieber im Tal der sprachlich Ahnungslosen verweilen, als ihre Schüler zum Erlebnis solcher Höhepunkte zu führen. Es wäre ein großer Verlust, wenn selbst Gymnasiasten, also Absolventen „höherer Bildung“, nicht mehr an solche Sprachkunstwerke herangeführt würden, weil sich unsere Sprache in ihrer allgegenwärtigen Trivialisierung in so großen Schritten von dem hohen Niveau unserer großen Schriftsteller entfernte, dass schon die kommende Generation sich diese Sprachzeugnisse allenfalls noch im germanistischen Studium erschließen könnte, so als handelte es sich beim „Doktor Faustus“ um das althochdeutsche Ludwigslied aus der Zeit Ludwigs des Stammlers.
Der Satzbau im Deutschen kann auch Kürze und Länge wirkungsvoll kombinieren. Ein Meister dieser Abwechslung zwischen lang und kurz ist Stefan Zweig. Der elegante Schwung seines Sprachstils rührt von dieser Abwechslung her, und er war gerade deswegen manch altfränkisch gesinnten Sprachliebhabern nahezu suspekt, so als wäre der deutschen Sprache Eleganz wesensfremd. Aber im Gegenteil: Wer meint, die Satzbauregeln des Deutschen zwängen zu holprigen Konstruktionen, dem sei die Lektüre Stefan Zweigs empfohlen. Der erste Satz seines historischen Romans über den Weltumsegler Magellan lautet: „Im Anfang war das Gewürz.“ So beginnt in Abwandlung des bekannten Bibelsatzes die Erzählung. Diesem prägnanten Satz, der den geschichtlichen Zusammenhang und den wirtschaftlichen Zweck der Entdeckungsreisen auf den Punkt bringt, folgt ein komplexer Satz mit mehreren illustrierenden Einschüben, die mit leichter Hand aneinandergereiht sind, sodass sie sich dem Leser mühelos erschließen:
„Seit die Römer bei ihren Fahrten und Kriegen zum erstenmal an den brennenden oder betäubenden, den beizenden oder berauschenden Ingredienzien des Morgenlandes Geschmack gefunden, kann und will das Abendland die „especeria“, die indischen Spezereien, in Küche und Keller nicht mehr missen.“14
Wer Zweig liest, hat den Eindruck, Französisch im Deutschen zu lesen. Das zeigt, wie vielseitig der deutsche Satzbau sein kann.
Genauigkeit im Raum
Nun zu einem weiteren Vorzug der deutschen Sprache, ihrer Präzision im Raum. Durch die Fälle Dativ und Akkusativ gibt das Deutsche mit den entsprechenden Fragen Wo? und Wohin? einen klaren Unterschied zwischen Richtung und Ort vor und zwingt den Sprecher zu einer Entscheidung, von der auch der Hörer profitiert. Denn er weiß unmittelbar – und nicht erst aus dem Zusammenhang – worum es geht: Geht es darum, dass jemand in den Garten läuft oder im Garten läuft?15
Auch in den Präpositionen zeigt sich dieser Druck in Richtung räumlicher Genauigkeit, zum Beispiel in den von Nicht-Muttersprachlern so gefürchteten Wechselpräpositionen, die sowohl Richtung wie auch Ort anzeigen können und, dementsprechend, mit dem Dativ oder dem Akkusativ verbunden sind: Sie steht auf dem Stuhl (Wo? also Dativ) und Sie stellt sich auf den Stuhl (Wohin? also Akkusativ). Man muss nur überlegen, ob es um eine Richtung oder um einen Ort geht. Diese Unterschiede sind mit zweierlei Kasus belegt. Eigentlich ganz logisch! Nur muss in anderen Sprachen der Kontext diese Unterscheidung gewährleisten.
Die Neigung des Deutschen zur Präzision im Raum zeigt sich auch an seinen Verben, zum Beispiel an den trennbaren Verben mit Vorsilben, die für das Deutsche so typisch sind. Nehmen wir das Verb gehen: angehen, ausgehen, weggehen, aufgehen, abgehen, entgegengehen, untergehen, hinaufgehen: hinuntergehen. Die Leichtigkeit der Kombination von Wörtern verbindet sich hier mit der Neigung zur räumlichen Genauigkeit. Als Deutscher braucht man eine gewisse Zeit, um im Französischen zu lernen, dass ausgehen sortir heißt und weggehen partir, also zwei ganz unterschiedliche Verben, die nicht wie im Deutschen die ähnliche Raumbeziehung erkennen lassen.
Das Wortfeld der Bewegungsverben und der Verben der Bewegungsart ist im Deutschen riesig und bietet viele Unterscheidungsmöglichkeiten, siehe beim Verb laufen die Ableitungen anlaufen, entlaufen, verlaufen, überlaufen, entgegenlaufen usw. Ein Sprachvergleich mit dem Französischen zeigt in diesem Bereich bei Übersetzungen einen Informationsverlust von einem Drittel.16 Das Deutsche neigt dermaßen zur Genauigkeit im Raum, dass es die Bewegung durch manche Verben übergenau angeben lässt, z. B. in dem Satz Der Apfel fällt vom Baum herunter. Zwar kann man im Deutschen auch eine Treppe hinauffallen, aber nur wortspielerich. Es kennzeichnet eine besondere Bewegung, während das Fallen des Apfels durch die Präposition herunter keine zusätzliche Information vermittelt. Man kann unserer Sprache deshalb, wenn man will, eine gewisse Neigung zur Pedanterie nachsagen. Man kann ihre Übergenauigkeit fürchten, belächeln – oder bewundern.
Ausdrucksstärke durch feine Abtönung
Früher nannte man sie verächtlich „Füllwörter“: jene kleinen, unscheinbaren Wörter, von denen es immer wieder heißt, sie seien nur eine Verlegenheitslösung. Zum Beispiel denn. Wir verwenden es zunächst vor allem als Konjunktion, und zwar dann, wenn wir einen auf der Hand liegenden Grund anzeigen wollen: Die Wasserrohre sind geplatzt, denn es hat Frost gegeben.17 Aber wir können denn auch in einem ganz anderen Sinne gebrauchen: Wir sehen zum ersten Mal das Kind des neuen Nachbarn. Wie fragen wir nach seinem Namen? „Wie heißt Du?“ Das wäre ziemlich brüsk. Und so fragen wir: „Wie heißt du denn?“ Auf diese Weise ist die Frage vermittelnder, abgeschwächt, abgefedert. Wir fragen, aber wir entschuldigen uns zugleich ein wenig dafür, dass wir fragen. Es ist eine feine Zusatzbedeutung, die uns die deutsche Sprache da an die Hand gibt und die es uns erleichtert, unsere Mitteilungsabsicht auf den Anderen und auf den Mitteilungsinhalt abzustimmen. Man nennt diese kleinen Wörter deshalb auch „Abtönungspartikel“. Der Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg nennt sie bewundernd „Zaunkönige im Pelz der Sprache“.18 Sie geben unserer Frage oder unserer Äußerung einen bestimmten Ton, sie helfen uns, nicht gleich mit einer kruden Behauptung oder mit der direkten Frage ins Haus zu fallen. Diese Abtönungspartikel haben keine gegenständliche Bedeutung, sondern sie haben eine kommunikative Funktion. Aber diese ist sehr nützlich. Glücklicherweise haben wir die kleinen Wörter zur Hand wie aber, auch, bloß, doch, eben, etwa, halt, ja, schon, vielleicht, wohl.19