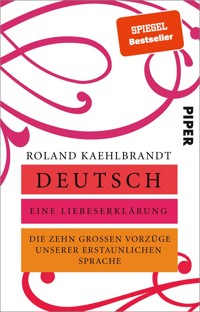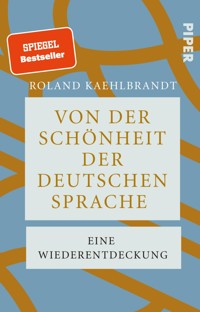
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Deutsche Sprache, schöne Sprache Deutsche Sprache, schöne Sprache Die deutsche Sprache steht im Ruf, genau und logisch, aber auch schwerfällig, hart im Klang und sogar unschön zu sein. Bestsellerautor Roland Kaehlbrandt widmet sich keiner geringeren Aufgabe, als zu beweisen: Deutsch ist eine schöne Sprache! Denn sie lädt zu feinsten Nuancen ein; sie ist klangvoll, klar und anschaulich, kann aber auch anmutig und elegant sein, ja sogar voller Witz. Dieses Buch ist eine Schatztruhe an Sprachschönheiten, aufgespürt in Wörtern, Sätzen, Versen, Liedern, Reden, im Sprachwitz und in unseren Mundarten. Ein ästhetisches Lesevergnügen für alle Sprachliebhaber. »Um die deutsche Sprache zu lieben, muß man ihre Schönheit entdecken – Roland Kaehlbrandt öffnet uns dafür Augen und Ohren.« Martin Mosebach
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2025Covergestaltung: Cornelia Niere, MünchenKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Zitate
Vorwort
0
Einstimmung
Zwei Seiten sprachlicher Schönheit
Falsche Klischees
Einspruch!
Leicht verblasstes Bild
Ist Schönheit bestimmbar?
Die Schönheit bleibt
Erster Teil~Wie das Deutsche schön sein kann
1
Was ist schön?
Ein Blick in die Kulturgeschichte
»Sinnliche Erkenntnis«
»Interesseloses Wohlgefallen«
Die Künste – nicht mehr schön?
2
Das Schöne und die Sprache
Die Sprache im Wettstreit der Künste
Was Sprache uns schenkt
»Grund des Menschseins«
Sprache bringt Schönheit hervor
Die »poetische Funktion«
Ein Beispiel aus der empirischen Ästhetik
Beziehungsreichtum belebt die Aufmerksamkeit
3
Die Schönheit des Sprachbaus
Wilhelm von Humboldt über die Schönheit des Sprachbaus
Freiheit in der Wortfolge
Eine bunte Gesellschaft
Umschalten!
Stellungsfreiheiten im Mittelfeld
Die Wortbildung
»Motivierte« Wörter
Umwandlungen der Wortart
Regisseur vielfältiger Perspektiven: das Verb
»Wie von Geisterhand«
»Möglichkeitssinn«
Zeit und Tempus
Der Sprachbau des Deutschen – das Potenzial der Schönheit
4
Wohlklang
Negative Klischees – »Valdberghoff-trarbk-dikdorff«
Positive Gegenstimmen
Das Wunder des Lautsystems
Wohlklang im Deutschen? Die klanglichen Tatsachen
Das reiche Angebot an Konsonanten – »Schönheit für den Verstand«
5
Schöner Stil
Stilbruch und Stilblüte
Angemessenheit
Klarheit
Anschaulichkeit und Bildlichkeit
Nicht gesucht, sondern echt
Bewegen und erfreuen: Gewandtheit
Fazit
6
Die beharrliche Verfeinerung des Deutschen
Die Lebensalter der Sprache
Zurück zum Anfang: »Thaz wir Kríste sungun in únsera zungun«
Gelehrtenbewegung
Mit Feuereifer für markantes Deutsch
Früher Sprachpatriotismus
Martin Opitz und die Verfeinerung des Deutschen
Vernunft und sprachliche Schönheit: Johann Christoph Gottsched
»Sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte: ›Klopstock!‹«
Unvergleichliche Kulturperiode
Zweiter Teil~Wie schön Deutsch sein kann
7
Wortkunstwerke
Empfindsamkeit, Einfühlsamkeit, Zartgefühl und Feingefühl
Abendhauch, Abendschimmer, Abendglanz
Wörter mit Eigenschaften
Bildliche Verben
8
Satzbauten
Meister des kurzen Satzes
Der schöne mittlere Satz
Kann der lange Satz schön und klar sein?
Ein sehr langer, sehr komplexer und sehr schöner Satz
9
Schöne Stellen
Das hat niemand sonst jemals so gesagt
»Kontaktstellen« zur »Lebenswelt«
Schöne Stellen: Kindheit
Klar und schön
»Eine Mutter und ihr Sohn auf einem kleinen Platz in Deutschland«
Ein »schwermütig schönes Bild«
Ein Bild nächtlicher Stille
10
Schönheit der Verssprache
Sinn der Form
Sechs Verse von Rilke
Vers und Rhythmus
Der Sprache Rhythmus und Klang ablauschen und einhauchen
Gleichklang und Wohlklang: der Reim
Dann kam Klopstock
»Die Frühlingsfeier«
Zwei Beispiele aus zeitgenössischer Lyrik
Bühnendichtung
11
Kann man auf Deutsch singen?
Wort- und Tonsprache
»Unzertrennlich vereint«: Dichtung und Musik
Das Lied
Kunstlied und Volkslied
Das deutsche Chanson
Schlager, Lieder, Songs
12
Fasslichkeit der Wissenschaftssprache
Heftige Kritik an der Schwerverständlichkeit
Sigmund Freuds stilistische Meisterschaft
Rückbindung an die Leser
Überraschende Parallelen
Auf neuer Spur
Scheinbar mühelos
Gegenwärtige Vorbilder
13
Bewegende Rede
Die bessere Sache wirksam vertreten
»Politik ist Sprache«
Ein Beispiel gewahrter Vernunft in aufgeheizter Lage
14
Schöner Humor, geistreicher Witz
Komische Lyrik
Eine Satire aus der Domstadt
Nomen est omen
Parodien
15
Schönes aus den Mundarten
Klangfülle der Mundarten
Grammatische Bereicherungen
Schöne Wörter in Mundarten
16
Weil es auch zur Sprache gehört: Hässliches und Vulgäres
Das Hässliche als Gegenstand
Vulgäre Sprache – deutscher Sonderweg
Schluss
17
Zur Schönheit begabt
Schönheit und Sprache
Das Wunder der Sprache
Wendigkeit begünstigt Schönheit
Inszenierungen: Grammatik und Schönheit
Wörter: Aus Bekanntem entsteht Neues
Wohlklang
Kunstfertigkeit wirkt schön
Errungene Feinheit
Kultivierter Wissenschaftsstil
Beredsamkeit
Es darf auch gelacht werden
Nähe und Wärme der Mundarten
Fazit
Danksagung
Literatur
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Widmung
Für Gaby, Anna, Philipp und für meinen Vater
Zitate
»Die Sprache ist eine Bedingung der Möglichkeit, dass das Schöne in die Welt treten kann.«
Hartmut Böhme
»Wen der Pfeil des Schönen je getroffen,Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe!«
August von Platen
»Die deutsche Sprache ist auf einen so hohen Grad der Ausbildung gelangt, dass einem jeden an die Hand gegeben ist, sowohl in Prosa als in Rhythmen und Reimen sich dem Gegenstande wie der Empfindung gemäß nach seinem Vermögen glücklich auszudrücken.«
Johann Wolfgang von Goethe
»Und als ich die deutsche Sprache vernahm,
Da ward mir seltsam zu Muthe;
Ich meinte nicht anders, als ob das Herz
Recht angenehm verblute.«
Heinrich Heine
»Ich denke auf Deutsch. Ich träume auf Deutsch.«
Udo Lindenberg
»Begreifen, was uns ergreift.«
Emil Staiger
Vorwort
In meinem letzten Buch, »Deutsch – eine Liebeserklärung«, ging es mir darum, die Vorzüge der deutschen Sprache aufzuzeigen. Ich beschrieb also, was die deutsche Sprache alles vermag: beispielsweise dass sie elastisch, kurz und schnell sein kann und nicht langatmig sein muss; oder dass sie kommunikations- und beziehungsfreundlich ist und nur fälschlicherweise als brüsk und barsch gilt.
Aber Sprache ist ja nicht nur nützlich für unser Zusammenleben und für »Welterfassung und Mitteilung«.[1] Das muss sie zwar natürlich sein, und das ist sie auch; aber sie hat zudem eine ästhetische Seite. Dieser Seite unserer Sprache, also ihrer Fähigkeit zur Darstellung dessen, was wir als schön empfinden, und der Schönheit ihres eigenen Baus einschließlich ihres Klangs, wollte ich in einem weiteren Buch über die deutsche Sprache nachgehen, kaum dass ich meine »Liebeserklärung« beendet hatte. Die Anregung dazu kam – wie auch schon bei meinen früheren Büchern – aus dem sprachverliebten Frankreich. Es war eine Rede, die Gabriel de Broglie als Mitglied der Académie française und als Kanzler des Institut de France einmal über die »Schönheit« des Französischen gehalten hatte. Er begründete sie mit den Anlagen der Sprache, vor allem der schlüssigen Ordnung des Satzbaus, aber auch mit der jahrhundertelangen stilistischen Arbeit an der Sprache, die ihre Eleganz und ihren Esprit begründet habe.[2] Wer würde ihm widersprechen?
Aber wie verhält es sich eigentlich mit den ästhetischen Qualitäten des Deutschen? Es steht im Ruf, zwar logisch und genau, aber leider auch schwerfällig, hart und unmelodisch zu sein.[3] Auch wird es im Ausland immer weniger als Kultursprache wahrgenommen.[4]
Das Urteil, Deutsch sei unmelodisch, ja in Teilen sogar unschön, begegnete mir immer wieder in Büchern und Schriften. Ich hörte es verschiedentlich im Ausland, wo es in manchen Umfragen bestätigt wurde, aber auch hin und wieder von Landsleuten.
Und ich las und hörte oft auch im Gegenteil: Deutsch sei nicht nur logisch (was im Übrigen ein positives Vorurteil ist), sondern auch schön.[5] Nämlich seine dunklen Vokale, seine unvergleichlichen Lieder, seine reiche Dichtung, seine singenden Mundarten.
Wie wir eine Sprache ästhetisch beurteilen, ist keine Nebensache. Es ist sogar sehr wichtig, denn damit fällen wir ein Urteil über ihre Attraktivität. Es entscheidet letztlich über ihren Ruf, ihre Reputation. Und so entschloss ich mich, den widersprüchlichen sprachästhetischen Urteilen nachzugehen. Dass das Deutsche sehr wohl zu sprachlicher Schönheit imstande sei, war dabei freilich meine etwas parteiliche Grundannahme.
Doch eine ganze Weile habe ich erst einmal über das Thema dieses Buches nachgedacht und vieles nachgelesen. Auch befragte ich Fachleute, ob die Schönheit der deutschen Sprache ein berechtigtes Thema sei. Zumal schon »Schönheit« ein weiter Begriff ist. Unsere Vorstellungen von dem, was schön ist, sind heute durchaus uneinheitlich, und auch in der Kulturgeschichte unserer Sprache hat es selbstverständlich unterschiedliche Vorstellungen von dem Schönen gegeben. Heutzutage gerät die Schönheit auch manchmal unter Verdacht des Gefälligen, Unkritischen. Und dennoch: Wir können vom Schönen nicht lassen, nicht einmal in unserer so entzauberten und ernüchterten Zeit. »Er hat so schön gesprochen«, sagten viele Stimmen anerkennend, als der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz seine Abschiedsrede im Römer hielt. »Das Buch ist so schön geschrieben«, hörte ich eine Mitreisende in einer Vorortbahn zu ihrer Bekannten über ein Buch von Stefan Zweig sagen, das sie in der Hand hielt (es waren die »Sternstunden der Menschheit«). Und als ich einmal in der bedrückenden Coronazeit den Jahresbericht einer Stiftung mit dem alten deutschen Wort »unverdrossen« überschrieb, reagierten viele Menschen erfreut und zustimmend: Das ein wenig vergessene Wort bringe in völliger Klarheit genau die angemessene Haltung auf den Punkt: dass man sich nicht unterkriegen lasse – nur schöner.
Schöne Sprache – Sprache, die wir als schön empfinden – ist also etwas, das uns auch heute bewegt und berührt. Sie fällt uns auf, wenn sie im grauen Einerlei des Alltags und in der kratzigen Aufgeregtheit öffentlicher Streitigkeiten überraschend aufscheint. Eine schlichte Zeile an einer verwahrlosten Haltestelle nachts irgendwo in Deutschland: »Du, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit«, ein Vers aus einem Lied von Wolf Biermann. Plötzlich stehen die einfachen, schönen Worte da und ermutigen uns. Oder eine Weihnachtskarte, auf die eine der traurig-schönen Kindergeschichten für Erwachsene von Erich Kästner aufgedruckt ist (zum Beispiel »Ein Kind hat Kummer«). Sie berührt uns. Oder in einer fremden Stadt: Jemand spricht in der U-Bahn mit seinem Nachbarn in der vertrauten Sprachmelodie des Dialekts unserer Heimat: Wir merken auf, hören hin und fühlen uns plötzlich zu Hause, obwohl wir den Fahrgast gar nicht kennen.
Natürlich – und glücklicherweise – gibt es verschiedene Vorstellungen vom Schönen. Aber es gilt doch eines, das mir bei meiner Entdeckungsreise, auf die ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, nun mitnehmen möchte, selbst klar geworden ist: dass die deutsche Sprache in ihrer langen Geschichte auch den unterschiedlichen Vorstellungen vom Schönen zum Ausdruck gedient hat. Gedient hat sie ihnen – und hervorgebracht hat sie sie! Denn sie kann sich, wie wir sehen werden, durch ihren wunderbaren »Sprachbau« (Wilhelm von Humboldt) verschiedenen Vorstellungen vom Schönen zur Verfügung stellen. Das kann und konnte sie auch deshalb, weil im Laufe ihrer Weiterentwicklung feinste Instrumente zur Darstellung des Schönen und zur schönen Darstellung entstanden sind und geschaffen wurden.
Manches davon ist heute in der Rauheit, teils auch in der Rohheit des Alltagslebens verblasst. Es ist Zeit für eine freudvolle Wiederentdeckung. Und manches schöne Neue blitzt auch auf. Zeit, es zu erkunden!
Noch ein kleiner Lesetipp: Natürlich gehe ich zu Anfang dieses Buches auf das Schöne selbst, auf die Schönheit in der Sprache wie auf Wohlklang und schönen Stil ein. Ich verspreche Ihnen: Die Lektüre ist leichtgängig, und sie lohnt sich. Wenn Sie es aber etwas eiliger haben und gleich die einzelnen konkreten Sprachschönheiten entdecken wollen, können Sie auch problemlos zum Teil 2 springen. (Und danach bitte zu Teil 1 zurückkehren.)
Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der sprachlichen Entdeckungsreise!
Roland Kaehlbrandt, Frankfurt am Main im Herbst 2025
0
»Verweilen wir aber nicht zu lange im allgemeinen Vorworte und treten unser Geschäft ungesäumt an.«
Johann Wolfgang von Goethe
Einstimmung
»Schönheit ist ein Strahlen«, sagte mir einmal meine Kollegin Eva Paul, Professorin für Kunsttherapie an der Alanus-Hochschule, an der ich unterrichte. Schönheit sei etwas, das uns betöre, verzaubere und tröste. Und sie sei eine Sehnsucht.
Was Wunder, dass sich Schönheit nicht nur in der bildenden Kunst findet. Auch die Schönheit der Sprache spricht uns an: Sprachschönheiten wie der Wolkendunst, den wir in der »Prometheus«-Hymne von Goethe finden, oder die Selbstüberraschung, eine Wortschöpfung der zeitgenössischen Lyrikerin Monika Rinck, die sie in ihrer Dankesrede zur Entgegennahme des Friedrich-Hölderlin-Preises[6] nannte – zwei Wortkunstwerke. Schönheiten wie die Maxime von Immanuel Kant über das, was unser Gemüt mit Ehrfurcht erfüllt: »Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir«. Schönheiten wie die rhetorische Kreuzform im Gedicht »Willkommen und Abschied«, die der junge Goethe in einem berühmt gewordenen Ausruf schwungvoll im Metrum des vierhebigen Jambus verwendet:
»Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück!«
Apropos Metrum: Die empirische Forschung bestätigt, dass Metrum und Reim als »variierte Wiederholung« regelmäßig Bewertungen wie »schön«, »wohlklingend« und »prägnant« hervorrufen.[7] Man möchte hinzufügen: Genau deshalb wurden sie vermutlich auch erfunden.
Sprachliche Schönheit finden wir in der Sprachkunst, also in Literatur und Dichtung; in Liedern, aber auch in der schönen, klaren Sprache der Vernunft, zum Beispiel in manchen Reden, ja manchmal sogar in elegant und anschaulich geschriebenen Abhandlungen der Wissenschaft. Auch schöner Humor erscheint einzig im Kleid der Sprache. Gerade er bedarf ihrer fein nuancierten Ausdrucksmittel.
Schön sein kann aber auch die Art, wie eine Sprache gebaut ist: ihr Sprachbau. Geradezu unglaublich ist es, wie stimmig ein solcher Sprachbau im Großen und Ganzen ist, obwohl er ja nicht geplant war, sondern evolutionär entstanden ist. Das trifft gerade auch auf das Deutsche zu. Es grenzt an ein Wunder, dass diese Sprache fast ohne staatlichen Einfluss aus der Mitte einer über Jahrhunderte zersplitterten Sprachgemeinschaft heraus zu einer reichen Kultursprache gewachsen ist.
Ganz in diesem Sinne schreibt Wilhelm von Humboldt über die Sprachen: »Wer von der Schönheit dieses Baus nicht ergriffen ist, hat ihn nie in seinem Zusammenhange zu durchschauen versucht.«[8] In diesem Buch werden wir sehen: Der Sprachbau des Deutschen ist zur Schönheit begabt. Man kann beispielsweise in den Feinheiten des Satzbaus, ja sogar in den Besonderheiten des zu Unrecht viel geschmähten deutschen Lautsystems ein großes Potenzial für sprachliche Schönheit entdecken. Die so wichtige Wortbildung bietet viele Möglichkeiten zu schönem Deutsch.
Schön ist die Sprache im allgemeinen Verständnis und Empfinden, wenn sie wohlklingend, anmutig, harmonisch ist; aber auch – in eher sachbezogenen Texten –, wenn sie klar und elegant ist. Schönheit, Eleganz und Klarheit sprechen uns an, sie beleben unsere Sinne und unseren Verstand zugleich. Das Beleben unserer Sinne und unseres Verstandes ist von zentraler Bedeutung für die Wirkung des Schönen, wie man aus der klassischen theoretischen Ästhetik und auch aus der modernen empirischen Forschung zur Ästhetik weiß.
Zwei Seiten sprachlicher Schönheit
Die sprachliche Schönheit hat zwei Seiten, sie hat einen Doppelcharakter: Die einzelnen Sprachschönheiten, denen wir in Texten begegnen, also in Wörtern, Sätzen oder Versen, nutzen das, was der Sprachbau ihnen an Grundlagen bietet. Und zugleich bereichern sie wiederum den Sprachbau, indem sie diese Grundlagen schöpferisch verwenden. So ist die hochelastische deutsche Wortbildung durch die zunehmende Verschriftlichung der Sprache erst richtig ausgebaut worden. Gute Anlagen zur elastischen Wortzusammensetzung und -ableitung zeigte zwar schon das Althochdeutsche, aber im 15. und 16. Jahrhundert setzte ein massiver Ausbau ein, zum Beispiel indem mehrere Endungen an ein Wort gehängt wurden wie -igkeit oder -barkeit.[9] Das war nun wiederum eine Quelle für schöne Neuschöpfungen wie die Gewordenheit.[10] Sprachschönheiten nutzen also das, was die Sprache ihnen an Potenzial und Repertoire bietet. Aber sie verwenden es nicht nur, sondern sie beleben und mehren es.
Doch treten wir einmal einen Schritt zurück und fragen: Ist denn das Deutsche überhaupt zu sprachlicher Schönheit in der Lage, ist es schön oder jedenfalls auch schön?
Die Frage stellt sich. Denn traurig, aber wahr: Verbreitete und festsitzende Vorurteile sprechen dem Deutschen die Schönheit ab. Umfragen im Ausland zeigen es, so zum Beispiel in Spanien.[11] Positive Bewertungen Deutschlands beziehen sich dort vordringlich auf wirtschaftliche Aspekte; am schlechtesten wird aber … die deutsche Kultur bewertet. Negativ fällt dabei vor allem das Bild der deutschen Sprache aus. Nur drei Prozent halten Deutsch für anziehend. Die deutsche Sprache als Schwachpunkt im Außenbild des Landes, das ihren Namen trägt – ein Umstand, der zum Nachdenken einlädt. In unserem Nachbarland Luxemburg zeigen Studien, dass Deutsch als eine der drei Landessprachen im Vergleich mit Französisch, Luxemburgisch (und Englisch) als »hässlich« und »grobschlächtig« bewertet wird.[12] Am Ende seines 1000 Seiten starken Buches über die Frage »Was ist Deutsch?« stellt der Literaturwissenschaftler Dieter Borchmeyer fast schon resigniert fest: »Dass Deutschland einmal als ›Land der Kultur‹ bezeichnet wurde, gar als ›Volk der Dichter und Denker‹, kommt bei diesen Umfragen kaum jemandem mehr in den Sinn.«[13]
Falsche Klischees
Negative Klischees über die deutsche Sprache sind nicht neu. Schon im 17. Jahrhundert klagte der Sprachgelehrte Justus Georg Schottel, ein beherzter Sprachkultivierer des Deutschen: »Die Außländer halten die Teutschen für grobe brummende Leute, die mit rösterigen Worten daher grummen und mit hartem blindem Geläute von sich knarzen.«
Und in Deutschland selbst? Eine Schülerumfrage aus dem Jahr 2010 ergab, dass nur 8,6 Prozent der Befragten die deutsche Sprache sympathisch fanden.[14] Das hat Tradition. Schon Friedrich II. behauptete, Deutsch sei »unmelodisch«, und schlug deshalb vor, den Vokal a an alle Verben anzuhängen. (Majestät konnten sich freilich mit diesem bizarren Vorschlag nicht durchsetzen.) Negativurteile dieser Art sind hierzulande aber auch heute nicht selten. Neulich hörte ich – wenn auch diesmal nicht aus königlichem Munde – in einem Café einige Zeitgenossen einander bestätigen, das Deutsche sei doch nicht schön, es sei unmelodisch. Das sei auch der Grund, warum man es »nicht singen« könne. Das Deutsche klinge eben hart. Ebendeshalb werde ja auch überall nur Englisch gesungen.
Einspruch!
Man möchte ausrufen: Einspruch, Euer Ehren! Dem Deutschen mit seiner großen Musiktradition ausgerechnet die Musikalität abzusprechen, ist schon verwegen. Hat Richard Wagner seine Opern nicht bewusst kompositorisch mit der besonderen Lautstruktur des Deutschen, dem im Unterschied zu anderen Sprachen festen stammbetonten Wortakzent (lob, lóben, verlóben), verbunden? Wer würde ausgerechnet seinen Gesangspartien den Klangreichtum absprechen?
Und bringt die deutsche Sprache nicht auch heutzutage Schönheit hervor? So heißt es in dem Refrain des Liedes »Der Weg« von Herbert Grönemeyer, in dem er den verstorbenen geliebten Menschen besingt:
»Du hast jeden RaumMit Sonne geflutet«
Kann man berührender das Strahlen beschreiben, das uns erfasst und umfängt, wenn ein geliebter Mensch den Raum betritt? Es ist das Sprachbild »mit Sonne geflutet«, eine ungewöhnliche Metapher, eine Synästhesie,[15] die uns anrührt: die Übertragung eines Bildes vom Wasser auf das Licht. Ein großer sprachlicher Einfall, traurig und schön zugleich – traurig-schön, wie das ganze Lied. Traurig und schön ist durchaus kein Widerspruch, wie Forschungen der empirischen Ästhetik nahelegen. So rufen traurige Gedichte hohe Bewertungen in puncto Bewegtheit, Wohlgefallen und Schönheit hervor.[16]
Finden wir also nicht doch auch in zeitgenössischen Erzählungen, Gedichten, Liedern, Versen und Aussprüchen so etwas wie schöne, anmutige, wohlklingende, elegante, verfeinerte Sprache, welche das Repertoire des Deutschen nutzt? Sollte es nicht auch heute Gesagtes und Geschriebenes in deutscher Sprache geben, das unser ästhetisches Empfinden anspricht?
Aber ja! Die deutsche Sprache inspiriert auch heute zu schönen, prägnanten Wortschöpfungen wie dem sekundengedränge der zeit, einem markanten Sprachbild des Schriftstellers Senthuran Varatharajah aus dem Roman »Vor der Zunahme der Zeichen«. Es zeigt uns durch die Übertragung des eigentlich räumlichen Bildes des Gedränges, wie eine Sekunde der nächsten buchstäblich im Nacken sitzt – und schafft damit einen tiefen Eindruck; ganz anders als die meist dahingesagte abgedroschene Klage über alltägliche Hektik. Das Sprachbild des Sekundengedränges ist aber eben nicht dahingesagt. Es belebt unsere Sinne, schärft unser Verständnis und bleibt im Gedächtnis haften.
Auch das Deutsch unserer Tage ermöglicht anmutige Verse, wie sie die Lyrikerin Safiye Can aus der grammatischen Geschmeidigkeit der Sprache schöpft:
»Sträucher fliedern ihren Duft in die Luft«
Wie sich die Dichterin hier die Fähigkeit des Deutschen zum leichtgängigen Wechseln der Wortart zunutze macht, ist meisterhaft: Denn sie formt in einem Kunstgriff den Flieder, ein Nomen, zu einem neuartigen, erfundenen Verb um und lässt den Strauch zurück. Der aber kann nun ausdrücklich eines: fliedern. Auch hier wieder ein Einfall, der eben genau das nutzt, was die deutsche Sprache an Geschmeidigkeit bietet. Und so entsteht eine einzigartige Sprachschönheit durch die Schönheit der Sprache selbst.
Ganz zu schweigen von den Sprachschönheiten der »Dichter und Denker« aus zurückliegenden Zeiten. Nur ein Beispiel, das (ich muss es gestehen) mich einmal wochenlang gefesselt und zu weitreichenden lebensverändernden Entscheidungen verführt hat:[17] Der große historische Roman »Die Jugend und Vollendung des Königs Henri Quatre« von Heinrich Mann über den bis heute in Frankreich beliebten, ehemals protestantischen König – der einzig und allein zum Katholizismus übertrat, um dem mörderisch zerrissenen Frankreich für eine Zeit den inneren Frieden zu bringen – beginnt so:
»Der Knabe war klein, die Berge waren ungeheuer. Von einem der schmalen Wege zum anderen kletterte er durch die Wildnis von Farnen, die besonnt dufteten oder im Schatten ihn abkühlten, wenn er sich hinlegte. Der Fels sprang vor, und jenseits toste der Wasserfall, er stürzte herab aus Himmelshöhe. Die ganzen bewaldeten Berge mit den Augen messen, scharfe Augen, sie fanden auf einem weit entfernten Stein zwischen den Bäumen die kleine graue Gemse! Den Blick verlieren in der Tiefe des blau schwebenden Himmels! Hinaufrufen mit heller Stimme aus Lebenslust! Laufen, auf bloßen Füßen immer in Bewegung! Atmen, den Körper baden innen und außen mit warmer, leichter Luft! Dies waren die ersten Mühen und Freuden des Knaben, er hieß Henri.«
Sofort ist man versetzt in eine wilde Berglandschaft (es sind die Pyrenäen). Unwillkürlich begleitet man den Jungen auf seinen ungestümen Erkundigungen, hört seine erstaunten Ausrufe, fühlt sich in seine Wachheit hinein, spürt seine unbändige Lebensenergie. Die Gewalt der Natur ängstigt den Jungen nicht, sondern sie begeistert ihn. Rasch schlägt die beschreibende Passage in Ausrufe um. Wir sind nun ganz in der Situation des Jungen selbst gefangen, ganz nah bei ihm. Doch dann tritt der Erzähler wieder auf und schließt die Szene ab (»dies waren die … Mühen«). Ein mitreißender Einstieg. Und schon ist man hineingezogen in den Text. Das ist gut so, denn es folgen über 1000 weitere Seiten.
Leicht verblasstes Bild
Doch leicht verblasst scheint das Bewusstsein über die Schönheiten des Deutschen, die spätestens in der Folge des Sturm und Drang, der Weimarer Klassik und der Romantik zum deutschen Sprachbewusstsein gehörten; damals, als die begnadeten Schriftsteller und Philosophen jener Zeit die guten Anlagen der Volkssprache immer weiterentwickelten und mit ihren Schöpfungen bis an die Grenze der Sprache gingen. Tatsächlich ist das Deutsche von Sprachschöpfern, eben den früher viel besungenen »Dichtern und Denkern«, zu einer Sprache geformt worden, die zu kulturellen Höchstleistungen und zu künstlerisch ästhetischen und schönsten Ausdrucksformen befähigt. Anders aber als im sprachverliebten Frankreich, das die Kunst beherrscht, zu sich selbst aufzublicken, wird hierzulande die eigene Sprache in vielem eher unterschätzt. Eine Entdeckungsreise zu den Schönheiten des Deutschen bietet sich an.
Ist Schönheit bestimmbar?
Aber treten wir noch einmal einen Schritt zurück: Denn es stellt sich auch die grundsätzliche Frage: Ist Schönheit überhaupt bestimmbar? Ihr Verständnis wird zweifellos von dem Geschmack des Zeitgeistes beeinflusst. Auch sind unsere Vorlieben durchaus verschieden.
Und doch lassen sich aus dem allgemeinen Verständnis einige Wesensmerkmale schön gestalteter Sprache herauskristallisieren. Der Literaturwissenschaftler Gero von Wilpert nennt folgende Bedingungen für sprachliche Schönheit: »Lebendigkeit, Abwechslung in der Einheit, harmonische Gliederung.« Immer geht es darum, dass das Sprachkunstwerk »Einstimmung und Mitschwingen ermöglicht«, sodass ein »Wohlgefallen« erzeugt wird.[18] Schon die Antike bestimmt in ähnlicher Weise die Schönheit als Harmonie der Teile. Spätere Epochen wie beispielsweise das 18. Jahrhundert betonen Lebendigkeit, Freiheit, Fülle und Sinnlichkeit; oder sie wenden sich (wie beispielsweise der George-Kreis Anfang des vergangenen Jahrhunderts) dem Material der Sprache selbst zu: Sie entdecken und erschließen die Sprache in ihrer Materialität – über ihre Darstellungsfähigkeit äußerer Schönheit hinaus. Immer aber geht es um das, was die gestaltete Sprache an Reiz, Faszination, an Wohlgefallen und Wohlgefühl, ja auch Beglückung bewirkt. »Sinnliche Erkenntnis« nannte der deutsche Philosoph Alexander Gottlieb Baumgarten in seiner 1758 erschienenen »Aesthetica« die Schönheit in der Kunst. Aus der modernen Forschung, der empirischen Ästhetik, wissen wir, dass in der Dichtung und in Redensarten insbesondere Ähnlichkeitsstrukturen, sogenannte Parallelismen – beispielsweise Metrum, Reim, Alliterationen, allerlei Wiederholungen von Lauten und Silben –, unsere lautliche Verarbeitungsfähigkeit in der Art eines Sprachflusses fördern und als schön empfunden werden, auch wenn sie auf Anhieb weniger verständlich sind als alltagssprachliche Formen. Der klangliche Sprachfluss kann die größere Anstrengung beim Verstehen mehr als ausgleichen.[19] Was heißt das? Anspruch an Form darf sein!
Sprachliche Schönheit kann sich weitgehend dem als schön empfundenen dargestellten Gegenstand verdanken. Ihr ganz eigenes Instrument ist aber der Stil. Er ist die Art, wie wir die Dinge sagen. Grundlage guten Stils ist das, was die Römer das aptum nannten, die Angemessenheit. Umgekehrt wird unangemessener Stil, beispielsweise in der Wortwahl, gerade nicht als schön empfunden. Stil ist eine Frage des passenden Stilniveaus. Stil meint dann aber auch den »Schmuck, den man menschlicher Rede verleiht (…), etwa durch rhythmische Wiederholungen, Ausdruckswechsel, ungewöhnliche Wortstellungen, Sprachbilder und Klänge, um ihren Aussagen größere Wirkung zu verleihen«.[20] Es ist die kreative Ausnutzung der Wahlmöglichkeiten, die uns die Sprache auf allen Ebenen ihres Systems und Gebrauchs bietet. Es liegt auf der Hand, dass auch die Rhetorik als die Lehre von der Kunst wirkungsvollen Redens hier ins Spiel kommt, mit ihrem großen klassischen Repertoire an Sprach- und Denkfiguren. Auch Aspekte der Poetik, der Lehre von der Dichtkunst, helfen beim Verstehen des Sprachschönen. Die erste deutsche Regelpoetik verdanken wir Martin Opitz, der 1623 das »Buch von der Deutschen Poeterey« als eine »theoretische Grundlegung und praktische Anleitung für die heimische Dichtkunst«[21] verfasste. Die Regelpoetik hat durch die zunehmende Individualisierung des Sprachschönen im 18. und 19. Jahrhundert zwar ihre kanonische Geltung für die Dichtkunst eingebüßt. Aber ihre Instrumente zur Analyse literarisch-dichterischer Texte gehören als eine Art Kunsttechnik immer noch zum guten Handwerk. Poetik in diesem Sinne ist die »Lehre vom Wesen, von den Zielen, Gattungen, Darstellungsmitteln und den Grundgehalten der Dichtung«.[22] Ihr geht es um Erzähltechniken, um Versmaße und Reimformen. Und selbstverständlich spielt auch die Sprachwissenschaft eine wichtige Rolle, da es in diesem Buch ja um das Repertoire der Sprache als System und im Gebrauch geht.
Stilistik, Rhetorik, Poetik, Literatur- und Sprachwissenschaft helfen bei der Annäherung an sprachliche Schönheit, denn sie befassen sich, mit jeweils eigenem Schwerpunkt, mit den sprachlichen Bauformen und ihren besonderen Wirkungen.
Nun leben wir in einer entzauberten Zeit, die mit Begriffen wie »Schönheit« ihre Schwierigkeiten hat. Braucht man überhaupt das Herausgehobensein des Schönen? Ist es nicht herabsetzend gegenüber dem nicht so Schönen? Oder ist nicht sogar das Hässliche das neue Schöne? In unserer ernüchterten und ernüchternden Welt wird der Wunsch nach Schönheit gern belächelt. Ist nicht das Hässliche viel interessanter? »Die Menschen tun so, als brauchten sie die Schönheit nicht«, sagte mir einmal kopfschüttelnd meine eingangs bereits erwähnte Kollegin Eva Paul. Doch jede kulturelle Bewegung erzeuge eben auch ihre Gegenbewegung. Schönheit sei »die Bildung der Seele und des Geistes«, setzte sie in Anlehnung an Friedrich Schiller hinzu.
Die Schönheit bleibt
Im Jahr 1927 veröffentlichte der geniale Stilist Hugo von Hofmannsthal ein Buch mit dem Titel »Wert und Ehre deutscher Sprache«. Es wird Zeit, dass wir uns des Wertes unserer alten und quicklebendigen Sprache bewusst werden. Ihre Ehre wurde befleckt. Das sollten wir als Mahnung nie vergessen. Aber ihre Schönheit bleibt, wenn wir sie denn bemerken und fortschreiben.
Der Schriftsteller Rolf Schneider schrieb zur Schönheit des Deutschen: »Die deutsche Sprache ist schön. Sie ist so schön wie irgendeines der genannten Idiome aus der Nachbarschaft, dem noch nie jemand die Schönheit hat bestreiten wollen.«[23]
Auch wir sollten um die Schönheit unserer Sprache wissen. In diesem Buch kann man sie entdecken. Oder wiederentdecken.
Erster Teil~Wie das Deutsche schön sein kann
1
»Einheit im Grunde, tausendfache Mannigfaltigkeit in der Ausbildung, Vollkommenheit in der Summe des Ganzen.«
Johann Gottfried Herder über das »Gefühl der Schönheit«
Was ist schön?
Was aber ist schön, was ist das Schöne? Unter welchen Bedingungen wirkt etwas schön? Wann gilt es als schön?
Schön ist verwandt mit schauen.[24] Und ganz offensichtlich denken wir zunächst an das, was wir schauen können, an sichtbar Schönes; aber auch Gedachtes, Vorgestelltes und Erinnertes können wir als schön empfinden und so benennen. Auch die Wörter, Sätze, Wendungen der Sprache können unser Wohlgefallen wecken. Wir empfinden das als schön, was unser Wohlgefallen hervorruft. Maß, Ordnung und Symmetrie bilden eine recht zuverlässige Grundlage für diese Empfindung, so jedenfalls die Philosophen der Antike.
Ein Blick in die Kulturgeschichte
Das Schöne ist in der Kulturgeschichte der Menschheit ganz unentbehrlich. Schönheit ist überhaupt der häufigste Begriff, wenn es um ästhetische Bewertung geht.[25] Und deshalb ist sie auch ständig präsent: vom Naturschönen und der nachgeahmten idealisierten Naturschönheit der bildenden Kunst bis zur Schönheit der Poesie und zum Stil großer Literatur – Schönheit und ihre Darstellung ist ein Bedürfnis, ja ein Verlangen, das sich gerade im Bereich der Kunst und der Künste immer wieder äußert, selbst zu Zeiten, in denen sie verstärkt unter Verdacht steht, weil sie nicht frei von missbräuchlicher Verwendung ist.
Das Schöne hat schon die antiken Philosophen in der Ästhetik, also der Lehre vom Schönen, und in der Poetik, der Lehre von der Dichtkunst, beschäftigt. Wie war es zu bestimmen? Konnte man Gesetzmäßigkeiten des Schönen finden?
Im Zentrum der antiken Vorstellungen von Schönheit steht das Wohlverhältnis der Teile zueinander und zum Ganzen, Schönheit als »Harmonie und Proportion der Teile«.[26] Aristoteles spricht in der »Poetik« von der »schönen Ordnung eines Handlungszusammenhangs«.[27] Ordnung, Symmetrie, Vielfalt in Einheit, Maß und Angemessenheit kennzeichnen hier das Schöne. Doch es steht nicht allein. In den sokratischen Dialogen wird es eingerahmt vom Guten und Wahren. »Das Gute zeigt sich nach Sokrates zuerst als angemessenes Maß, dieses Maß als Schönheit und, in seiner zweifellosen Gültigkeit, auch als Wahrheit.«[28]
Viel später wird das Zeitalter der Aufklärung diese Trias zum Bildungsprogramm des 18. Jahrhunderts erheben. »Die Bildung des Menschen zum Wahren und Guten ist zugleich eine Bildung zum Schönen und umgekehrt.«[29] Der Dreiklang des Wahren, Schönen, Guten ist ein ästhetisches Programm, das letztlich aber ein Rückgriff auf die Antike ist. Wobei einschränkend hinzuzufügen ist, dass Platon den Dichtern und der Dichtkunst heftiges Misstrauen entgegenbrachte, weil sie aus seiner Sicht das Volk zu täuschen und zu verführen drohten.
Der römische Dichter Horaz geht über die klassische Idee des Schönen als Symmetrie der Teile und des Ganzen hinaus und bestimmt die Bewegung des Publikums als Voraussetzung für das Schöne: »Nicht nur genügt es, dass die Dichtungen formschön sind; süß und zu Herzen gehend sollen sie den Hörer ergreifen und unwiderstehlich mitreißen.«[30] Hier kommt die Rhetorik mit ihrem Schmuck und ihren wirkungsvollen Stilfiguren ins Spiel.
Cicero und Quintilian betonen die Bedeutung der evidentia: Anschaulichkeit, Lebendigkeit und Fasslichkeit der Darstellung. Gleichwohl bleibt das Wohlverhältnis der Teile zueinander und zum Ganzen über Jahrhunderte eine geteilte Grundbestimmung und Bedingung des Schönen.
Die Renaissance bringt mit ihrer Wiederentdeckung der Schriften des griechischen und römischen Altertums die Vorstellungen der klassischen Ästhetik wieder stärker ins Bewusstsein. Rege Übersetzungstätigkeit begünstigt die Aufnahme klassischer ästhetischer Vorstellungen in die Ideale höfischen, galanten Lebens. Die Beurteilung des Schönen, aber auch, damit verknüpft, des Guten und des Wahren, wird zu einer Frage des Geschmacksurteils, zu dem der aufgeklärte Mensch des Barock, geleitet von Kenntnis und Empfindung, imstande sein soll.
In einer »Untersuchung von dem Geschmack« aus dem Jahr 1727 heißt es in griffiger Definition: »Der allgemeine gute Geschmack ist eine aus gesundem Witz und scharfer Urteilskraft erzeugte Fertigkeit des Verstandes, das Wahre, Gute und Schöne richtig zu empfinden, und dem Falschen, Schlimmen und Hässlichen vorzuziehen, wodurch im Willen eine gründliche Wahl und in der Ausübung eine geschickte Anwendung erfolget.«[31] Es geht demnach bei dem Geschmacksurteil als einem ästhetischen Urteil eben nicht um eine schlichte Geschmacksvorliebe[32], sondern um ein durch kanonisches Wissen, Übung und Scharfsinn geprägtes Urteilsvermögen. Es verwundert nicht, dass später Immanuel Kant diese besondere Form des Urteils von anderen Urteilen absetzen wird.
»Sinnliche Erkenntnis«
Mit der »Aesthetica« von Alexander Gottlieb Baumgarten erscheint im Jahr 1758 – also in der Zeit der Aufklärung – die erste Abhandlung über eine Wissenschaft vom Schönen, die Ästhetik. Darin wird das Schöne weniger als ein Gegenstand, sondern als eine Erkenntnisform gesehen, und zwar in der klugen Formulierung, das Schöne sei »die Form der sinnlichen Erkenntnis«.[33] Dabei geht das Schöne über das schiere Empfinden hinaus, wird aber andererseits nicht als verstandesmäßiges, begriffliches Erkennen, sondern in seiner besonderen Verbindung von Empfindung und Erkenntnis gesehen. Baumgarten begreift Ästhetik als die »Wissenschaft sinnlicher Erkenntnis«.[34]
Unterdessen geraten Begriff und Bewertung des Schönen freilich als zu harmonisch in Diskussion und Zweifel: Johann Wolfgang von Goethe warnt vor »weicher Lehre neuerer Schönheitelei« und betont, »wahre, große Kunst« sei oft »wahrer und größer als die schöne selbst.«[35] Friedrich Schiller verbindet das Schöne mit dem Gedanken der Freiheit. Schön ist, »wenn jedes Einzelne zugleich eigenem Gesetz und zwanglos höherer Ordnung folgt«.[36] Dass Schönheit sich mit Interessantem mischen muss, um die Aufmerksamkeit zu fesseln, bringt der deutsche Philosoph Johann Friedrich Herbart so zur Sprache: »Gibt es überhaupt irgendeine weitreichende Formel zur Erklärung des Schönen, so ist es diese: am Regelmäßigen verlieren, um es sogleich wieder zu gewinnen.«[37] Lebendigkeit, Fülle, Sinnlichkeit, Tiefe, Originalität sind Eigenschaften, die dem Schönen nun zugemessen werden, zumindest ergänzend zur »edlen Einfalt und stillen Größe« des klassischen Schönheitsverständnisses.
Angetrieben von der Sprachphilosophie Johann Gottfried Herders, derzufolge die Sprache ursprünglich in der Natur gründet, und ins Werk gesetzt vom Sturm und Drang, wird Natur zum »Schlüsselwort für die Kunst«.[38] Es geht um den Ausdruck echter, ursprünglicher Empfindungen und um die Abwendung von allem Unechtem zugunsten eines subjektiven Ausdrucks in der Kunst. Diese Verselbstständigung wird zwar noch aufgehalten von der Weimarer Klassik, die in Rückbesinnung auf die Ästhetik der Antike die »Vermittlung von Gefühl und Verstand, die Zügelung des Individuellen durch das Typische« unternimmt.[39] Doch die Romantik wird die Loslösung der Kunst, insbesondere der Literatur, von vorgegebenen Bewertungskategorien weiter vorantreiben. Auf dieser Spur bewegt sich die Kunst von der Darstellung und Nachahmung des Naturschönen, also äußerer Schönheit, zusehends hin zu einer Schönheit aus eigenem Recht, in eigener Materialität und Stofflichkeit. Die Kunst verlagert sich vom Vorrang der Inhaltsebene zur Betonung der Ausdrucksebene.
»Interesseloses Wohlgefallen«
Immanuel Kant bestimmt in seiner »Kritik der Urteilskraft« die Wirkung der schönen Künste mit der berühmten Definition des »interesselosen Wohlgefallens«. Frei formuliert: Etwas ist dann schön, wenn es geeignet ist, ein freies Spiel der Erkenntniskräfte zu erzeugen. Wir haben kein Eigeninteresse daran, sondern wir freuen uns daran, dass es ist.
Die Frage des Geschmacks ist eine der zentralen Fragen im 18. Jahrhundert. Kant setzt das Geschmacksurteil von logischer Erkenntnis ab. Welche Art von Urteilen sind nun Geschmacksurteile? Es sind keine Erkenntnisurteile. Vielmehr sind es subjektive Urteile, die wir freilich anderen »ansinnen«, von denen wir also andere durchaus überzeugen wollen. Vernunftideen unterscheidet Kant klar von ästhetischen Urteilen und Empfindungen, die »keine Sprache völlig erreicht und verständlich machen kann«.[40] Dennoch aber werden ästhetische Urteile durchaus formuliert und geteilt und treffen auch einen allgemeinen Geschmack, sodass sie eine gewisse Gültigkeit beanspruchen. Klarsichtig bestimmt Kant die Eigenart der Geschmacksurteile in diesem Doppelcharakter, weil sie, so Peter V. Zima, »einerseits mit dem partikularen Geschmack verquickt sind, andererseits jedoch Allgemeinheit beanspruchen«.[41] In unerreichter Kant’scher Prägnanz gesagt: Das Schöne ist das »subjektive Allgemeine«.
Zwar scheint Georg Wilhelm Friedrich Hegel mit der Bestimmung des Schönen als »sinnliches Scheinen der Idee«[42] (so einer seiner Schüler) und der Dichtung als »Kunst zwischen Sinnlichkeit und Vernunft«[43] dem Königsberger Philosophen auf den ersten Blick nahezustehen; doch im Gegensatz zu Kant bestimmt Hegel das Kunstwerk als eines, das durchaus begrifflich erfassbar ist, ja, das Aufgehen im Begriff ist seinem Urteil nach die höchste Stufe der Kunst, denn das begriffliche Denken nimmt im Wege seiner Perfektionierung die Kunst in sich auf: »Schönheit ist nur als geistige denkbar.«[44] In der griechischen Klassik und ihrer Skulptur sieht Hegel die bedeutendste Kunstperiode, in welcher äußere Gestalt und Bedeutung einander im genannten Sinne entsprechen. Letztlich soll also auf einer hohen Entwicklungsstufe die Darstellung des Schönen im begrifflichen Denken aufgehen: Die Kunst löst sich in der Vernunft auf.
Da verwundert es nicht, dass ein solch besonderes Verständnis von Kunst und Ästhetik Gegenbewegungen auf den Plan ruft, und schon sein Adept Friedrich Theodor Vischer wendet gegen Hegel ein: »Wenn wir uns betrachtend zum Schönen wenden, so wollen wir es nicht erst begreifen müssen.«[45]
Der Herrschaft der Vernunft, aber auch des Wahren und Guten, über die Kunst und das Kunstschöne stellt sich dann aber radikal Friedrich Nietzsche entgegen. In grundsätzlicher »Umwertung aller Werte« löst er die Gegensätzlichkeit von schön und hässlich wie auch von gut und böse, wahr und falsch auf und betont deren Verwandtschaft, ja sogar Wesensgleichheit. Folglich ist die Kunst nicht mehr dem nur scheinbar Wahren verpflichtet, sondern soll sich von jeder »Vermoralisierung« befreien.[46] »Kunst hat für ihn mit Moral und Wahrheit nichts zu tun, sondern mit Fülle, Energie und Lust des Lebens, mit Macht.«[47]
Zur selben Zeit aber werden Museen, Opernhäuser und Theater in Hülle und Fülle gebaut, um den antiken ästhetischen Idealen zu huldigen, und wird auf dem Kapitel der 1873 in Frankfurt am Main erbauten Oper die Triade »Dem Wahren Schoenen Guten« angebracht. Die platonische Idee vom Schönen als idealisierter Natur setzt sich im bildungsbürgerlichen Verständnis des 19. Jahrhunderts bis in die Kulturpolitik jener Zeit fort. »So wie das Heilige sich vom Profanen abgrenzt, so grenzen sich diese Kunsträume von der Welt draußen ab.«[48] Es ist diese Musealisierung, die – nicht nur vonseiten Friedrich Nietzsches – immer wieder starkem Gegenwind ausgesetzt sein wird.
Der Ästhetizismus als literarische Strömung des ausgehenden 19. Jahrhunderts stellt zwar – in Deutschland insbesondere mit dem George-Kreis – die Schönheit der Sprache, vor allem ihrer eigenen Stofflichkeit, in den Mittelpunkt seines Schaffens. Doch die Kunstrichtungen des 1887 erstmals geprägten Begriffs der Moderne[49] entfernen sich zusehends von traditioneller Ästhetik und Poetik und setzen die völlige Unabhängigkeit der Kunst an deren Stelle. Es versteht sich, dass das Schöne unter diesen Umständen unter Verdacht gerät, sodass ihm mehr und mehr mit Misstrauen begegnet wird, schon gar nach dem radikalen verbrecherischen Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus, den weder Kunst noch Sprache hatten verhindern können.
Die Künste – nicht mehr schön?
Doch obgleich in den Umbrüchen der 68er-Jahre die »nicht mehr schönen Künste« geradezu programmatisch ausgerufen werden, überlebt dennoch, wenn auch verändert, der alte Dreiklang des Wahren, Schönen, Guten und damit eben auch das Schöne. Denn »selbstverständlich geht es ihr [der Literatur nach 1945, RK] um Moral und um Erkenntnis, um das Gute und das Wahre, in seinem Scheitern und – seltenerem – Gelingen. Selbstverständlich soll Literatur auch schön sein, nur vermeidet man die großen Worte (…).«[50] Und selbstverständlich beurteilen Leserinnen und Leser Literatur und Dichtung auch danach, ob sie sie als schön geschrieben bewerten, wenn auch das Schöne nicht mehr eine leitende Kategorie sein mag, weil auch weder Krasses, Hässliches und Vulgäres noch Schauerliches und Schreckliches in der Kunst tabu ist.
Dass das Schöne nicht harmonistisch sein darf, sondern der »Vielgestaltigkeit« bedarf, wussten freilich schon die Gelehrten der Antike. Bereits Dionysos von Halikarnassos erkannte, dass Schönheit auch »Attribute des Erhabenen, Befremdenden oder Ungefälligen auf sich vereinen kann«.[51] Heute würden wir das Abgleiten in das zu Gefällige und Vorhersehbare als Kitsch bezeichnen. Nicht, dass Kitsch nicht seine Berechtigung im Geschmacks- und Gefühlshaushalt der Menschen verdient hätte, zumal gerade er auch Tröstung bereithält, aber eben in durchsichtiger Absicht. Das Schöne hingegen kann die Spur des Kontrastes gut vertragen, »einen Moment des Ungeplanten, Ungefälligen«.[52]
Und so bleibt das Schöne als ein Kriterium des ästhetischen Urteils auch in unserer Zeit bestehen. Ausstellungen widmen sich dem Thema, von der »Wiederentdeckung der Schönheit« ist die Rede, von einer »Renaissance der Rede vom Schönen«.[53] Dass die Kunst also mit dem Konzept ihrer Unabhängigkeit von Moral, Wahrheit und Schönheit tatsächlich ihre »Selbstabschaffung« betrieben habe, wie befürchtet wurde, scheint dann doch ein zu krasses Urteil zu sein.[54]
Vermutlich liegt es auch an seiner Überlebensnotwendigkeit, dass sich das Schöne als ästhetische Kategorie trotz aller Widrigkeiten als überlebensfähig erweist. Dafür spricht die nur auf den ersten Blick überraschende These Sigmund Freuds über die Schönheit als Ergebnis vielfältiger kultureller Verfeinerung (»Sublimierung«) ursprünglich werblichen Verhaltens der Geschlechter. Schon Charles Darwin hatte Schönheit als werbliches Moment der Evolution erkannt. In einer zugleich eleganten und plausiblen Wendung zeichnet Freud den Weg der Schönheit hin zu einer sich verselbstständigenden kulturellen und auf diese Weise verfeinerten Kategorie des Menschseins nach, immer aber evolutionsgeschichtlich rückgebunden und daher unauslöschlich.[55]
Wie sehr dieses Begehren in der Verantwortung des Betrachters liegt, scheint Johann Gottfried Herder uns gerade für unsere so ablenkungswillige Zeit mit auf den Weg gegeben zu haben: »Die höchste Liebe und die höchste Kunst ist Andacht. Dem zerstreuten Gemüt erscheint die Wahrheit und die Schönheit nie.«[56]
2
»Sprache ermöglicht den Menschen.«
Hans-Martin Gauger