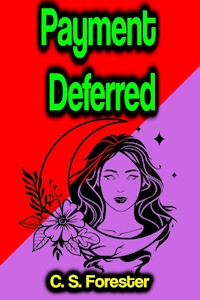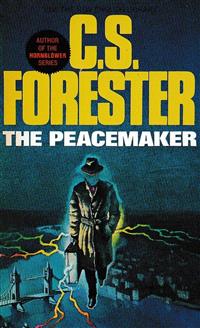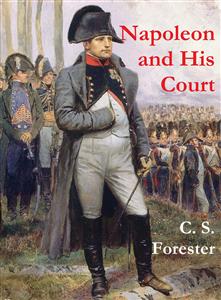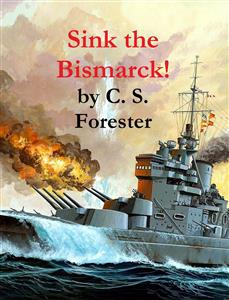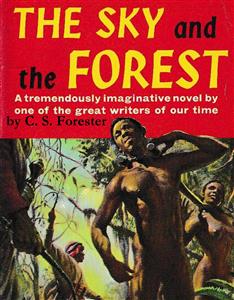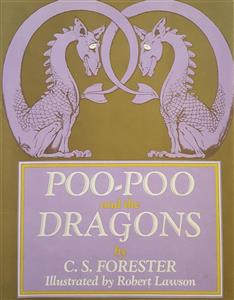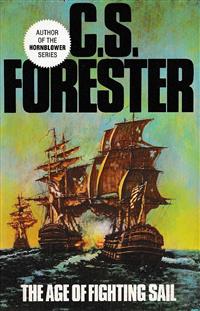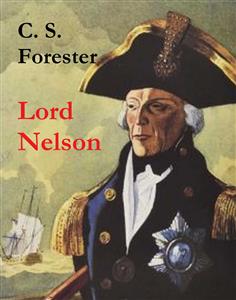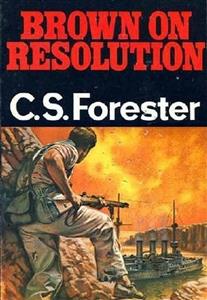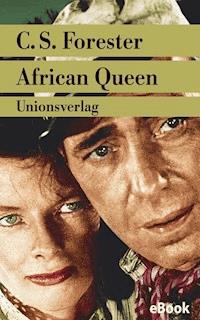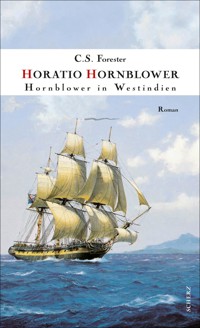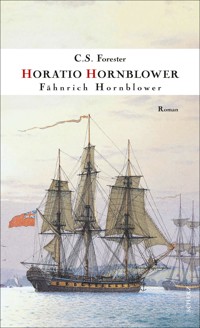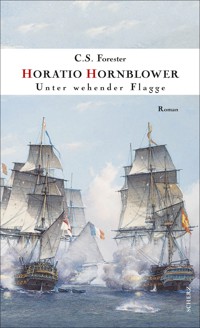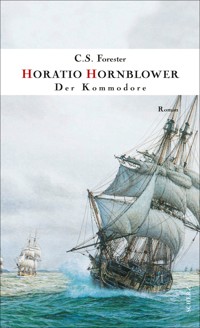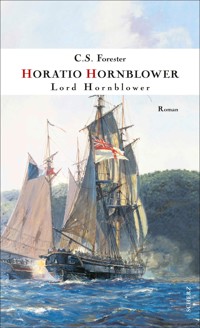
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hornblower
- Sprache: Deutsch
Der Klassiker unter den Seefahrerepen: Horatio Hornblowers neuntes Abenteuer. Hornblowers steile Karriere in der Marine ihrer Majestät bringt für den Kommodore auch Pflichten mit sich, die seine Moral auf die Proben stellen: Er soll einen Matrosenaufstand niederschlagen, was ihm mit einem raffinierten Manöver auch gelingt. Doch da droht schon die nächste Gefahr. In Paris wird Hornblower von den Garden des besiegt geglaubten Napoleon gefangen genommen. Wieder geht es für Hornblower um Leben und Tod. Der neunte Band der berühmten Romanserie um Horatio Hornblower, einem Meilenstein der maritimen Literatur, ist ein großes Seeabenteuer und ein Lesevergnügen, das bereits Generationen von Lesern begeistert hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Cecil Scott Forester
Lord Hornblower
Horatio Hornblower Band 9
Über dieses Buch
Meuterei auf der englischen Brigg ›Flame‹. Hornblower erhält den Befehl, den Matrosenaufstand niederzuschlagen. Allein gegen eine Übermacht kann er mit einem raffinierten Täuschungsmanöver das Schiff in seine Gewalt bringen, um dann mit Hilfe französischer Royalisten die Stadt Le Havre einzunehmen. Napoleons Niederlage ruft Hornblower nach Paris. Doch der errungene Sieg über die Franzosen ist nur von kurzer Dauer. Napoleon kehrt triumphal aus Elba zurück und lässt Hornblower gefangen nehmen. Damit droht ihm erneut der Tod.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Cecil Scott Forester wurde 1899 in Kairo als Sohn eines ägyptischen Regierungsbeamten geboren. Schon bald schickte ihn der Vater ins weit entfernte England, wo er neben dem Medizinstudium zunehmend Gedichte verfasste, bis er der Medizin schließlich den Rücken wandte, um sich ausschließlich der Literatur zu widmen. Mit dem Zyklus seiner Seeabenteuerromane um Horatio Hornblower schuf Forester ein unvergängliches Epos, das ihm Weltruhm einbrachte und ihn bis heute zu einem der großen Erzähler des 20. Jahrhunderts macht. Während des Zweiten Weltkrieges ging Forester nach Hollywood, wo er 1966 starb.
Die Gesamtserie um Horatio Hornblower:1 ›Fähnrich Hornblower‹2 ›Leutnant Hornblower‹3 ›Hornblower auf der Hotspur‹4 ›Kommandant Hornblower‹5 ›Der Kapitän‹6 ›An Spaniens Küsten‹7 ›Unter wehender Flagge‹8 ›Der Kommodore‹9 ›Lord Hornblower‹10 ›Hornblower in Westindien‹11 ›Zapfenstreich‹
Impressum
Coverabbildung: Derek G. M. Gardner
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel ›Lord Hornblower‹ im Verlag Michael Joseph Ltd., London
›Lord Hornblower‹ © 1946 C. S. Forester
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© Wolfgang Krüger Verlag GmbH, Hamburg 1967
Alle deutschsprachigen Rechte:
S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Veröffentlicht als E-Book 2012.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402696-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1 MEUTEREI AUF DER FLAME
2 EINE KURZE FRIST
3 STURM IM KANAL
4 BROWN IST UNENTBEHRLICH
5 DIE SEINE-BUCHT
6 EIN HUSARENSTREICH
7 SWEETS ENDE
8 NAPOLEONS REICH WANKT
9 VERSTÄRKUNG TRIFFT EIN
10 IM NAMEN DES KÖNIGS
11 GOUVERNEUR VON LE HAVRE
12 ZEITUNGSBERICHTE
13 DIE EXPLOSION VON CAUDEBEC
14 DAMENBESUCH
15 DIE FRIEDENSNACHRICHT
16 ALS LORD IN PARIS
17 WIEDER IN GRACEY
18 NAPOLEON KEHRT ZURÜCK
19 GUERILLA
20 EIN SCHMÄHLICHES ENDE
Karten
ERKLÄRUNG SEEMÄNNISCHER AUSDRÜCKE
VORBEMERKUNG
RANGFOLGE ZUR ZEIT HORNBLOWERS
DIENSTSTELLUNGEN
1MEUTEREI AUF DER FLAME
Sir Horatio Hornblower saß in einem der höchst unbequemen Kirchenstühle aus geschnitzter Eiche und fand die Predigt des Dekans von Westminster zum Sterben langweilig. Da packte ihn die Unruhe wie einen kleinen Jungen, er ließ seine Blicke durch die Kirche wandern und sah sich die versammelte Gemeinde an, um sich von den rein körperlichen Beschwerden, die ihm sein Sitz verursachte, etwas abzulenken. Zu seinen Häupten schwang sich in vollendeter Fächerung das edle Maßwerk des Domes empor, der für sein Empfinden entschieden das schönste Gebäude der Welt war. Die Art, wie die ausstrahlenden Gewölberippen einander schnitten und wieder schnitten, befriedigte seinen mathematischen Sinn und schien ihm von einer erleuchteten Logik zu zeugen. Die namenlosen Werkleute, deren Meißel diese Formen geschaffen hatten, mußten wahrhaft schöpferische Männer mit umfassendem Weitblick gewesen sein.
Die Predigt plätscherte weiter, und Hornblower hatte Grund zu fürchten, daß nach ihrem Ende wieder der Gesang begann, daß dann die Chorknaben in ihren weißen Hemden wieder mit ihren hohen Sopranstimmen einsetzten, die ihm durch Mark und Bein gingen und noch viel schlimmer waren als die ganze Predigt und der harte, eichene Kirchenstuhl zusammengenommen. Aber das war eben der Preis, den man bezahlen mußte, wenn man Band und Stern tragen durfte, wenn man ein Ritter des hochangesehenen Bathordens war. Man wußte, daß er auf Erholungsurlaub in England weilte und gesundheitlich schon wieder ganz auf der Höhe war – da konnte er diesem höchsten Fest seines Ordens unmöglich fernbleiben. Die Kirche bot jedenfalls ein besonders eindrucksvolles Bild. Alle die karmesinroten Mäntel und die blitzenden Ordenssterne der versammelten Ritter fingen das trübe Sonnenlicht auf, das durch die hohen Fenster in das Schiff der Kirche fiel, und wandelten es zu einer vielfachen Glut von aufwühlender Farbengewalt. Wollte man dieser Zurschaustellung eitler Pracht das Wort reden, dann konnte man wenigstens das eine zu ihren Gunsten anführen, daß sie von einer seltsamen, aber mitreißenden Schönheit war, die jeden ergriff, ob er nun historische Vorstellungen damit verband oder nicht. Der Chorstuhl, in dem er saß, war vielleicht früher einmal einem Hawke oder Anson ebenso hart vorgekommen wie ihm heute, und Marlborough mochte zu seiner Zeit in dem gleichen rotweißen Ordensgewand, wie er es trug, während einer gleich langweiligen Predigt genauso zappelig und ungeduldig gewesen sein wie er.
Einer der Herren sah ganz besonders bedeutend und wichtig aus, er trug nämlich eine silbervergoldete Krone auf dem Kopf und einen roten Samtmantel mit eingesticktem Königswappen um die Schultern. Aber das war nur der erste Herold des Bathordens, irgendein Mann mit guten Verbindungen, der sich dieses anständig bezahlte Pöstchen ergattert hatte. Der konnte diese Predigt natürlich leicht über sich ergehen lassen, wenn er sich überlegte, daß er mit diesem Opfer, das nur einmal jährlich fällig war, seinen ganzen Lebensunterhalt verdiente. Neben ihm saß der Prinzregent als Großmeister des Ordens, das Karmesin seines Mantels vertrug sich schlecht mit der scharlachroten Farbe seines Gesichts. Da waren eine Menge Soldaten, Generäle und Obersten, deren Gesichter ihm unbekannt waren. Aber hier und dort erblickte er auch Männer, die er kannte, Männer, in denen er jetzt mit Stolz seine Ordensbrüder sah. Dazu gehörte zum Beispiel Lord St. Vincent, der Riese mit dem finsteren Gesicht, der damals mit seiner Flotte mitten in einen doppelt so starken spanischen Verband hineingestoßen war, Ducan, der die holländische Flotte bei Camperdown vernichtet hatte, und noch ein Dutzend anderer Admirale und Kapitäne, darunter sogar einige, die im Range noch jünger waren als er selbst, so Lydiard, der die Pomona vor Havanna wegnahm, Samuel Hood, der bei Abukir die Zealous geführt hatte, und Yeo, der Erstürmer des Forts El Muro.
Der Gedanke, dem gleichen ritterlichen Orden anzugehören wie diese Männer, machte einen froh und erwärmte einem das Herz – das war vielleicht lächerlich, aber es ließ sich nicht leugnen. Dabei war die Gesamtzahl der Helden mindestens dreimal so groß. Viele der ritterlichen Brüder befanden sich in See (anwesend waren nur solche, die Landkommandos innehatten oder auf Urlaub waren) und holten zu den letzten Schlägen aus, die das Reich Napoleons zertrümmern sollten. Hornblower fühlte sich von einer Woge vaterländischer Begeisterung ergriffen, sein Geist ließ sich von der Flut dieses Gefühls emportragen, begann aber doch alsbald kritisch zu prüfen, was es mit diesem ganzen Überschwang auf sich hatte, und stellte sich die Frage, wieviel davon er der romantischen Schönheit des Bildes verdanken mochte, das ihm seine Umgebung bot.
Ein Marineleutnant in Uniform war in die Kirche eingetreten, stand einen Augenblick zögernd, bis er Lord St. Vincent entdeckt hatte, und eilte dann auf ihn zu. Er überreichte ihm das umfangreiche Schreiben, das er in der Hand hielt und dessen Siegel bereits erbrochen war. Jetzt achtete niemand mehr auf die Predigt – alle anwesenden Seeoffiziere, die Blüte der Royal Navy, renkten sich die Hälse aus und schauten auf Lord St. Vincent, während dieser die Depesche las, die offenbar soeben von der Admiralität am anderen Ende von Whitehall herüberkam. Die Stimme des Dekans wurde ein bißchen unsicher, aber er nahm sich tapfer zusammen und ließ seine Rede vor tauben Ohren weiterplätschern. Diese Taubheit dauerte recht lange, denn St. Vincent laß das Schreiben nicht nur einmal durch, sondern kehrte, als er fertig war, wieder zum Beginn zurück, ohne daß sich in seinem zerklüfteten Gesicht auch nur eine Miene verzog. St. Vincent hatte zwar in der Schlacht, deren Namen er jetzt als Titel führte, mit einer einzigen, raschen Entscheidung das Schicksal ganz Englands aufs Spiel gesetzt, aber er war dennoch nicht der Mann übereilter Entschlüsse, wenn er genügend Zeit zum Überlegen hatte.
Er kam zum zweitenmal ans Ende, faltete den Brief zusammen und ließ dann seinen Blick langsam durch die Kirche schweifen. Und ein paar Dutzend Ritter des Bathordens hofften in erregter Spannung, diesem Blick zu begegnen. St. Vincent aber erhob sich, hüllte sich in den roten Rittermantel, ergriff den Federhut und humpelte nach einem kurzen Wort an den wartenden Leutnant mit steifen Schritten hinaus. Sofort übertrug sich die Aufmerksamkeit auf diesen Leutnant, und aller Augen folgten ihm, während er das Kirchenschiff durchquerte. Hornblower fuhr unwillkürlich zusammen und fühlte sein Herz laut klopfen, als er merkte, daß jener geradewegs auf ihn zukam.
»Eine Empfehlung von Seiner Lordschaft, Sir«, sagte der Leutnant, »und er läßt Sie sofort zu einer kurzen Besprechung bitten.«
Jetzt war Hornblower an der Reihe, seinen Umhang zu schließen und an seinen Federhut zu denken. Er mußte sich unter allen Umständen gleichmütig geben, es durfte nicht sein, daß die versammelten Bathritter etwa über ihn lächelten, wenn sie ihm seine Erregung über diese Aufforderung des Ersten Lords anmerkten. Er mußte sich also den Anschein geben, als wären derlei Dinge für ihn etwas ganz Alltägliches. Unachtsam trat er aus seinem Kirchenstuhl, da kam ihm gleich der Säbel zwischen die Beine, und er hatte es nur einer gütigen Vorsehung zu verdanken, daß er nicht der Länge nach hinfiel. Mit klirrenden Sporen und klappernder Scheide rettete er sein Gleichgewicht und stelzte dann langsam und würdevoll durch das Kirchenschiff. Dabei folgten ihm alle mit den Blicken; bei den anwesenden Armeeoffizieren handelte es sich gewiß um bloße Neugier, aber die Navy – Lydiard und die anderen – war natürlich aufs höchste gespannt, welche überraschende Wendung der Seekrieg neuerdings genommen hatte, und beneidete ihn um die neuen Abenteuer und Auszeichnungen, die ihn erwarteten. Weiter hinten, in einer der für bevorzugte Gäste bestimmten Bänke, entdeckte Hornblower Barbara, die gleichfalls aufgestanden war und ihren Stuhl verließ, um sich ihm anzuschließen. Er begrüßte sie mit einem gezwungenen Lächeln – solange er alle diese Blicke auf sich ruhen fühlte, mochte er nicht sprechen – und reichte ihr seinen Arm. Sogleich fühlte er den festen Druck ihrer Hand, hörte er ihre klare, sichere Stimme. Barbara ließ sich natürlich nicht dadurch einschüchtern, daß sie von allen angestarrt wurden.
»Ist wieder etwas los, mein Lieber?« fragte sie.
»Ich nehme es an«, flüsterte Hornblower.
Draußen vor dem Tor erwartete sie St. Vincent. Die leichte Brise spielte in den Straußenfedern seines Hutes und in den Falten seines rotseidenen Mantels. Die weißen seidenen Kniehosen schienen für seine wuchtigen Beine fast zu eng zu sein. Er schritt langsam auf und ab, seine riesigen Füße waren von Gicht entstellt und hatten die weißen Seidenschuhe, die er trug, ganz aus der Form gebracht. Aber auch der seltsamste Aufzug vermochte diesem Mann nichts von seiner strengen Würde zu nehmen. Barbara zog ihre Hand aus Hornblowers Arm und trat diskret zurück, um den beiden Männern ein Gespräch unter vier Augen zu ermöglichen.
»Sir?« begann Hornblower fragend, dann fiel ihm – zu spät – ein, wen er vor sich hatte, er war ja nicht daran gewöhnt, mit dem Hochadel umzugehen. Er verbesserte sich: »Mylord?«
»Sind Sie so weit hergestellt, daß Sie wieder Dienst machen können, Hornblower?«
»Jawohl, Mylord.«
»Sie müssen noch heute abend in See gehen.«
»Aye aye, Sir – Mylord.«
»Wenn mein verfluchter Wagen endlich erscheint, dann bringe ich Sie zur Admiralität hinüber und gebe Ihnen Ihren Befehl.« St. Vincent erhob seine Stimme zu jener Lautstärke, die auch in westindischen Zyklonen mit Leichtigkeit genügt hatte, sich im Großtopp seines Schiffes verständlich zu machen: »Sind denn diese verdammten Gäule immer noch nicht da, Johnson?«
Da entdeckte er über Hornblowers Schulter hinweg Barbara.
»Ihr Diener, gnädige Frau«, sagte er, nahm seinen Federhut vom Kopf und hielt ihn quer vor die Brust, während er eine vollendete Verbeugung vor ihr machte. Weder Alter noch Gicht, noch ein ganzes langes Seemannsleben hatten es vermocht, die höfische Grazie seiner gesellschaftlichen Formen zu beeinträchtigen. Aber jetzt ging es um die Pflicht gegen das Vaterland, und der gebührte immer der Vorrang. Deshalb wandte er sich sofort wieder Hornblower zu.
»Worum handelt es sich, Mylord?« fragte dieser.
»Unterdrückung einer Meuterei«, gab St. Vincent finster zur Antwort. »Wieder so eine verfluchte Meuterei. Man könnte meinen, wir schrieben noch 1794. Kennen Sie Chadwick – Leutnant Augustin Chadwick?«
»War mit mir Fähnrich unter Pellew, Mylord.«
»Gut, also dieser … Ach, hier ist endlich mein verfluchter Wagen. Aber was wird aus Lady Barbara?«
»Ich fahre mit meinem eigenen Wagen zurück zur Bondstreet«, entgegnete Barbara, »und schicke ihn dann gleich zur Admiralität, um Horatio abzuholen. Da kommt er schon!«
Der Wagen, auf dessen Bock Brown neben dem Kutscher saß, fuhr hinter der Kutsche des Lord St. Vincent vor. Brown sprang sogleich ab.
»Sehr schön, also kommen Sie, Hornblower. Nochmals Ihr gehorsamer Diener, gnädige Frau.«
St. Vincent kletterte schwerfällig in den Wagen, und Hornblower setzte sich neben ihn, dann kam das schwere Fahrzeug unter lautem Hufgeklapper langsam in Bewegung. Bleicher Sonnenschein spielte durch das Fenster herein und huschte über das steinerne Gesicht St. Vincents, der vornübergebeugt auf seinem Lederpolster saß. Ein paar Gassenjungen entdeckten die buntgekleideten Männer in der Kutsche, brüllten laut hurra und schwenkten ihre zerlumpten Mützen.
»Chadwick hatte die Flame, eine Brigg mit 18 Geschützen«, sagte St. Vincent. »Die Besatzung hat in der Seine-Bucht gemeutert und hält ihn und die anderen Offiziere als Geiseln gefangen. Nun haben sie einen Steuermannsmaat und vier unbeteiligte Männer mit einem an die Admiralität gerichteten Ultimatum in der Gig losgeschickt. Das Boot ist gestern abend in Bembridge angelangt, und das Schreiben hat mich soeben erreicht. Hier ist es.«
Zornig schüttelte St. Vincent den Brief mit seinen Anlagen in der knotigen Hand. Er hatte die Papiere nicht mehr losgelassen, seit er sie in der Westminsterabtei erhalten hatte.
»Und was steht in diesem Ultimatum, Mylord?«
»Amnestie wollen sie haben – alles soll vergessen sein. Und Chadwick soll gehängt werden. Wenn wir nicht darauf eingehen, wollen sie die Brigg den Franzosen ausliefern.«
»Diese närrischen Dummköpfe!« sagte Hornblower.
Er erinnerte sich an Chadwick von der Indefatigable her. Er war damals vor zwanzig Jahren für einen Fähnrich schon alt gewesen und mußte jetzt schon ein guter Fünfziger sein, und er hatte es immer noch nicht weiter gebracht als bis zum Leutnant. Schon als Fähnrich war er ein launischer, unangenehmer Mensch gewesen, da konnte man sich leicht vorstellen, wie es um die Stimmung des alten, so oft in der Beförderung übergangenen Leutnants heute bestellt war. Wenn er wollte, dann konnte er ein kleines Schiff wie die Flame für die Besatzung zu einer wahren Hölle machen, zumal er wahrscheinlich der einzige Offizier mit Patent war, der sich an Bord befand. Daraus mochte sich dann die Meuterei ergeben haben. Nach den schrecklichen Lehren von Spithead und vom Nore, nachdem Pigott auf der Hermione ermordet worden war, hatte man einige der schlimmsten Härten des Kriegsschiffsdienstes beseitigt. Gewiß, das Leben an Bord war auch jetzt noch hart und grausam genug, aber doch nicht so, daß sich die Menschen für die selbstmörderische Narrheit einer Meuterei entschieden, wenn nicht besondere Umstände dazukamen.
War der Kommandant ein grausamer und obendrein ungerechter Mensch und fand sich unter der Besatzung ein entschlossener, kluger Rädelsführer, dann war eine Lage geschaffen, die den Keim des Aufruhrs in sich trug. Aber es galt vor allem, jede Meuterei, ganz gleich, was ihre Ursache gewesen war, sofort zu unterdrücken und mit äußerster Strenge zu bestrafen. Nichts, keine Blattern und keine Pest, war in einer Kriegsmarine ansteckender als Meuterei. Ging auch nur ein einziger Meuterer straflos aus, dann erinnerten sich die Leute in der Folge bei jedem Anlaß zur Klage dieses verlockenden Beispiels und ahmten es ohne Hemmung nach. Dabei stand England mitten im Entscheidungskampf gegen die französische Gewaltherrschaft. Fünfhundert Kriegsschiffe, darunter zweihundert Linienschiffe, standen im Dienst, um die Weltmeere vom Feinde frei zu halten. Unter Wellington brachen soeben hunderttausend Mann in Südfrankreich ein. Und die buntscheckigen Armeen des östlichen Europa, die Russen und Preußen, die Schweden und Österreicher, die Kroaten und Ungarn und Holländer, sie alle wurden mit englischer Hilfe eingekleidet, ernährt und bewaffnet. Es schien fast, als müßte jede weitere Belastung in diesem Ringen die Kräfte Englands übersteigen, als müßte es schon jetzt unter der furchtbaren Last niederbrechen, die es auf seinen Schultern trug. Wie nicht anders zu erwarten war, kämpfte Bonaparte mit verbissener Kraft und mit Aufwand aller Listen um sein Leben. Noch ein paar Monate des Ausharrens, ein paar Monate höchster Anspannung aller Kräfte reichten vielleicht hin, seinen endgültigen Zusammenbruch herbeizuführen und der von Wahnsinn umnachteten Welt den Frieden zu schenken. Umgekehrt konnte jetzt ein Augenblick des Schwankens, ein bloßer Hauch von Unsicherheit und Zweifel genügen, die Menschheit für eine, nein, für ungezählte Generationen an das Kreuz der Tyrannei zu schlagen.
Die Kutsche bog in den Hof der Admiralität ein, und zwei Veteranen der Flotte kamen mit ihren Holzbeinen angestapft, um die Schläge zu öffnen. St. Vincent kletterte hinaus und ging mit Hornblower, beide in der Pracht ihrer rotweißseidenen Gewänder, durch die Korridore zum Zimmer des Ersten Lords.
»Da, das Ultimatum!« sagte St. Vincent und warf ein Blatt Papier auf den Schreibtisch.
Ungeübte Handschrift, war Hornblowers erster Eindruck. Jedenfalls war das nicht die Arbeit eines bankerotten Kaufmanns oder eines Anwaltsgehilfen, den man zum Dienst in der Flotte gepreßt hatte.
An Bord HMS Flame vor Havre, den 7. Oktober 1813
›Wir sind alles anständige, ehrliche Leute, aber Leutnant Augustin Chadwick hat uns immer auspeitschen lassen und wollte uns nichts zu essen geben. Seit einem Monat hat er auf jeder Wache zweimal ›Alle Mann‹ gepfiffen. Gestern sagte er, er wolle heute jeden dritten Mann auspeitschen lassen und, sobald sie wieder dienstfähig seien, den Rest. Deshalb haben wir ihn jetzt in seiner Kammer eingesperrt, und an der Fockrah ist schon das Ende geschoren, das ihm um den Hals gelegt werden muß. Nach dem, was er dem Schiffsjungen James Jones angetan hat, hat er nichts anderes verdient. Er hat ihn nämlich umgebracht, aber in seinem Bericht hat er wohl geschrieben, er sei an Fieber gestorben. Wir bitten Ihre Lordschaften in der Admiralität um die Zusage, daß er für seine Missetaten zur Verantwortung gezogen wird. Wir möchten andere Offiziere und wünschen uns, daß das, was geschehen ist, vergeben und vergessen sein soll. Wir möchten für die Freiheiten Englands weiterkämpfen, denn wir sind anständige, ehrliche Seeleute, wie wir schon gesagt haben. Aber in Lee liegt Frankreich, und für uns geht es jetzt ums Ganze. Wir werden uns nicht als Meuterer hängen lassen. Wenn Sie den Versuch machen, unser Schiff wegzunehmen, dann baumelt Chadwick an der Rah und wir laufen zu den Franzosen ein. Dieser Brief ist von uns allen unterschrieben.
Mit hochachtungsvoller Ergebenheit.‹
Um den ganzen Rand des Schreibens standen die Unterschriften, sieben Namen und dazu ein paar Dutzend Kreuze, jedes mit einer Bemerkung: ›Zeichen des Henry Wilson, Zeichen des William Owen‹ usw. Ihr Zahlenverhältnis gab ein Bild der üblichen Zusammensetzung der englischen Schiffsbesatzungen aus Leuten mit Schulbildung und Analphabeten. Als Hornblower die Prüfung des Schreibens beendet hatte, blickte er wieder St. Vincent an.
»Meuterische Hunde«, knirschte der.
Ja, vielleicht waren sie das, dachte Hornblower. Aber, hatten sie nicht im Grunde ein Recht, es zu sein? überlegte er weiter. Er konnte sich so gut vorstellen, wie man sie behandelt hatte, diese ganze endlose, sinnlose Grausamkeit, die das ohnehin harte Leben an Bord eines Schiffes im Blockadedienst völlig unerträglich machte, dieses Elend, von dem wirklich nur der Tod oder die Meuterei Erlösung brachten, weil es einfach keinen anderen Weg der Befreiung gab.
Angesichts der unfehlbar bevorstehenden Auspeitschung hatten sich die armen Kerle zum Widerstand entschlossen und gemeutert. Er konnte ihnen daraus im Ernst keinen Vorwurf machen. Hatte er nicht schon genug zerfetzte Rücken sehen müssen? Er wußte genau, daß er selbst buchstäblich zu allem imstande wäre, um einer solchen Folter, wenn sie ihm einmal drohen sollte, zu entgehen. Wie, wenn er zum Beispiel wüßte, daß er nächste Woche ausgepeitscht würde? Als er im Ernst versuchte, sich in diese Lage hineinzudenken, kroch es ihm kalt über den Rücken. Diese Männer hatten das moralische Recht auf ihrer Seite. Wenn man sie jetzt für ihr durchaus entschuldbares Verbrechen dennoch bestrafte, dann geschah das nicht im Dienste des Rechts, sondern aus Gründen der Staatsraison. Es war für das Schicksal des Vaterlandes von entscheidender Bedeutung, daß man alle Meuterer ergriff, die Rädelsführer hängte und die übrigen auspeitschte, daß man diesen neuen Krankheitsherd, der an Englands Schwertarm aufgetreten war, sofort ausbrannte, ehe sich das Übel weiterfraß.
Sie mußten hängen, ob sie eine moralische Schuld traf oder nicht, das gehörte ganz einfach mit zum Krieg, so wie es zum Krieg gehörte, Franzosen zu töten, Männer, die vielleicht die besten Väter und Gatten waren. Immerhin war es besser, St. Vincent nichts von diesen Gefühlen und Überlegungen ahnen zu lassen – der Erste Lord haßte die Meuterer ganz einfach, weil sie Meuterer waren, er gab sich keine Mühe, tiefer in die Problematik des einzelnen Falles einzudringen.
»Welche Befehle haben Sie für mich, Mylord?« fragte Hornblower.
»Ich gebe Ihnen carte blanche«, antwortete St. Vincent.
»Sie sollen freie Hand haben. Bringen Sie mir die Flame heil und sicher zurück nach England und die Meuterer mit. Wie Sie diese Aufgabe lösen wollen, bleibt ganz Ihnen überlassen.«
»Ich habe also unbeschränkte Vollmacht – zum Beispiel auch zu Verhandlungen, Mylord?«
»Nein, verdammt, so war es nicht gemeint«, gab St. Vincent zur Antwort. »Was ich meinte, war, daß Sie an Schiffen haben können, was Sie wollen. Ich könnte Ihnen drei Linienschiffe verfügbar machen, wenn Sie sie brauchen. Ein paar Fregatten, Kanonenboote … sogar ein Raketenschiff stelle ich Ihnen, wenn Sie sich etwas davon versprechen – dieser Congreve möchte seine Raketen gern wieder einmal praktisch erproben.«
»Der Einsatz stärkerer Kräfte scheint mir in diesem Falle wenig Vorteil zu bringen, Mylord. Vor allem dürfte sich die Verwendung von Linienschiffen erübrigen.«
»Damit sagen Sie mir verdammt nichts Neues.« St. Vincents massige Züge verrieten deutlich, wie es in ihm arbeitete.
»Diese unverschämten Lumpen können ja beim ersten Anzeichen einer Gefahr schneller in die Seinemündung hineinrutschen, als eine Ente zweimal mit dem Schwanz wackelt. Eine solche Aufgabe kann nur mit dem Kopf gelöst werden. Das ist es ja gerade, weshalb ich Sie dafür ausgesucht habe, Hornblower.«
Das war ein hübsches Kompliment. Hornblower konnte nicht umhin, sich heimlich etwas aufzuplustern. Sprach er nicht fast wie gleich zu gleich mit einem der größten Admirale, die je eine Flagge geführt hatten? Das gab ein wunderbares Gefühl stolzer Befriedigung. Und nun entrang sich dem Ersten Lord unter einem zunehmenden inneren Zwang noch ein anderes, viel erstaunlicheres Eingeständnis:
»Außerdem sind Sie bei den Leuten beliebt, Hornblower«, platzte er heraus. »Ich kenne verdammt keinen, der Sie nicht mag. Man folgt Ihrem Beispiel, man hört auf das, was Sie sagen. Sie sind einer von den Offizieren, die den Leuten immer wieder Gesprächsstoff geben. Die Männer vertrauen Ihnen und setzen große Erwartungen auf Sie – ich auch, verdammt nochmal, falls Sie das noch nicht gemerkt haben sollten.«
»Wenn ich mit den Leuten reden soll, dann heißt das doch nichts anderes, Mylord, als daß ich mit ihnen zu verhandeln habe.«
»Keine Verhandlungen mit Meuterern!« brüllte St. Vincent und knallte seine Faust, die an Umfang einer Hammelkeule glich, krachend auf den Schreibtisch. »Damit haben wir anno 94 unsere Erfahrungen gemacht.«
»Dann bedeutet also die Carte blanche, die Sie mir geben, nicht mehr als die üblichen Befehle, Mylord«, sagte Hornblower.
Das war wirklich kein Vergnügen mehr. Man übertrug ihm hier eine äußerst schwierige Aufgabe, die sehr leicht schiefgehen konnte, und machte ihm natürlich allein den Vorwurf, wenn er keinen Erfolg hatte. Er hatte sich gewiß nie träumen lassen, daß er sich je dazu versteigen würde, mit einem Ersten Lord eine Meinungsverschiedenheit auszutragen, und doch sah er sich nun mitten darin; es ging nicht anders. In einem hellsichtigen Augenblick machte er sich klar, daß er dabei im Grunde gar nicht für sich selbst sprach, daß er nicht einmal darauf aus war, seine persönlichen Interessen zu wahren. Er verhandelte vielmehr ganz unpersönlich. Der Offizier, der den Auftrag erhielt, den Meuterern die Flame wegzunehmen und dessen ganze Zukunft vielleicht von den Vollmachten abhing, die er bekam, dieser Offizier war nicht der Hornblower, der hier in seinem weiß-roten Seidengewand auf dem geschnitzten Stuhle saß, sondern ein armer Teufel, der ihm leid tat und dessen Sache er verfocht, weil sie mit der großen Sache des Vaterlandes eins war. Aber dann verschmolzen diese beiden Wesen gleich wieder zu einem einzigen, und er entdeckte, daß ihn diese Geschichte ganz allein anging, ihn, Hornblower, den Mann Barbaras, der gestern bei Lord Liverpool diniert hatte und heute als Folge davon noch ein leichtes Stechen in der Mitte der Stirn fühlte. Ausgerechnet ihm wurde hier diese höchst unerfreuliche Aufgabe übertragen, die ihm nicht für fünf Pfennige Ruhm oder Auszeichnung einbrachte, während er sich der Gefahr aussetzte, dabei einen gründlichen Fehlschlag zu erleiden, einen Versager, der ihn zur Witzfigur der ganzen Marine machte und dem Gelächter des Landes preisgab.
Wieder beobachtete er aufmerksam das Mienenspiel seines Gegenübers. Lord St. Vincent war alles andere als beschränkt, und hinter dieser zerklüfteten Stirn saß ein scharfer Verstand. Er kämpfte im Augenblick einen harten Kampf gegen seine eigenen Vorurteile und rang sich endlich dazu durch, sie einer höheren Pflichtauffassung zum Opfer zu bringen.
»Also gut, Hornblower«, entschied der Erste Lord endlich, »ich gebe Ihnen unbeschränkte Vollmacht und werde Ihren Befehl in diesem Sinne ausfertigen lassen. Natürlich behalten Sie den Rang eines Kommodore.«
»Ich danke Ihnen, Mylord.«
»Hier ist die Besatzungsliste der Flame«, fuhr St. Vincent fort. »Bei uns liegt gegen keinen der Leute etwas vor. Der Bootsmannsmaat Nathaniel Sweet – hier ist seine Unterschrift – war vorher Erster Steuermann auf einer Kohlenbrigg aus Newcastle. Er wurde dort wegen Trunkenheit entlassen. Vielleicht ist er der Rädelsführer. Aber ebensogut kann es auch ein anderer sein.«
»Weiß die Öffentlichkeit von der Meuterei?«
»Nein! Gebe Gott, daß sie nichts davon erfährt, ehe die Kriegsgerichtsflagge geheißt wird. Holden in Bembridge war klug genug, den Mund zu halten. Er setzte den Steuermannsmaaten und die Matrosen sofort hinter Schloß und Riegel, als er ihre Nachricht gehört hatte. Die Dart segelt nächste Woche nach Kalkutta, und ich stecke die ganze Gesellschaft dahin an Bord. Dann kann es noch Monate dauern, ehe etwas von der Geschichte durchsickert.«
Meuterei war ansteckend, sie wurde durch Reden übertragen. Man mußte den Ansteckungsherd so lange isolieren, bis er ausgeätzt werden konnte. St. Vincent zog ein Blatt Papier heran und griff nach seiner Feder – einer hübschen Truthahnfeder mit einer der neumodischen Goldspitzen.
»Was für Schiffe wollen Sie nun haben?«
»Am liebsten hätte ich etwas Schnelles, Handiges«, sagte Hornblower.
Er hatte noch nicht die leiseste Idee, wie er die Aufgabe angehen sollte, ein Fahrzeug abzufangen, das sich nur zwei Meilen nach Lee zurückzuziehen brauchte, um für jeden Verfolger unerreichbar zu sein. Aber sein Stolz gebot ihm, diese Unsicherheit hinter einer Maske von Selbstvertrauen zu verbergen. Er hätte zu gern gewußt, ob die Menschen alle so waren wie er: nach außen hin ein Bild tapferer Entschlossenheit, in Wirklichkeit schwache, hilflose Kreaturen. Dabei fiel ihm eine Bemerkung Suetons ein, der von Nero berichtet, er habe alle Menschen, obgleich sie es öffentlich nicht zugaben, für ebenso verderbt gehalten, wie er es war.
»Da hätten wir die Porta Coeli«, sagte St. Vincent und hob seine weißen Augenbrauen. »Das ist eine Brigg mit 18 Geschützen, Schwesterschiff der Flame. Liegt seeklar in Spithead. Ihr Kommandant ist Freeman, der unter Ihnen in der Ostsee den Kutter Clam geführt hat. Er hat Sie doch nach Hause gebracht, nicht wahr?«
»Jawohl, Mylord.«
»Paßt Ihnen dieses Schiff?«
»Ich glaube, das ist das richtige, Mylord.«
»Pellew führt das Kanalgeschwader. Ich werde ihm befehlen, Ihnen jede Unterstützung zu gewähren, die Sie anfordern.«
»Besten Dank, Mylord.«
So war er. Da stürzte er sich in ein schwieriges, vielleicht sogar aussichtsloses Unternehmen und machte nicht den leisesten Versuch, sich wenigstens eine Rückzugsstraße offen zu halten. Es fiel ihm gar nicht ein, jetzt die Saat späterer Entschuldigungen und Ausflüchte in die Erde zu bringen, die nachher im Fall eines Mißerfolges so willkommen war und so nützlich aufging. Das war gewiß ein unverantwortlicher Leichtsinn, aber er konnte einfach nicht anders, sein lächerlicher Stolz hinderte ihn daran, etwas Derartiges zu tun. Er brachte es nicht fertig, Männern wie St. Vincent mit Wenns und Abers zu kommen, er konnte sich überhaupt vor einem anderen Mann nicht in dieser Weise bloßstellen. Ob das daher kam, daß ihm die Anerkennung des Ersten Lords vorhin zu Kopf gestiegen war oder daß er eben die beiläufige Bemerkung von ihm gehört hatte, er dürfe von einem Geschwaderchef wie Pellew Unterstützung ›anfordern‹, dem Mann, der vor zwanzig Jahren sein Kommandant gewesen war, als er noch Fähnrich war? Nein, nichts von alledem war schuld, es lag nur an seinem unsinnigen Stolz.
»Der Wind ist stetig aus Nordwest«, sagte St. Vincent mit einem Blick auf den Zeiger an der Decke, der die Bewegungen der Windfahne auf dem Dach der Admiralität in sein Zimmer übertrug. »Aber das Glas fällt. Je eher Sie auslaufen, desto besser. Ich schicke Ihnen Ihre Order in die Wohnung nach, dann haben Sie noch Zeit, sich von Ihrer Frau zu verabschieden. Wo haben Sie denn Ihre Sachen?«
»In Smallbridge, Mylord, das liegt fast an der Straße nach Portsmouth.«
»Um so besser. Jetzt ist es Mittag. Wenn Sie um drei Uhr die Postkutsche nach Portsmouth nehmen – Kurierpost können Sie mit Ihrer Seekiste nicht benutzen – dann sind Sie in acht, nein, in sieben Stunden dort. Die Straßen sind zu dieser Jahreszeit ja noch nicht so übel. Jedenfalls könnten Sie um Mitternacht unterwegs sein. Freeman bekommt jetzt sofort seinen Befehl durch die Post. Ich wünsche Ihnen Glück und Erfolg, Hornblower.«
»Danke, Mylord.«
Hornblower raffte seinen Ordensmantel, griff nach dem Säbel und verabschiedete sich. Er hatte das Zimmer noch nicht verlassen, da kam auf St. Vincents heftiges Klingeln von nebenan ein Sekretär hereingestürzt, um die für ihn bestimmte Order als Diktat aufzunehmen. Draußen wehte der frische Nordwest, von dem St. Vincent gesprochen hatte. Hornblower fröstelte in seinem festlichen Gewand aus roter und weißer Seide, er fühlte sich recht verlassen und einsam. Aber da stand schon der Wagen, der ihn nach Barbaras Wort erwartete.
2EINE KURZE FRIST
Mit ruhigem Blick und gefaßter Miene kam sie ihm entgegen, als er in der Bondstreet anlangte. Das war bei diesem Sproß einer Soldatenfamilie nicht anders zu erwarten. Aber sprechen? Wenn sie die Haltung wahren wollte, konnte sie höchstens ein kurzes Wort wagen:
»Eine Order?« fragte sie.
»Ja«, gab Hornblower zur Antwort, und dann machten sich seine starken, widerstreitenden Gefühle in der einfachen Wiederholung Luft: »Ja, mein Liebling!«
»Und wann?«
»Ich laufe noch heute nacht von Spithead aus. Meine Order wird in diesem Augenblick geschrieben – ich muß fort, sobald sie hier ankommt.«
»Etwas Ähnliches habe ich mir gedacht, St. Vincent sah ganz danach aus. Ich habe Brown schon nach Smallbridge geschickt, damit er deine Sachen zusammenpackt. Wenn wir hinkommen, ist schon alles klar.«
Tüchtige, vorausschauende, einsichtige Barbara! Und doch konnte er darauf keine passendere Antwort finden als ein farbloses: »Danke, meine Liebe.«
Immer noch, auch nach so langer gemeinsamer Zeit, erlebte er solche Augenblicke, in denen er keine Worte fand, um Gefühle auszudrücken, die ihn doch fast überwältigten – aber vielleicht war das eben die Folge ihrer übermächtigen Gewalt.
»Darf ich dich fragen, wohin du fährst?«
»Ich kann dir auf diese Frage keine Antwort geben«, sagte Hornblower mit gezwungenem Lächeln, »das tut mir besonders leid, mein Schatz.«
Barbara hätte natürlich kein Wort weitererzählt, er konnte auch sicher sein, daß es ihr nicht einfiel, die Leute durch versteckte Winke und Andeutungen erraten zu lassen, welcher Art sein Auftrag war, dennoch konnte er ihr nichts darüber sagen. Dann blieb ihr wenigstens jeder Vorwurf erspart, wenn die Meuterei doch auf irgendeine Weise bekanntwerden sollte. Aber der eigentliche Grund für sein Verhalten war ein anderer. Es war einfach seine Pflicht, Stillschweigen zu bewahren, und diese Pflicht duldete keine Ausnahme. Barbara erwiderte sein Lächeln mit der heiteren Gefaßtheit, die er jetzt von ihr erwarten durfte. Dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit seinem seidenen Umhang zu und legte ihn in schönerem Wurf über seine Schultern.
»Schade«, sagte sie, »daß es in unseren Tagen für Männer so wenig Gelegenheiten gibt, sich schön anzuziehen. Dieses Rot und dieses Weiß hebt dein gutes Aussehen, Liebster. Du bist ein sehr schöner Mann, weißt du das eigentlich?«
Dann brach die künstlich errichtete, ach, so gebrechliche Schranke zwischen ihnen zusammen und löste sich in nichts auf wie eine angestochene Seifenblase. Sein Wesen dürstete nach menschlicher Nähe, bedurfte der Liebe, aber er hatte in einer Welt ohne Erbarmen gelebt, und Selbstzucht hieß sein tägliches Brot. So fiel es ihm unendlich schwer, war es ihm fast unmöglich, sich so zu geben, wie er in Wirklichkeit war. Da war immer die lauernde Angst, eine Zurückweisung zu erfahren, eine schreckliche Möglichkeit, die er natürlich nie in Kauf nehmen konnte. Und sie, sie wußte genau, was da in ihm vorging, und ihr Stolz lehnte sich dagegen auf. Die in England übliche stoische Erziehungsmethode hatte sie daran gewöhnt, allen Gefühlsregungen zu mißtrauen und alles hemmungslose Zurschaustellen von Gefühlen zu verachten. Ihr Stolz war genauso entwickelt wie der seinige, sie litt gelegentlich darunter, daß sie zur Erfüllung ihres Lebens seiner bedurfte, genauso wie er darunter leiden konnte, daß er sein Leben ohne ihre Liebe als Stückwerk empfand. Beide waren stolze Naturen, für die aus irgendeinem Grunde ein Dasein, das sich selbst genügte und der Gemeinschaft mit anderen nicht bedurfte, den Inbegriff des Vollkommenen bedeutete. Beide erblickten sie in dem Verzicht auf diese Lebensform ein Opfer, das ihnen oft genug unangemessen groß erschien.
Aber in diesem Augenblick, da sie die Schatten der Trennung schon umgaben, schwand aller Stolz und alle Gegenwehr, sie streiften den starren Panzer ab, den die Jahre um ihre Herzen gelegt hatten, und entdeckten den Segen ihrer natürlichen Gefühle. Sie lag in seinen Armen, ihre Hände griffen unter seinen Rittermantel und fühlten durch das dünne Seidenwams die Wärme seines Körpers. Er umfing sie mit der gleichen glühenden Leidenschaft, die sie entflammte. Korsetts waren damals verpönt, und auch sie trug daher nur eine winzige Versteifung aus Fischbein um die Hüften. Er fühlte also in seinen Armen die ganze Pracht ihres schlanken Körpers, der trotz seiner wunderbaren Muskeln, dem Ergebnis scharfer Ritte und langer Wanderungen, so herrlich biegsam war. Er hatte sich erst dazu erziehen müssen, Muskeln bei einer Frau für begehrenswert zu halten. Früher war er der Ansicht gewesen, Frauen müßten schwach und weichlich sein. Ihre warmen Lippen preßten sich aufeinander und zwei Augenpaare lächelten sich an.
»Mein Liebling, o mein Herz!« sagte sie und flüsterte dann Lippe an Lippe immer wieder jene süßeste Liebkosung der kinderlosen Frau für ihren Geliebten: »Mein Kindchen, mein Herzenskindchen!«
Das war das Köstlichste, was sie ihm sagen konnte. Und ihm war es recht, er wollte ihr Kind und ihr Mann sein, sobald er einmal seinen schützenden Panzer abgelegt hatte und seine Gefühle frei strömen ließ. In seiner schutzlosen Blöße wünschte er sich dann nichts anderes als Geborgenheit, und dazu mußte sie so wahrhaftig und so treu zu ihm sein wie eine Mutter zu ihrem Kind, durfte sie aus seiner Wehrlosigkeit nicht den leisesten Vorteil ziehen. Nun lösten sich auch die letzten Vorbehalte, und sie schmolzen in jener heißesten Glut der Leidenschaften ineinander, die ihnen so selten geschenkt war. Heute aber hätte sie nichts mehr zu löschen vermocht. Hornblowers kräftige Finger rissen die Seidenschnur los, die den Rittermantel zusammenhielt, dann die ungewohnten Nestel seines Wamses und die lächerlichen Bändsel seiner Kniehose – auch diese Hantierungen vermochten seiner Leidenschaft nichts anzuhaben. Barbara ertappte sich dabei, daß sie immer wieder seine Hände küßte, diese langen, schönen Finger, die in Zeiten der Trennung so manches Mal durch ihre Träume geisterten, auch das war ein Ausdruck reinster Leidenschaft ohne jede sinnliche Bedeutung. Sie fanden frei, ohne Fessel, ohne Hemmnis, in reiner Liebe zueinander. Sie waren in wunderbarer Weise eins und blieben es, auch als das Feuer verglomm, sie genossen das Glück der Erfüllung, aber es machte sie nicht überdrüssig, und sie blieben eins, auch als er sie auf ihrem Ruhebett verließ und mit einem Blick in den Spiegel feststellte, daß seine schütteren Haare wüst zerzaust waren.
Seine Uniform hing an der Tür des Ankleidezimmers, Barbara hatte wirklich an alles gedacht, während er bei St. Vincent war. Er wusch sich vor dem Waschbecken und rieb seinen erhitzten Körper mit einem nassen Schwamm ab. Dabei dachte er nicht im mindesten an eine Reinigung von irgendwelchem Schmutz, es ging ihm einzig um die angenehme Erfrischung. Als der Butler an die Tür klopfte, zog er über Hemd und Hose seinen Schlafrock an und öffnete. Es war seine Order. Er unterschrieb den Empfangsschein, erbrach das Siegel und setzte sich, um sie genau durchzulesen und festzustellen, ob sie auch keine Unklarheiten enthielt, die beseitigt werden mußten, ehe er London verließ. Da waren sie wieder, die alten, alten Formeln: ›Sie werden beauftragt und angewiesen‹, ›es wird Ihnen mit größtem Nachdruck zur Pflicht gemacht‹, jene gewichtigen Worte, in deren Bann schon Nelson bei Trafalgar und Blake bei Teneriffa ins Gefecht gegangen waren. Der Sinn des Befehls war klar, und der Umfang seiner Vollmacht unterlag keinem Zweifel. Es konnte kein Mißverständnis geben, wenn er vor einer Schiffsbesatzung – oder einem Kriegsgericht verlesen wurde. Würde man ihn eines Tages zwingen, diesen Befehl laut zu verlesen?
Das hieß dann, daß er mit den Meuterern verhandelt hatte. Gewiß, das Recht dazu hatte er, aber es sah doch verdammt nach Schwäche aus, wenn er es tat. Die ganze Flotte nahm bestimmt mit hochgezogenen Brauen davon Kenntnis, und auf St. Vincents zerklüftetes Gesicht würde sich der Schatten der Enttäuschung niedersenken. Es gab keinen Ausweg: Er mußte hundert englische Seeleute durch List und Tücke in seine Gewalt bringen, daß man sie hängen oder auspeitschen konnte, weil sie etwas getan hatten, was er, wie er genau wußte, unter den gleichen Umständen selbst ebenso tun würde. Er hatte auch hier ganz einfach seine Pflicht zu erfüllen. Manchmal war es seine Pflicht, Franzosen zu töten, diesmal war es eben etwas anderes. Wenn schon jemand getötet werden mußte, dann hätte er sich allerdings lieber an die Franzosen gehalten. Aber wie in Gottes Namen sollte er die bevorstehende Aufgabe angehen?
Die Schlafzimmertür öffnete sich, Barbara trat mit strahlendem Lächeln ein. Kaum begegneten sich ihre Blicke, da klangen auch ihre Seelen von neuem wunderbar zusammen. Weder die bevorstehende körperliche Trennung noch die Überlegungen Hornblowers über seine widerwärtige Aufgabe vermochten es, diese Harmonie der Seelen zu stören. Sie fühlten sich heute in einem ganz neuen, viel umfassenderen Sinne eins als je zuvor. Daß sie sich dieser Erhöhung bewußt waren, gab ihrem Glück die Weihe der Vollkommenheit. Hornblower erhob sich.
»Ich bin in zehn Minuten fertig zum Aufbruch«, sagte er.
»Willst du mich nicht bis Smallbridge begleiten?« »Ich hoffte, du würdest mich darum bitten«, sagte Barbara.
3STURM IM KANAL
Die Nacht war pechrabenschwarz, der Wind hatte nach Westen gekrimpt und wehte schon jetzt mit halber Sturmstärke, die Anzeichen sprachen dafür, daß er bald noch härter würde. Er zerrte an Hornblower, daß ihm die Hosenbeine über seinen Seestiefeln um die Knie flatterten, er riß an seinem Mantel, rings um ihn und über ihm heulte und pfiff das ganze Takelwerk wie ein Chor von Wahnsinnigen, als lehnte es sich dagegen auf, daß sich der Mensch vermaß, sein zerbrechliches Schiffsgeschöpf tollkühn den entfesselten Gewalten des Weltalls auszuliefern. Sogar hier, in Lee der Insel Wight, arbeitete die kleine Brigg schon lebhaft genug unter den Füßen Hornblowers, der breitbeinig auf ihrem winzigen Achterdeck stand. Irgendwo in Luv von ihm kanzelte jemand – wahrscheinlich ein Unteroffizier – wegen irgendeines Versehens einen Matrosen ab, der Wind trug die Schimpfworte brockenweise an sein Ohr.
Ein Wahnsinniger, dachte Hornblower, erlebte wohl immer diese verrückten Gegensätze, dieses plötzliche Umschlagen der Stimmung, diese gewaltsame Verwandlung der Umwelt. Nur daß sich beim Wahnsinnigen der Wandel in jenem selbst vollzog, während es in seinem Falle wirklich die Umwelt war, die ihr Gesicht fast von Stunde zu Stunde veränderte. Heute vormittag erst, es war noch kaum zwölf Stunden her, hatte er noch mit den Rittern des Bathordens, in weiße und rote Seide gekleidet, in der Westminsterabtei gesessen, und am Abend zuvor hatte er beim Premier gespeist. Er hatte in Barbaras Armen gelegen, er hatte in der Bondstreet in allem denkbaren Überfluß gelebt; ein Zug an der Klingel hatte genügt, und jeder Wunsch, jede Laune war ihm in Erfüllung gegangen. Das war ein bequemes Herrenleben gewesen, ein Dutzend Dienstboten gerieten in helle Aufregung, wenn das ruhige Dasein ihres Sir Horatio die geringste Störung erlitt. Sir Horatio – sie zogen diese beiden Worte natürlich zusammen, so daß daraus ein kurioser Wechselbalg entstand, der sich wie Sörrorescho anhörte. Barbara hatte den ganzen Sommer mit Sorgfalt über ihm gewacht, um ja gewiß zu sein, daß er auch die letzten Folgen des russischen Typhus überwand, mit dem er nach Hause gekommen war. Hand in Hand mit dem kleinen Richard war er im Sonnenschein durch die Gärten von Smallbridge gewandert, die Gärtner waren bei seiner Annäherung ehrerbietig zurückgetreten und hatten höflich den Hut gezogen. Auch jener goldene Nachmittag fiel ihm ein, an dem sie, er und Richard, am Rande des Fischteichs auf dem Bauch gelegen und versucht hatten, die Goldfische mit der Hand zu greifen. In die Glut des Sonnenuntergangs getaucht, waren sie dann nach Hause gepilgert, beide naß und schmutzig, aber strahlend vor Glück – er und sein kleiner Junge. Damals waren sie einander so nahe, wie er es heute Barbara gewesen war. Ein Leben voller Glück – ach, zu viel Glück!
Heute nachmittag in Smallbridge, während Brown und der Postjunge seine Seekiste zur Kutsche hinausbrachten, hatte er von Richard Abschied genommen, hatte ihm die Hand geschüttelt wie einem Mann.
»Mußt du wieder in den Krieg, Vater?« hatte Richard gefragt. Dann kam noch ein Abschied von Barbara; er war alles andere als leicht gewesen. Wenn er Glück hatte, war er womöglich in acht Tagen wieder zu Hause, aber das konnte er ihr nicht sagen, es hätte zu viel von der Art seiner Aufgabe verraten. Das bißchen Täuschung genügte aber schon, das Gefühl der Einheit, der unzertrennlichen Verbindung zu erschüttern. So kam es, daß er sich wieder ein bißchen kalt und förmlich gab. Als er sich von ihr abwandte, war ihm seltsamerweise zumute, als hätte er etwas für immer verloren.
Dann war er in die Kutsche geklettert und mit Brown an seiner Seite davongerollt. Bis Guildford ging es, während schon der Abend herabsank, an den Ausläufern des Gebirgszuges der Downs entlang, dann fuhren sie auf der Straße nach Portsmouth weiter in die Nacht hinein. In wie vielen entscheidenden Stunden seines Lebens war er schon diese Straße gefahren! Der Übergang von Überfluß zu spartanischer Härte war so schrecklich kurz! Um Mitternacht setzte er seinen Fuß an Deck der Porta Coeli. Freeman begrüßte ihn am Fallreep, vierkant, untersetzt und dunkel wie je, eine schwarze Locke hing ihm nach Zigeunerart ins Gesicht, und man wunderte sich unwillkürlich, daß er keine Ohrringe trug. Hornblower brauchte nur zehn Minuten, um Freeman unter dem Siegel der Verschwiegenheit von der Aufgabe in Kenntnis zu setzen, die die Porta Coeli erwartete. In Ausführung der vor vier Stunden erhaltenen Order hatte dieser seine Brigg bereits seeklar gemacht, und als die zehn Minuten um waren, besetzten seine Leute das Spill, um den Anker zu lichten.
»Wird eine böse Nacht, Sir«, sagte Freeman irgendwo im Dunkel neben ihm. »Das Glas fällt immer noch.«
»Ja, es sieht ganz so aus, Mr. Freeman.«
Da stieß Freeman mit geradezu unwahrscheinlichem Stimmaufwand einen Befehl hervor. In diesem mächtigen, tonnenförmigen Brustkasten wohnte eine überraschende Lautstärke:
»Mr. Carlow! Alle Mann auf! Großstengestagsegel bergen! Das zweite Reff in die Marssegel! Rudergänger! Kurs Südost zu Süd!«
»Südost zu Süd, Sir.«
Hornblower fühlte nur ein leises Vibrieren des Decks unter seinen Füßen, als die Männer auf ihre Stationen eilten, sonst konnte er in der stockdunklen Nacht nichts von der Ausführung des Manövers erkennen. Sogar das Quietschen der Scheiben in den Blöcken wurde vom Sturm davongetragen, oder es ging in dem orgelnden Geheul unter, das der Wind im stehenden und laufenden Gut vollführte. Die Dunkelheit verschlang auch die Männer, die zum Reffen der Marssegel in die Riggen enterten. Er hatte einen langen Tag hinter sich, der – fast schien es unglaublich – damit begonnen hatte, daß sich der Schneider melden ließ, um ihm beim Anlegen der Rittertracht des Bathordens zu helfen. Jetzt, an seinem Ende, fühlte er sich kalt und hundemüde.
»Ich gehe unter Deck, Mr. Freeman«, sagte er, »rufen Sie mich, wenn es nötig sein sollte.«
»Aye aye, Sir.«
Freeman öffnete ihm die Schiebekappe, die den Niedergang bedeckte – die Porta Coeli war ein Glattdecker. Schwacher Lichtschimmer drang von unten herauf und zeigte die steile Treppe. Es war nur eine elende Funzel, aber nach der pechrabenschwarzen Finsternis oben an Deck blendete sie doch die Augen. Hornblower kroch hinunter; er mußte sich tief bücken, um nicht an die Decksbalken zu stoßen. Die Tür zur Rechten führte in seine Kammer, diese maß sechs Fuß im Quadrat und war nur vier Fuß zehn Zoll hoch. Hornblower mußte also in die Kniebeuge gehen, als er sich beim flackernden Schein der am Decksbalken hängenden Laterne darin umsah. Das war nun der beste Wohnraum auf dieser Brigg, Gold gegen die Unterbringung der anderen Offiziere und zwanzigmal Gold gegen die Verhältnisse, unter denen die Mannschaften lebten. Im Vorschiff war die Höhe unter Deck genau die gleiche wie hier, vier Fuß zehn Zoll, aber da mußten die Leute ihre Hängematten in zwei Etagen übereinander aufhängen, so daß die obere Schicht der Schläfer mit der Nase an die Decksbalken stieß, die untere mit dem Steiß das Deck unter sich wetzte, während sich in der Mitte Nasen und Hinterteile unsanft berührten. Die Porta Coeli stellte an Kampfkraft das Beste dar, das in ihrer Gattung und Größe der See befuhr; sie führte eine Bestückung, die jeden gleichgroßen Gegner zerschmettern konnte; sie besaß Pulverkammern, deren Fassungsvermögen ausreichte, diesen Geschützen für ein Stunden, ja, Tage währendes Gefecht Munition zu liefern; sie führte so viel Proviant mit sich, daß sie monatelang in See bleiben konnte, ohne einen Hafen anzulaufen; sie war so stark und dicht gebaut, daß sie mit jedem Wetter fertig wurde; aber sie hatte einen Fehler: bei einer Wasserverdrängung von ganzen einhundertneunzig Tonnen konnte man diese glänzenden Eigenschaften nur erzielen, wenn sich die an Bord lebenden Menschen mit einer Unterbringung begnügten, die ein anständiger Bauer nicht einmal seinem Vieh zumuten würde. Es war nicht zu leugnen, wenn England eine Unzahl kleiner Fahrzeuge in Dienst hielt, die unter dem starken Schutz der schweren Linienschiffsgeschwader für die Sicherheit auf allen Meeren sorgten, dann geschah dies auf Kosten des Lebens und der Gesundheit ihrer Besatzungen.
Klein wie die Kammer war, beherbergte sie doch einen geradezu erstaunlichen Gestank. Das erste, was die Nase wahrnahm, war der stickige Rußgeruch der Lampe, aber dann entdeckte er nur zu bald noch eine ganze Skala anderer, zusätzlicher Gerüche. Da war zunächst der schale Dunst des Bilgewassers. Der war noch am erträglichsten, und Hornblower nahm auch kaum davon Notiz, weil er seit zwanzig Jahren daran gewöhnt war. Außerdem aber stank es durchdringend nach Käse. Als sollte sich dieser edle Duft ganz besonders abheben, spürte man dahinter deutlich den Geruch von Ratten. Dazu gesellte sich der bekannte Gestank nasser Kleider, und endlich ein ganzes Gemisch menschlicher Ausdünstungen, unter denen der abgestandene Körpergeruch ungewaschener Männer überwog.
Diese ganze Geruchskomposition erhielt ihr Gegengewicht in Form einer ebenso wirksamen Batterie von Geräuschen. Jeder Balken, jede Planke vibrierte vom Geheul der Takelage. So mußte einer Maus zumute sein, die im Inneren einer Violine saß, während sie gespielt wurde. Und die ständigen Schritte über dem Kopf, das Knallen an Deck geworfener Enden mischte sich, um im Bilde zu bleiben, genauso in dieses Konzert, als ob jemand anderer den Geigenkörper während des Spiels mit kleinen Hämmern bearbeitete. Die hölzerne Beplankung der Brigg krachte und knisterte bei jeder Bewegung im Wasser, als klopfte ein Riese von außen an, und in den Geschoßracks rollten auch die Kugeln ein ganz klein wenig hin und her, so daß es immer gerade am Ende einer jeden Rollbewegung feierlich und infolge der Nacheilung überraschend ›Bum‹ machte.
Als Hornblower gerade in seine Kammer eingetreten war, holte die Porta Coeli unerwartet besonders weit über. Offenbar hatte sie den Schutz der Insel Wight verlassen und legte sich nun unter dem vollen Druck des Westwindes stärker auf die Seite als zuvor. Hornblower ließ sich durch die plötzliche Bewegung überraschen – nach einem längeren Landaufenthalt gewann er seine Seebeine immer nur langsam wieder – und taumelte unfreiwillig vornüber. Glücklicherweise befand sich dort die Koje, auf die er mit dem Gesicht nach unten hinfiel. Während er noch hilflos mit den Beinen angelte, fing sein Ohr auch schon eine ganze Serie von neuen Geräuschen auf. Sie kamen von den verschiedensten losen Gegenständen, die bei Beginn einer jeden Reise meist nicht ordentlich seefest gestaut sind und dann beim ersten stärkeren Überholen durch die Decks poltern.
Hornblower kroch nun mühsam ganz auf die Koje, ließ sich dabei noch einmal von einem heftigen Überholen überraschen, so daß er mit dem Kopf gegen den Decksbalken stieß, und sank endlich stöhnend auf das grobe Kopfkissen. In der feuchten Stickluft der Kammer brach ihm der Schweiß aus allen Poren, eine Folge seiner Anstrengung, aber auch ein sicheres Zeichen der nahenden Seekrankheit. Er begann leise, aber inbrünstig vor sich hin zu fluchen, ein abgründiger Haß gegen diesen Krieg stieg in ihm auf und erfüllte ihn deshalb mit besonderer Bitterkeit, weil er so gar keine Hoffnung auf ein Ende schimmern sah. Er konnte sich kaum vorstellen, wie das war: Friede. Als die Welt zum letztenmal Frieden hatte, da war er noch ein Kind gewesen. Dennoch verzehrte er sich vor Sehnsucht danach, nein, er sehnte sich nur nach einem Zustand, der nicht Krieg war. Er hatte genug, übergenug von diesem endlosen Krieg; die Erfahrungen des letzten Jahres bewirkten, daß er diesen Überdruß nur um so nachdrücklicher und bitterer empfand. Die Nachricht von der völligen Vernichtung der Armeen Bonapartes in Rußland hatte in den Menschen gleich die Hoffnung geweckt, daß der Friede unmittelbar bevorstand. Aber Frankreich schien nicht zu wanken, im Gegenteil, es stellte immer neue Heere auf und hatte alle lebenswichtigen Punkte des Reiches vor dem Ansturm des russischen Gegenangriffs bewahrt. Die Neunmalweisen hatten allerdings auf die unerhörte Strenge und den gewaltigen Umfang der von Bonaparte befohlenen Aushebungen hingewiesen, die alle Schichten und Altersklassen in Mitleidenschaft zogen, sie hatten die Härte seines Steuersystems betont und daraus gefolgert, daß eine Volkserhebung im Inneren nahe bevorstehen müsse und vielleicht sogar durch eine Revolte der Generale unterstützt würde.
Nun waren aber schon wieder zehn Monate vergangen, seit die Voraussagen allgemein Verbreitung gefunden hatten, und es gab noch kein Anzeichen dafür, daß sie in Erfüllung gingen. Als Österreich und Schweden in die Reihen der Gegner Bonapartes übertraten, hofften die Menschen wieder, daß nun der Sieg wirklich nahe sei; sie erwarteten, daß Bonapartes unfreiwillige Bundesgenossen, die Dänen, die Holländer und alle die anderen, sich endlich entschließen würden, ihm die Gefolgschaft zu kündigen, und daß dann für das Napoleonische Reich der Tag des Zusammenbruchs unmittelbar bevorstünde. Aber jedesmal wurden die Hoffnungen enttäuscht. Kluge Männer hatten schon lange vorausgesagt, das Ringen werde fast von selbst ein Ende nehmen, sobald Bonaparte seine Methode, den Krieg aus dem Krieg zu nähren, nicht mehr auf dem Boden seiner Feinde oder seiner Hilfsvölker anwenden könne, sondern die eigenen Untertanen damit heimsuchen müsse.
Und doch, waren nicht schon drei Monate vergangen, seit Wellington mit hunderttausend Mann über die Pyrenäen in das französische Heiligtum selbst eingebrochen war? Stand er nicht immer noch weit unten im Süden, siebenhundert Meilen von Paris, in einem Ringen, in dem es auf Leben und Tod ging? Bonapartes Hilfsquellen, Bonapartes eiserner Wille schienen in der Tat unerschöpflich zu sein.
Hornblower war es in dieser bösen Stunde zumute, als wären sie alle verurteilt weiterzukämpfen, bis der letzte Mann in ganz Europa tot war, bis die Kraft Englands unwiderruflich verbraucht war, als müsse vor allem er selbst nur wegen des verbissenen Wahnsinns eines einzigen Mannes seine Freiheit opfern, sich von Weib und Kind losreißen und unter diesen widerwärtigen Verhältnissen seekrank, frierend und elend endlose Tage und Nächte verbringen, so lange, bis ihn zuletzt sein Alter von diesem unseligen Zwang befreite. Es war wohl das erstemal in seinem Leben, daß er den Wunsch empfand, es möchte ein Wunder geschehen oder irgendein unverhoffter Glücksfall eintreten – daß etwa Bonaparte einer verirrten Kugel zum Opfer fiele oder daß er endlich den Fehler beginge, der ihm die nicht zu verleugnende, die endgültige Niederlage einbrachte, daß die Bevölkerung von Paris sich erfolgreich gegen den Tyrannen erhöbe, daß Frankreich eine Hungerernte erlebte oder daß sich die Marschälle aus Angst um die Erhaltung ihrer erbeuteten Schätze gegen den Kaiser wendeten und ihre Soldaten dazu bestimmten, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Dabei bestand, wie er genau wußte, nicht die geringste Aussicht, daß etwas Derartiges wirklich geschah. Der Kampf ging weiter und immer weiter, und er blieb seekrank, gefesselt an die Kette des Gehorsams, bis sein Haar weiß geworden war.
Er hatte die Augen fest geschlossen gehabt. Als er sie nun aufschlug, sah er Brown, der sich über ihn beugte:
»Ich habe geklopft, Sir, aber Sie hörten mich nicht.«
»Ist etwas los?«
»Kann ich Ihnen etwas bringen, Sir? In der Kombüse wird gleich Feuer ausgemacht. Wollen Sie noch eine Tasse Kaffee? Oder Tee? Oder einen heißen Grog?«
Ein richtiger steifer Grog schenkte ihm vielleicht den Schlaf, den er brauchte. Dann konnte er seine krankhaften, düsteren Gedanken eine Zeitlang vergessen, dann fand er wenigstens vorübergehend Erlösung von dem dunklen Druck, der ihn vollends zu überwältigen drohte. Als er sich schließlich Rechenschaft darüber gab, daß er im Ernst mit diesem Gedanken spielte, war er ehrlich entsetzt über sich selbst. Seit fast zwanzig Jahren hatte er keinen Tropfen mehr in der Absicht getrunken, sich damit zu berauschen, und Trunkenheit war ihm bei sich selbst womöglich noch widerlicher als bei anderen Leuten. Daß er jetzt imstande war, so etwas auch nur einen Augenblick ernstlich in Erwägung zu ziehen, machte ihn bestürzt, jagte ihm geradezu einen Schrecken ein. Das war ja wieder ein Abgrund in seiner Seele, von dem er bis jetzt nicht das mindeste geahnt hatte! Dabei war er noch dazu in einem besonders wichtigen, geheimen Auftrag unterwegs, zu dessen Erfüllung ein klarer Kopf und schnelle Überlegungen lebenswichtig waren. Um so schlimmer! Er kam sich bei diesen Erkenntnissen bitter verächtlich vor.
»Nein«, sagte er. »Ich werde wieder an Deck gehen.«
Damit schwang er auch schon die Beine aus der Koje. Die Porta Coeli war jetzt gut frei von Land, in dem kurzen Seegang des Kanals rollte und stampfte sie wie verrückt. Der backstags einkommende Wind legte sie so weit über, daß Hornblower sofort gegen das Schott auf der anderen Seite gerutscht wäre, als er sich erhob, wenn Brown ihn nicht mit starker Hand gestützt hätte. Brown verlor nie seine Seebeine, Brown war nie seekrank, Brown besaß die körperlichen Kräfte, die Hornblower sich immer so sehnlich gewünscht hatte. Da stand er breitbeinig und fest wie ein Felsen vor ihm und ließ sich auch bei den wildesten Bocksprüngen der Brigg nichts anmerken, während er, Hornblower, unsicher hin- und hertaumelte. Er wäre mit dem Kopf gegen die Hängelampe gestoßen, hätte Brown seine Bewegung nicht mit kräftigem Druck auf die Schulter abgelenkt.
»Eine elende Nacht, Sir. Ich glaube, ehe es abflaut, bekommen wir noch allerhand auf den Hut.«
Hiob hatte man ähnliche Trostsprüche geboten. Hornblower konnte nicht umhin, Brown über die Schulter anzuknurren, und sein Ärger wurde nur noch größer, als er sah, mit welchem Gleichmut dieser seine Gereiztheit hinnahm. Sollte man keine Wut bekommen, wenn man sich behandelt sah wie ein launisches Kind?
»Am besten nehmen Sie den Schal um, Sir, den die Gnädige Frau gemacht hat«, fuhr Brown mit unerschütterlicher Ruhe fort. »Gegen Morgen wird es bitter kalt werden.«
Mit einer einzigen Bewegung zog er ein Schubfach auf und brachte den Schal zum Vorschein, ein quadratisches Seidentuch von unschätzbarem Wert, federleicht und doch warm. Es war vielleicht das wertvollste Stück, das Hornblower je besessen hatte, den Hundert-Guinee-Säbel eingerechnet. Barbara hatte es mit unendlicher Sorgfalt bestickt – daß sie das getan hatte, war der hübscheste Liebesbeweis, den sie ihm geben konnte, denn das Hantieren mit Nadel und Fingerhut war ihr sonst gründlich zuwider. Hornblower legte den Schal unter dem Kragen des Peajacketts um den Hals. Seine Wärme und Weichheit und nicht zuletzt die Erinnerung an Barbara, die er weckte, taten ihm wohl. Er nahm noch einmal festen Stand, zielte auf die Tür und gelangte in einem Schwung über die fünf Stufen des Niedergangs auf das Achterdeck.
Oben herrschte pechrabenschwarze Dunkelheit, Hornblower war sogar von der elenden Beleuchtung in seiner Kammer noch geblendet. Rings um ihn heulte der Sturm mit verbissener Wut, er mußte sich mit vorgebeugtem Kopf dagegen anstemmen. Obwohl der Wind nicht querein, sondern achterlich stand, lag die Porta Coeli hart über. Dabei schlingerte und stampfte sie gleichzeitig wie von Sinnen. Spritzer vermengten sich mit dem Regen, der über das Deck hinjagte und Hornblower wie mit Nadeln ins Gesicht stach, während er sich mühsam zur Luvverschanzung hinkämpfte. Selbst als sich seine Augen bereits an die Dunkelheit gewöhnt hatten, war er kaum imstande, das schmale Rechteck des gerefften Großmarssegels auszumachen. Das kleine Fahrzeug sprang unter seinen Füßen wie ein scheuer Gaul, die See ging hoch, selbst durch das Heulen des Sturmes konnte Hornblower das Knirschen der Ruderketten vernehmen, wenn der Rudergänger hinten am Rad mit aller Kraft zu verhindern suchte, daß das Schiff gierend in die Wellentäler fiel.