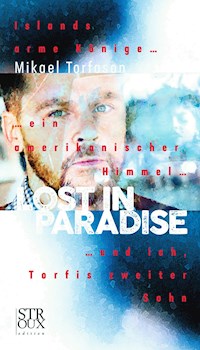„Denkt nicht, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen; ich bin nicht
gekommen, Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. Denn ich bin gekommen, um zu
entzweien: einen Menschen mit seinem Vater und eine Tochter mit ihrer Mutter
und eine junge Ehefrau mit ihrer Schwiegermutter.“
Jesus von Nazareth (Matthäus 10,34–35)(1)
Für Dr. Guðmundur Bjarnason.
Danke für alles.
1. Kapitel
Mama verschwindet
„Dann ließ Jehova Schwefel und Feuer von Jehova, von den Himmeln her, auf Sodom und Gomorra regnen. So ging er daran, diese Städte umzukehren, ja den ganzen ‚Bezirk’ und alle Bewohner der Städte und die Pflanzen des Erdbodens. Und seine Frau begann sich hinter ihm
umzuschauen, und sie wurde zu einer Salzsäule.“
1. Mose 19,24–26
Mama war verschwunden.
Ich weiß noch, dass mein Bruder Ingvi mir zuflüsterte, wir sollten uns nicht umschauen, sonst würden wir zu Salz.
„Salz?“, wiederholte ich, noch ziemlich geschwächt neben ihm auf der Rückbank von Papas Wolga.
„Ja, wie in Sodom.“
„Wo?“, flüsterte unsere Schwester Lilja. Sie kauerte auf der anderen Seite von Ingvi, der in der Mitte saß.
Lilja war noch keine drei Jahre alt und kapierte nie was. Ich war fast fünf, meinte ich jedenfalls, dabei hatte ich erst im nächsten Jahr Geburtstag. Allerdings feierten wir keine Geburtstage und redeten
auch nie darüber, aber das sollte sich in den nächsten Tagen ändern, so wie eigentlich alles in unserem Leben.
Es war der zweite Weihnachtstag, was uns gar nicht richtig bewusst war, denn wir
waren Zeugen Jehovas und durften kein Weihnachten feiern. Lilja kannte Weihnachten überhaupt nicht, doch ich war gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden, und
dort hatten alle ständig von Weihnachten geredet. Außerdem erzählte Ingvi mir andauernd Geschichten über dieses Fest des Lichts und des Friedens, denn er war acht Jahre alt und in einer richtigen
Schule, in der es Weihnachten gab, auch wenn es ihm streng verboten war,
Girlanden zu basteln oder Bilder von den isländischen Weihnachtsmännern zu malen. (2)
Ich merkte mir alles, was Ingvi erzählte, und er sagte, ich hätte ein Gehirn aus Klebstoff, weil ich so viele Geschichten aus der Bibel
auswendig konnte. Deshalb wusste ich ganz genau, welche Frau zur Salzsäule erstarrt war. Ich wusste auch, dass mein Bruder mich veräppelte, traute mich aber trotzdem nicht, mich umzuschauen, denn ich wollte nicht
zu Salz werden wie Lots Frau. Jehova hatte sie in eine Salzsäule verwandelt, als er die Engel geschickt hatte, um die Städte Sodom und Gomorra zu verbrennen. Das wusste ich alles.
„Erinnerst du dich nicht mehr an das Bild im Bibelbuch?“, versuchte ich Lilja begreiflich zu machen, ohne dass uns Papa auf dem Fahrersitz hören konnte. Er war genervt und wütend auf Mama, die einfach so abgehauen war.
„Wir fahren zu Papas Freundin“, hatte Ingvi mir gesagt, bevor wir losgefahren waren, denn er hatte gehört, wie Papa sie vom Telefon im Flur aus angerufen hatte. Er hatte auch gehört, wie Mama dasselbe zu Papa gesagt hatte, dass er doch zu seiner Freundin
gehen und bei ihr wohnen solle. „Will sie die Kinder nicht auch gleich haben?“, hatte sie gekeift. Ingvi hatte mir das alles erzählt, bevor Papa uns befohlen hatte, zum Auto zu gehen.
„Wo ist Mama?“, fragte Lilja, und Ingvi schüttelte den Kopf.
„Sie kapiert echt nichts“, flüsterte er mir im Wagen zu und warf Lilja, die sich einen Schnuller in den Mund steckte, einen strengen Blick zu. „Die Mama ist weg. Papa sucht dir eine neue Mama.“
„Wir müssen auf Jehova vertrauen“, fügte ich gewichtig hinzu. Ingvi nickte, und wir lauschten Papas Flüchen über den einsetzenden Schneefall. Ich hatte ihn letzte Woche, nachdem ich aus dem
Krankenhaus entlassen worden war, das erste Mal fluchen gehört.
Ingvi hielt mich allerdings für blöd und meinte, Papa würde schon seit Langem fluchen, ich würde nur nie was mitkriegen, weil ich immer im Krankenhaus sei. Am Morgen hatte
mir Ingvi auch erzählt, er habe gestern vor dem Einschlafen gesehen, wie Mama und Papa sich wieder
geprügelt hätten. Mama habe Papa die Kehle zugedrückt und ihn gezwungen, alles zu gestehen. Daraufhin habe Papa sie als Hure
beschimpft und geschrien, ob sie ihn etwa umbringen wolle.
„Mama? Eine Hure?“ Meine Schwester Lilja gab nicht auf. Sie konnte sehr hartnäckig sein, aber ich wusste, dass sie noch nicht alt genug war, um zu verstehen,
dass ihre Mutter verschwunden war und wahrscheinlich nie wieder zurückkommen würde.
„Was sollte er denn gestehen?“, hatte ich Ingvi am Morgen gefragt. Er behauptete immer, alle in der Familie würden mich „Herr Reporter“ nennen, weil ich ständig nach Sachen fragte, von denen die ich keine Ahnung hätte.
„Ehebruch“, antwortete Ingvi, „er sollte Ehebruch gestehen.“
Ingvi hatte mir auch erzählt, es sei der zweite Weihnachtstag, aber das sei nichts Besonderes, weil da
niemand Geschenke bekomme. Aber in ein paar Tagen sei Silvester, und dann würden alle feiern, dass ein neues Jahr beginnt, außer uns natürlich, weil wir nichts feierten und an Heiligabend Fleischklößchen aßen, um allen zu demonstrieren, dass es uns völlig egal war, was auf den Tisch kam. Denn bald, sehr bald kam das Ende der
Welt, und dann würde ich nie wieder krank sein und für immer und ewig im Paradies leben, wo es wunderschön und immer warm war. Ich würde mit allen möglichen Tieren in der Sonne herumtollen und mit Mama und Papa und allen, die an
Jehova glaubten.
Ingvi war sich jedoch nicht mehr ganz sicher, ob Mama auch da wäre, denn wenn Papa Ehebruch gestanden hatte, musste sie ja eine Hure sein und würde nicht mit uns ins Paradies kommen. Um Papa machte er sich keine Sorgen,
obwohl er Ehebruch gestanden hatte. Ingvi erzählte, als ich das letzte Mal im Krankenhaus gewesen sei, habe Mama Papa oft
angebrüllt, auf ihn eingeschlagen und ihn gedrängt, seinen Koffer zu packen und zu gehen, aber er war nicht gegangen. Daraufhin
hatte sie ihre Sachen in den Koffer gepackt, war aber auch nicht gegangen und
hatte alles wieder herausgerissen. Laut Ingvi hatte Papa ihr dann vorgeworfen, sie sei verrückt, weil sie andauernd putzen würde, außerdem habe sie sowieso nie Kinder gewollt, deswegen habe er sich eine neue Frau
suchen müssen.
„Man kann auch mehr als eine Frau haben“, flüsterte ich Ingvi zu, denn viele Männer in der Bibel hatten mehr als eine Frau, wenn Jehova Gott es ihnen befohlen
hatte. Papa meinte allerdings, das könne teuer werden, weil Frauen so kostspielig im Unterhalt seien und man dann ja
für alle seine Frauen sorgen müsse.
„Mama?“, fragte Lilja schon wieder, als hätte sie uns überhaupt nicht zugehört.
„Sie ist weg“, zischte Ingvi streng und verbot ihr, weiter nach Mama zu fragen.
„Glaubst du, dass sie einen neuen Mann hat?“, wisperte ich, und Ingvi verdrehte die Augen, obwohl er schielte, und entgegnete, das sei das Dümmste, was er je gehört habe.
„Wie soll eine Frau denn zwei Männer haben?“, fragte er und boxte mir so fest in die Rippen, dass ich am liebsten laut
losgeheult hätte.
Woher sollte ich denn wissen, wie viele Männer eine Mutter haben konnte?
2. Kapitel
Schottlands Könige
Mama verschwand vier Jahre und vier Monate, nachdem ich auf der
Entbindungsstation in Reykjavík zur Welt gekommen war. Ins Mütterverzeichnis des Landekrankenhauses hatte die Hebamme auf Papas Anweisung eingetragen: „Zeugen Jehovas – kein Blut“. Mama hatte sich zu diesem Zeitpunkt sowohl ihm als auch der Gemeinschaft
untergeordnet und versprochen, sich kurz nach meiner Geburt durch Untertauchen
als Zeugin Jehovas taufen zu lassen. Dadurch wollten die beiden ihre
hoffnungslose Ehe retten – mit einer Wassertaufe und einem zweiten Kind.
Papa war dreiundzwanzig, als ich auf die Welt kam, und Mama ein Jahr jünger. Heute beharrt sie darauf, dass ich als Neugeborenes wunderschön gewesen sei, mit rotbraunen Haaren, während Papa meint, ich habe ausgesehen wie Idi Amin. Der war damals Diktator in Uganda und ließ Hunderttausende seiner Landsleute ermorden. Idi Amin betitelte sich als König von Schottland, und Papa fand das besonders witzig, denn mein Urururgroßvater war Þorsteinn der Rote, der erste König von Schottland. Als seine Untertanen ihn hintergingen und töteten, floh seine Mutter, Auður die Tiefsinnige, zusammen mit Thorsteins Witwe Þuríður Eyvindsdóttir, meiner Urururgroßmutter, nach Island. Laut dem mittelalterlichen Geschichtswerk Isländerbuch, auf das Papa heute, viele Jahre später, gerne verweist, ist dies das einzige blaue Blut in unseren Adern.(3)
Mama weiß noch, wie Papa sagte: „Er sieht aus wie Idi Amin“, als sie mich endlich in die Arme schließen durfte. Ich war nämlich blau angelaufen und hatte Atemprobleme, nachdem ich mich durch den
Geburtskanal gekämpft hatte. Papa, der entschieden hatte, mich nach einem weiteren König, dem Erzengel Michael, zu benennen, behauptet, ich sei vor lauter Fett ganz
entstellt gewesen.
„Mann, ist der dick“, sagte er zu Mama. Ich war das größte Baby auf der ganzen Station und das größte Kind, das die Hebamme Fríða Einarsdóttir in ihrer gesamten beruflichen Laufbahn auf die Welt geholt hatte. Deshalb
hatte der Arzt, der nach Papas Aussage Sigurður Samúelsson hieß, Fríða vorgewarnt und sie angeherrscht, diese Geburt müsse reibungslos verlaufen, denn auf der Station sei so viel los, dass er keine
Zeit für Komplikationen habe.
Doch meine Geburt war von Anfang an eine einzige Komplikation. Mama schimpfte
mit Papa, der von der Arbeit nach Hause gekommen war, meinen Bruder Ingvi schnell irgendwo untergebracht hatte und dann auf kürzestem Weg mit ihr zur Entbindungsstation gerast war. Sie kam sofort an den
Tropf und beruhigte sich ein wenig, fand jedoch, Papa bringe nicht genug Verständnis für sie auf.
„Jetzt entspann dich doch mal“, sagte er. „Du bist immer so ungeduldig. Immer soll alles schon gestern passiert sein.“
„Ich bin längst überfällig“, schrie Mama wie wahnsinnig, denn die Wehen kamen und gingen in unregelmäßigen Abständen, und ihr Mann schaffte es noch nicht einmal, ihr die Sauerstoffmaske
richtig auf die Nase zu drücken. „Das ist das Einzige, was du tun sollst“, keifte sie, doch Papa war vollauf damit beschäftigt, den Arzt und die Hebamme zu beobachten.
Der Arzt hielt offensichtlich nicht viel von Fríða. Papa sagt, er sei damals gerade aus Schweden zurückgekehrt und habe ihm anvertraut, dass es dort nicht so massiven Personalmangel
gebe. In Island müsse man auf Gott und sein Glück vertrauen, denn alles sei furchtbar schlecht organisiert. Mama behauptet
hingegen steif und fest, besagter Sigurður habe Magnússon geheißen und Gynäkologie in London studiert.
„Seien Sie vorsichtig!“, herrschte Sigurður Fríða an und ließ sich dann wieder über meine Größe aus: „Das ist ein riesiges Baby. Aha, der Ellbogen kommt zuerst. So, jetzt. Schneiden
Sie! Wir müssen schneiden. Möglichst sauber. Ich hab keine Zeit, den ganzen Abend hier zu sitzen und zu nähen. Der Schnitt muss sauber sein!“
„Ja, ja“, entgegnete Fríða, während Papa alles ganz genau verfolgte. „Ich mach das schon.“
Mama schrie wie am Spieß und erzählte mir später oft, dass sie erst im Nachhinein begriffen habe, dass man schräg in den Damm schneiden soll, damit die Haut nicht wie eine geplatzte Naht bis
zum Anus aufreißt.
„Ich hab doch gesagt, seien Sie vorsichtig!“, fauchte Sigurður Samúelsson oder Magnússon und holte mich heraus, indem er an dem blauschwarzen Ellbogen zog, der als
Erstes in diese Welt lugte.
„Wo ist das Baby? Wo ist mein Baby?”, heulte Mama und stieß die Sauerstoffmaske weg, die Papa ihr aufs Gesicht zu drücken versuchte. „Ich will mein Baby!“, schrie sie weiter in einem dieser Anfälle von Hysterie, die Papa wahnsinnig nervten.
„Entspannen Sie sich“, sagte der Arzt und hob mich auf einen nahestehenden Tisch. Als er es dort nicht schaffte, mich zu reanimieren, eilte er
mit mir aus dem Raum und ließ meine Eltern mit Fríða alleine zurück. Die Hebamme wies den frischgebackenen Vater an, seine Frau im Bett zu
halten, doch Papa musste Mama nicht festhalten, denn sie war kurz davor, in
Ohnmacht zu fallen. Deshalb stand er einfach nur tatenlos da, während Fríða zum Telefon stürzte, um Hilfe zu rufen. Er warf Mama einen kurzen Blick zu und erinnerte die
Hebamme daran, dass wir Zeugen Jehovas seien und keine Blutspenden annähmen.
„Was für Blutspenden?“, soll Fríða gesagt haben, bevor sie am Telefon um Unterstützung bat.
Mama war total erschöpft, und obwohl sie nicht genau wusste, was los war, erinnert sie sich an das
Gefühl, nur noch weinen zu wollen. Sie hätte am liebsten losgeheult, aber es kamen keine Tränen, und sie konnte sich nicht bewegen. Sie weiß auch noch, dass sie an die Kleidungsstücke dachte, die sie für mich gestrickt und nicht mit zur Entbindungsstation genommen hatte. Der
Pullover war weiß und passte perfekt zu dem kleinen Engel, der Mikael und nach seinem Vater Torfason heißen sollte. Laut Bibel und Wachtturm würde er niemals alt oder krank werden oder sterben, sondern ewig im Paradies
leben. Vielleicht hätte sie sich ja doch schon vor der Geburt taufen lassen sollen, dachte Mama.
Doch solange sie ausgesehen hatte wie ein Wal, hatte sie es nicht fertig
gebracht, einen Badeanzug anzuziehen und sich im Schwimmbad untertauchen zu
lassen.
Sie verdrängte den Gedanken an die bevorstehende Taufe bei den Zeugen Jehovas, während sie dalag und versuchte, sich von der Geburt zu erholen. Dennoch schoss ihr durch den
Kopf, dass sie womöglich verbluten könnte, aber im nächsten Moment schämte sie sich für ihre ständigen Sorgen. Doch ihre Angst war real, denn sie wusste, dass der Wachtturm und die Bibel und Papa und die Frauen, mit denen sie den Wachtturm studierte, behaupteten, sie dürfe unter keinen Umständen Blut annehmen, sonst komme sie nicht ins Paradies.
„Na gut“, dachte sie gleichgültig.
Und es war ihr wirklich egal. Alles war ihr egal, nur das Baby nicht, dass sie
gerade zur Welt gebracht hatte. Wenn Torfi der Meinung war, eine Bluttransfusion würde alles nur noch schlimmer machen, dann wäre es wohl besser, kein Blut anzunehmen und am 8. August 1974 für den Herrn zu sterben, anstatt Gefahr zu laufen, nicht ins Paradies zu kommen.
Plötzlich drang lautes Weinen aus dem Nachbarraum, und Mama dachte an die
orangefarbene Hose, die sie mir nach der neuesten Mode genäht hatte. Dann schlummerte sie ein und glitt unbeschwert in einen traumlosen Schlaf. Sie hatte ihre Pflicht erfüllt und hörte nicht, wie Papa sich mit Fríða stritt. Er beharrte darauf, dass der Name Mikael unverzüglich auf das Schild an meinem Babybett geschrieben würde, was in Island unüblich ist, da die Eltern den Namen des Kindes normalerweise erst bei der Taufe
bekanntgeben.
„Wollen Sie ihn jetzt schon taufen lassen?“, fragte Fríða arglos, nachdem sie mich vom Arzt in Empfang genommen hatte.
„Nein, die Taufe ist kein christliches Vermächtnis“, leierte Papa sein Wissen aus dem Wachtturm herunter. „Jesus Christus war dreißig, als er sich taufen ließ, nur um das klarzustellen, aber dieses Kind ist noch nicht mal eine halbe Stunde alt. Wir
wollen ihm nur einen Namen geben, so wie Jesus ein Name gegeben wurde und Ihnen ein Name gegeben
wurde und mir ein Name gegeben wurde, das hat nichts mit einer Taufe zu tun.“
„Aha, okay“, sagte Fríða und hielt stolz das größte Baby im Arm, das sie je auf die Welt geholt hatte.
Papa behauptet, ich sei 5.200 Gramm schwer und 53 Zentimeter groß gewesen, dabei war ich in Wirklichkeit 4.900 Gramm schwer und 55 Zentimeter groß. Diese knapp fünf Kilo bekamen den Namen Mikael, nach dem Erzengel, den Jehova Gott erschuf und auf die Erde sandte, um
als Kind geboren zu werden. Seine Mutter nannte ihn Jesus, und die Menschen
proklamierten ihn als Christus. (Mehr über diese Geschichtsauffassung der Zeugen Jehovas später.)
Papa redete weiter auf Fríða ein und befahl ihr dann regelrecht, auf das leere Schild Mikael zu schreiben:
„Mikael Torfason. So heißt er, und es ist mein gutes Recht, ihm diesen Namen zu geben, ohne Priester oder
irgendein Ritual, über das in keinem wichtigen Buch etwas geschrieben steht.“
Fríða lächelte besänftigend, und dann kam der Arzt zurück, und Papa sagt, er habe zugesehen, wie er Mama wieder zusammennähte. Das fand er richtig spannend. Er kann diese Geschichte sehr gut erzählen und mit blumigen Adjektiven ausschmücken, aber die möchte ich lieber nicht wiedergeben. Nicht jetzt.
3. Kapitel
Sieben Jahre Unglück
Mama verblutete nicht auf der Entbindungsstation. Als sie wieder zu sich kam und
mich endlich im Arm halten durfte, fragte sie sich: „Ist das wirklich mein Kind?“
Dasselbe hatte sie sich schon vier Jahre zuvor gefragt, nachdem sie meinen
Bruder Ingvi auf derselben Entbindungsstation auf die Welt gebracht hatte. Es kam ihr
vor wie eine Ewigkeit. Als Ingvi Reynir geboren wurde, hatte sie Angst vor allem gehabt, doch nun war sie fest
entschlossen, daran zu glauben, dass mit Jehovas Hilfe alles gut gehen würde.
Vier Jahre vorher hatten die Hebammen sie in ihrem Bericht als „18-jährige Verkäuferin“ bezeichnet. Jetzt war sie eine 22-jährige Hausfrau und fühlte sich viel älter und reifer. Als Ingvi auf die Welt kam, machte Papa sich gerne darüber lustig, wie jung und ahnungslos sie sei, dabei war sie nur ein Jahr jünger als er. Papa sagt, Mama sei so naiv gewesen, dass sie sogar behauptet hätte, mein Bruder sei unisexuell.
„Wovon sprichst du?“, entgegnete Papa. „Unisexuell? Ingvi ist nicht unisexuell.“
„Ingvi Reynir“, korrigierte Mama, denn sie wollte nicht, dass mein Bruder nur Ingvi genannt wurde. „Er heißt Ingvi Reynir, und natürlich ist er unisexuell, wenn wir nicht verheiratet sind.“
„Hahaha!“, lachte Papa und erklärte ihr, dass ein außerhalb der Ehe geborenes Kind nicht unisexuell, sondern unehelich sei. „Oder willst du etwa behaupten, das war eine Jungfernzeugung?“ Er erzählte diese Geschichte noch jahrelang und lachte sich jedes Mal kaputt. Noch
heute hält er das für ein gutes Beispiel für Mamas Naivität.
Ich kam weder unisexuell noch unehelich auf die Welt, denn meine Eltern hatten geheiratet, als Ingvi Reynir getauft worden war. Vier Jahre später waren wir also eine vierköpfige Familie, und Papa war mit meinem großen Bruder auf dem Weg zu Mama und mir ins Krankenhaus.
„Alles wird gut“, flüsterte Mama mir in ihrem Krankenbett zu, während sie mich stillte. Sie streichelte meinen Specknacken und dachte an die
Hebammen und Krankenschwestern, die nicht müde wurden, ihr zu sagen, wie groß ich sei und wie stolz sie auf mich sein könne. Sie bemerkte den rotgoldenen Glanz meiner Haare, die einzeln von meinem großen Kopf abstanden, drückte ihr Gesicht in den Flaum und spürte eine Woge von Mutterinstinkt, der die Kontrolle übernehmen und dieses Kind vor allen Katastrophen der Welt beschützen wollte.
Während sie in meine Haare eintauchte, stolperte mein Bruder Ingvi auf der Treppe zur Entbindungsstation und zerbrach den Spiegel, den er Mama
mitgebracht hatte. Er rannte laut heulend ins Zimmer, erzählte ihr die ganze Geschichte und schenkte mir ein Spielzeugauto. Dieser große Bruder, den ich in den darauffolgenden Jahrzehnten bewundern und vergöttern sollte, sagt heute, er sei vom ersten Moment an sauer auf mich gewesen. Er
hatte das Gefühl, ich wäre zu nichts zu gebrauchen. Der Altersunterschied war einfach zu groß, und er hatte erwartet, dass ich viel größer und bemerkenswerter wäre.
In Ingvis Augen war ich weder besonders groß noch hübsch. Für ihn war ich nur ein kleines blassrosa Säckchen, das auf dem Schoß seiner Mutter lag und sich für nichts interessierte. Ich wollte nicht mit dem Auto spielen, das er mir
geschenkt hatte, und scherte mich nicht darum, dass er wegen des zerbrochenen
Spiegels heulte. Damals wussten wir beide nicht, dass ein zerbrochener Spiegel
sieben Jahre Unglück bringt. Unsere Eltern wussten es natürlich, aber es war ihnen egal. Sie hatten den isländischen Aberglauben abgelegt und eine amerikanische Religion angenommen.
Diese Religion bestimmte in jenen Jahren alles in unserem Leben, und nachdem Ingvi und Papa sich von uns verabschiedet hatten, gingen sie sofort zu einer
Zusammenkunft der Zeugen Jehovas. Mama und ich blieben zurück, lagen uns in den Armen und genossen es, die beiden und den Wachtturm an
meinen ersten Lebenstagen los zu sein. Manchmal war Mama sichtlich erschöpft von Papa und seinem ständigen Gerede über die Bibel und den Weltuntergang, obwohl sie eingewilligt hatte, sich taufen
zu lassen. Oft kamen ihr Zweifel, und manchmal glaubte sie gar nichts mehr.
Papa wusste nie, woran er bei ihr war, warum sie so stur war. Im Grunde stellte
er sie meist als eine Art Schwachkopf hin. Diese Einstellung passte gut zur
Ideologie der Zeugen Jehovas, die Frauen nicht respektieren, es sei denn als
Kindermädchen oder Köchin. Mama hatte jedoch auch keine sonderlich hohe Meinung von Papa und fand ihn
charakterschwach und leicht manipulierbar. Als sie ihn kennenlernte, propagierte er eine neue Gesellschaftsordnung nach den Theorien von
Marx und Engels, und nur zwei Jahre später kam er von der Arbeit nach Hause und erklärte ihr, der Weltuntergang stehe bevor. Sie könnten das ewige Leben im Paradies erlangen.
Papa war wie besessen von dieser neuen Wahrheit, und so wie er vorher alles in
sich aufgesogen hatten, was im Funke stand, dem offiziellen Organ der Allianz
der Radikalen Sozialisten, glaubte er nun alles, was im Wachtturm stand. Als
ich auf die Welt kam, studierte Papa gerade den 95-sten Jahrgang der
Zeitschrift, die in seinen Augen auch von Gott dem Allmächtigen persönlich hätte geschrieben sein können. Darin fand er Antworten auf alle seine Fragen. In der neuesten Ausgabe vom
August 1974 wurde eine Leserfrage veröffentlicht, die ihn von da an schwer beschäftigte. Es ging um Sexualität, und Papa hatte ohnehin ständig Sex im Kopf. (Er brachte es sogar fertig, gut zehn Jahre später äußerst inspirierende und informative Artikel über Sexualität in der Zeitschrift Haar und Schönheit zu schreiben, die sich, wie der Name schon sagt, in erster Linie mit
Frisuren beschäftigte.) Die Leserfrage drehte sich um die Auslegung der Worte des Apostels Paulus, dass es „für einen Menschen gut ist, keine Frau zu berühren“. (4) Die Antwort der Redaktion des Wachtturms war eindeutig: Männer sollten am besten zölibatär leben. Es folgte ein Zitat von Jesus Christus, das ungefähr so lautet, dass jeder, der eine Frau leidenschaftlich ansieht, in seinem
Herzen schon mit ihr Ehebruch begangen habe. (5)
Vielleicht schaffte Papa es nie, Jehova gänzlich gefällig zu sein, da nun mal alle Menschen Sünder sind, auch Papa, besonders auf diesem Gebiet. Manchmal fühlte er sich schlecht wegen all seiner begehrlichen Gedanken, als wäre sein Gehirn ein Muskel, den er nicht kontrollieren konnte. Dann sprach er mit
Jehova und bat ihn darum, ihn zu einem guten Ehemann und Vater zu machen und
ihn vor den Verlockungen Satans zu schützen. In einem Aufwasch bat er auch gleich noch darum, Mama besser und
entgegenkommender und lustvoller zu machen, weil sie ständig über ihn schimpfte und klagte und ihn fast nie lieben wollte, wie es eine gute
und gehorsame Ehefrau gemäß der Heiligen Schrift tun sollte.
Über all dies dachte Torfi nach, als er sich am Abend nach meiner Geburt in dem kleinen, ungesunden
Kabuff im Laugavegur zur Ruhe bettete. Mein Bruder Ingvi schlief in seinem eigenen Zimmer, während Papa Jehova darum bat, ihm Kraft zu geben, die nächsten fünfzehn Monate durchzustehen. Dann würde der langersehnte Weltuntergang, das Harmagedon, uns alle mitreißen, und unsere Ängste und ständigen Sorgen würden in Windeseile verschwinden.
4. Kapitel
Harmagedon im Laugavegur 19b
Der Junge isst kaum etwas und hat keinen Stuhlgang. Auf der Entbindungsstation
hatte er einmal Stuhlgang, das sogenannte Kindspech, ein lakritzartiger Brei, der bei allen Babys in der ersten Windel landet.
Danach: nichts.
Der Junge weint nicht, sondern brüllt seine Mutter an, als wäre er besessen und mit einem qualvollen Fluch belegt. Zwischen den Brüllattacken starrt er vor sich hin, wie von aller Hoffnung verlassen. Wenn er
endlich einnickt, schläft er nicht tief und fest, sondert schneidet Grimassen. Dieses finstere
Mienenspiel wirkt sonderbar bei einem Neugeborenen, und die älteren Leute reden von einem schwierigen Charakter.
„Er hat eine starke Persönlichkeit, der Kleine“, sagen sie.
Die 22-jährige, frischgebackene zweifache Mutter hört ihnen nicht zu. Sie weiß, dass sie früher oder später einem Arzt gegenübersitzen wird, der sie fragt, ob der Junge etwas isst. Ob er auch wirklich
zunimmt. Mama kann den Arzt nicht anlügen. Er wird den kleinen Jungen messen und wiegen, und die ganze Welt wird
erfahren, dass dieses große dicke Baby, das seinen Vater an Idi Amin, den letzten König von Schottland, erinnert hat, jetzt viel weniger wiegt als bei seiner
Geburt.
So vergehen meine ersten Tage in dem kleinen Haus im Laugavegur 19b. Mama versucht, mir die Brust zu geben, die ich immer sofort
wieder ausspucke, ohne dass sie versteht, warum. Ich bin nicht so robust wie Ingvi Reynir, als er von der Entbindungsstation nach Hause kam. Damals, als sie für ihre kleine Familie die obere Etage in diesem Hinterhaus mieteten, kamen sie
und Papa sich noch so jung und unschuldig vor. Die Wohnung hat zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine Küche. Mein Bruder Ingvi schläft jetzt in dem einen Zimmer und meine Eltern und ich in dem anderen. Das
Wohnzimmer und die Küche füllen sich regelmäßig mit Zeugen Jehovas, die darauf warten, dass die Welt untergeht. Deshalb haben
wir solches Glück mit der Mietwohnung, denn es lohnt sich nicht, eine Wohnung zu kaufen, wenn
das Harmagedon so nah ist. Das Wichtigste für unsere kleine Familie ist, so viele Menschen wie möglich vor dem sicheren Tod zu retten. Und Papa gibt sein Bestes. Dabei kann er
nicht die ganze Zeit die gute Botschaft verkünden, sondern muss auch im Friseursalon im Klapparstígur arbeiten. Papa hat zwei Monate vor meiner Geburt die Gesellenprüfung abgelegt und bekommt jetzt etwas mehr Gehalt. Der Friseursalon gehört seinem Schwager Sigurpáll und dessen Kompagnon. Sie werden sterben, genau wie Papas Schwester Inga.
Ihre Seelen werden nicht mehr existieren, wenn die Welt untergeht,
wahrscheinlich schon im nächsten Jahr. Sie haben Papa sehr geholfen, aber so ist es nun mal. Ziemlich
viele Menschen werden sterben.
In diesem Friseursalon im Klapparstígur packten Örn Svavarsson und Ástríður Guðmundsdóttir Papa zum ersten Mal beim Wickel, als sie im Laden vorbeischauten, um die
gute Botschaft zu verkünden. Papa war Kommunist, als die beiden den Friseursalon betraten und mit ihm über Glaubensfragen und die Weltpolitik diskutieren wollten. Sie beknieten ihn,
zu einer Zusammenkunft ins Obergeschoss in Brautarholt zu kommen, und er war leichte Beute. Die Zeugen Jehovas waren seiner
Ansicht nach genauso wütend und redlich wie die radikale Linke in Island, hatten aber eine klarere
Vision. Und ihr internationaler Anstrich reizte Papa auch mehr als der
verdammte Akademikerdünkel vieler Kommunisten.
Als ich auf die Welt kam, hatte Papa zusammen mit seinen Glaubensbrüdern und -schwestern bereits ein Versammlungshaus im Sogavegur errichtet. Unsere Wohnung fungierte als eine Art Treffpunkt für die Arbeiter des Herrn. Diese Arbeiter waren beiderlei Geschlechts, doch die
Frauen sollten still sein, wenn die Männer redeten. Alle verzehrten Mamas Schokoladenkuchen und tunkten ihn in den
Kaffee, den sie extra für sie aufgebrüht hatte. Anschließend wurde sie in den höchsten Tönen gelobt, und Papa natürlich auch, weil er eine so gute Frau hatte, die endlich einwilligte, den
Wachtturm zu studieren, als sie mit mir schwanger war. Zwei Glaubensschwestern
besuchten die Hochschwangere regelmäßig, lasen mit ihr, stellten ihr Fragen und vermittelten ihr die ganze Wahrheit über das Königreich Gottes im Himmel und Satan und das Paradies auf Erden.
Am Anfang interessierte sich Mama nicht sonderlich für die Berechnungen der Zeugen Jehovas über das genaue Ende der Welt, ebenso wenig wie für ihre Kritik an anderen Religionen. Stattdessen überzeugten die Frauen sie mit dem Versprechen, sie müsse nie mehr ängstlich oder besorgt sein, – Gefühle, von denen ihr bisheriges Leben bestimmt gewesen war. Jede Angst ist im
Grunde genommen Angst vor dem Tod, und die Glaubensschwestern, die im Laugavegur in Mamas Wohnzimmer saßen, erklärten ihr, der Tod, so wie sie ihn verstehe, existiere gar nicht.
„Wenn du stirbst, fühlt es sich an, als würdest du einschlafen, und am jüngsten Tag wachst du von diesem Schlaf auf und lebst bis in alle Ewigkeit glücklich im Paradies.“
Falls dieses Versprechen nicht den Ausschlag für Mamas Taufe im Herbst nach meiner Geburt gab, dann war es das vom baldigen
Weltende im darauffolgenden Jahr. Die Glaubensschwestern erzählten ihr, in den USA, wo die Gemeinschaft vom allmächtigen Jehova persönlich geführt werde, würde man bei Zusammenkünften und Landeskongressen rufen:
„Stay alive to seventy five!“
Da Mama kein Wort Englisch verstand, übersetzten ihr die Frauen in unserem Wohnzimmer den Satz und erklärten ihr, dass schon im nächsten Jahr, 1975, das Paradies kommen werde. Nach den jüngsten Berechnungen der Leitenden Körperschaft in Brooklyn vermutlich am vierten oder siebten Oktober. Vor dem
Paradies finde natürlich der Weltuntergang statt, den die Freundinnen Harmagedon nannten. Die Welt,
wie Mama sie kenne, stehe vor dem spirituellen Bankrott, erläuterten sie, und gehe zugrunde. Sie müsse lediglich das Radio einschalten, um zu erfahren, dass die Welt dem Untergang geweiht sei, und nur
wer sich zu Jehova bekenne, werde überleben und für tausend Millionen Jahre ewiges Leben im Paradies erlangen.
Mama strich über ihren Babybauch, in dem ich trat und mich drehte. Sie dachte an mich und meinen Bruder
und Papa, der sich bereits auf dem Weg ins Paradies befand, und merkte, dass
sie keine andere Wahl hatte. Sie fühlte sich schlecht und klein. Voller Angst vor dem Leben, das sie manchmal zu
ersticken drohte.
Ihr fiel auf, dass ihr Mann viel umgänglicher war, seit er sich Jehova verschrieben hatte; er hatte sogar aufgehört zu trinken. Sie dachte daran, wie aufopferungsvoll er sich um Ingvi Reynir kümmerte. Er behandelte sie gut, und sie stritten sich viel weniger als in den
ersten Jahren. Sie wusste immer, wo er sich aufhielt, selbst wenn er nicht zu
Hause war: Er verkündete die gute Botschaft, las den Wachtturm, war bei einer Zusammenkunft oder
half anderen in dieser netten, kleinen Gemeinde, die sich zu Jehova bekannte.
Papa sagte ihr auch viel öfter, wie schön und gut und klug sie sei und dass er sie liebe. Dabei wusste sie genau, dass
sie nicht mehr schön war, sondern fett, mit Wassereinlagerungen und Herpesbläschen am Mund. Alles, was anschwellen konnte, schwoll an, und die Ärzte sagten ihr, sie sei viel zu schwer. Mama sah nie gut aus, wenn sie
schwanger war, und diese zierliche Frau, die normalerweise um die fünfzig Kilo wog, hatte während der Schwangerschaft ein Höchstgewicht von fünfundneunzig Kilo. Eigentlich spielte es keine Rolle, für wie schön Torfi sie hielt. Sie spürte, wie sie auseinanderging, und fand, dass das Leben keinen Sinn mehr hatte, auch wenn sie
heute sagt, dass sie gerne mit mir schwanger war und es kaum erwarten konnte,
dass ich auf die Welt kam.
Auf Fotos wirkt sie als Schwangere so, als hätte das Kind in ihrem Bauch ihren gesamten Körper in Besitz genommen und sie gezwungen, ihm alles zu überlassen. Immer wenn sie schwanger war, konnte sie nichts mehr geben, weder
sich selbst noch Papa oder sonst jemanden. Sämtliche Kraft und Energie ging für das Baby und dessen Wachstum drauf. Und dort auf dem Sofa mit den
Glaubensschwestern (die Torfi garantiert auf sie angesetzt hatte, auch wenn er das nicht zugeben will) gab sie
endgültig klein bei und akzeptierte die Wahrheit. Sie konnte nicht mehr. Die Vorbehalte der Glaubensschwestern bezüglich des Weltendes am vierten oder siebten Oktober 1975 waren ihr völlig egal. Sie erzählten ihr, der Zeitpunkt, an dem alle außer den Zeugen Jehovas von der Erde ausgelöscht würden, könne sich auch um ein oder zwei Jahre verzögern. Es sei zwar unwahrscheinlich, dass die Prophezeiung nicht eintreffen würde, aber „Vorsicht sei besser als Nachsicht“. Die Schwestern gelobten den Weltuntergang für allerspätestens 1977.
5. Kapitel
Twiggy
„Selbstverständlich gibt es Personen, die Bekleidungsregeln aufstellen können. Wer sind sie? Ehemänner und Väter. Das Verhalten aller Familien- oder Haushaltsmitglieder des Mannes fällt auf ihn zurück. Er ist das von Gott bestimmte Oberhaupt der Familie und kann gewisse
Kleidung mit Fug und Recht als anstößig verbieten.“
Der Wachtturm, 1. Oktober 1972
Vielleicht hatte Mama nie die Chance auf ein besseres Leben. Sie war schon immer
sensibel, sagt sie selbst, genau wie ihr Vater; beiden fiel es stets schwer, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Bereits in frühester Kindheit hatte Mama Schwierigkeiten, einen eigenen Namen zu bekommen, und wurde
erst im Alter von drei Jahren getauft. Ihre Eltern konnten sich nicht einigen,
wie sie heißen sollte. Oma Hulda wollte, dass ihre Tochter nach ihr benannt würde, doch die Großmutter meines Opas, die alte Hólmfríður, verlangte, dass das Mädchen ihren Namen bekommen sollte. Opa wagte es nicht, sich seiner Großmutter zu widersetzen, denn immerhin hatte sie ihn großgezogen, nachdem seine Mutter an Krebs gestorben war. Hólmfríður war mit ihm und Oma aus einer Wellblechhütte in eine Wohnung nach Selfoss und von dort in den Bústaðavegur 97 gezogen, im selben Jahr, als Mama auf die Welt kam.
Es existieren noch Fotos von dieser Hólmfríður, meiner Ururoma, aber kein Foto ihrer Tochter, der Mutter meines Großvaters und somit meine Uroma, die an Krebs starb. Sie kratzte ihr eigenes
Gesicht aus allen Fotos, die es von ihr gab, weil sie so unglücklich war. Sie wollte nicht leben und nahm den Tod freudig in Empfang. Diese
Frau hieß Herborg Björnsdóttir, aber heute findet man nicht mehr viele Informationen über sie. Sie lebte lange mit einem Mann namens Fritz Berndsen zusammen, meinem Uropa. Er bekam mit ihr zwei Söhne, meinen Großvater und dessen Bruder, die beide Malermeister wurden. Fritz betrieb in der
Innenstadt einen Kiosk, der sich in einem richtigen kleinen Turm befand und
heute auf dem Lækjartorg steht. Als kleines Mädchen nahm Mama einmal allen Mut zusammen und ging zu ihm. Er öffnete die Luke des Kiosks und wunderte sich, als sie ihm sagte, sie heiße Hulda Fríða Berndsen und er sei ihr Großvater.
„Mein Papa heißt Ingvi Reynir Berndsen“, erklärte sie ihm, und ihr Großvater Fritz schenkte ihr Süßigkeiten. Darüber hinaus wollte er nichts mit ihr und ihren Geschwistern zu tun haben, bis
sein Sohn, Mamas Vater, starb. Da tauchte er im Bústaðavegur auf, schenkte Oma ein rotes Negligé und machte ihr den Hof.
Mama war neun Jahre lang die Jüngste von vier Geschwistern. Dann bekam sie eine kleine Schwester und schließlich noch einen kleinen Bruder, drei Jahre, bevor ihr Vater sich zu Tode soff.
Mama wurde von ihren Eltern und Lehrern schnell als dumm abgestempelt und
zusammen mit anderen Kindern, die als minderbemittelt galten, weil sie wie Mama
aus armen Familien stammten, in eine Förderklasse gesteckt.
Als Mama älter wurde, protestierte sie gegen den Idiotenstempel des Schulsystems, indem sie sich schick kleidete. Sie kreierte
ihren eigenen Stil mit Klamotten, die sie selbst nähte und sehr mutig kombinierte. Für ihr erstes Rendezvous mit Papa im Sommer 1969, als sie siebzehn war, nähte sie sich Dreiviertelhosen aus Tweedstoff mit Fischgrätmuster, den sie bei Jacobsen gekauft hatte. Dazu trug sie karierte Strümpfe und einen Pullover in dezenten Erdfarben. Vom Hals bis zum Bauchnabel zog
sich ein breiter, schwarzer Streifen, der ihre – wie sie meinte – fehlenden Brüste kaschieren sollte. Damals stopfte sie ihre BHs mit Watte aus, weil sie sich für ihren kleinen Busen schämte.