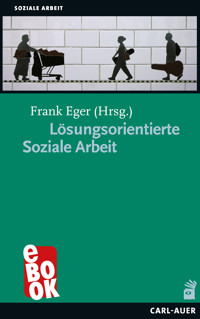
Lösungsorientierte Soziale Arbeit E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Soziale Arbeit
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch rüttelt an den Grundfesten der Sozialen Arbeit. Es propagiert den Paradigmenwechsel von der intensiven Problemanalyse hin zur konsequenten Lösungsorientierung mit der Ausrichtung auf Ziele, Ressourcen und Kompetenzen. Die Autoren beschreiben zunächst die Grundlagen und die gesellschaftliche Bedeutung des lösungsorientierten Ansatzes, bevor sie sich einzelnen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe zuwenden, darunter Hilfen zur Erziehung, stationäre Jugendhilfe, Zwangskontexte und Schulsozialarbeit. In den Beiträgen werden das Potenzial und die enorme Brauchbarkeit der Lösungsorientierung deutlich: für die professionellen Fachkräfte, die Klienten, die im Feld der Sozialen Arbeit tätigen Organisationen und für den wissenschaftlichen Diskurs. Mit Beiträgen von: Kaspar Baeschlin & Marianne Baeschlin • Stefan Bestmann • Frank Eger • Katharina Gerber • Karl-Heinz Gröpler • Wilfried Hosemann • Tobias Kosellek • Benjamin Landes • Frauke Mangels • Hans-Georg Weigel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Eger (Hrsg.)
Lösungsorientierte Soziale Arbeit
2015
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Friedrichshafen)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Alfter bei Bonn)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Potsdam)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Umschlaggestaltung: Uwe Göbel, Daniela Gaus
Umschlagfoto: © Uwe Göbel
Satz: Drißner-Design u. DTP, Meßstetten
Printed in Germany
Druck und Bindung: Freiburger Graphische Betriebe, www.fgb.de
Erste Auflage, 2015
ISBN 978-3-8497-0019-5
ISBN 978-3-8497-8449-2 (ePub)
© 2015 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: www.carl-auer.de.
Wenn Sie Interesse an unseren monatlichen Nachrichten aus der Vangerowstraße haben, können Sie unter http://www.carl-auer.de/newsletter den Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14
69115 Heidelberg
Tel. 0 62 21-64 38 0
Fax 0 62 21-64 38 22
Inhalt
Vorwort von Heiko Kleve
Zur Einführung
Teil 1: Theoretische Verortung
1Zukunft, die wir uns wünschen – Lösungsorientierte Soziale Arbeit
Frank Eger
1.1Lösungsorientierung und Soziale Arbeit
1.2Lösungsorientierung zwischen systemischen und utilitaristisch-pragmatistischen Merkmalen
1.3Lösungsorientierte Handlungstheorie
1.4Soziale Arbeit als Disziplin und Profession
1.5Fazit
Teil 2: Bestimmungen und Standpunkte
2Soziale Gerechtigkeit zuerst! – Lösungsorientierte Soziale Arbeit als gesellschaftliches Handeln
Wilfried Hosemann
2.1Zur aktuellen Karriere des Lösungsbegriffs in der Sozialen Arbeit
2.2Zu den gesellschaftlichen Hintergründen der Lösungsdebatte
2.3Lösungen als Erwartungen und Zuschreibungen sozialer Systeme
2.4Zu den Anwendungsbedingungen des lösungsorientierten Ansatzes in der Sozialen Arbeit
2.5Der Beitrag zum gesellschaftlichen Handeln
3Familie im Bild – Beziehungsbilder als Medium lösungsorientierter systemischer Beratung
Tobias Kosellek
3.1Zur Einleitung: Lösungsorientierung, Beratung und die Kunst
3.2Kunst kommt von Beobachten
3.3Die Kommunikation der Familie
3.4Über Bilder sprechen (lassen)
3.5Abschließendes: Verformung und Neuanstrich
4Die Haltung des Nichtwissens und der sozialraumorientierte Ansatz
Stefan Bestmann
4.1Lösungsorientierung – von einem Beratungsansatz zu einem Paradigma in der Sozialen Arbeit
4.2Sozialraumbezogene Soziale Arbeit
4.3Sozialraum
4.4Lösungsorientiert-einzelfallunspezifische Arbeit im Sozialraum
4.5Fazit
5Den Auftrag aushandeln – Lösungsorientierung im Zwangskontext
Katharina Gerber
5.1Voraussetzungen für eine lösungsorientierte Beratung
5.2Auf dem Weg zum Arbeitsbündnis
5.3Möglichkeiten der Begleitung in der Arbeit mit Herrn M.
5.4Wenn der Zwang der Beratung hilft
5.5Über die Beratung hinaus
Teil 3: Handlungsfeldbezug Kinder- und Jugendhilfe
6Einfach, aber nicht leicht – Lösungsorientierte Hilfeplanung bei den Hilfen zur Erziehung
Benjamin Landes und Hans-Georg Weigel
6.1Einleitung
6.2Relevanz und rechtliche Voraussetzungen des Hilfeplanverfahrens
6.3Relative Freiwilligkeit
6.4Lösungsorientiertes Hilfeplanverfahren
6.5Fazit
7Unerreichbare erreichen – Lösungsorientierte Individualpädagogik mit traumatisierten Jugendlichen
Frauke Mangels
7.1Haltungen und Schlüsselfragen
7.2Wie erreichen wir die »Unerreichbaren«?
7.3Zur Zielgruppe: Verhaltensoriginelle Jugendliche oder »Systemsprenger«?
7.4Individualpädagogik als ressourcen- und lösungsorientiertes Angebot der Kinder- und Jugendhilfe
7.5Individualpädagogik in Verbindung mit Traumapädagogik
7.6Fallspezifische Folgerungen für die sozialarbeiterische Praxis
7.7Anknüpfungspunkte für Lösungsorientierung in der Individualpädagogik
7.8Weitere lösungsorientierte Impulse für die Individualpädagogik
7.9Fazit
8Neues Verhalten lernen – Lösungsorientiertes Denken und Handeln in der stationären Jugendhilfe
Marianne und Kaspar Baeschlin
8.1Einleitung
8.2Was wird grundsätzlich anders?
8.3Exemplarischer Ablauf des stationären Aufenthalts
8.4Schlusswort
9Vom Profil zur Unabhängigkeit – Rahmung für systemisch-lösungsorientierte Schulsozialarbeit
Karl-Heinz Gröpler
9.1Das System Schule und seine Bezüge zur Sozialen Arbeit
9.2Schulsozialarbeit
9.3Zur aktuellen Situation der Sozialen Arbeit im Praxisfeld Schule
9.4Systemisch-lösungsorientierte Beratung und Schulsozialarbeit
9.5Beispiele für Wirkungsbereiche
9.6Fazit
Literatur
Über die Autoren
Über den Herausgeber
Vorwort
Die Lösungsorientierung kann ohne Übertreibungen als ein neues Paradigma im Diskurs um Interventionstheorien und -methoden hinsichtlich aller Kontexte gelten, in denen es um die Initiierung und Gestaltung von Veränderungsprozessen geht. Steve de Shazer und Insoo Kim Berg haben in der Tat eine Wende initiiert, haben unser gesamtes Denken über die Logik von Problemlösungs- und Zielerreichungsprozessen radikal neu ausgerichtet und Methoden kreiert, mit denen wir Abschied nehmen von klassischen Annahmen zur Logik erfolgreicher Interventionen. Daher ist es an der Zeit, dass sich nicht nur zahlreiche Praktiker in der Sozialen Arbeit die lösungsorientierte Beratungsmethodik aneignen und erfolgreich in ihrer täglichen Arbeit nutzen, sondern dass auch die intensive theoretische Reflexion dieses Ansatzes erfolgt, dass die Möglichkeiten und Grenzen dieses Konzepts bezüglich Sozialarbeitspraxis und -wissenschaft ausgelotet werden.
Die Notwendigkeit dieser theoretischen Auseinandersetzung mit einem ausgesprochen praxisorientierten Konzept, das professionelle Fachkräfte gerade aufgrund seiner enormen Brauchbarkeit für die Soziale Arbeit dankbar aufgreifen werden, ergibt sich aus dem oben erwähnten Paradigmenwechsel, mit dem die Lösungsorientierung einhergeht. Denn das neue Paradigma dieses Konzepts rüttelt auch an Grundfesten der Sozialen Arbeit, etwa an klassischen Vorstellungen von Problemanalyse und Zielorientierung.
In nahezu allen methodischen Ansätzen der Sozialen Arbeit wird die Problemanalyse als ein wichtiger Anfangsschritt für Lösungsprozesse beschrieben. Nach unserer abendländischen Vorstellung von der Entstehung von Problemen und der Initiierung von Lösungen ist dies zweifellos naheliegend. Demnach sind Probleme der Gegenwart in der Vergangenheit verursacht, sodass die Lösungssuche – gerade wenn sie radikal sein will, wenn sie die Wurzeln der Probleme zu packen und zu beseitigen sucht – die Betrachtung der Ursachen in der Vergangenheit notwendig macht. Daher erscheint es plausibel, dass erst die Aufdeckung der sich in der Vergangenheit manifestierenden und in die Gegenwart hineinwirkenden Ursachen der Probleme die Lösung ermöglicht. Wer lösen will, der muss zunächst analysieren, wo, wie und wann die Blockierung sich ereignet hat. Denn bestenfalls ist die Lösung der Blockierung die Lösung, wie es der Ökonom und Tiefenpsychologe Bernd Senf so schön formuliert.1 In der Psychoanalyse, die eine besonders elaborierte Theorie dieses klassischen Paradigmas bietet, wird daher das Bewusstmachen von verdrängten vergangenen Problemursachen bereits als heilend beschrieben. Freilich lassen sich viele Beispiele für den Erfolg dieser Sichtweise und der darauf basierenden Verfahrensweise finden. Problemanalyse kann sehr hilfreich oder bereits die Lösung sein, kann lösend und befreiend wirken. Das gilt es freilich anzuerkennen, praktisch und wissenschaftlich anzunehmen.
Aber es könnte auch ganz anders sein!
Wie Steve de Shazer und Insoo Kim Berg in ihren Publikationen zeigen und wie in diesem Band sehr kenntnisreich und für die Soziale Arbeit gewinnbringend untersucht wird, müssen Probleme und Lösungen nicht ursächlich miteinander verknüpft werden – zumindest nicht durch die methodische Arbeit. Dass über Probleme gesprochen wird, ist in der Lösungsorientierung höchstens noch eine beziehungsfördernde Finesse, um den Klienten Akzeptanz, Wertschätzung und Empathie entgegenzubringen. Freilich wissen wir mit Carl Rogers, dass bereits das Einnehmen dieser Haltungen die Lösungsprozesse wahrscheinlicher macht. Aber aus Sicht der Lösungsorientierung ist das Sprechen über die Probleme nicht notwendig, um Lösungen zu initiieren bzw. um die Klienten dabei zu unterstützen, ihre Lösungen zu konstruieren. Denn Lösungen und Probleme gehören zu unterschiedlichen Sinnwelten, wie in Andeutung an die Sprachphilosophie Ludwig Wittgensteins formuliert werden kann, die insbesondere Steve de Shazer stark inspiriert hat.
Lösungen werden in diesem Konzept initiiert durch eine im Vergleich zum klassischen Problemlösungskonzept grundsätzliche Wende bzw. Drehung der Aufmerksamkeit: Die Klienten werden eingeladen, zum einen auf eine problemfreie Zukunft zu schauen, die – wie nach einem Wunder – plötzlich am Morgen nach einer gut durchschlafenen Nacht aufscheint. Die gesamte kommunikative Aufmerksamkeit des Beratungsgesprächs wird nun auf die Unterschiede gelenkt, die nach diesem Wunder wahrnehmbar sind, und zwar von den Klienten selbst, aber auch von anderen Beteiligten. Zum anderen wird der Fokus auf problemfreie Zeiten gerichtet bzw. auf Vergangenheiten, in denen die Klienten selbst bereits Lösungen initiieren konnten, oder auf erlebte Situationen, in denen Probleme wider Erwarten ausblieben. Auch hier wird der gesamte Gesprächsfokus auf die Unterschiede gelegt, die bezüglich dieser Zeiten im Vergleich zur Gegenwart hinsichtlich des eigenen Denkens und Handelns aus verschiedenen Perspektiven wahrnehmbar sind.
Der Paradigmenwechsel der Lösungsorientierung besteht also darin, dass das Modell der Problementstehung verabschiedet wird zugunsten eines Modells der Lösungskreation, das insbesondere mit verschiedenen Formen der Wunderfrage (als Technik des Futur II bzw. der vollendeten Zukunft) und der Frage nach Ausnahmen bzw. nach problemfreien Zeiten in der Vergangenheit arbeitet. Über beide Fragen werden neue Energien freigesetzt, entstehen innere Zustände, die Lösungen tatsächlich wahrscheinlicher machen. Oder es werden Zugänge zu bereits erlebten Ressourcen freigelegt bzw. von den Klienten (wieder)erschaffen, die die Gegenwart in einem neuen Licht erscheinen lassen.
Bereits sichtbar wird an dieser Stelle, dass damit auch die klassische Zielorientierung verabschiedet wird. Denn Ziele sind im klassischen Verständnis bisher nicht erreichte Sollzustände in der Zukunft, die wir von der Gegenwart aus, von der Perspektive eines unerwünschten Istzustands betrachten. Das Wunder jedoch, das mit der Frage nach der vollendeten Zukunft fokussiert, analysiert, bis ins letzte Selbst- und Fremdwahrnehmungsdetail eruiert wird, zeigt sich bereits im Erleben, wird durch die Intensität und Gründlichkeit der Exploration, die mit dieser Frage einhergeht, mit der gegenwärtigen Wahrnehmung verbunden. Die Wunderfrage kann bewirken, dass Klienten sich plötzlich körperlich aufrichten, anfangen zu lächeln, dass sich ihre gesamte Mimik und Gestik entspannt – gerade so, als ob sie tatsächlich das erleben, was im Fokus des Gesprächs steht: ihr Wunder, ihr persönlicher Zustand einer problemfreien Zukunft.
Freilich stehen hinter der Lösungsorientierung auch sehr bekannte, bereits von der klassischen Psychoanalyse praktizierte Prinzipien: zum einen die gekonnte Nutzung alltäglicher Hypnose- und Trancezustände, zum anderen das Einblenden des Ausgeblendeten bzw. das Einbeziehen des Ausgeschlossenen oder – nochmals anders – die Integration des Verdrängten.
Die etwas mysteriös klingende Nutzung von Hypnose- und Trancezuständen meint nichts anderes als die gezielte Lenkung unserer kommunikativen und kognitiven Aufmerksamkeit auf bestimmte Ausschnitte der Wahrnehmung mit all den körperlichen und emotionalen Wirkungen, die das hat. In der Psychoanalyse wird die Aufmerksamkeit im Kontext des freien Assoziierens auf der Couch auf Erinnerungen aus der Vergangenheit gelenkt, auf Zustände, die häufig leidvolle Gefühle hervorrufen und entsprechende Körperreaktionen anregen. Mit den Worten von Steve des Shazer und Insoo Kim Berg wird hier »problem talking« betrieben, das letztlich zur Problemtrance führt. Im Gegensatz dazu favorisiert die Lösungsorientierung »solution talking«, um bei den Klienten eine Lösungstrance anzuregen.
Schließlich führt dieses Sprechen über Lösungen, die bereits in der Vergangenheit erreicht wurden und bezüglich der Zukunft imaginiert werden, zum Einblenden des Ausgeblendeten: In akuten Problemzeiten fokussieren wir eher das Negative, das Schwierige, Leidvolle, eben Problematische. Dies erzeugt eingeschränkte Wahrnehmungen, bremst kreative Prozesse und lässt sowohl die eigene biografische Geschichte als auch die persönliche Zukunft eher in dunklem Licht erscheinen. Die Lösungsorientierung erreicht im Gegensatz dazu ein Einbeziehen ausgeschlossener Wahrnehmungen: dass etwa in der Vergangenheit durchaus bereits etwas erreicht wurde, dass eigene Ressourcen genutzt werden konnten und dass eine andere Zukunft nicht nur denkbar, sondern sogar spürbar, fühlbar und damit greifbar wird.
Ob diese durch die Wunderfrage sichtbar werdende Zukunft dann tatsächlich real wird, ist nicht entscheidend. Wichtiger ist, dass dieses Integrieren einer anderen, positiveren Zukunft Kreativität, Energie und Motivation freisetzt, sodass die Kontingenz der eigenen Biografie (wieder) spürbar wird, dass das Leben anders als bisher weitergehen kann, dass Unterschiede nicht nur möglich, sondern sogar realisierbar sind.
Die Lösungsorientierung bietet mit ihrem Paradigmenwechsel hinsichtlich der Theorie und Methodik psychosozialer Arbeit enorme Potenziale. Diese beschränken sich nicht auf die Einzelfall- oder Familienarbeit, sie lassen sich in der Sozialen Arbeit mit Gruppen, Teams, Organisationen oder ganzen Gemeinwesen innovativ nutzen. Es ist das Verdienst dieses Buches, diese Potenziale in den Blick zu rücken, um eine intensive Reflexion der Möglichkeiten und Grenzen lösungsorientierter Sozialer Arbeit zu beginnen. Denn auch in der Sozialen Arbeit können wir noch stärker als bisher davon profitieren, dass wir mit der Lösungsorientierung die These des Physikers Fritjof Capra ernster nehmen als zuvor und in ihrer Wirkung unmittelbar spüren: »Erst wenn wir die Welt anders wahrnehmen, werden wir anders handeln können.«2
Heiko KlevePotsdam, im Frühjahr 2014
1Etwa als zentraler Slogan auf seiner Webseite: http://www.berndsenf.de [19.03.2014].
2Fritjof Capra (1991): Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild. München (dtv), S. VIII.
Zur Einführung
Frank Eger
Beratung, Therapie und Organisationsentwicklung entlang lösungsorientierter Merkmale zu betrachten und auszurichten ist ein bereits erprobtes Vorgehen. Doch welches Bild ergibt sich, sobald Entwicklungen in der Sozialen Arbeit in den Blick genommen werden? Sowohl im Sinne eines Theorieverständnisses Sozialer Arbeit als auch in der gegenwärtigen Praxis sollte Lösungsorientierung von Bedeutung sein, denn kommt die Sprache darauf, sind vielfältige Antworten, Stellungnahmen, Meinungen und Haltungen gewiss. Es zeigt sich dann, dass der Begriff der Lösungsorientierung sowohl präsent als auch offen ist. An dieser Stelle ist Hosemanns Einschätzung aus Kapitel 2.1 zuzustimmen: »Einen Begriff, den jeder versteht, versteht jeder anders.« Aus scheinbarer Beliebigkeit und der Tatsache, dass der Anspruch der Lösungsorientierung in der Praxis der Sozialen Arbeit von vielen Trägern bereits geäußert wird, ergibt sich für das vorliegende Buch die Anregung einer Verortung des Gedankens.
Auf dieser grundsätzlichen Intention aufbauend sind in der Sozialen Arbeit unterschiedliche Perspektiven erkennbar, die einer Bezugnahme bedürfen. Welchen Sinn stiftet Lösungsorientierung in der Sozialen Arbeit? Wozu Lösungsorientierung? Wie wird mit der Idee der Lösungsorientierung in der Sozialen Arbeit umgegangen? Welche Perspektiven ergeben sich aus dieser Verwendung? Dieser Band versucht Antworten auf diese Fragen entlang durchaus heterogener Blickrichtungen der Autoren zu vermitteln. Bei aller Unterschiedlichkeit lässt sich eine übergreifende Perspektive entlang folgender zwei Feststellungen erkennen:
•Lösungsorientierte Soziale Arbeit fokussiert zentral die Entwicklungs- statt die Problemperspektive personaler und sozialer Systeme als Gegenstand ihres Handelns.
•Lösungsorientierte Soziale Arbeit nimmt die Funktion wahr, die Entwicklung personaler und sozialer Systeme ressourcen- und zielbezogen anzuregen.
Statt den Band komplett zu lesen, kann auch eine Auswahl derjenigen Beiträge erfolgen, die von jeweiligem Interesse sind. Nachfolgende Unterscheidungen dienen der Unterstützung einer solchen Auswahl:
•Den Leser3 erwarten sowohl theorieorientierte (die ersten drei Kapitel) als auch praxis- und fallorientierte Beiträge (die folgenden sechs Kapitel).
•Die ersten fünf Beiträge (Teil I und II) sind eher auf den Querschnitt der Sozialen Arbeit bezogen, während die Beiträge in Teil III einen deutlichen Handlungsfeldbezug aufweisen. Das Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe wurde ausgewählt, da die Entwicklung in Richtung lösungsorientiert-systemischer Perspektiven aus Sicht des Herausgebers in diesem Feld am weitesten fortgeschritten ist.
Entlang dieser Unterscheidungen erwarten den Leser vielfältige Anregungen für eine Entwicklung lösungsorientierter Sozialer Arbeit.
Die Tatsache, dass lösungsorientiertes Handeln in der Praxis der Sozialen Arbeit bereits an vielen Orten zum Anspruch erhoben wird, nimmt Frank Eger mit seinem Beitrag (Kap. 1) zum Anlass, aus der lösungsorientierten Perspektive Potenzial für eine Anregung der Disziplin hinsichtlich ihres geschichtlichen Selbstverständnisses, ihrer basistheoretischen Grundlegung, ihres Gegenstandes sowie ihrer gesellschaftlichen Funktionsbestimmung zu entnehmen. Aus einer Kritik an einem Disziplinverständnis Sozialer Arbeit, das soziale Probleme als ihren Gegenstand fokussiert, erwachsen erste Vorschläge für eine Handlungstheorie lösungsorientierter Sozialer Arbeit, die Merkmale der Entwicklung personaler und sozialer Systeme als Anlass für eine Ressourcen- und Zielorientierung nimmt.
Wilfried Hosemann setzt sich in seinem Beitrag (Kap. 2) mit der Frage auseinander, wie sich Soziale Arbeit infolge der Lösungsorientierung zu gesellschaftlichen und demokratischen Entwicklungen positioniert. Der Autor betrachtet die Idee der Gerechtigkeit nicht als frei stehende Größe, sondern als Teil normativer Ansprüche. Die Frage, inwiefern eine lösungsorientierte Perspektive Sozialer Arbeit in der Lage ist, soziale Gerechtigkeit reflexiv zu befördern, ist für Hosemann zentral. Der Autor plädiert für Lösungswege in der Sozialen Arbeit, die davon absehen, soziale Probleme zu individualisieren, und stattdessen normativ gebunden einem gesellschaftlich-politischen Auftrag gerecht werden.
Tobias Kosellek schließt den Anteil theoretisch verorteter Beiträge mit Ausführungen entlang der Frage »Was können die bildenden Künste der lösungsorientierten Beratung bieten?« ab (Kap. 3). Der Autor ordnet Lösungsorientierung dem systemtheoretischen Paradigma Sozialer Arbeit zu und regt mit seinem Beitrag diejenigen Leser an, die an Theorieentwicklung ausgeprägtes Interesse zeigen. Kosellek koppelt erstens lösungsorientiert-systemische Beratung von Familien an Möglichkeiten des gesellschaftlichen Funktionssystems der Kunst und setzt zweitens mit der zirkulären Frage ein Instrument ein, das den Anspruch des »Sozialen« in der Beratung versinnbildlicht.
Stefan Bestmann eröffnet in Kapitel 4 die an Fallexempeln orientierten Beiträge. Der Autor entwickelt in seinem Beitrag ein lösungsorientiertes Verständnis für das Fachkonzept Sozialraumorientierung, um so die Wechselwirkung zwischen Individuum und gesellschaftlichen Ausgangslagen nutzbar zu machen. Bestmann betrachtet den sozialen Raum als zentralen Fokus Sozialer Arbeit und bezieht sich auf die in diesem Kontext verwendete Formel »vom Fall zum Feld«, wonach sich professionelle Arbeit von der Intervention im Fall hin zu einzelfallunabhängiger Infrastrukturarbeit im Feld erweitert.
Ein Bestandteil Sozialer Arbeit ist der Umgang mit sich widersprechenden Zielvorstellungen und daraus entstehenden Konflikten, die ein Handeln im Zwangskontext begründen. Katharina Gerber befasst sich in ihrem Beitrag (Kap. 5) mit der Frage, wie es im Zwangskontext gelingen kann, einen gemeinsamen Auftrag als Grundlage der Zusammenarbeit zu definieren. Die Autorin schlägt das Konzept von Pflicht und Kür vor, das für den Sozialarbeiter einen Rollenwechsel vorsieht, mit dem unterschiedliche Zielvorstellungen eine Repräsentanz finden.
Benjamin Landes und Hans-Georg Weigel verknüpfen in ihrem Beitrag (Kap. 6) Merkmale der Lösungsorientierung mit Anforderungen der Hilfeplanung bei den Hilfen zur Erziehung. Die Autoren konstatieren Fehlentwicklungen bei der Anwendung von Modellen der Zielformulierung (SMART) in der Hilfeplanung und favorisieren stattdessen eine Vorgehensweise in der Hilfeplanung, die an das Phasenmodell lösungsorientierter Beratung nach Bamberger angelehnt wird.
Frauke Mangels nimmt mit ihrem Beitrag (Kap. 7) die Frage auf, was lösungsorientierte Individualpädagogik in der Begleitung Jugendlicher mit einem traumatischen Erfahrungshintergrund zu leisten vermag. Die Autorin erkennt sowohl in lösungsorientierten Verfahrensweisen als auch in der Traumapädagogik die Relevanz der Ressourcenorientierung anstelle einer intensiven Suche nach Problemursachen. Mangels betrachtet Lösungsorientierung als Entwurfsmodus, mit dem Jugendliche Selbstbemächtigung erfahren können, indem sie Wünsche entwickeln und sich Ziele setzen. Die Autorin erachtet das individualpädagogische Setting anstelle von tradierten Heimgruppen als geeignet, um Jugendliche mit traumabedingten Herausforderungen angemessen begleiten zu können.
Marianne und Kaspar Baeschlin skizzieren mit ihrem Beitrag (Kap. 8) Merkmale lösungsorientierten Denkens und Handelns in der stationären Jugendhilfe. Ausgehend von ihrer langjährigen Erfahrung in der Werkschule Grundhof bei Winterthur (Schweiz) und mit Unterstützung von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg ist eine Jugendhilfe entstanden, die ihren Fokus auf neu zu lernende Verhaltensweisen der Jugendlichen legt, anstatt Defizite zu thematisieren. Mit dem konsequenten Bezug auf Ressourcen und Ziele sowie einer partizipativen Maßgabe werden junge Menschen in ihrer Entwicklung begleitet und auf Anforderungen in der Gesellschaft vorbereitet.
Mit dem Beitrag von Karl-Heinz Gröpler (Kap. 9) erfolgt zunächst eine sozialpädagogische Verortung von Schulsozialarbeit. Der Autor betrachtet Schulsozialarbeit als Angebot der Jugendhilfe, mit dem junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung gefördert werden. Gröpler identifiziert für Schulsozialarbeit Zielsetzungen der Ressourcenstärkung, Resilienzförderung und des Empowerments. Auf dieser Grundlage reflektiert der Autor beispielhaft Programme der Schulsozialarbeit in einem Schulzentrum der Stadt Wolfsburg. Daraus leitet er Merkmale einer lösungsorientierten Schulsozialarbeit ab.
3Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Buch darauf verzichtet, jeweils die weibliche und die männliche Form (hier: Leserinnen und Leser) anzuführen. Gemeint sind jeweils beide Geschlechter, unabhängig davon, ob die männliche oder die weibliche Form benutzt wird.
Teil 1:Theoretische Verortung
1Zukunft, die wir uns wünschen Lösungsorientierte Soziale Arbeit
Frank Eger
1.1Lösungsorientierung und Soziale Arbeit
Soziale Arbeit bestimmt in einigen ihrer Theorien und Konzepte (Engelke 2004; Lambers 2013) personale und soziale Probleme als Gegenstand ihrer Disziplin und Profession. Soziale Arbeit wird infolgedessen tätig, sobald auf Grundlage einer intensiven Problemanalyse Hilfebedarf angezeigt wird.
In den vergangenen Jahren erhielt demgegenüber Lösungsorientierung, ausgehend von systemischen Grundlagen der Beratung und Begleitung, bei unterschiedlichen Trägern Sozialer Arbeit Relevanz. Davon zeugen die entsprechenden Positionierungen in Konzeptionen von Einrichtungen und Diensten. Unterstützung erhalten diese Träger Sozialer Arbeit von Vertretern des systemischen Paradigmas der Beratung, z. B. von Paul Watzlawick. Dieser bezweifelte, dass Probleme eher gelöst werden, wenn eine intensive Beschäftigung mit diesen erfolgt. Insbesondere die lösungsorientiert-systemische Linie verweist in dem Zusammenhang auf die Gefahr einer Problemtrance und praktiziert stattdessen die Auseinandersetzung mit Zielen und Ressourcen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Lösungsorientierte Soziale Arbeit bedeutet mehr als eine partielle Anwendung von Instrumenten. Sie erfordert eine konstituierende Ausrichtung auf Ressourcen und Ziele. Denn lösungsorientierte Soziale Arbeit wird von der Überzeugung getragen, Aufgaben mit der entsprechenden Fokussierung als Herausforderung betrachten zu können. Ressourcen werden in lösungsorientierter Sozialer Arbeit als vorhanden vorausgesetzt und im sozialarbeiterischen Handeln wird eine Erwartung von darauf aufbauender Veränderung geschaffen. Damit zeichnet sich lösungsorientierte Soziale Arbeit durch das Bekenntnis aus, personalen und sozialen Systemen auf der Basis ihrer Anliegen und unter Würdigung ihrer Strategien zu helfen, ohne sie zu pathologisieren. Stattdessen versucht sie eine Problemlösung zu erreichen, indem die Konzentration von Anfang an auf Ressourcen und Ziele erfolgt. Damit knüpft lösungsorientierte Soziale Arbeit in einer ihrer zentralen Aussagen an das »Milwaukee-Axiom« des lösungsorientierten Beratungsansatzes an (Bamberger 2010, S. 11).
Nach dem Verständnis des Herausgebers wird lösungsorientierte Soziale Arbeit infolge der personalen und sozialen Entwicklungstatsache tätig. Die Funktion Sozialer Arbeit liegt nun darin begründet, personale und soziale Systeme im Hinblick auf eine Ressourcen- und Zielfokussierung kontextbezogen anzuregen. Der Anspruch des Kontextbezuges wird dem trifokalen Ansatz entsprechend als Arbeit mit dem Fall, der Fallumgebung und der Sozialstruktur eingelöst. Damit erteilt lösungsorientierte Soziale Arbeit Perspektiven eine Absage, die auf eine reine Interventionsmethodologie setzen.
Diese Perspektive birgt ein außerordentliches Potenzial für eine Anregung Sozialer Arbeit hinsichtlich ihrer basistheoretischen Grundlegung, des Gegenstandes und ihrer gesellschaftlichen Funktionsbestimmung sowie relevanter Handlungsmuster.
In den folgenden Kapiteln wird nach der Skizzierung einiger Merkmale lösungsorientierter Sozialer Arbeit die Entwicklung einer lösungsorientierten Handlungstheorie präferiert.
1.2Lösungsorientierung zwischen systemischen und utilitaristisch-pragmatistischen Merkmalen
Lösungsorientierung wird den systemischen Ansätzen zugeordnet (Hollstein-Brinkmann 2000). Dass systemische Denkweisen und Soziale Arbeit immer wieder in unterschiedliche Bezüge gesetzt werden, führt Hollstein-Brinkmann (2000, S. 49) darauf zurück,
»dass Systemtheorie mit ihrer Grundunterscheidung System-Umwelt‹ genau dem entspricht, was in der Theorie der Sozialarbeit seit hundert Jahren das Grundmodell bildet: die Austauschbeziehungen von Mensch und Umwelt, deren wechselseitige Bedingtheit und die Verpflichtung der Sozialarbeit, nicht nur die menschlichen Anpassungspotenziale und Bewältigungsmuster zu verbessern, sondern auch auf unzureichende Umweltbedingungen Einfluss zu nehmen«.
Neben der System-Umwelt-Differenz werden insbesondere Kybernetik und Konstruktivismus als wesentliche Merkmale systemischer Ansätze betrachtet. Hinweise zu Kybernetik lassen sich in den Texten zur Lösungsorientierung eher am Rande und dann insbesondere im Zusammenhang methodischer Anwendungen (z. B. der zirkulären Frage) entdecken, während Konstruktivismus und insbesondere sprachtheoretische Ideen breiten Raum einnehmen. Grundsätzlich weiterführend erscheint die in früheren Publikationen angedeutete, neuerdings klarer benannte erklärungstheoretische Position des Poststrukturalismus (de Shazer bezog sich auf Wittgensteins Theorie des Sprachspiels) und Konstruktivismus, die dem Ansatz zugrunde gelegt wird (de Shazer 1992a; Gergen u. Gergen 1986).
Das Konzept lösungsorientierter Beratung weist bei de Shazer neben systemischen und poststrukturalistischen auch utilitaristische und pragmatistische Merkmale auf. Entsprechende Hinweise in seinen Schriften offenbarte de Shazer entlang der durchgehenden Verwendung grundlegender Begriffe aus diesen nicht zuletzt in den USA bedeutsamen Denkrichtungen.
1.2.1Konstruktivismus und Wittgensteins Sprachtheorie
Bereits Limbacher und Willig (1998, S. 131) vertraten die Ansicht, dass sich das Interesse der Systemtheorie auf die Frage verlagert hat, wie Mitglieder sozialer Systeme Wirklichkeit konstruieren bzw. rekonstruieren und wie problemerzeugende und problemstabilisierende Wirklichkeitskonstruktionen in lösungsfördernde überführt werden können. Konstruktivistische Positionen werden im Kontext der systemischen Sozialen Arbeit in den vergangenen Jahren unter Bezugnahme auf das Konzept der Autopoiesis gestützt, das seit Anfang der 1970er Jahre von Maturana und Varela (1987) entwickelt wurde. Dem radikalen Konstruktivismus entsprechend wird die Annahme vertreten, dass Wirklichkeit in der Wahrnehmung »erschaffen« und Bilder der Wirklichkeit Erzeugnisse unseres Gehirns sind, die über eine wahre Wirklichkeit außerhalb unserer selbst nichts auszusagen vermögen. Daraus folgt, dass wir über die Welt nichts wissen können, außer dass bestimmte unserer Handlungen für uns nützlich sind und sich in der Welt bewähren. Wirklichkeitskonstruktion ist der zentrale Begriff, in dem sich sowohl die Subjektivität der Wahrnehmung als auch die Relativierung bewusstseinsunabhängiger Realität ausdrückt (vgl. Hollstein-Brinkmann 2000, S. 50 f.).
Wahrnehmung ist insofern subjektiv-aktive Informationsherstellung. Schmidt (2000, S. 241 ff.) ersetzt deshalb den Begriff der Wahrnehmung durch den der »Wahrgebung«. Infolge dieser »Wahrgebung« werden von unterschiedlichen Systemen Unterschiede konstruiert, die dann unter spezifischen Konstellationen zu Konfrontationen führen, welche letztlich Konfrontationen unterschiedlicher Realitätskonstruktionen sind. Jeder sieht dieselbe Sache doch wieder anders und jeder beharrt auf seinen Realitätsannahmen, als ob sein Bild von der Welt die wirkliche Wirklichkeit repräsentieren würde. Grundlegend für diese konflikthafte Eskalation ist: Wir merken nicht, dass wir Subjektives konstruieren, sondern denken, dass wir Objektives wahrnehmen (vgl. Bamberger 2010, S. 21).
De Shazer (2009, S. 74) erachtet infolge solch unterschiedlicher Wirklichkeitskonstruktionen Sprache als zentrales Instrument, um von einem Problem- in ein Lösungserleben zu gelangen:
»Mit dem Klienten darüber zu sprechen, was das Problem / die Beschwerde nicht ist, z. B. ›Nicht-Depression‹, ist eine Möglichkeit, Missverständnisse kreativ zu nutzen. Der Fokus ›Nicht-Depression‹ erlaubt es der Therapeutin und dem Klienten, auf Basis der Erfahrungen des Klienten außerhalb des Problembereichs gemeinsam eine Lösung zu konstruieren oder wenigstens damit anzufangen.«
Die Grundlagen der lösungsorientierten Sozialen Arbeit stellen insofern die Grundlagen der Grammatik der lösungsorientierten Sprache dar. In der sozialarbeiterischen Interaktion als Kommunikation werden entlang dieser Grammatik Lösungen konstruiert. Gleichzeitig sollte der Sozialarbeiter in der Lage sein, die damit entstehende Sinngebung im Hinblick auf ihre temporäre Relevanz einzustufen, denn
»Man soll diese Nötigung, Begriffe […] zu bilden […] nicht so verstehen, als ob wir damit die wahre Welt zu fixieren imstande wären; sondern als Nötigung, uns eine Welt zurechtzumachen, bei der unsere Existenz ermöglicht wird […] Die Welt erscheint uns logisch, weil wir sie erst logisiert haben« (Nietzsche 1968, S. 282, zit. nach de Shazer 2009, S. 73).
Die Tatsache temporärer Sinnbildung wurde von Ludewig für systemische Beratung folgendermaßen ausgedrückt (Ludewig 2000, S. 37):
»Was uns bliebe, wäre die Gewissheit, dass wir es zu jeder Zeit mit sich wandelndem Wissen zu tun haben: Man weiß, dass man nichts weiß, und doch muss man handeln. Da dies aber nicht leicht auszuhalten ist, benötigen wir, um uns in der Welt zurechtzufinden, ein Mindestmaß an anschlussfähigen Selbstverständlichkeiten, also Wissen.«
1.2.2Pragmatismus und Utilitarismus
Schönig (2012) hat zu einer Auseinandersetzung mit der luhmannschen Systemtheorie angemerkt, diese böte keine ausreichende Grundlage, um die Zielrichtung einer sozialarbeiterischen Intervention zu begründen und zu legitimieren. Der Autor verwies gleichzeitig auf Möglichkeiten, diese Lücke mit Rückgriff auf den deweyschen Pragmatismus zu füllen.
Nach dem Verständnis des Herausgebers impliziert Lösungsorientierung einige Bezugspunkte zu pragmatistischen sowie utilitaristischen Argumentationslinien.
Für den lösungsorientierten Ansatz der Beratung betonte de Shazer (2009), dieser sei nicht aus einer Metatheorie, sondern aus der alltäglichen beraterischen Praxis entstanden. In experimenteller Weise habe er beraterische Anteile beibehalten bzw. ausgeschieden, je nach deren Erfolg in der Anwendung.
Entlang dieser Vorgehensweise stimmt de Shazer mit der pragmatistisch-utilitaristischen Tradition überein. Aus pragmatistischer Perspektive ist Wahrheit ein Geschehen, bei dem sich Vorstellungen in der Praxis bewähren (vgl. Kitcher 2013, S. 35 ff.). Dem Pragmatismus zufolge sind es die praktischen Konsequenzen und Wirkungen einer lebensweltlichen Handlung oder eines natürlichen Ereignisses, die über die Bedeutung eines Gedankens entscheiden. Entsprechend schlugen die Vertreter des Pragmatismus als Methode der Wissensvermehrung vor, nur noch das als Wissen zu akzeptieren, was anhand von Experimenten intersubjektiv nachprüfbar ist bzw. nachgeprüft wurde. In seiner Theorie der Bedeutung war der Pragmatismus dann auch darauf gerichtet, Vorstellungen aller Art im Hinblick auf ihre möglichen praktischen Wirkungen zu beurteilen.
Im Anschluss an die konstruktivistische Erkenntnis, dass wir über die Welt nichts wissen können, außer dass bestimmte unserer Handlungen für uns nützlich sind und sich in der Welt bewähren, setzte de Shazer (2009) zentral neben das Primat der Praxis die Idee der Nützlichkeit. Er gestaltete das Konzept lösungsorientierter Beratung entlang dieser Nützlichkeitserwägung und betrachtete die Tatsache postmoderner, pluraler Sinngebung und daraus entstehende Missverständnisse als eine der Aufforderungen an den Berater, statt einer Problemanalyse die Konstruktion von Lösungsbildern zu präferieren (vgl. ebd., S. 74): »Im Endeffekt erscheint es nützlicher, die Situation so hinzunehmen, wie sie ist, und unsere gesammelten Missverständnisse dazu zu benutzen, dem Klienten bei der Konstruktion einer Lösung zu helfen.«
Bentham (1789, zit. in Höffe 2013, S. 55 ff.) beschreibt den für den Utilitarismus zentralen Gedanken:
»Mit dem Prinzip des Nutzens ist jenes Prinzip gemeint, das jede beliebige Handlung gutheißt oder missbilligt entsprechend ihrer Tendenz, das Glück derjenigen Gruppe zu vermehren oder zu vermindern, um deren Interessen es geht […] Mit Nutzen ist diejenige Eigenschaft an einem Objekt gemeint, wodurch es dazu neigt, Wohlergehen, Vorteil, Freude, Gutes oder Glück zu schaffen.«
Auch im konstruktivistischen Sinne bewähren sich Wirklichkeitskonstruktionen am weiteren Erleben (oder auch nicht). Dies führt dazu, dass das Individuum primär solche Konstruktionen als wahr erachtet, die für sein Wohlbefinden und seine Existenz im Zusammenleben mit anderen nützlich sind. Diese Abhängigkeit von den Sichtweisen und Verhaltensreaktionen der anderen begründet eine in vieler Hinsicht gemeinsame Welt der »Nützlichkeit«. Nur auf diese Weise ist Überleben möglich. Entlang dieser Nützlichkeitsorientierung existieren »Konsensrealitäten«, in denen viele Menschen an einer zumindest ähnlichen Sicht der Dinge teilhaben und dadurch erfolgreich miteinander kommunizieren und interagieren können. Daran schließt sich eine gesellschaftliche Vermitteltheit an, infolge derer der Mensch von Sinnstrukturen angeregt wird, die nicht nur von Individuen, sondern ebenfalls von sozialen Systemen, z. B. der Gesellschaft, erzeugt werden (vgl. Schütz u. Luckmann 1979). Lösungsorientierte Soziale Arbeit berücksichtigt Kommunikation entlang ebensolcher sozialer (z. B. gesellschaftlicher) Orientierungen. Es besteht daher die Notwendigkeit, dass professionelle Sozialarbeit methodologisch und methodisch nach Zugängen zur sozialen Realität sucht.
Personale und soziale Systeme können also wiederum von personalen und sozialen Systemen sinnhaft angeregt werden, wobei das System nach dem Prinzip der Nützlichkeit entscheidet, ob es das Sinnangebot annimmt oder verwirft.
Und wenn es infolge unterschiedlicher Sinnkonstruktionen nicht die Wahrheit gibt, mit der das sozialarbeiterische Vorgehen wahr konzipiert werden kann, dann sollte man sich als Sozialarbeiter darauf beschränken, diskursiv mit Adressaten Nützlichkeit zu beschreiben, und zwar in dem Sinne, dass damit hilfreiche Sozialarbeit möglich wird.
1.3Lösungsorientierte Handlungstheorie
Soziale Arbeit ist in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend als Beruf ausgeübt worden. Insofern benötigen Sozialarbeiter ein theoretisches Modell für ihr Handeln, das mit einem instrumentalen Verständnis vorgetragen wird.
Herwig-Lempp (2003, S. 12) schlägt vor, Theorien als Werkzeuge bzw. Instrumente zu betrachten, mit denen wir uns (unsere) Wirklichkeit beschreiben und erklären, und als Grundlage für unsere Entscheidungen darüber, wie wir handeln wollen (ebd.):
Ein großes Problem dieser großen und komplexen theoretischen Konzepte sehe ich darin, dass diese Theorien keinen wirklichen Diskurs mit der Praxis finden, dass sie von der Praxis nicht aufgegriffen und diskutiert werden, dass man ihnen dort eher ablehnend gegenübersteht und konstatiert, dass sie ›unbrauchbar‹ sind für den Alltag von SozialarbeiterInnen. Diese Werkzeuge sind dort nicht zu gebrauchen.«
Herwig-Lempp kann zwar entgegengehalten werden, dass gerade die zunehmende Relevanz systemischer Handlungskonzepte in Sozialer Arbeit einen Gegenbeweis zu seinen Ausführungen anbietet; gleichzeitig stimmt der Autor zu, dass Theorieentwicklung in der Sozialen Arbeit den Diskurs mit der Praxis benötigt.
Der vorliegende Band greift die Tatsache auf, dass lösungsorientiertes Handeln in der Praxis der Sozialen Arbeit bereits an vielen Orten zum Anspruch erhoben wird. Insofern liegt die Entwicklung einer Handlungstheorie lösungsorientierter Sozialer Arbeit nahe – einer Handlungstheorie, die sich an ihrem Nutzen für die Praxis Sozialer Arbeit messen lässt.
»Sinn« ist dabei die zentrale Kategorie, die die Perspektiven des Beobachters und des Handelnden in der Sozialen Arbeit verknüpft und somit Intentionen über Sinndeutungen rekonstruierbar macht (vgl. Engelke 2004, S. 406). Lösungsorientierte Soziale Arbeit steht also vor der Aufgabe, unterschiedliche Ansätze zur Erfassung und Beschreibung von Handlungen zu integrieren, Handlungsbegriffe zu analysieren und Handeln zu beschreiben sowie eine interdisziplinäre Handlungstheorie zu entwickeln. Diese entsteht somit als Folge der Formulierung von Regeln und deren begründeter Nutzung im Rahmen der Anwendung einer Methode professionellen Handelns.
Im Unterschied zu Basistheorien (z. B. der Systemtheorie, Sprachtheorie usw.) sind in Handlungstheorien nach dem Verständnis des Autors dieses Beitrags mindestens drei Formen der (theoretischen) Integration von Bedeutung:
1)die Integration im Bereich von Basistheorien,
2)die Integration im Bereich der Theorie des methodischen Handelns und
3)die Integration im Bereich der Methoden.
Die Integration der Basistheorien (1) ermöglicht eine Akzentuierung, welche grundlegenden Beschreibungen der Struktur der Dinge und ihrer Verknüpfung in der Sozialen Arbeit angemessen sind. Für die lösungsorientierte Soziale Arbeit sind hier Anteile der Systemtheorie, der Sprachtheorie, des Pragmatismus und des Utilitarismus maßgebend.
Die für Handlungstheorien spezifische Form der Integration geht nun über die Integration von Basistheorien hinaus, indem alle im Rahmen von methodischen Handlungen bedeutsamen Wissensformen wie Beschreibungen, Ziele und Interventionsregeln in einen handlungstheoretischen Zusammenhang gebracht werden. Dies geschieht in Form einer zu entwickelnden allgemeinen Handlungstheorie (2). Mit ihr werden die im Rahmen professionellen Handelns erforderlichen Operationen identifiziert und logische Beziehungen zwischen den an ihnen beteiligten Wissensformen geklärt. Im Rahmen der Fallbearbeitung ermöglicht eine solche allgemeine Handlungstheorie auf der Grundlage systematisch beschriebener und erklärter sozialarbeiterischer Situationen eine begründete Auswahl und Anwendung einzelner Methoden (3) (vgl. Obrecht 2003).
Nach dem Verständnis des Autors dieses Beitrags weist eine Handlungstheorie lösungsorientierter Sozialer Arbeit über einen bloßen Ansatz Sozialer Arbeit insofern hinaus, als dass erstere entsprechend o. g. Schrittfolge insbesondere eine Verknüpfung von einer Basistheorie mit einer zu entwickelnden allgemeinen Handlungstheorie leistet.
Zentral für eine zu entwickelnde Handlungstheorie lösungsorientierter Sozialer Arbeit ist die Reflexion von Handlungskompetenz im Sinne einer Fähigkeit, »in unterschiedlich komplexen Situationen angemessene Handlungsstrategien, Kommunikationsmuster und Handlungslegitimationen zu entwickeln und einzusetzen« (vgl. Engelke 2004, S. 407).
1.4Soziale Arbeit als Disziplin und Profession
Lösungsorientierte Soziale Arbeit gewährleistet die Funktion, mit personalen und sozialen Systemen eine lösungsorientierte Haltung zu erzeugen, um Kontakt mit Ressourcen und Zielen herzustellen und damit Herausforderungen der Entwicklungstatsache (des Gegenstands) zu begleiten.
Hauptmerkmal von Professionalität im lösungsorientierten Paradigma Sozialer Arbeit ist die Anforderung, auf wissenschaftlicher und berufsethischer Basis ein Bild der ressourcen- und zielträchtigen Entwicklungsanforderung zu erstellen und – davon ausgehend – einen selbstbestimmten Auftrag zu formulieren, der sowohl die Sichtweisen der Adressaten als auch der Auftraggeber berücksichtigt.
1.4.1Soziale Arbeit konstruiert ihren Gegenstand
Soziale Probleme werden in einigen Theorien als Gegenstand Sozialer Arbeit betrachtet. Demgegenüber war der systemische Ansatz auch angetreten, um den Einfluss problemfokussierter Paradigmen zu überwinden und durch geeignetere Modelle aus dem Bereich des Sozialen, nämlich Kommunikation, Diskurs und Narrative, zu ersetzen.
Denn Soziale Arbeit kann infolge pluraler Sinnangebote keine abschließende Wahrheit konzipieren. Um diese Unklarheit nach Kleve (2006, S. 109) »zumindest zeitweise, vielleicht für die Dauer eines Hilfeprozesses aufzulösen, sind die Beteiligten auf Kommunikation verwiesen. Kommunikation ist das Medium, mit dem unsichere Situationen zeitweilig und teilweise sicherer werden können.« Kleve identifiziert somit einen Wandel, der Kommunikation einfordert sowohl im Hinblick auf die Frage, was als unproblematisch bzw. problematisch gilt, als auch in Bezug auf das, was die Klienten brauchen. Mit dieser Vorstellung verabschiedet sich Soziale Arbeit von der Idee des Sozialarbeiters als Experten, der infolge singulärer Entscheidungen Diagnostik und Intervention vollzieht. Gleichzeitig erachtet Kleve eine Problemanalyse in der Sozialen Arbeit als notwendig.
Einen Schritt weiter geht die Zürcher Schule. Während Kleve Problembetrachtung noch im Sinne einer kommunikativen Aushandlung präferiert, versuchen Staub-Bernasconi und andere Autoren »›objektiv‹ festzustellen, was ein Problem, ist‹ – was zu skurrilen Kategorierungsversuchen [sic!] mit fragwürdigem Nutzen führt« (Pantucek 2005, S. 2). Ausgangspunkt der Problemtheorie der Zürcher Schule, so Gregusch (2005, S. 6), bildet die Annahme,
»dass Menschen, wie alle Organismen, bevorzugen, in bestimmten Zuständen zu sein. Diese werden als Biowerte bezeichnet, und sind diese in einem relativen Gleichgewicht, erleben Menschen dies als Zustand des Wohlbefindens. Als Bedürfnisspannung wird die Abweichung von den bevorzugten Zuständen bezeichnet. Jede Abweichung, die bewusst oder nicht bewusst sein kann, wird dabei vom Nervensystem registriert und motiviert Individuen, die entstandene Spannung mittels zielführendem Verhalten zu kompensieren […] Die erste Aufgabe besteht darin, den erfahrenen Spannungszuständen Rechnung zu tragen. Die zweite Aufgabe besteht darin, die Bedürfnisspannungen erzeugenden Gegebenheiten und Prozesse möglichst zu beseitigen, sie mindestens im Rahmen des Erträglichen zu beeinflussen oder aber das Eintreten (weiterer) Spannungen zu verhindern«.
Insbesondere die Zürcher Schule stellt also mit großer Selbstverständlichkeit fest, dass Soziale Arbeit soziale Probleme zum Gegenstand hat und sozialarbeiterisches Handeln ein »problemorientierter, rationaler Vorgang« (Obrechtu. Gregusch 2003, S. 84) ist.
Die Verortung sozialer Probleme als Gegenstand Sozialer Arbeit provoziert nach Überzeugung der Vertreter lösungsorientierter Sozialer Arbeit für einzelne Adressaten, Professionelle, Familien, Organisationen, Sozialräume und die Gesellschaft insgesamt erhebliche Nachteile.
Zwischen Problem und Lösung besteht nicht zwangsläufig ein Zusammenhang
Die Zürcher Schule propagiert die fragliche Notwendigkeit, ein Problem zuerst genau erkunden zu müssen, bevor eine Lösung dafür gefunden werden kann. Dabei übersehen ihre Vertreter, dass es systemisch betrachtet kaum möglich ist, in so komplexen Feldern wie der Sozialen Arbeit ursächliche Zusammenhänge für Probleme sicher herzuleiten. Demgegenüber ist eine der Kernaussagen des lösungsorientierten Ansatzes, es sei ein großer Irrtum zu vermuten, zwischen einem Problem und seiner Lösung bestehe ein Zusammenhang. Im Gegenteil zeigt sich, »dass der Prozess der Lösung sich von Fall zu Fall stärker ähnelt als die Probleme, denen die Intervention jeweils gilt« (de Shazer 1989a, S. 12).
Stattdessen gehen Vertreter der Lösungsorientierung davon aus, dass Problem und Lösung im Prinzip unabhängig voneinander sind. Zu dieser überraschenden Grundannahme der Lösungsfokussierung finden wir in Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus (1989a, Abschn. 6.4321): »Die Tatsachen gehören alle zur Aufgabe, nicht zur Lösung.« Hier weist Wittgenstein darauf hin, dass Problem (Aufgabe) und Lösung von gänzlich verschiedener Art und nicht voneinander ableitbar sind. Dies bedeutet nicht, dass aus einer Problem- und Ursachenanalyse keine Hinweise auf Lösungen gefunden werden können. Es besagt nur, dass eine Problem- und Ursachenanalyse keine notwendige Bedingung für das Auffinden von Lösungen ist. Wittgenstein erklärt die Annahme ursächlicher Zusammenhänge in seinem »Blauen Buch« (Wittgenstein 1970, S. 18):
»Philosophen haben ständig die naturwissenschaftliche Methode vor Augen und sind in unwiderstehlicher Versuchung, Fragen nach Art der Naturwissenschaften zu stellen und zu beantworten. Die Tendenz ist die eigentliche Quelle der Metaphysik und führt den Philosophen in vollständiges Dunkel.«
In der Konzeptualisierung lösungsorientierter Sozialer Arbeit ist somit die Einschätzung zentral, dass eine Analyse der Genese sozialer Probleme nicht zwingend erforderlich ist für das »Erfinden, Entdecken und Anwenden von Lösungen« (de Shazer 1992a, S. 76).
Problemtrance in mehrere Richtungen
Eine ausführliche und intensive Problemanalyse hat den Effekt, genau die bedrückende Hilflosigkeit zu aktualisieren, die personale und soziale Systeme mit der Sozialen Arbeit in Kontakt geführt haben. »Ein solches Hineinfragen in das, was nicht funktioniert – was der Klient nicht kann, was ihn unglücklich macht, wo er versagt hat usw., ist im Erleben des Klienten nichts anderes als eine Fortsetzung des Nichtfunktionierens«, so Bamberger (2010, S. 32) für den Bereich der Beratung. Wenn das Bewusstsein seine Aufmerksamkeit auf Defizite fokussiert, gibt der Organismus die entsprechenden Gefühle dazu. Probleme und das Reden über Probleme haben eine »demoralisierende« Wirkung. Und auf diese Weise werden die »Problemhypnose« und das durch Klagen gekennzeichnete Verhaltensmuster des Klienten noch verstärkt (vgl. ebd.).
Die Folgen skizziert Klaus Grawe (2004, S. 56) am Beispiel der Psychotherapie: »Wenn sich die Therapie zu sehr oder zu lange mit der Feststellung und Analyse von Problemen aufhält, werden keine neuen, positiveren neuronalen Erregungsmuster ausgebildet.«
Was für den Adressaten gilt, trifft in gleicher Weise auf den Sozialarbeiter zu. Denn aufseiten der Fachperson besteht die Gefahr, dass sie sich in das Problem verstrickt, und der Klient, der solche Veränderungen bei seinem Sozialarbeiter sieht und spürt, ist nun endgültig überzeugt, dass seine Lage hoffnungslos ist. »Damit ist ein wechselseitig induzierter Status der Problemhypnose realisiert«, formuliert Bamberger (2010, S. 33) treffend. Schließlich dauert eine vermeintlich sorgfältige Erfassung und Analyse »aller« Problemkomponenten sehr lange und nimmt sowohl bei der Fachperson wie bei den Klienten viel Energie in Anspruch.
Die für personale Systeme beschriebenen Folgen intensiver Problemanalyse legen es nahe, für soziale Systeme ebenfalls die Wirkungen einer Problemfokussierung näher zu betrachten.
Zur organisationalen und gesellschaftlichen Konstruktion personaler und sozialer Probleme
In der Theoriebildung Sozialer Arbeit wird nicht selten die Auffassung vertreten, vor der sozialarbeiterischen Hilfeleistung müsse zunächst eine Problemfeststellung erfolgen. So ist z. B. Geiling (2002, S. 85) der Ansicht, dass Soziale Arbeit vor Beginn der Hilfe konkrete Problemattributionen vornehmen muss, die die Verursachung und Entwicklung sozialer Probleme zum Gegenstand haben. Nach Auffassung von Fuchs und Schneider (1995, S. 203 ff.) leistet das System sozialer Hilfe eine doppelstufige Transformation: von Soziallagen in soziale Problemlagen und deren Transformation in Fälle. Soziale Arbeit wird nach Auffassung dieser Autoren also erst tätig, soweit ein Problem festgestellt wurde.
Tatsächlich wird in vielen Handlungsbereichen der Sozialen Arbeit von einer Problemdiagnostik abgesehen. Stattdessen ist die neutrale Tatsache der Entwicklung bzw. eines Entwicklungsbedürfnisses für die Hilfegewährung maßgebend (siehe Kap. 1.4.4). Beispielhaft seien an dieser Stelle die Tätigkeiten in Jugendhäusern oder Kindertagesbetreuung genannt.
Statt der Entwicklungstatsache jedoch in der Weise gerecht zu werden, dass diese von Beginn des Hilfeprozesses an im Hinblick auf Ressourcen und Ziele angeregt wird, hat Soziale Arbeit traditionell an Problemdefinitionen und -auslegungen mitgewirkt. Spector und Kitsuse (1973, S. 145 ff.) haben Soziale Arbeit infolgedessen als individuellen und kollektiven Akteur mit bestimmten »Problemkonstruktionsmustern« und entsprechenden Forderungen identifiziert. Dass Soziale Arbeit soziale Probleme entlang systemimmanenter Logik (ein Gestaltungsauftrag entsteht nur, soweit soziale Probleme festgestellt werden) als gesellschaftliches Funktionssystem mitorganisiert, ist einer der großen schwarzen Flecke dieser Disziplin und Profession.





























