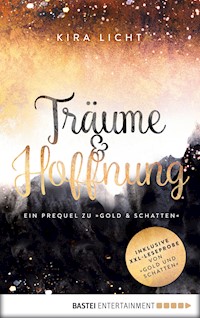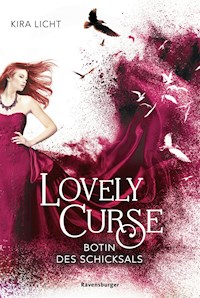
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Lovely Curse
- Sprache: Deutsch
Es ist dein Erbe, der Welt das Ende zu bringen. Es ist dein Schicksal, genau dies zu verhindern. Vergiftetes Wasser, unbarmherzige Hitze, verheerende Gewitter: Littlecreek wird von einer Katastrophe nach der anderen erschüttert und nur Aria, Dean und Noemi wissen, was dahintersteckt. Als Todesboten ist all dies ihre Schuld – und zugleich können nur sie das nahende Ende der Welt verhindern. Aber dazu müssen sie den vierten Todesboten, den grauen Reiter, finden und ausschalten. Mitten im Chaos fühlt Aria sich so zerrissen wie nie zuvor – denn während Simon ihr Herz höherschlagen lässt, treiben Deans Blicke und Berührungen sie in den Wahnsinn. Doch angesichts des Weltuntergangs bedeuten Gefühle den Tod … DAS FINALE DES BETÖREND-GEFÄHRLICHEN ROMANTASY-ZWEITEILERS VON KIRA LICHT Der Erste ist blass wie der Tod. Der Zweite verzehrt mit Feuer. Der Dritte schickt die Schwärze der Nacht. Der Letzte bedeutet das Ende. Dies ist das Schicksal der vier Todesboten. Und du bist einer von ihnen. Das Ende der Welt naht und Aria ist die erste von vier Todesboten. Als Todesboten bringen sie den Weltuntergang – und zugleich können nur sie das nahende Ende der Welt verhindern. Aber dazu müssen sie den vierten Todesboten, den grauen Reiter, finden und ausschalten.*** Eine knisternde Leseprobe aus dem Finale von Lovely Curse ***Ich küsste ihn sanft auf den Mund, doch dann löste ich mich von ihm und sah ihn ernst an. "Ich muss ständig an dich denken, obwohl –""Mir geht es genauso", unterbrach er mich. "Verdammt, die Welt geht unter, aber wenn ich dich im Arm halte, ist mir das alles egal."Wir küssten uns noch einmal. Dieses Mal langsam und ausgiebiger. Das Gefühl seiner Hände auf meiner Haut, ließ meinen Körper wie von innen heraus strahlen, leuchten, verglühen und all die Sorgen, die Ängste und drohende Apokalypse schienen für einen Moment vergessen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2020Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbHOriginalausgabeText: Copyright © 2020 by Kira LichtDieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.Umschlaggestaltung: unter Verwendung von Fotos von KInara Prusakova / Shutterstock, piyaphong / AdobeStock, konradbak / AdobeStock, Yevhen Rehulian / ShutterstockLektorat: Charlotte HüttenCopyright Originalausgabe © 2020 Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 RavensburgAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-473-47967-2www.ravensburger.de
Kapitel 1
Das freundliche goldene Strahlen der Sonne schien mich zu verhöhnen. Es schien uns alle zu verhöhnen. Den ganzen Morgen war es bewölkt gewesen, zu dunkel für diese Tageszeit und doch so stickig, als habe die Erde sich über Nacht nicht merklich abgekühlt. Das Tageslicht, das sich jetzt seinen Platz am Himmel erkämpft hatte, wirkte erschreckend friedlich und harmlos. So als würde die Sonne nicht schon am frühen Mittag mit ihrem zerstörerischen Werk beginnen. Als würde sie nicht so kräftig vom Himmel brennen, dass man sich kaum mehr im Freien aufhalten konnte. Dass sich die kostbaren Zuchtpferde schreckliche Verbrennungen zuzogen und die trockene Erde in Rissen aufbrach wie in einem stummen Schrei. Nein, der schimmernde Feuerball am Himmel verhieß mehr einen gemütlichen warmen Urlaubstag als das, was er wirklich bedeutete: Tiere, die verdursteten, Ernten, die verdorrten; eine Stadt, die jeden Mittag in einem unfreiwilligen Dornröschenschlaf gefangen lag.
All diese Gedanken wirbelten mir durch den Kopf, während Mr Mallory vorne an der Tafel dozierte. Ich hatte keine Ahnung, worüber er redete. Noemi neben mir schien es ähnlich zu gehen. Sie war noch blasser als sonst, hatte das tiefrote Haar zu einem nachlässigen Dutt hochgebunden und die Finger so heftig ineinander verschränkt, dass die Knöchel weiß hervortraten. Ihr Blick glitt zwar nach vorne und jeder würde meinen, dass sie dem Unterricht folgte, doch ich kannte sie mittlerweile gut genug, um zu erkennen, dass sie mit ihren Gedanken ebenso ganz woanders war.
Der Platz zu meiner Rechten war frei. Dean war an diesem Montagmorgen nicht zum Unterricht erschienen. Genauso wie er sich gestern nicht mehr gemeldet hatte. Der Zwischenfall mit Tammy war etwas über einen Tag her und seitdem war meine beste Freundin spurlos verschwunden. Beim Gedanken daran zog sich alles in mir zusammen.
Irgendein Farmer, der das ganze Schauspiel auf der Landstraße aus weiter Ferne mitbekommen haben musste, hatte die Feuerwehr von Littlecreek gerufen. Als die zwei kleinen Einsatzwagen näher kamen, war Dean – immer noch blutend und ziemlich zerrupft – auf sein Motorrad gestiegen und wortlos davongerauscht. Noemi und ich waren zitternd und tränenüberströmt zurückgeblieben.
Kurze Zeit später war auch Richard zu uns gestoßen. Er hatte sich Sorgen gemacht, weil wir nicht in Odessa auftauchten und ich auch nicht auf meinem Handy erreichbar war. Deswegen hatte er sich entschlossen, nach uns zu suchen und die Landstraße zur Ranch abzufahren.
Noemi und ich schafften es, die Feuerwehrleute so weit zu beschwichtigen, dass sie nicht die Polizei einschalteten. Wir erzählten ihnen, dass Jugendliche ein paar Feuerwerkskörper gezündet haben mussten, als die Dunkelheit über Littlecreek hereingebrochen war. So schnell fiel mir keine andere Möglichkeit ein, das gleißende Licht von Tammys Flammenschwert zu erklären. Der Farmer hatte am Telefon berichtet, er habe Funken durch die Luft sprühen sehen. Zum Glück war er so weit entfernt gewesen, dass er den gesamten Zwischenfall nur bruchstückhaft mitbekommen hatte.
Bei der Erinnerung an das Flammenschwert krampfte sich mein Magen erneut schmerzhaft zusammen. Tammy. Ich konnte noch immer nicht glauben, dass ich sie verloren hatte. Die ganze Nacht hatte ich wach gelegen und mich hin und her gewälzt, bis ich gestern, am Sonntagmittag, schließlich ihre Eltern angerufen hatte. Ich musste ihnen sagen, dass Tammy etwas Schlimmes passiert war.
Ich erreichte ihre Mutter in ihrem Restaurant, doch sie wirkte nicht beunruhigt. Ganz im Gegenteil, sie schien unter einer Art Bann zu stehen. Als ich sie nach Tammy fragte, erzählte sie mir leichthin, diese sei auf Klassenfahrt. Und als ich nachhakte, wann sie ihre Tochter zurückerwarte, antwortete sie lediglich: »Na ja bald, du weißt schon.«
Obwohl ich den Umstand, dass Tammy sich uns als Engel offenbart hatte, immer noch verdauen musste, war ich mir relativ sicher, dass sie es war, die dafür gesorgt hatte, dass ihre Eltern sich keine Sorgen machen würden, wenn sie unplanmäßig verschwand. Denn, dass ihr Auftauchen bei uns nicht geplant gewesen war, dessen war ich mir inzwischen sicher.
Trotzdem gab ich mir die Schuld für all das, was passiert war. Tammy war überrascht worden, und ich war nicht in der Lage gewesen, ihr zu helfen. Ich hatte zwar übermenschliche Kräfte entwickelt, aber ich war nicht fähig, sie einzusetzen, wenn ich sie wirklich brauchte.
Ich hatte Tammy sterben sehen. Den Anblick, wie sie von den Rabendämonen in die Lüfte davongezerrt wurde, würde ich nie vergessen. Ihr lebloser Körper hatte in ihren Fängen gehangen wie eine kaputte Puppe.
Der Schmerz in meinem Bauch explodierte, und gleichzeitig war mein Mund so trocken, dass ich kaum schlucken konnte. Noch mehr Tod. Noch mehr Leid. Es schien, als würde ich seit einiger Zeit alles Unheil dieser Welt anziehen. Was auch irgendwie passte, wenn man bedachte, dass ich einer der vier Todesboten war, die der Welt den Untergang bringen würden. Ich selbst hatte zwar keinerlei Intention, meinen Mitmenschen etwas Böses anzutun, doch das finstere Erbe, das ich in mir trug, schien sich nun nicht mehr verleugnen zu lassen.
Ein weiterer Gedanke drängte sich mir auf, den ich mit aller Macht zu unterdrücken versuchte. Konnte meine düstere Bestimmung irgendetwas mit dem Tod meiner Eltern zu tun haben? Fahrig beugte ich mich zur Seite und griff nach meiner Wasserflasche. Ohne hinzusehen, schraubte ich sie auf und setzte sie vorsichtig an die Lippen. Das Wasser war lauwarm und schmeckte faulig und verdorben. Ich musste mich zwingen, es hinunterzuschlucken.
Noemi und ich wechselten einen kurzen Blick. Sie griff nach ihrer Apfelschorle und schubste sie zu mir herüber. Ich nickte dankbar. Sie hatte sie sich kurz vor Unterrichtsbeginn am Automaten gezogen und das Getränk war immer noch herrlich kühl. Ich seufzte leise auf.
Wie von selbst glitt mein Blick zum leeren Tisch neben mir. Dean schien es nicht für nötig befunden zu haben, uns über sein Verschwinden zu informieren. Und das obwohl er eindeutig zu uns gehörte. Denn wenn wir richtig geschlussfolgert hatten, war er der Dritte der vier Todesboten.
Er war bisher der jüngste Todesbote, denn er war als Letztes erschienen und er hatte scheinbar noch keine Fähigkeiten entwickelt. Das hatte ich natürlich so nicht gesagt, weil ich wusste, wie Dean sich über alles aufregte. Und dafür hatte ich im Moment gar keinen Kopf. Weder für Deans Befindlichkeiten noch dafür, dass er uns einfach im Stich ließ.
Meine Gedanken waren ganz bei Tammy, bei ihrer Familie und bei dem, was passieren würde, wenn sie herausfanden, was ihrer Tochter wirklich zugestoßen war. Ein kurzer Verdacht streifte mich. Ob Tammys Eltern vielleicht wussten, dass ihre Tochter ein Engel war? Ob sie einfach nur verleugnet hatten, dass sie auf dem Weg zu mir gewesen war, weil sie annahmen, Tammy hätte mich noch nicht eingeweiht? Schließlich hatte sie angedeutet, dass sie eigentlich nicht mit uns reden durfte. Doch … nein. Ihre Mutter hatte gewirkt, als stünde sie unter starken Beruhigungsmitteln. Da ich mir sicher war, dass Tammy ihre Eltern nicht unter Drogen setzen würde, vermutete ich, dass es eine ihrer Kräfte war … gewesen war, korrigierte ich mich. Meine Güte, es fühlte sich immer noch so unwirklich an.
Ich kannte die Stufen der Trauer und das Verleugnen des Schicksals war eine von ihnen. Das Nicht-wahrhaben-Wollen, das Sich-an-einen-letzten-Strohhalm-Klammern. Es war nur menschlich und in diesem Punkt schien mein düsteres Erbe meinen Verstand nicht übernommen zu haben. Ich trauerte um Tammy, und die Trauer um sie gesellte sich zu der um meine Eltern. Das Leben meinte es im Moment nicht gut mit mir. Innerhalb weniger Monate hatte ich drei der wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren. Und nun stand uns praktisch die Apokalypse bevor. Das Ende der Welt. Und ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde …
Vor der Mittagspause jedoch, erwartete mich erst einmal Simon auf dem Flur vor unserem Klassenzimmer. Hatte mich seine sehr fürsorgliche Art auf der Klassenfahrt noch ziemlich genervt, so war ich nun dankbar dafür, dass er sich seiner Gefühle so uneingeschränkt sicher schien. Er hatte sich von Anfang an für mich entschieden. Schon am ersten Tag hier an der Highschool von Littlecreek hatte er mir zugelächelt und mich, anders als meine Mitschüler, niemals aufgrund meiner Haare oder meines individuellen Kleidungsstils aufgezogen. Simon war von Anfang an da gewesen. Und er war unbemerkt zu meinem Anker geworden. Zu jemandem, auf den ich mich verlassen konnte.
Auch gestern war er für mich da gewesen. Kaum dass er von dem Zwischenfall erfahren hatte, war er zur Ranch gekommen, um sich um mich zu kümmern. Vergessen waren all unser Streit und die Missverständnisse.
Ich war völlig außer mir gewesen und hatte gleichzeitig in Suzan und Richard keine Vertrauenspersonen, denen ich die ganze Wahrheit erzählen konnte. Bei Simon hingegen hatte ich kein Blatt vor den Mund nehmen müssen. Ich hatte ihm gegenüber schon vorher angedeutet, dass ich bestimmte Vermutungen hatte, was meine plötzlich veränderte Haarfarbe betraf. Wir hatten schon über die Angriffe der Raben gesprochen und ich hatte ihm von meinem Verdacht bezüglich Noemi erzählt.
Obwohl Simon immer sehr skeptisch und zurückhaltend geblieben war, hatte er mich doch niemals zurückgestoßen oder mich als Lügnerin hingestellt. Und genauso hatte er sich auch jetzt verhalten. Er hatte mir zugehört und mich in den Arm genommen, als ich wegen Tammy zu weinen begonnen hatte.
Auch Richard hatte sehr besonnen gehandelt. Er hatte sofort Noemis Eltern angerufen, um sie darauf vorzubereiten, dass es wohl einen Zwischenfall auf der Landstraße gegeben hatte, es Noemi aber gut ging. Mr und Mrs Gladis waren daraufhin im Rekordtempo erschienen und hatten ihre Tochter abgeholt. Richard hatte sich um alles gekümmert, mit den Beamten gesprochen und Noemis Eltern beruhigt. Doch genau wie Simon hatte er keine bohrenden Fragen gestellt. Ich wäre ohnehin viel zu aufgelöst dafür gewesen.
Dennoch war ich mir sicher, dass er anhand meiner im Kampf beschädigten Kleidung ahnte, dass wir nicht einfach nur Opfer eines dummen Streichs auf der Landstraße geworden waren. Dass wir nicht einfach nur in einen Hagel aus Feuerwerkskörpern gefahren waren, die uns so emotional durcheinandergeschüttelt hatten. Er hatte den dunklen Staub auf Noemis Bluse gesehen, und die Kratzer an unseren Armen mussten ihm auch aufgefallen sein. Doch Richard war genau wie Simon sehr diskret. Trotzdem hatte ich mir vorgenommen, noch heute mit ihm zu sprechen.
Aber nun war ich erst mal froh, dass ich in Simons Gegenwart wieder Kraft tanken konnte. Die Erinnerungen, die mich immer wieder in den letzten zwei Doppelstunden überfallen hatten, hatten mir schwer zugesetzt. Wider besseres Wissen hatte ich noch zweimal unauffällig unter dem Tisch versucht, Tammy zu erreichen. Hatte es bei ihr klingeln lassen, einfach nur, um zu sehen, ob sie das Gespräch annahm – in der verzweifelten Hoffnung, dass all das nur ein schlechter Traum gewesen war, dass ich im nächsten Moment die Stimme meiner besten Freundin hören könnte. Doch, wie immer, war sofort die Mailbox angesprungen. Die Gewissheit, dass ich meine Freundin aus Kindertagen für immer verloren hatte, ließ sich langsam, aber sicher nicht mehr leugnen.
Simon zog mich in seine Arme, nachdem er Noemi kurz aber herzlich begrüßt hatte. Wie immer ließ ich mich komplett von ihm einhüllen. Ich sog seinen frischen Duft ein und schmiegte meine Wange an sein weiches T-Shirt. Er wiegte mich leicht hin und her, bevor er mich einen Moment später aus seinen Armen entließ und mir einen Kuss auf die Stirn hauchte.
»Wie geht es euch?«, fragte er und schaute von mir zu Noemi.
Noemi, sonst alles andere als um Worte verlegen, zuckte einfach nur die Schultern. Ein Kratzer von einer Rabendämonenkralle zog sich quer über ihr Dekolleté und verschwand im Ausschnitt ihres Tanktops. Sie schien die Wunde trotzig zur Schau zu tragen, und ich wusste, dass einige Leute bereits darüber tuschelten. Ich hatte mich für ein Oberteil mit Dreiviertelarm entschieden, um meine Verletzungen zu verbergen. Zwar begegnete uns in der Schule niemand mehr mit offener Feindseligkeit, doch ich wusste, dass hinter unserem Rücken die wildesten Gerüchte kursierten. Und unser ramponiertes Äußeres würde diese noch weiter anheizen.
»Es geht irgendwie«, sagte ich mühsam, wobei meine Stimme immer noch so klang, als wäre es die bessere Idee, nicht zu sprechen. Simon strich mir kurz durchs Haar.
»Was auch immer euch geschehen ist, ihr wart beide unglaublich tapfer.« Wieder zuckte Noemi nur die Schultern und ihr Blick glitt an Simon vorbei in Richtung Treppenhaus. Die Sehnsucht, diesen Ort einfach zu verlassen, war ihr ins Gesicht geschrieben. Kein Wunder, ich hatte mich ebenso wenig auf den Unterricht konzentrieren können.
»Ich glaube, ich gehe nach Hause«, sagte Noemi just in diesem Moment. »Mir ist schlecht, und ich werde mir einen Zettel von der Schulkrankenschwester holen, damit ich mich im Sekretariat abmelden kann.« Sie seufzte leise, dann sah sie zu mir. »Kommst du klar?«
Ich nickte schnell. »Ruh dich aus und lass dich ein bisschen pflegen. Ich rufe dich nach Schulschluss an.« Sie nickte knapp, dann straffte sie die Schultern und ließ uns stehen. Simon sah ihr kurz nach.
»Sie hat sich verändert«, sagte er schließlich.
»Ich glaube, wir haben uns alle verändert in den letzten Wochen.«
Simon nickte bedächtig. »Möchtest du etwas essen?«
Ich schüttelte schnell den Kopf. »Nein, eigentlich hatte ich vor, in der Bibliothek zu recherchieren. Dieser Dämonenanführer hat Tammy Michael genannt und er selbst hieß Belial. Ich weiß, dass Michael einer der vier Erzengel ist, aber vielleicht gibt es in den Heerscharen des Himmels noch mehr Engel, die so heißen? Außerdem sollte Michael doch eigentlich ein Mann sein, oder?«
Simon verzog nachdenklich den Mund. »Wenn ich das im Religionsunterricht richtig verstanden habe, dann sind Engel geschlechtsneutrale Wesen. Sie tragen einfach nur irgendeinen Namen, aber sie sind weder männlich noch weiblich. Beziehungsweise sind sie in ihrer eigentlichen Gestalt weder männlich noch weiblich. Wenn sie als Inkarnation auftreten, könnten sie durchaus in einem weiblichen Körper wiedergeboren werden.«
Das leuchtete mir ein. »Und Belial?«
Simon starrte gedankenverloren an mir vorbei. Ein Muskel zuckte an seinem Kinn. »Klingt wie eine Gestalt aus einem Horrorfilm.«
Da gab ich ihm stumm recht. »Trotzdem. Ich glaube, ich habe den Namen schon mal irgendwo gehört. Das wollte ich mir jetzt eigentlich mal genauer angucken.«
Simon sah zurück in mein Gesicht. Seine dunkelblauen Augen strahlten voller Wärme. »Ich kann verstehen, dass du Antworten haben willst. Und ich weiß, wie ungeduldig du bist. Alles muss sofort passieren. Aber glaubst du nicht, es ist klüger und gesünder, sich heute mal einen Tag freizunehmen? Wenn Tammy wirklich ein Engel ist, sollte sie dann nicht härter im Nehmen sein? Glaubst du wirklich, dass sie tot ist? Vielleicht meldet sie sich ja im Laufe des Tages noch bei dir.«
Wieder wallte Verzweiflung in mir auf. »Das ist ja der Punkt. Ich weiß nicht viel über Engel. Sterben die Körper, in denen sie wiedergeboren wurden? Ist es nur die unsterbliche Seele, die mächtige Engelsgestalt, die überlebt? Wie oder wo irgendetwas passiert, ist mir völlig schleierhaft. Vielleicht ist auch nur meine Freundin tot, und der Engel, dessen Inkarnation sie war, von dem sie besessen war, oder was auch immer, lebt einfach weiter.« Ich klang jämmerlich, konfus und verzweifelt zugleich.
Simon lachte trocken auf. »Das Wort ›besessen‹ und das Wort ›Engel‹ im selben Satz … das passt zusammen wie Feuer und Wasser.«
Ich sah ihn überrascht an. »Wie meinst du das?«
Um uns herum wurde es leiser, denn die meisten unserer Mitschüler waren schon in Richtung Mensa verschwunden. Ein leicht salziger Geruch nach Fettgebackenem waberte durch die Luft.
Simon blinzelte. »Von einem Engel kann man nicht besessen sein. Nur Dämonen können Besitz von einem Menschen ergreifen.«
Ich neigte den Kopf. »Bist du dir sicher? Dann ist Tammy also ein geborener Engel? Sind ihre Eltern dann auch Engel?« Erst jetzt sickerten Tammys Worte erneut in mein Bewusstsein. Sie hatte es mir gesagt, hatte mir vor dem Kampf anvertraut, dass sie schon immer von ihrer Bestimmung als Engel gewusst hatte. Nur ich hatte das nicht wahrhaben wollen, hatte nicht verstehen wollen, dass meine beste Freundin mich ein Leben lang belogen hatte. Und jetzt hatte auch Simon diese unfassbare Wahrheit bestätigt.
Dessen Blick glitt wieder an mir vorbei, und für einen Moment hatte ich den Eindruck, dass er über dieses Thema nicht weiterreden wollte. Gut, ich konnte ihn verstehen, denn alles, was ich erzählte oder fragte, klang wie aus einem Märchen – Engel, Dämonen, Inkarnationen. Ich wusste, dass man hier im bibelfesten Texas viel ausführlicher in Religionsfragen unterrichtet wurde. Normalerweise sollte Simon gut Bescheid wissen. Was er ja auch tat. Schließlich hatte er einige meiner Fragen beantwortet.
Doch das Thema Religion schien ihn irgendwie zu nerven, was ich ebenso verstehen konnte. Die meisten 17-jährigen Jungs, die ich kannte, interessierten sich kein Stück für die Kirche oder die Lehren des Alten und Neuen Testaments. Ich ruderte also zurück. »Vielleicht gehen wir nur ein paar Minuten in die Bibliothek und dann etwas essen? Wie wäre das?«
Simon wirkte nicht begeistert. »Heute gibt es Corn Dogs. Und du weißt, dass die grundsätzlich nach fünfzehn Minuten ausverkauft sind, weil sie nie genug machen.«
Ich ließ die Schultern hängen. Wir verschoben die Recherche über den Weltuntergang zugunsten von frittierten Würstchen im Teigmantel?
»Warum textest du nicht einem deiner Footballkollegen, dass er dir ein paar zurücklegt?«
»In der Mensa rücken sie nicht mehr als drei Stück pro Person raus. Die sind ja auch nicht blöd.« Irgendwie schien es seltsam surreal, dass wir über Corn Dogs diskutierten, während ich in Gedanken immer noch dabei war, zu verarbeiten, dass meine Freundin sich mir erst als Engel offenbart hatte und dann vor meinen Augen gestorben war.
»Ich kann jetzt nichts essen«, sagte ich also entschieden. »Die Sache mit Tammy geht mir nicht aus dem Kopf. Ich habe gesehen, wie sie ganz grau wurde im Gesicht. Wie sie die Augen verdreht hat. Und dann hing sie schlaff in den Krallen von diesen ekelhaften Kreaturen, die sie mit sich nach oben in den Himmel getragen haben. Ich bin heute Nacht dreimal schreiend aufgewacht, weil ich immer noch ihre Schmerzenslaute in meinen Ohren höre. Ich kann doch jetzt nicht in irgendeiner Mensa sitzen und frittierte Würstchen essen und …« Meine Stimme brach. Sofort wurden Simons Augen groß und sein Blick weich. Wieder zog er mich an sich.
»Es tut mir leid. Ich bin so unsensibel. Ich bin einfach nur ein dummer Kerl, der mit seinem Magen denkt. Dabei will ich doch nur, dass du dich nicht so verrückt machst. Du bist mir wichtig. Ich will, dass es dir gut geht. Und deshalb solltest du etwas essen, auch wenn du dir große Sorgen machst.« Er schob mich ein kleines Stückchen von sich, legte aber seine Hände zart um meine Schultern.
»Vorschlag. Ich hole uns beiden ein gekühltes Sandwich am Automaten und dazu zwei Dosen Coke. Wir setzen uns irgendwo im Schatten auf die Tribünen und schalten einfach mal eine Stunde ab, machen nichts. Es ist mir egal, wenn du nur neben mir sitzt und schweigst. Solange ich weiß, dass es dir gut geht, musst du nie wieder ein Wort mit mir sprechen, falls du keine Lust dazu hast. Und wenn du die ganze Zeit reden willst, dann rede die ganze Zeit. Wenn dir das guttut, dann sprich dir alles von der Seele. Ich höre dir zu. Ich will für dich da sein, und ich werde dafür sorgen, dass du dieses Sandwich isst, damit du nicht spätestens in zwei Stunden ohnmächtig vom Stuhl kippst. Denn ich sage es gerne noch mal: Du bist mir wichtig. Also besorge ich dir jetzt ein paar Kohlenhydrate, etwas Zucker und ein bisschen prickelndes Koffein. Und dann werden wir uns einfach zu zweit irgendwohin verkrümeln. Wie hört sich das an?«
Obwohl alles in mir sich dagegen wehrte, malte sich ein Lächeln auf mein Gesicht.
»Simon«, sagte ich leise.
»Ja?« Er sah mich an.
»Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass du der Beste bist?«
Sein Lächeln wurde noch breiter, aber er antwortete nicht. Stattdessen legte er einen Arm um meine Schultern und gemeinsam spazierten wir in Richtung des Snackautomaten.
Simons Nähe tat mir so gut. Die Mittagspause verging wie im Flug und natürlich redete ich die ganze Zeit wie ein Wasserfall. Es war eine Wohltat, so ungezwungen sprechen zu können. Sich nicht darum kümmern zu müssen, ob man etwas sagte, was klang wie aus einem schrecklichen Albtraum, und nicht stets befürchten zu müssen, dass der andere aufstand und ging, weil er einen für verrückt erklärte. Simon kaute schweigend auf seinem Sandwich und hörte mir einfach zu. Hin und wieder nickte er oder streichelte kurz meinen Arm. Nach einer zweiten Runde kühler Getränke hatte er sich schließlich zu mir gebeugt und mich geküsst. Er hatte nach Cola geschmeckt und ein paar Minuten lang war ich völlig in seiner Nähe versunken. Das zarte Prickeln in meinem Bauch, die aufkeimende Anziehung und all das, was mich an tiefen Gefühlen mit Simon verband, hatte bewirkt, dass ich meine Welt und das, was aus ihr geworden war, für einen kurzen Moment vergessen konnte. Als Simon mich schließlich zu meinem Klassenraum brachte, fühlte ich mich noch immer leicht benommen. Und vermutlich hatte mir die gute Hälfte der Doppelstunde das typisch verliebte Grinsen im Gesicht geklebt.
Der Rest meines Schultages verlief recht eintönig, denn Noemi war bereits nach Hause gegangen und auch Dean blieb weiterhin verschwunden. Obwohl ich mehrfach zu meinem Smartphone griff und ihm texten wollte, ließ ich es jedes Mal wieder abrupt sinken, als mein Kopf bemerkte, was meine Hände taten. Ich würde es einfach nicht mehr zulassen. Diese Sache zwischen ihm und mir, diese unerklärliche Anziehung, diese Kraft, die uns wie magisch zueinander zog, all das würde ich nicht mehr zulassen. Es war falsch. Dean war nicht der Richtige. Er trug so ein großes Päckchen mit sich herum und ich kam im Moment selbst schon kaum zurecht.
Simon war ausgeglichen und sein Leben war so aufgeräumt wie ein Bilderbuch. Er hatte genug Kraft, um mit jemandem wie mir klarzukommen. Natürlich fühlte ich mich irgendwie schlecht dabei, doch ich genoss es gleichzeitig, dass Simon so uneingeschränkt für mich da war. Und in all dem Chaos tat es gut, jemanden an meiner Seite zu haben, der so herrlich normal war.
Noemi textete mir kurz nach Schulschluss und erklärte, dass sie zu Hause sei, es dort aber schrecklich finde, weil ihre Eltern sich permanent stritten. Sie hatte sich wohl in ihrem Zimmer verbarrikadiert und ins Bett verzogen, doch selbst ein Kissen über den Ohren sperrte die Geräuschkulisse scheinbar nicht aus. Ich bot ihr an, zu mir zu kommen, doch das lehnte sie ab. Stattdessen wollte sie Jonah besuchen.
Dafür hatte ich natürlich Verständnis. Schließlich hatte ich Jonah schon kennengelernt und gefühlt, was für eine große Liebe die beiden verband. Ich wusste, dass Noemi sich im Angesicht des drohenden Weltuntergangs schreckliche Sorgen um Jonah machte. Deshalb gönnte ich ihr jede Minute mit ihm und wünschte ihr, dass sie, genauso wie früher, Halt in ihm fand.
Simon hatte noch Football-Training, doch er fragte mich per Textnachricht, ob ich am späten Nachmittag Lust hätte, mit ihm ein paar der selbst gebauten Tiertränken aufzustellen. In unserem ersten Gespräch im »Farmhouse Diner« hatten wir schon über diese Tränken gesprochen. Ich hatte sie fast vergessen, doch jetzt sagte ich sofort zu. Es brach mir jedes Mal das Herz, wenn ich die verendeten Tiere am Straßenrand sah.
Obwohl es mir vor der Fahrt nach Littlecreek hinein graute, beschloss ich trotzdem, auf meinem Rückweg von der Schule bei der Apotheke haltzumachen. Meine zerkratzen Arme brannten unangenehm, und ich wollte mir eine Creme kaufen, damit die Wunden schneller verheilten. Sicherlich hatte auch Betsy in ihrem Drugstore so etwas auf Lager, doch mir war heute nicht nach einer Unterhaltung zumute. Der Apotheker musterte mich nur kurz, doch er stellte keine Fragen.
Erleichtert machte ich mich auf den Heimweg. Das Stück Land außerhalb von Littlecreek, das den Ort von den umliegenden Farmen trennte, sah aus wie eine apokalyptische Brachlandschaft. Das meiste Gras war inzwischen vollends verdorrt und sogar die ersten Bäume wurden braun. Irgendwo mitten im Nirgendwo stand ein grüner Forschungsvan der biologischen Fakultät der Universität von Odessa. Neben den Meteorologen hatten nun also auch die Biologen angefangen, sich für Littlecreek zu interessieren. Dass Flora und Fauna hier starben, war aber auch wirklich nicht mehr zu übersehen.
Einerseits war ich dankbar, dass scheinbar irgendwie gehandelt wurde, doch andererseits machte es mich wütend, dass nur zwei magere kleine Vans abgestellt worden waren, um diesen, offenbar dem Tode geweihten Landstrich, zu überprüfen. Schon wieder sah ich kleine verendete Tiere in dem vertrockneten Gras am Rande der Landstraße liegen. Wie auch die anderen zuvor bluteten sie aus Nase und Augen, und Schaum stand ihnen vor dem Maul. Ich wusste, dass die rote Alge dafür verantwortlich war. Die Alge, der man hier einfach nicht Herr zu werden schien, die das Wasser vergiftete und sich wie eine tödliche Seuche langsam, aber sicher in ganz Littlecreek ausgebreitet hatte.
Kurz bevor ich auf den Weg, der zur Ranch führte, einbog, entdeckte ich eine Gruppe toter Vögel. Sie mussten aus einem der kleinen Bachläufe getrunken haben, denn auch sie waren von der roten Alge gezeichnet. Schnell wandte ich den Blick ab. Das hier sah wirklich aus wie das Ende der Welt. Sollten unsere Vermutungen stimmen, dann begann es hier in Littlecreek, einem Ort irgendwo im Nirgendwo. Ich umklammerte das Lenkrad noch fester, als mir etwas klar wurde: Es begann in einem Ort, der so klein war, dass niemand daraufkommen würde, bis es zu spät war …
Auf dem Vorplatz der Ranch stand Suzan mit ein paar Arbeitern zusammen. Ich wollte ihr nichts unterstellen, aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass sie auf mich gewartet hatte. Fast so, als habe sie vermutet, dass ich aus irgendwelchen Gründen nicht nach Hause kommen würde. Als ich ausstieg, sah sie demonstrativ auf ihre goldene Uhr. Gut, ich hatte vielleicht eine Viertelstunde verloren, als ich in der Apotheke gewesen war, aber das war nun wirklich kein Grund für einen mahnenden Blick wie diesen. Suzan entließ ihre Arbeiter mit einem letzten kurzen Befehl und die Männer zerstreuten sich.
»Hi«, sagte ich und schwang meine Tasche über die Schultern.
»Da bist du ja.« Wie immer konnte ich nicht richtig erkennen, ob sie verärgert war oder ob sie einfach nur so streng wirkte, weil die Sorgen im Moment immer größer wurden. Suzan hatte eine Art, ihre wahren Gefühle zu verstecken, die es oft schwierig machte, ihr offen gegenüberzutreten. Ich wusste, dass sie eine gute Beziehung zu mir aufbauen wollte, ebenso wie ich auch, doch wir hatten es uns beide nicht leicht gemacht. Und es schien immer noch, als ob wir uns umkreisten wie zwei Wölfe, die nicht wirklich wussten, wie sie miteinander umgehen sollten.
»Wir müssen reden«, sagte sie und ging voraus.
Ich wusste, was jetzt kam. Wenn Suzan mich so ansah, wurde ich für gewöhnlich in ihr Arbeitszimmer zitiert. Ich musste mich vor den beeindruckend breiten Eichenschreibtisch setzen und sie würde dahinter Platz nehmen wie eine Königin, die Hof hielt – die Hände sorgsam über einem dicken, in Leder gebundenen Rechnungsbuch verschränkt, mit steif gebügelter Bluse und einem strengen Blick. Ich wusste, dass ihre Arbeiter sie respektierten und gleichzeitig fürchteten. Auch ich hatte manchmal Mühe, ihr standzuhalten. Suzan nahm die große Verantwortung, die sie gegenüber ihren Pferden und den Arbeitern hatte, sehr ernst. Sie sicherte hier eine Menge Jobs und sie arbeitete Tag und Nacht hart dafür, all das, was sie von ihren Eltern übernommen und aufgebaut hatte, am Laufen zu halten, obwohl sich die Natur derzeit mit aller Kraft gegen sie gewandt zu haben schien.
»Setz dich, bitte.« Wie erwartet, nahm sie hinter ihrem Schreibtisch Platz. Ich ließ meine Tasche auf den Boden sinken. Eigentlich hatte ich gehofft, ich würde Macy kurz sehen, doch die Tür zur Küche war geschlossen gewesen. Vermutlich war Macy zum Einkaufen nach Odessa gefahren. Das tat sie häufig montags, um die Wochenvorräte der Ranch aufzustocken. Da die Ranch jedoch mehrere Pick-ups besaß, war mir nicht aufgefallen, ob einer fehlte oder nicht.
»Es gibt Neuigkeiten und außerdem müssen wir noch mal über Samstagabend reden«, sagte Suzan und faltete in bekannter Manier ihre Hände über dem ledernen Rechnungsbuch.
»Du warst am Wochenende ziemlich durcheinander, und ich wollte dir einfach etwas Zeit geben, um alles zu verdauen, aber jetzt …« Sie brach ab, als suche sie nach den richtigen Worten. Dann sah sie mir wieder direkt ins Gesicht. »Wir haben Interessenten für eins der Gästezimmer, ein Paar in den 50ern. Sie sind Autoren und recherchieren für ein neues Buch.« Sie seufzte. »Wir brauchen das Geld und ich habe zugesagt. Sie haben erst mal für drei Wochen gebucht, aber mit der Option zu verlängern. Du weißt, wir nehmen Rücksicht auf deine Situation, aber …«
»Das ist lieb, aber das ist wirklich nicht mehr nötig«, unterbrach ich sie. »Ich habe kein Problem mit Gästen im Haus.«
Suzan schien erleichtert. »Wirklich? Das ist gut. Dann können wir jetzt zu einem anderen Thema kommen, das du dir vermutlich schon denken kannst. Was ist wirklich passiert auf der Landstraße?«
Ich wollte gerade Luft holen und ihr erneut die Geschichte mit den Feuerwerkskörpern auftischen, als sie einfach weitersprach. »Vor ein paar Jahren sind hier schon einmal Jugendliche überfallen worden. Wir wissen nicht, wer es war – Leute aus Odessa, Saisonarbeiter, die hier auf irgendeiner Ranch gearbeitet haben –, was weiß ich. Jedenfalls sind sie mit vorgehaltenen Waffen bedroht worden und es wurde sogar ein Auto gestohlen. Den Jugendlichen nahm man Bargeld und Handys ab. Es ist schon einige Zeit her, deshalb erinnert sich vermutlich kaum noch jemand daran, aber ich weiß es noch sehr genau. Ich sehe die Kratzer auf deinen Armen. Richard hat mir erzählt, wie Noemi zugerichtet war. Dass sie aussah, als habe man sie in den Dreck geworfen. Er hat auch diesen Dean gesehen, wie er auf seinem Motorrad davongebraust ist. Seine Kleidung war zerrissen und er schien sogar zu bluten. Eure Wagen standen da, als seid ihr mitten auf der Landstraße angehalten worden. Wenn euch jemand überfallen hat, dann ist das keine Schande. So was passiert auf einsamen Landstraßen immer wieder. Erst recht, bei dem Chaos, das im Moment in Littlecreek herrscht. Du musst dich dafür nicht schämen und mir irgendeine Geschichte von Feuerwerkskörpern erzählen. Klar, Bobby von der Tucson-Ranch hat irgendwas von Lichtern erzählt, aber der hat ab 12 Uhr mittags grundsätzlich mindestens eine Promille Alkohol im Blut und würde wahrscheinlich auch von fliegenden bunten Kühen erzählen, wenn man ihn ließe.« Suzan schloss mit ihrer Rede, indem sie ihre Hände löste und sich dann über den Tisch zu mir beugte. »Geht es dir wirklich gut? Fehlt dir etwas? Möchtest du vielleicht Anzeige erstatten? Brauchst du ein neues Handy oder kann ich sonst etwas tun?«
Damit hatte ich nicht gerechnet. Eigentlich hatte ich wieder Vorwürfe erwartet. Doch sollte ich Suzan wirklich die ganze Wahrheit erzählen? Eigentlich hatten Noemi und ich vergangenen Samstag nach Odessa fahren wollen, um Richard einzuweihen. Richard, der zu einhundert Prozent auf Suzans Seite stand, der ihr alles erzählte und der seine Frau sicher nicht anlog, selbst wenn wir ihn darum gebeten hätten. War vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt?
»Ich weiß, dass du im Moment viel verdrängst«, redete Suzan plötzlich weiter. »Das ist auch okay. Aber wenn ich dir irgendwie helfen kann, und sei es auch nur mit einem neuen Handy, dann mache ich das gern.« Nervös fuhr sie sich durch die Haare. »Aber was viel wichtiger ist, wenn dir wirklich etwas zugestoßen ist, dann solltest du Anzeige erstatten.«
»Nein, das will ich nicht«, stellte ich klar. So wie ich Suzan kannte, würde sie im nächsten Moment trotzdem zum Telefonhörer greifen und irgendeinen »guten alten Freund«, der zufällig der Sheriff von Littlecreek war, anrufen. Und jemanden, der Noemi und mir bohrende Fragen stellte, konnte ich gerade so gar nicht gebrauchen. Noemi wirkte labil, und ich rechnete damit, dass sie tränenüberströmt zusammenbrechen würde, sollte man sie nur einmal streng ansehen.
»Nein, alles ist gut«, sagte ich erneut. »Es war einfach nur ein dummer Zwischenfall, ein Streich. Das Wetter hat verrücktgespielt und vielleicht haben diese Kids das ausgenutzt, um sich einen Spaß zu erlauben, keine Ahnung. Jedenfalls war es sehr dunkel und Dean … Er wollte uns nur helfen.« Ich musste mir schnell irgendetwas ausdenken, was einigermaßen plausibel klang. »Er hat sich mit einem der anderen Typen geprügelt. Und als Noemi einen von ihnen beleidigt hat, wurde sie dafür in den Dreck gestoßen.«
»Und wie habt ihr sie in die Flucht geschlagen?«
»Das war Dean«, sagte ich und dann lächelte ich möglichst gequält. »Er kann schon ziemlich krass sein, wenn er muss.«
Suzan nickte vielsagend. Ihr Blick verriet, dass sie durchaus davon ausging, dass Dean ein Messer im Stiefel mit sich herumtrug. »Willst du wirklich keine Anzeige erstatten? Das geht auch gegen Unbekannt.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, nein, ich will einfach nur Gras über die Sache wachsen lassen. Es war gut, dass Richard gekommen ist. Er war eine tolle Unterstützung.«
Auf Suzans Gesicht erschien ein kleines Lächeln. So wie immer, wenn Richards Name fiel.
»Richard hat gesagt, ihr saht wirklich sehr verschreckt aus. Und warum ist Dean einfach davongefahren?«
Ich zuckte die Schultern. »Du weißt doch, wie er ist. Er ist ein Einzelgänger.«
Suzan zog eine Augenbraue hoch. »Eigentlich weiß ich nicht, wie er ist. Ich kenne ja nur die Gerüchte, aber sie zeichnen schon ein deutliches Bild.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen. Suzan warf mir unter gesenkten Lidern immer wieder einen kurzen Blick zu, doch ich wusste, dass sie über Dean nachdachte und über die Frage, wie er wohl zu mir stand. Schließlich hatte er mich schon auf der Ranch besucht. Und wenn Suzan eins und eins zusammenzählte, musste ihr auch klar sein, dass er nicht zufällig auf der Landstraße gewesen war, um uns zu helfen.
Davon abgesehen hatte Macy, die viel feinere Antennen als Suzan besaß, garantiert gemerkt, dass zwischen Dean und mir irgendetwas lief. Und so wie ich sie kannte, hatte sie die ein oder andere Bemerkung dazu fallen lassen. Und Suzan, die grundsätzlich alles ernst nahm, hatte sich so ihre Gedanken gemacht.
»Ich möchte helfen«, sagte ich, damit sie das Thema endlich fallen ließ. Suzan sah mich fragend an.
»Du hilfst doch. Du kümmerst dich um deine kleine Stute Snow.« Mein Herz machte einen Satz, als sie ›deine‹ Snow sagte. Die Stute mit dem Fell so weiß wie Schneeflocken, die einfach aus dem Himmel gefallen zu sein schien … Sie war mir so sehr ans Herz gewachsen, dass ich mich kaum an die Zeit erinnerte, als sie noch nicht in mein Leben getrabt war.
»Du kümmerst dich gut um sie und Tom ist sehr zufrieden mit dir. Und auch in dem schlimmen Sturm hast du deine Frau gestanden. Im Moment habe ich keine weiteren Aufgaben für dich.« Suzan wusste, dass ich Angst vor den großen Quarter Horses hatte, die sie züchtete. Deshalb sollte ich mich ausschließlich um Snow kümmern, während ich mit den anderen Pferden nicht wirklich viel zu tun hatte.
»Nein, warte, ich …« Ich war mir sicher, dass es meinem Gemütszustand guttun würde, wenn ich etwas mit den Händen machte. Außerdem hatte ich noch Zeit, bevor Simon mit dem Football-Training fertig war. Und die konnte ich sicher besser nutzen, als unentwegt auf mein Handy zu starren und darauf zu warten, vielleicht doch noch ein Lebenszeichen von Tammy oder eine Nachricht von Dean zu bekommen. Suzan schien etwas überfordert.
»Wir holen jetzt gleich die Pferde wieder rein. Die Sonne war zwei Stunden lang hinter einer Wolkendecke verschwunden, genauso wie heute Morgen. Diese Zeitslots nutzen wir, damit die Tiere wenigstens kurz über die Weiden rennen können. Laut unserem Wetterradar soll es heute Abend noch mal richtig sonnig werden. Das Wetter spielt eindeutig verrückt. Vor ein paar Tagen wurde es früh am Abend schon pechschwarz, jetzt könnte man meinen, wir haben gerade Mittag. Deshalb müssen sie wieder in die Stallungen. Die Pferde, die Verbrennungen haben, sollten mit Kühlgel eingerieben werden. Das ist ziemlich viel Arbeit und wir könnten jede helfende Hand gebrauchen, aber du …« Sie beendete den Satz nicht, stattdessen sah sie mich forschend an. »Du fürchtest dich doch, so nah an die Quarter Horses heranzugehen.«
Da hatte Suzan nicht ganz unrecht. Aber irgendetwas in mir trieb mich dazu, über meinen eigenen Schatten zu springen. Was sollte schon groß passieren? Die Welt stand am Abgrund, Tammy war tot, und ich war komplett verwirrt und hing in den Seilen, weil ich keine Ahnung hatte, was meine Rolle als apokalyptische Reiterin von mir verlangte. Was konnte es da Harmloseres geben, als ein paar Pferde einzureiben? Also sagte ich mit fester Stimme: »Nein, ich will helfen.«
Suzan schien wirklich beeindruckt. »Na, dann.« Sie erhob sich und schenkte mir ein Lächeln. »Sehen wir doch mal nach, ob die ersten Pferde schon zurück in ihren Boxen sind. Tom wird dir zeigen, wie es geht. Du musst keine Angst haben.«
Ich nickte. Und ich hatte keine Angst. Tom war ein hervorragender Lehrmeister. Er war lustig, immer charmant und gleichzeitig hatte alles, was er sagte, Hand und Fuß. Ich vertraute ihm hundertprozentig. Tom kannte jedes der Pferde wie sein eigenes Kind. Bei ihm würde ich nicht in Gefahr sein.
»Ich bin schon sehr gespannt«, sagte ich, als ich Suzan aus dem Büro folgte. Ich freute mich darauf, mich beweisen zu können, und über die willkommene Abwechslung. Und doch konnte ich nicht verhindern, dass ich mich ein wenig vor der eigenen Courage fürchtete.
Gunpowder war das gefühlt riesigste Quarter Horse, dem ich je begegnet war. Tom hinter mir lachte dunkel auf, als ich beeindruckt einen Schritt zurück machte und gegen seine Schulter stieß. Wie automatisch legte er eine Hand um meinen Oberarm, um mich zu stützen.
»Wow.« In seiner Stimme schwang noch immer ein Lachen mit. »Mit seinem Stockmaß von 1,76 Meter ist Gunpowder schon ein großer Junge, aber ein Riese ist er nun wirklich nicht.« Tom schob sich an mir vorbei und tätschelte dem Wallach den Rücken. Passend zu seinem Namen stieg Staub aus seinem braungrauen Fell empor.
»Braver Junge«, murmelte Tom. Dann drehte er sich zu mir. »Sag ihm ruhig Hallo, er beißt nicht.«
Ich, die mit einem ›Stockmaß‹ von knapp 1,66 Meter ein gutes Stückchen kleiner war als Gunpowders Widerrist, umklammerte den Henkel des Kühlgel-Eimers wie einen Rettungsring. Der Kopf des Tieres schien riesig vor mir aufzuragen. Gunpowder zwinkerte mir gutmütig zu, dann neigte er den Kopf und seine Nüstern kamen mir ziemlich nah. Sogar die schienen doppelt so groß wie Snows. Ich löste eine verkrampfte Hand vom Griff und streckte sie vorsichtig aus. Der Wallach ließ seine samtweichen Nüstern über meine Finger gleiten und knibbelte ganz zart an ihnen.
»Na, sieh mal einer an«, erklang es von Tom. »Das war doch ein freundliches Hallo. Ihr scheint euch gut leiden zu können. Kein Grund zur Sorge also, oder?«
Ich zuckte etwas unbeholfen mit der Schulter. Tom hatte mir schon vor fünf Minuten erklärt, dass der alte Wallach die Ruhe in Person war und bei Suzan sein Gnadenbrot gefunden hatte. Wie zur Bestätigung stupste Gunpowder mich noch mal vorsichtig mit seinen Nüstern an. Sein Schnaufen ließ meine Haare wehen.
»Du hast wirklich ein Händchen für Pferde.« Tom nahm mir den Eimer aus der Hand. »Dann wollen wir mal loslegen.« Er riss den Deckel ab und nahm eine Portion des kühlen Gels in seine Hand. Es war in einem zarten Grün eingefärbt und roch angenehm nach Menthol und Aloe Vera.
»Ziehst du keine Handschuhe an?«, fragte ich skeptisch. Tom hatte mir Einmalhandschuhe gereicht, als wir in der Materialkammer nach dem Kühlgel gesucht hatten.
»Ist doch bloß Feuchtigkeitspflege«, sagte er achselzuckend. »Was für Pferde gut ist, kann für Menschen auch nicht schlecht sein.«
Er verteilte das Gel in seinen Handflächen und rieb es dann vorsichtig über Gunpowders Rücken. Ich machte einen Schritt zur Seite, damit der Wallach sich nicht erschreckte. Dann betrachtete ich die verbrannten Stellen, die rosig zwischen seinem Fell hervortraten. Sofort tat er mir leid. Gunpowders Blick folgte mir, als ich mich zu dem Eimer bückte und ebenfalls etwas von dem Kühlgel zwischen meinen Händen verrieb. Es fühlte sich tatsächlich angenehm an – ein bisschen wie eine After-Sun-Lotion, deren kühlender Effekt sofort spürbar war.
»Soll ich dir eine Fußbank holen?«, witzelte Tom. Obwohl es total lächerlich war, hatte er recht. Zwar kam ich mehr schlecht als recht an Gunpowders Rücken heran, aber oberhalb des Widerrists sah ich einfach nicht, wo die Sonne seine Haut verbrannt hatte.
»Bin sofort wieder da«, flötete Tom und klang verdächtig amüsiert. Ich schnaubte und Gunpowder tat es mir gleich.
»Es ist nett, dass du dich auf meine Seite stellst«, murmelte ich. Wieder stupste er mich mit den Nüstern an. »Ich bin noch neu hier«, erklärte ich ihm. »Verzeih mir also, wenn ich manchmal etwas ungeschickt bin.«
Gunpowder stampfte mit dem Huf auf, als wolle er sagen: »So ein Quatsch, mach einfach und dann ist es gut.«
Der Wallach wirkte tatsächlich so ruhig, dass mir Snow dagegen wie ein Temperamentbolzen vorkam. Sie schien immer in Bewegung zu sein, und sei es auch nur, dass sie mit ihrem Schweif nach nicht existenten Fliegen schlug. Gunpowder hingegen stand ruhig und gelassen da und zuckte kaum merklich mit den Ohren, als Tom mit einer kleinen Fußbank zurückkehrte. Ich hatte es bis dahin ja immer noch für einen Scherz gehalten.
»Das darf doch wohl nicht wahr sein«, brummte ich. Tom stellte die Fußbank grinsend vor mir auf den Boden. Gunpowder mit seiner jahrzehntelangen Reitererfahrung schien gänzlich unbeeindruckt.
»Husch, husch«, sagte Tom und bedeutete mir, mich auf die hölzerne Fußbank zu stellen. Ich zögerte kurz, stieg dann aber doch auf den überraschend soliden Holztritt. Der Effekt war wirklich phänomenal. Erst jetzt erkannte ich das ganze Ausmaß des Sonnenbrandes, der den armen Gunpowder quälte.
»Das muss doch schrecklich wehtun«, murmelte ich. Tom reichte mir den Eimer an und noch mal tauchte ich meine Hand in das Gel. »Der Arme. Bekommt er etwas gegen die Schmerzen?«
Tom schüttelte den Kopf, doch sein Blick wirkte sehr ernst. »Nein. Es sei denn, die Stellen entzünden sich, dann werden die Tiere mit einem Antibiotikum behandelt. Aber Zuchtpferde sollen so wenig Medikamente wie möglich erhalten, deshalb beurteilt der Tierarzt alle zwei Tage, welche Pferde medikamentös behandelt werden, und bei welchen es noch erträglich ist.«
»Verstehe. Und bei ihm hier ist es nicht so schlimm?«
»Zum Glück nicht. Aber bei Gunpowder wäre es auch kein Drama, wenn er ein Antibiotikum bekommen würde, weil wir mit ihm nicht mehr züchten. Dr. Braunegger ist ein guter Tierarzt.« Tom sah ernst zu mir hoch. »Er lässt keine Tiere leiden. Wir vertrauen seinem Urteil. Glaub mir, wenn Gunpowder starke Schmerzen hätte, hätte ihm Dr. Braunegger schon längst ein Mittel gegeben, das sie lindert.«
Ich nickte. Den hageren Tierarzt der Ranch hatte ich schon vor einigen Tagen kennengelernt und ihn sofort sympathisch gefunden. Ebenso wie Gunpowder und auch Tom hatte er eine angenehm unaufgeregte Art und sprach leise, aber bestimmt. Ich war mir sicher, dass die Pferde bei ihm in guten Händen waren. Und da auch Suzan schon jahrzehntelang mit ihm zusammenarbeitete, schienen alle auf der Ranch seinem Urteil zu vertrauen.
Als mein Handy in den Taschen meiner Shorts brummte, sahen Tom und Gunpowder neugierig zu mir herüber. Schnell wischte ich mir die rechte Hand an dem Jeansstoff ab, dann zog ich das Telefon hervor. Es war Noemi. »Darf ich mal kurz?«
Tom nickte. »Aber natürlich.«
Ich wollte nicht, dass der Eindruck entstand, dass die Pflege der Tiere für mich nur zweitrangig war. Denn das stimmte nicht. Auch wenn ich immer noch großen Respekt vor den Quarter Horses hatte, waren sie mir in meiner kurzen Zeit auf der Ranch sehr ans Herz gewachsen. Ich hatte mich nie für so tierlieb gehalten, denn in New York hatte ich nicht mehr als einen Hamster besessen. Doch seit ich hier auf dem Land lebte, war ich mir bewusst geworden, wie sehr ich Tiere mochte. Und wie sehr mir ihr Leid das Herz zerriss.
»Hey, was machst du gerade?«, fragte Noemi.
Ich musste grinsen. »Ich stehe auf einer Fußbank und creme einem riesigen Pferd den Rücken ein.«
Für einen Moment war es still am anderen Ende der Leitung. Doch dann hatte Noemi sich wohl wieder gefangen. »Das klingt doch nach Spaß.«
»Ist es auch«, sagte ich. Ich wollte sie schon fragen, warum sie mich anrief, da sprach sie weiter.
»Kann ich gleich doch noch zu dir kommen? Hier spielen alle verrückt. Meine Eltern zoffen sich die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, was los ist. Gerade kam der Paketbote und selbst mit dem haben sie Streit angefangen. Und der Typ hat sogar zurückgeblafft. Ich meine, der liefert seit fünfzehn Jahren Pakete bei uns aus und plötzlich schreien er und meine Mutter sich an. Heute muss irgendetwas im Wasser gewesen sein, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich tierisch genervt. Ich habe Mom schon gefragt, ob es okay ist, wenn ich heute Nachmittag noch ein Stündchen zu dir fahre. Davor schaue ich noch kurz bei Jonah vorbei. Wie wäre es, wenn ich so gegen 17 Uhr bei dir bin?«
Ich überschlug das kurz im Kopf. Dann würde ausreichend Zeit bleiben, um Tom bei der Versorgung der Pferde zu helfen. »Das passt, komm einfach her, wenn du so weit bist.«
»Alles klar. Bis später.« Sie legte auf. Ich hatte das Handy gerade wieder in der Tasche verstaut und Tom wollte irgendetwas sagen, als es schon wieder brummte.
»Na, wir sind aber heute gefragt«, grinste Tom. Ich machte eine wegwerfende Handbewegung und nahm das Gespräch an. Es war Simon.
»Was machst du gerade?«
Oh, ein Déjà-vu. »Ich stehe auf einer Fußbank und reibe einem riesigen staubgrauen Pferd den Rücken ein.« Anders als Noemi war Simon nicht stumm, er prustete sofort los.
»Genial. Finde irgendjemanden, der ein Foto davon macht.«
»Moment.« Ich zog den Hörer von meinem Mund weg. »Tom, machst du gleich mal ein Foto von mir?«
»Na klar.«
»Okay, wird gemacht«, wandte ich mich an Simon, während ich Tom ein »Daumen hoch« zeigte.
»Soll ich gleich noch vorbeikommen? Wir wollten uns doch endlich mal um das Projekt mit den Wildtiertränken kümmern. Ich dachte mir, es wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, für etwas Abwechslung zu sorgen. Mit den Händen zu arbeiten, hilft schließlich, den Kopf für einen Moment zum Schweigen zu bringen.«
Es war unheimlich, wie ähnlich Simon und ich uns waren. Genau dasselbe hatte ich vor einigen Stunden auch schon gedacht. Aber was war mit Noemi? Würde sie uns begleiten? Wir hatten gar nicht besprochen, was wir machen würden, aber ich nahm automatisch an, dass sie mir helfen wollte herauszufinden, wer uns am Samstagabend angegriffen hatte und was es eigentlich mit Tammy in ihrer Rolle als Engel Michael auf sich hatte. Ich beschloss, es darauf ankommen zu lassen. Vielleicht könnten wir uns zu dritt einfacher absprechen. »Noemi kommt um 17 Uhr vorbei, dann bin ich fertig mit den Pferden. Willst du dich uns anschließen? Wir könnten gemeinsam überlegen, was wir machen.«
»Okay.« Simon klang irgendwie vage. Vermutlich konnte er sich nicht vorstellen, dass Noemi mit uns irgendwo in der Pampa aus alten Ölfässern gebaute Tiertränken aufstellte. Doch schließlich sagte er: »So machen wir’s. Dann sprechen wir einfach noch mal, wenn Noemi auch da ist. Ich bin um 17 Uhr bei dir.«
»Super«, sagte ich. »Ich freue mich.«
»Ich mich auch«, erwiderte er. »Bis dann.«
Wir legten auf und ich steckte das Handy wieder weg. Tom hielt demonstrativ einen Moment lang inne, als würde er schon wieder mit einem neuen Anruf rechnen. Das war natürlich nicht der Fall und er ließ übertrieben resigniert die Schultern hängen.
»Wie? Das war’s schon? Und ich dachte, ihr Teenager steht permanent miteinander in Kontakt.« Ich musste lachen und fast wäre ich von meiner Fußbank gefallen. Wie automatisch legte ich eine Hand auf Gunpowders breiten Rücken, rutschte aber an dem kühlenden Gel ab.
»Ups«, japste ich und konnte mich in letzter Sekunde noch fangen. Tom war schon herbeigeeilt und hatte den Arm ausgestreckt, doch das war nicht nötig. Ich stand wieder aufrecht.
»Kannst du surfen?«, fragte er und hatte eine Augenbraue hochgezogen. »Du hast ja den Gleichgewichtssinn eines Ninjas.«
So hatte ich Tammy manchmal genannt. »Nein, das war jetzt wirklich Zufall«, sagte ich leise, weil der Gedanke an Tammy mir einen schmerzhaften Stich versetzte.
»Hey, alles okay?«, fragte Tom, der sehr viel sensibler war, als er sich den Anschein gab.
»Ja, alles gut.« Ich gab mir einen Ruck. »Lass uns weitermachen.«
»Wir sind mit Gunpowder fast fertig«, sagte Tom, obwohl ich ihm ansah, dass er mir nicht glaubte. »Ich hätte da noch einen Kandidaten. Der ist zwar etwas kleiner, aber genauso charmant und liebenswürdig.«
»Sorry, Tom«, sagte ich möglichst lässig, »dich creme ich nicht ein.«
Tom brach in wieherndes Gelächter aus und Gunpowder gab ein begeistertes Schnauben von sich. Offensichtlich gefiel es ihm, wenn die Menschen in seiner Umgebung gute Laune hatten. »Du bist so ein Scherzkeks«, brummte Tom kopfschüttelnd. Er schnappte sich den Eimer und ging an mir vorbei zum Ausgang der Box.
»Schnapp dir dein Fußbänkchen und folge mir. Wir wollen ja, dass du rechtzeitig frei hast, um dich mit deinen unzähligen Freunden und Verehrern zu treffen.«
»Hey«, sagte ich grinsend. »Nur keinen Neid.« Doch Tom war schon in der Stallgasse verschwunden und ich hörte ihn leise lachen. Ich schnappte mir mein Fußbänkchen und nahm die Verfolgung auf.
»Bis dann, Gunpowder!« Schnell zog ich die Boxentür hinter mir zu. Ich nahm mir vor, den gutmütigen Wallach bald mal wieder zu besuchen.
Als um 17 Uhr Simon und Noemi auf der Ranch eintrafen, hatte ich es sogar geschafft, vorher noch Snow einen Besuch abzustatten und eine kurze kalte Dusche zu nehmen. Außerdem platzte ich vor Stolz. Ich hatte nicht nur eins der riesigen Quarter Horses erfolgreich behandelt, nein, ich war nun fast zum Profi geworden. Tom hatte mir anerkennend auf die Schulter geklopft und ich schwebte seitdem ein paar Zentimeter über dem Boden.
Wenn mir vor einem Jahr jemand erzählt hätte, ich würde schon bald in Shorts und Sneakern auf einer Fußbank stehend riesige graubraune Pferde eincremen, ich hätte mich kaputtgelacht und ihn für verrückt erklärt. Nun hatten Tom und ich sogar ausgemacht, dass ich morgen wieder helfen würde. Auch Simon entging der Glanz in meinen Augen nicht.
»Und?«, fragte er, als er mich in seine Arme zog. »Konntest du ein paar Pferde versorgen?«
Ich nickte und mein Strahlen wurde sogar noch breiter. »Es hat sogar richtig Spaß gemacht. Und die Fußbank ist so praktisch.«
Er lachte und küsste mich auf den Scheitel. »Gut gemacht, kleines Großstadtmädchen.«
In diesem Moment rauschte auch Noemi in ihrem Cabrio heran. Wegen der bereits wieder vom Himmel brennenden Sonne hatte sie ihr Verdeck geschlossen. Als wir ihr nur Minuten später von unserem Plan erzählten, schien sie, wie erwartet, nur mäßig begeistert. »Ich werde zu einem Häufchen Asche verbrennen. Habt ihr mal nach oben gesehen?«
Simon schien ernsthaft darüber nachzudenken und war vermutlich auch bereit, das als Argument gelten zu lassen. Aber ich ließ nicht so schnell locker. »Ich ziehe mir gleich noch ein Langarmshirt über. Wenn du magst, leihe ich dir eins. Und für alle anderen Bereiche gibt es Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50. Wir können bestimmt auch noch einen Hut für dich auftreiben. Und beim Arbeiten werden wir sicherlich Handschuhe tragen, also sind sogar deine Hände vor der Sonne geschützt.« Ich sah Noemi abwartend an.
»Na gut«, brummte sie. »Warum gehe ich nicht gleich in einem Taucheranzug los?«
Ich sah sie eindringlich an. »Sind dir die Tiere egal? Sie verdursten.«
Das schien auch bei Noemi einen Nerv zu treffen. Sie schluckte und ihr Blick wurde plötzlich weich. »Nein, natürlich nicht.« Sie gab sich einen Ruck.
»In Ordnung. Dann lass uns zusehen, dass wir uns Schutzkleidung anziehen, und los geht’s.«
Noemi und ich wollten gerade ins Haus gehen, als Macy durch die Tür trat. Sie trug ein kariertes Spaghettiträger-Kleid und dazu Flip-Flops in Neonpink. Ihre leicht gewellten dunklen Haare hatte sie bei der Hitze hochgesteckt und mit einem bunt gemusterten Tuch umwickelt. Mal wieder sah sie aus, als wäre sie einem alten Film entsprungen. Sie war so eine zauberhafte Person, aber ich hatte bis jetzt noch nicht mitbekommen, ob sie in einer Beziehung war. Sie lebte hier auf der Ranch, und ich hatte sie noch nie gefragt, was sie an ihrem freien Tag unternahm. Eine Frau wie sie war eigentlich viel zu liebenswert, um allein zu sein. Ich nahm mir vor, sie irgendwann mal vorsichtig darauf anzusprechen.
»Kinder, was habt ihr vor?«, flötete sie und stemmte eine Hand in die Taille. »Ihr seht so aus, als ob ihr etwas ausheckt.«
Simon lachte, Noemi sah tatsächlich etwas ertappt aus und ich grinste. Vermutlich war Noemi einfach viel zu sehr geschädigt durch ihre Eltern. Sie schienen alles, was Noemi unternehmen wollte, grundsätzlich für fragwürdig oder überflüssig zu halten. Doch bei Macy hatte sie nichts zu befürchten, und ich hatte nicht vor, ein Geheimnis aus unseren Plänen zu machen.
»Wir wollen gleich Wassertränken für Wildtiere aufstellen. Aber vorher ziehen Noemi und ich uns eben noch um, damit wir vor der Sonne besser geschützt sind.«
»Das finde ich toll«, sagte Macy und klang wirklich begeistert. »Mich wundert nur, dass Suzan euch Wasser bereitstellt, wo das doch schon für die Pferde so knapp ist.«
»Nein, nein«, warf Simon ein. »Einer der Brüder meines Vaters betreibt außerhalb von Odessa eine Ranch. Er ist sehr im Tierschutz engagiert, und nachdem ich mit ihm gesprochen habe, hat er uns einen großen Wassertank gesponsert. Das hat er schon mal gemacht und ich bin ihm echt dankbar dafür. Das Lieferunternehmen hat den Tank schon in der Gegend abgestellt, wo wir die Tränken aufbauen wollen. Dort können wir das Wasser dann ganz einfach abzapfen, und der Tank wird wieder abgeholt, wenn er leer ist.«
»Das ist wirklich großzügig«, sagte Macy. »Du hast ja tolle Verwandte.«
Simon grinste. Dann sah er zu mir. »Wollt ihr los, Mädels?«
»Genau … richtig«, sagte ich und packte Noemi am Arm. »Dann beeilen wir uns jetzt, damit wir gleich losfahren können.«
»Sehr schön«, meinte Macy. »Ich bringe euch ein paar Flaschen Wasser zum Wagen. Mit welchem fahrt ihr?«
Simon hob den Arm. »Wir nehmen meinen. Ich weiß schließlich, wo wir hin müssen.«
»In Ordnung«, erwiderte Macy. »Ich bin gleich wieder da.«
»Danke«, sagte Simon. »Das ist wirklich total nett.«
»Danke, Macy«, sagte auch ich und drückte kurz ihren Arm, bevor ich ihr mit Noemi ins Haus folgte.
Wir fuhren in Richtung des Waldgebiets, in dem ich das erste Mal auf die Raben getroffen war. Ich kämpfte das ungute Gefühl in der Magengegend herunter. Zum Glück zog Simon uns ein bisschen mit unserer »Verkleidung« auf. Anders als wir, die sich darum bemüht hatten, dass am Oberkörper kein Quadratzentimeter Haut mehr zu sehen war, trug er nur ein T-Shirt mit kurzen Ärmeln. Er schien sich nicht mal eingecremt zu haben, denn er roch nicht nach Sonnencreme.
Seit wir uns kennengelernt hatten, hatte seine Haut eine tief goldene Bräune angenommen, die ihm wirklich ausgezeichnet stand. Ich hatte ihn noch nie mit einem Sonnenbrand gesehen. Er schien zu der kleinen Gruppe glücklicher Menschen zu gehören, für die dieses Wort ein Fremdwort war. Noemi hingegen hatte eine gerötete Nase, die sich an der Spitze schon leicht zu pellen begann. Ich war noch weitestgehend verschont geblieben, doch nach meinem gestrigen Spaziergang mit Snow war auch meine Haut am Dekolleté rötlich verfärbt.
»Ist es noch weit«, maulte Noemi und holte demonstrativ ihr Handy hervor. Zwar zog sie eine Show ab, aber vermutlich war alles irgendwie angenehmer, als aus dem Fenster zu sehen und einen Tierkadaver nach dem anderen ausmachen zu müssen. Noemi folgte meinem Blick. Sie saß zwischen mir und Simon auf der Bank des Pick-ups und hatte mittlerweile schmollend die Arme übereinander gekreuzt. »Warum räumt die eigentlich niemand weg?«
»Sie räumen sie weg«, sagte Simon in seiner bekannt ruhigen Art. »Ich habe mit Dad gesprochen, doch die Patrouille, die sich um die Instandhaltung der Straßen kümmert, kommt kaum noch hinterher. Die Männer haben erzählt, es sähe aus wie ein Massaker. Es ist wirklich schlimm …« Seine Stimme wurde immer leiser.
Er wollte noch etwas sagen, aber vor uns in der Ferne tauchte plötzlich ein großer weißer Van auf. Er sah weder aus wie ein Wagen der Post noch eines Paketdienstes, und wir erkannten auch keine Embleme der Universität von Odessa. Stattdessen war der Wagen mit kreischenden Farben und einem Logo verziert, das mir nichts sagte.
»Was wollen die denn hier?«, blaffte Noemi schließlich.
»Wer soll das sein?« Simon hielt den Blick fest auf den Van gerichtet, der nun immer näher kam.
»Das ist das Logo von WTV. Einem überregionalen Fernsehsender«, antwortete Noemi fachmännisch. »Was haben die hier zu suchen?«
»Na ja, vermutlich hat denen irgendjemand gesteckt, was hier abgeht.« Ich sah sie an. »Die Politik mischt sich kaum ein, da wäre es doch der nächste logische Schluss, die Presse darauf aufmerksam zu machen, um so Druck auszuüben.«
»Hier aus dem Dorf war es garantiert niemand.« Simon klang absolut überzeugt.
»Vielleicht waren es die Leute von der Uni?«, überlegte Noemi laut.
Ich sah sie forschend an. »Ich kann mir kaum vorstellen, dass die in Ruhe ihre Arbeit erledigen und ihre Proben nehmen können, wenn um sie herum tausend Leute mit Kameras springen. Das wäre doch total kontraproduktiv. Die wollen sicher ihre Ruhe haben und haben erst recht keine Lust darauf, dass ihnen die Leute alles platt trampeln, was sie als Indizien sammeln könnten.«
Das schien Noemi zu überzeugen. »Na gut, dann war es vielleicht irgendein Tourist, der die Presse alarmiert hat. Kann doch sein? Oder sie haben sich irgendwelche Instagram-Kanäle angeschaut und sind über die Fotos gestolpert. Ich weiß, dass einige der jüngeren Kids Fotos der verendeten Tiere bei Instagram hochgeladen haben. Wenn sie in den Redaktionen Leute sitzen haben, die nach neuen Storys Ausschau halten, wird doch irgendjemand früher oder später auf so was aufmerksam geworden sein.«
Das klang einleuchtend. In diesem Moment passierte der Wagen uns. Auf dem Dach hatte er einige große Antennen und vorne erkannte ich zwei dunkel gekleidete Personen. Gleich dahinter fuhren noch zwei kleinere PKWs, ebenfalls mit dem Logo des Senders versehen.
»Wo einer ist, da kommen bald noch mehr«, unkte Noemi mit düsterer Miene.
»Wenn es die Politik wachrüttelt, dann soll es uns recht sein. Oder?« Ich sah von Noemi zu Simon.
»Irgendetwas muss geschehen.« Simon hatte die Hände um das Lenkrad gekrampft und starrte geradeaus. Ich war mir sicher, dass er all das Leid und Elend, was Littlecreek bereits zugestoßen war, Revue passieren ließ, denn sein Blick war so ernst, dass ich ihn am liebsten in den Arm genommen hätte, um ihn ein wenig zu trösten.
Als wir ankamen, befanden sich bereits einige Helfer vor Ort. Unsere Truppe war bunt gemischt. Ich erkannte ein paar Schüler aus Simons Klasse, aber es waren auch Ältere dabei. Wie üblich glitt mein erster Blick zum Himmel, als ich aus dem Pick-up rutschte. Die Angriffe der Rabendämonen hatten mich dazu gebracht, jedes Mal, wenn ich einen Raum oder ein Auto verließ, ängstlich nach oben zu sehen. Doch der Himmel war klar und ohne jedes Wölkchen.
Obwohl es schon halb sechs am Abend war, brannte die Sonne immer noch gnadenlos herunter. Die meisten unserer Mitstreiter waren verhüllt, als wollten sie mit einer Karawane quer durch die Sahara reisen. Einige hatten sogar Tücher um ihre Köpfe gebunden. Wieder mal fühlte ich mich, als würde ich langsam, aber sicher in einem Katastrophengebiet wohnen. Ich verstand nicht, warum wir kaum Hilfe von außerhalb bekamen. Mein Blick glitt zu Simon, der in Shorts und T-Shirt irgendwie deplatziert wirkte. Er trug nicht mal ein Basecap.
»Bist du feuerfest, oder was, Mann?«, begrüßte ihn einer seiner Teamkollegen und haute ihm donnernd auf die Schulter.
Simon winkte bescheiden ab. »Ich kriege halt einfach keinen Sonnenbrand.«
Damit schien das Thema für alle erledigt. Ich hingegen betrachtete kritisch seinen Rücken. Die Sonne, wegen der selbst hartgesottene Farmarbeiter lange Ärmel trugen, schien ihm überhaupt nichts auszumachen.