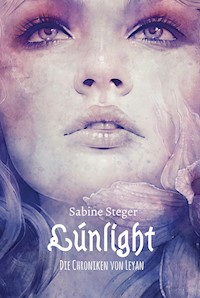
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Ich werde das alles hier zerstören." DIE WAHL ZWISCHEN ZWEI VERFEINDETEN RASSEN, EINE LIEBE ENTGEGEN ALLER VERNUNFT UND EIN MÄDCHEN, DAS DIE WELT VERÄNDERN WIRD. Das Leben der 17-jährigen Sulay wird komplett auf den Kopf gestellt, als sie von einer Gruppe fremder, magiebegabter Krieger, die sich selbst Feyj nennen, in eine ihr völlig unbekannte, wenngleich mystisch faszinierende Welt entführt wird. Gemeinsam mit anderen menschlichen Gefangenen, den Nah'ru, wird sie auf brutalste Weise zur Kriegerin ausgebildet - für einen bevorstehenden Kampf gegen das Dunkel, welches sowohl ihre eigene als auch die Heimat der Feyj zu verschlingen droht. Ihre Liebe zu Muyak, dem Jungen, der sie einst entführt und der ihr damaliges Leben zerstört hat, wird gefährdet durch die Missbilligung zweier verfeindeter Rassen - und durch die ungewisse Zukunft eines dem Untergang geweihten Landes. Als Sulay endlich das wahre Ausmaß der bevorstehenden Katastrophe begreift, versteht sie, dass sie eine Entscheidung treffen muss. Zwischen zwei Welten. Zwei Rassen. Sie muss das Dunkel besiegen, das sie selbst in sich trägt. Sulay weiß nicht, ob sie sich selbst noch trauen kann: Wird sie für die Menschen, die sie liebt, die lang ersehnte Erlösung darstellen? Oder verkörpert sie die Vernichtung, die alles beenden wird? "Du bist das Lúnlight, das sie sucht - ich bin die Zerstörung. Ich bin das Licht."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1710
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
www.tredition.de
Sabine Steger
Lúnlight
Die Chroniken von Leyan
www.tredition.de
© 2015 Sabine Steger
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Umschlaggestaltung: Anna Dittmann, San Francisco
ISBN
Paperback:
978-3-7323-6310-0
Hardcover:
978-3-7323-6311-7
e-Book:
978-3-7323-6312-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
DIE CHRONIKEN VON LEYAN
❖ Lúnlight ❖
Für all diejenigen, die mitgeholfen haben,dass ein Traum Wirklichkeit wird.
Ai danýrnýë vúc lócu sjáh.
Prolog:
Grünliches Mondlicht fiel durch den Eingang der Höhle, als sich der Junge schwungvoll umdrehte und seine dunklen Augen im Schatten so düster wirkten wie das Wasser des Sháná-fír bei Winter. Sein schwarzer Umhang bauschte auf, war schwer von der Kälte des Nebels, der sich in seine Kleidung gesogen hatte.
Es war der Tag der Lúnesce, der ihnen diesen undurchdringlichen, grünen Nebel bescherte, ein stummes, unerklärliches Schauspiel der Natur. Der Tag des Falls der Göttin Rýanië Neiy, die sich zur Rettung der Welt der Menschen geopfert hatte – er konnte mit der Geschichte wenig anfangen; seiner Meinung nach hatten es die Nah’ru nicht verdient, von irgendjemandem gerettet zu werden.
Überall waren als Gedenksymbole Bastkörbe mit bläulich leuchtenden yilh-Blüten zu Wasser gelassen worden und einzelne Blütenblätter schwammen in den Flüssen Leyans dahin, trugen als stille Zeugen einstiger Geschehnisse ihre Botschaft über die gesamte Insel – bis sie untergingen, wann immer der Ruf der Tiefe sie zu sich forderte.
Seine ebenmäßigen, feinen Gesichtszüge lagen unter der Kapuze seines Umhangs verbogen, als er sich mit grimmiger Miene einem weiteren Jungen zuwandte, der sich auf dem kalten, steinernen Boden niedergelassen hatte. „Sie verspätet sich.“ Unverhohlener Vorwurf schwang in seiner Stimme mit, ließ sie dunkler erklingen, als sie sowieso schon erschien. „Du hattest behauptet, sie würde bis zum Mondhoch hier eintreffen.“
Bisher hatte der Blonde gedankenverloren vor sich hingestarrt, lediglich ab und zu die Augen zum fahlen Mond gerichtet, doch nun sah er ihn erstmals direkt an und bleckte die Zähne zu einem angriffslustigen Lächeln – im nächsten Moment hatte er sich gefangen, bemühte sich um einen neutralen Gesichtsausdruck, als er entgegnete: „Du weißt sehr wohl, dass sie sich von uns nicht hetzen lassen wird“, sein Gegenüber funkelte ihn aus stechend blauen Augen heraus an, „also tu‘ mir den Gefallen und halt die Klappe.“
Er schnaubte lediglich in verächtlichem Zorn. „Als ob ich von dir Befehle entgegennehmen würde, Soel.“ Du bist nichts weiter als eine Motte auf der Suche nach Licht. Und eines Tages werde ich dich zu mir in die Dunkelheit reißen.
Vielleicht hatte der Blonde die Verachtung aus seinem Tonfall herausgehört, vielleicht hatte er aber auch einen seiner Gedanken aufgeschnappt – seine Muskeln hatten sich jedenfalls reflexartig angespannt, die Hände waren inzwischen zu Fäusten geballt. Dennoch blieb er ruhig sitzen, verschränkte seine hellen Augen mit den seinen; die Spannung, die zwischen ihnen herrschte, elektrisierte die Luft, setzte ihren Atem in Brand, bis ihn ein grimmiges Lächeln befiel.
Einmal wandte er sich zum anderen Ende der Höhle, lief langsam, provozierend vor Soel im Kreis, bis er abrupt vor seinem Feind stoppte und einen Schritt nähertrat – gerade so weit entfernt stehen blieb, dass Soel noch genügend Luft zum Atmen bekam. „Komm‘ schon, Soel“, raunte er leise, intensiv, „ich weiß, dass du dieses aufgezwungenen Friedens ebenso leid bist wie ich.“ Er entblößte in einer auffordernden Geste seine Zähne. „Warum greifst du mich nicht einfach an?“
Beinahe hätte er gelacht, als seine Provokation den gewünschten Effekt erzielte: Mit einer fließenden Bewegung erhob sich Soel, baute sich mit geballten Fäusten vor ihm auf, bis er das Prickeln seiner Magie unter der Haut spüren konnte.
„Du gehst zu weit Yin. Du entehrst die Götter.“
„Ach, wirklich?“ Yin legte schadenfreudig den Kopf schief.
„Ja, das tust du.“ Soels Stimme klang nun merklich unterkühlt, warnend – aber Yin selbst hatte bereits eine drohende Haltung angenommen, eine explosive Mischung aus angespannter Elektrizität und ruhiger Erwartung. Abschätzig musterte er seinen Gegner von oben bis unten – es war das eisige Lächeln eines Kriegers, in dem sich die Vorfreude auf gegnerisches Blut an seinen Händen widerspiegelte.
Soel tat sich ebenfalls schwer, seine Finger ruhig zu halten, nur locker auf dem Schwertgriff – die alte Feindschaft zwischen ihnen beiden saß zu tief, um sie von einem Tag auf den anderen hinfortzuwischen. Und er wusste, dass Yin selbst an ihrem höchsten Feiertag keine Skrupel kennen würde, ihn anzugreifen und seine Leiche anschließend der Göttin –
Er ließ den Gedanken gleiten, als Yin ohne Vorwarnung auf ihn zugeschossen kam. Das Langschwert hatte er in einem eleganten, tödlichen Bogen erhoben, richtete es zielsicher auf Soels Kehle. Soel war sich bewusst, dass er zu Boden gehen würde, sollte er diesen Hieb nicht parieren.
Und da zog er selbst das Schwert, ließ sich reflexartig in eine tiefe Abwehrstellung fallen, um Yins Schwert entsprechend zu empfangen –
Eine dunkelblaue Magiekugel explodierte zwischen ihnen und die Druckwelle schleuderte sie beide voneinander fort, gegen die harten Wände der Höhle, wo sie einige Augenblicke lang benommen liegen blieben.
Instinktiv rappelte er sich wieder auf, selbst wenn grelle Punkte vor seinen Lidern tanzten und richtete abwehrend das Schwert gen Höhleneingang – und steckte es hastig, reumütig wieder weg, als er erkannte, wer ihn so unsanft von Yin getrennt hatte. Lejha – bei der Göttin. Sie wird uns den Kopf abreißen, weil wir in ihrer Höhle einen Kampf begonnen haben.
Die Schamanin war in festliche, reich mit Schriftzeichen bestickte Kleidung gehüllt. Auf ihrer hellblauen Tunika erkannte er goldene, eingearbeitete Fäden, die sie leuchten ließen wie die Göttinnenschwester Hayóna Nyx persönlich. Auf Höhe ihrer Brust waren mit rotem Garn die Symbole der Gottheiten eingenäht: Ein Kreis, von dem diagonal zwei Striche wegführten und ein darunter platziertes X, von dem rechts und links waagrechte Striche ausgingen – nur sie durfte die Zeichen der Göttinnen so offensichtlich tragen; eine Bestätigung, dass sie als einzige mit den Geistern und Ahnen Leyans in Verbindung stand. Wie bedeutungsvoll dieser Tag doch für sie sein muss. Ob sie den Schmerz Hayónas über den Verlust ihrer Schwester am eigenen Leib spürt?
Nagend befiel ihn das schlechte Gewissen; am Tag der Lúnesce galt strengstes Kampfverbot, wurde selbst von den verfeindetsten Clans eingehalten. Nur wir beide haben die alte Fehde nicht überwinden können.
Schuldbewusst wandte er den Kopf und suchte Yins Blick – doch dieser stand nur mit gerecktem Kinn und vor der Brust verschränkten Armen hinter ihm und sah die Schamanin an, als erwarte er eine Herausforderung.
Lejha hingegen warf ihnen beiden einen vernichtenden Blick zu und erhob anschließend das Wort. Ihre sonst so warme und offene Stimme klang nun kalt und zweischneidig wie eine Klinge: „Das nächste Mal werde ich treffen.“ Ihre hellen Augen wurden überraschenderweise eine Spur dunkler, wandelten sich von dem hellen Grün eines Waldsees in ein dunkles Smaragd. „Ihr beschmutzt den Namen der Gefallenen.“ Sie machte eine Geste zur Huldigung der Göttin und hastig tat Soel es ihr gleich – aus dem Augenwinkel erkannte er, wie Yin sich ihnen anschloss. Wenngleich mit deutlich weniger Begeisterung, mit einem feinen Ausdrucks des Spotts in den Augen, der ihn abermals zur Weißglut brachte.
„Ich gehe davon aus, dass ihr euch für den Rest der Nacht beherrschen werdet.“ Mit diesen Worten zwängte sich die Schamanin zwischen ihnen hindurch und verschwand um die Biegung einer scharfen Rechtskurve.
Obwohl das ältere Mädchen keinerlei Andeutungen gemacht hatte, verstand Soel augenblicklich, dass sie von ihnen erwartete, ihr zu folgen und so unterdrückte er ein Seufzen und wartete, bis Yin sich dazu entschlossen hatte, voranzugehen – er würde den unberechenbaren Krieger sicherlich nicht hinter seinem Rücken wissen wollen.
An der strafen Haltung von Yins Schultern und dem festen Schritt erkannte Soel, dass Lejhas Worte den Schwarzhaarigen nicht im Geringsten kümmerten. Beinahe hätte er bitter aufgelacht. Yin ist skrupellos. Das ist er schon immer gewesen.
Aber wenigstens er selbst würde sich vornehmen, sich im Laufe der Nacht keine Anmaßung mehr zu Schulden kommen zu lassen – Rýanië hatte zu viel verloren, als dass man ihr Opfer mit Füßen treten sollte.
Auf einmal blieb Yin vor ihm abrupt stehen und er stieß einen mürrischen Zischlaut aus, als er beinahe in den etwas größeren Krieger hineingelaufen war. Genervt spähte Soel an dessen breiten Schultern vorbei – Lejha war nirgends zu sehen. Schien verschluckt worden zu sein von der Wand, die sich direkt vor ihnen im Gestein erhob, massiv und unüberwindlich.
„Na wunderbar“, Yins Stimme triefte vor Sarkasmus, „erst schickt sie uns mit ihrer Magiekugel beinahe ins Reich der Göttin – und jetzt das hier.“ In Yins Aura flackerte Ärger auf, der ihm eine verwegene, unberechenbare Ausstrahlung verlieh – Soel kam nicht umhin, erbost festzustellen, dass der dunkle Krieger bemerkenswert viele Waffen zu ihrem Treffen mitgebracht hatte: Dolche, Messer, Seiran – eine typische Waffe Leyans, bestehend aus einem einschneidigen Ring, der mithilfe eines bestimmten Handschuhs als Wurfwaffe eingesetzt werden konnte – und Chakka, eine kastanienförmige, mit Gift gefüllte Kugel. Zudem war da noch das Langschwert, dessen silberner Knauf hinter seiner Schulter hervorblitzte. Er scheint Lejha herausfordern zu wollen.
Yin musste seinen musternden Blick bemerkt haben – denn er grinste abermals süffisant, wovon sich Soel diesmal jedoch nicht provozieren ließ. Stattdessen spöttelte er leise: „Sag‘ nicht, es gibt bei den Dunklen Klippen keine Illusionszauber, Yin.“ Behutsam fuhr er mit den Fingern über den glatten Stein vor sich – und im nächsten Moment mitten durch ihn hindurch.
Yin hinter ihm lachte amüsiert auf und löste sich lässig von der Wand, an der er bis gerade eben gelehnt hatte. Er hörte, wie er zu ihm schlenderte und sich anschließend ein wenig zu ihm vorbeugte, sodass sein heißer Atem unangenehm über Soels Wange strich. „Natürlich kenne ich Illusionszauber – wenngleich wir uns dort unten wohl eher mit etwas Höherem beschäftigen, als ihr fanyár im Süden.“
„Mit Dunkler Magie“, warf Soel ihm vor, aber wieder lachte Yin nur, bevor er sich grob an ihm vorbeidrängte und den Zauber furchtlos durchquerte.
Tief atmete Soel ein, versuchte seine Wut unter Kontrolle zu bringen und folgte dem Krieger anschließend in den bewohnbareren Teil der Höhle.
Auf der anderen Seite der imaginären Wand wirkte es wärmer; ein kleines Feuer im Kamin spendete gleichzeitig Licht als auch ein beruhigendes Gefühl von Geborgenheit und Soel trat dankbar näher. Vom langen Warten waren seine Finger bereits ganz klamm geworden, fühlten sich seltsam leblos an in seinen schwarzen Lederhandschuhen. Normalerweise hätte die Alltagskleidung der Feyj ihm genügend Wärme gespendet – doch nichts konnte sich dem allgegenwärtigen, göttlichen Nebel entgegensetzen, der das still gewordene Land umschlungen hielt.
Auf den zweiten Blick erkannte Soel unzählige Nischen, die in die Felswand hineingearbeitet worden waren. Sie enthielten allerlei Gläser, Beutel, Grimoires, Nachschlagewerke und zudem noch eine beachtliche Sammlung verschiedener Heilkräuter, von denen Soel viele nicht einmal vom Namen her kannte.
„Ziemlich unhöflich von dir, uns einfach vor deiner Tarnmauer sitzen zu lassen, Lejha-ehrý.“ Soel gefiel der unterdrückt verächtliche Tonfall nicht, mit dem Yin die höfliche Namensendung ausgesprochen hatte und erwiderte kalt: „Scheint die gerechte Behandlung für dich zu sein, nachdem du so gedankenlos die Waffenruhe gebrochen hast.“
„Ach was“, Yin winkte abfällig ab und grinste diabolisch. „Ich habe die Wut in deinen Augen gesehen, Soel – du hättest dich früher oder später auf ein kleines Kämpfchen mit mir –“
„Rivak [Schweigt]. Einzig Lejha vermochte eine solche Intensität in ihre Worte zu legen, dass selbst Yin verstummte und gelangweilt aufseufzte. „Anstatt euch gegenseitig anzugiften, solltet ihr mir besser helfen.“ Wortlos drückte sie ihnen beiden kleine Schalen mit unterschiedlichen Inhalten in die Hand und stapfte anschließend mit wutschweren Schritten zu einem Regal, aus dem sie zwei Mörser hervorzauberte. Ohne hinzusehen warf sie ihnen die Werkzeuge über die Schulter zu und machte sich anschließend daran, die restlichen Zutaten für die Beschwörung aus verschiedenen Ecken ihres Wohnzimmers hervorzusuchen.
Neugierig blickte Soel nun in seine Schale; unverkennbar Maiskörner, die Saat der Sonne. Ich hätte nie erwartet, dass meine Persönlichkeit einmal durch Mais verkörpert werden würde – aber Asche trifft es im Hinblick auf Yin äußerst gut. Abermals warf er dem Schwarzhaarigen einen musternden Blick zu. Weil er nichts errichten, sondern nur zerstören kann.
Mittlerweile hatte Lejha einige faustgroße Beutel zusammengetragen, deren Inhalt Soel lediglich erahnen konnte, da sie bereits durch einen Vorhang in den hinteren Teil der Höhle verschwand. Einige drückende, unangenehme Minuten lang ließ die Schamanin sie beide in feindseligem Schweigen allein, dann kehrte sie schließlich mit einer Steintafel zurück, die einige Vertiefungen in Form der Insignien der Göttinnen aufwiesen. Später würden sie der Schlüssel zur Ahnenwelt sein, den sie so dringend benötigten.
Soel wurde aus seinen Gedankengängen gerissen, als Lejha mit schnellen Schritten auf sie zukam und ihre Arbeit begutachtete. „Ich denke, das wird reichen.“ Mit Erleichterung stellte er fest, dass die Schamanin mittlerweile ein wenig besänftigt wirkte, wenngleich ihre Aura an den Rändern immer noch erregt brodelte. „Folgt mir.“
Hintereinander verließen sie den Wohnraum abermals durch die magische Illusion und begaben sich mit schnellen Schritten auf den Weg zum Ausgang.
Auf der anderen Seite schlug ihm sogleich die Kälte der Nacht entgegen, die er hinter dem geschützten Innenraum so leichtfertig vergessen hatte und hastig zog er seinen Mantel enger um sich, bevor der Nebel auch seine untere Kleidung gänzlich durchnässen konnte.
Sie traten ins Freie und Soel blieb einen Moment lang bewundernd stehen; einzig der leuchtende, lebendig wabernde Nebel durchdrang die Schwärze der Nacht, legte sich über die im Schlaf versunkene Insel, schob sich vor den Mond, wann immer eine besonders heftige Bö ihn in den Himmel erhob.
Er atmete einmal tief ein; die Luft schmeckte nach Vergangenheit, nach Leid – und nach Veränderung.
Hastig setzte er sich wieder in Bewegung und schloss zu den beiden anderen Feyj auf, die den Hügel in der Nähe der Höhle schon zur Hälfte erklommen hatten. Oben angekommen hielten sie ungeduldig inne, um auf ihn zu warten – die Tatsache, dass Yin ihm herablassend entgegenblickte, zerrte an seinen Nerven, doch er ließ sich nichts anmerken.
„Ich hatte bereits angenommen, ein Dämon hätte dich zu sich geholt“, empfing ihn der Schwarzhaarige und die Art, wie er die Silben betonte, verriet Soel, dass Yin dieser Umstand mehr als recht gewesen wäre.
„Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen“, presste er deshalb hervor und wandte sich hastig Lejha zu, die vorsichtig ihre Fracht auf dem Boden ausbreitete: Die Schale legte sie auf dem höchsten Punkt des Hügels ab, dort, wo der Nebel sich in Spiralen in die Lüfte erhob. Sie nahm sein Erscheinen mit einem leichten Kopfnicken zur Kenntnis und Erleichterung durchflutete ihn: In ihren mandelförmigen Augen hatte wieder dieselbe Güte gelegen, die er von ihrem ruhigen Charakter gewohnt war.
Neben dem Mädchen ging Soel in die Hocke und platzierte seine Schale mit geriebenen Maiskörnern an die vorgesehene Stelle auf der flachen Steintafel, die ein schwaches Glühen angenommen hatte, sobald sie unmittelbar mit dem Nebel in Berührung gekommen war.
Als er einen kurzen Augenblick den Kopf hob, hielt er lächelnd inne: Von Lejhas Hügel aus konnte man eine weite, schier endlose Strecke über das Land blicken, das er so liebte. Die Wälder im Süden, die weiten Ebenen im Westen und die Wolfsberge im Osten, welche die Sicht auf die Dunklen Klippen verbargen, die in der Ferne ihre dunkle Energie verströmten.
Er zuckte leicht zusammen, als er Yins argwöhnischen Blick auf der Haut spürte und hastig richtete er die Augen wieder auf die Steintafel, die Lejha unermüdlich für die bevorstehende Aufgabe präparierte: Einige der Pflanzen kannte er; die yilh beispielsweise würde ihnen für die Befragung die nötige Kraft schenken.
„Tretet näher“, vernahm er in diesem Moment die auffordernde Stimme des Mädchens in seinem Geist und er ließ sich gänzlich im Gras nieder, achtete nicht auf die Nässe, die sich an seinen Schienbeinen ausbreitete.
Yin hingegen schien länger zu zögern, ließ sich dann jedoch mit einem leidvollen Seufzen ihm gegenüber nieder, wenngleich er seine Hand in der Nähe seiner Messer ruhen ließ – was Lejha ein missbilligendes Zischen entlockte.
„Fasst euch an den Händen“, wies sie an und deutete auffordernd auf ihrer beider Finger, bis sie sich dazu durchgerungen hatten, mit sichtbarem Unwohlsein den Kreis zu beginnen. Erst jetzt nahm Lejha den Inhalt der Schalen zur Hand, ließ sie, durchmischt von einigen Funken ihrer dunkelblauen Magie, über der Steintafel tanzen, die wie zur Bestätigung aufflackerte. Wörter schienen sich in der Luft zu formatieren und Lejha ergriff Soels und Yins freie Hand – urplötzlich spürte er das Knistern der Magie der beiden anderen Feyj auf seiner Haut, fühlte die Energie, die sie drei in ihrem Kreis gefangen hielt. Sie schien sich zu formatieren, auf die Tafel zu konzentrieren, die so bedeutungsschwer zwischen ihnen lag.
Soel kam nicht umhin, Respekt für die Mächte der Schamanin zu verspüren, die so scheinbar mühelos ihre Magie anzapfte und in die Umgebung lenkte, bis ihm von dem Kraftentzug beinahe schwindelte. Es ist ein Glück für uns alle, dass sie stets neutral bleiben muss – niemand hätte auch nur den Hauch einer Chance gegen ihre gewaltige, jahrhundertealte Magie.
Er ließ den Gedanken hastig fallen, als das Mädchen mit klarer, tranceartiger Stimme zu sprechen begann: „Hayóna Nyx, ehrerbietig öffnen wir uns dir. Empfange unsere Seelen –“ Der Rest ihrer Worte verblasste in einem Strudel aus canejischen Silben und Tönen, die er noch nie vernommen hatte. Dennoch berührten sie etwas von ihm, ließen ihn in merkwürdig ergriffener Stimmung zurück – bis Lejha ihn aus seiner Starre riss: „Ihr müsst nun eure Cchei miteinander verbinden – nichts darf der Vereinigung eures Geistes mehr im Wege stehen.“
Es war beinahe amüsant, wie Yins aufgesetzte Maske aus emotionsloser Gleichgültigkeit Risse bekam – hätte Soel nicht ebensolchen Unwillen verspürt. Ich soll meinem größten Feind Eintritt in meinen Kopf gewähren?! Lejha schien mit ihrem Widerstand gerechnet zu haben und bedachte sie mit einem solch stechenden Blick, dass er seufzend nachgab, die Schutzschilde um seinen Geist ergeben fallen ließ. Wir sind bereits so weit gekommen. Das hier werden wir auch noch überstehen.
Angestrengt tastete er nach Yins dunkler Aura, die wie Gift für seine eigenen, hellen Farben schien – verbissen kämpfte er sich weiter voran, bis er den Sitz des Ccheis seines Gegenübers erreichte: Ein wirbelndes Chaos aus Dunkelheit, erhellt von nur wenigen Lichtpunkten von Yins Magie.
Kurz darauf verspürte er das vertraute Ziehen in seinem Kopf, als Yin eine Verbindung zu ihm herstellte, die wie ein Fremdkörper durch seine Adern pulsierte; unerwünscht und – mächtig.
Er hielt den Atem an, als er das Ausmaß der Kräfte begriff, die nun durch seinen Körper wogten; gemeinsam mit Yin und Lejha würde er die Welt zu Fall bringen können.
„Sprecht.“ Lejhas Stimme erklang nun lauter in seinem Geist, hallte in jeder seiner Zellen nach wie ein flackerndes Echo und er sammelte sich, konzentrierte sich auf das eine, weshalb sie gekommen waren: „Existiert ein dritter Mýan?“
Die Worte explodierten hinter seiner Schädeldecke, setzten sein Gehirn in Brand, bis er heißes Feuer atmete, das ihm die Lungen versengte – endlich, endlich schien Lejha ihnen die Frage zu entziehen, an die Ahnen weiterzuleiten und eine erlösende Kühle setzte sich in seinem Geist fest, die ihn in die Realität zurückgleiten ließ.
Zaghaft öffnete er die Augen und wandte prüfend den Kopf zu Yin hinüber, der mit einer ungewohnten Ernsthaftigkeit die schwarzen Augen auf Lejha geheftet hatte. Die Schamanin hatte die Lider vor Anstrengung geschlossen und ihre Lippen bewegten sich zu einem ihm unbekannten, überirdischen Takt, bis sie schließlich Buchstaben, Silben, Wörter formten, die immer lauter, gespenstisch den Weg in seine Ohren suchten: „Agua elýía [Es beginnt].“
Wie aus dem nichts zerriss ein Blitz den nebelverhangenen Himmel, erleuchtete einen Herzschlag lang den gesamten Hügel, bevor die knisternde Energie sich mit einem ohrenbetäubenden Knall in der Steintafel entlud, die augenblicklich zu qualmen anfing – bei genauerem Hinsehen erkannte Soel feine Magiefunken, die inmitten der Asche tanzten.
„Sahnai [Seht].“ Lejhas Stimme klang seltsam verzerrt, berauscht von einer Macht, auf die sie keinen Zugriff mehr zu haben schien und eine innere Unruhe erfasste Soel, machte ihn taub und stumm zugleich, als er der Aufforderung Folge leistete –
Umrisse schälten sich aus dem magiedurchtränkten Nebel, formierten sich immer wieder neu, verschwammen, fügten sich letztendlich zu ausdrucksstarken Augen, einer schmalen Nase und vollen, einladenden Lippen. Ein … Mädchen. Er blinzelte verwirrt. Sie muss ein wenig jünger sein als wir, vielleicht 17 yí.
Ein seltsamer Drang manifestierte sich als feines Kribbeln in seinen Fingerspitzen; er wollte die Vision berühren, so als würde er hierdurch einen Beweise für ihre Echtheit erhalten – im nächsten Moment zerfiel das Bild und der Nebel formierte sich neu, bildete einen sichelförmigen Halbmond, der pulsierend leuchtete.
Einen Herzschlag erschien sein Symbol, die aufgehende Sonne über einem weiten Horizont und Yins Blitz an einem sich verdunkelnden Nachthimmel unter dem Mond; es schien, als würde er heller strahlen noch als ihrer beider Insignien, doch die Erscheinung war von solch kurzer Dauer, dass er sich nicht sicher sein konnte.
Allmählich wurde der Rauch von den Winden Leyans davongetragen, ließ sie alle sprachlos und mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend zurück; tiefes Schweigen erfasste sie, als sie jeweils ihren eigenen Gedanken nachhingen und dabei vollkommen vergaßen, dass sie sich noch immer an den Händen hielten, wie Matrosen vor einem heraufziehenden Sturm. Es gibt also einen dritten Mýan. Und es ist ein Mädchen.
Zitternd wanderte sein Blick nach den Sternen, doch durch den allgegenwärtigen Nebel hindurch konnte er nichts weiter als ein fernes Funkeln erkennen. Meine Sonne – ein willkommener, schützender Mantel um unsere Insel. Sein Blitz, der aus dem Inneren heraus die Zerstörung bringt, der Gut und Böse im Gleichgewicht hält – der abnehmende Mond, der so gar nicht in dieses Gefüge passt. Er biss sich auf die Lippe und versuchte vergeblich, einen weiteren Hinweis in dem Rauch zu finden, der inzwischen nutzlos gen Boden sank. Wie soll sie in das von der Göttin errichtete Gleichgewicht passen? Ein Mond – kaltes Licht, stille Unbeteiligtheit. Oder hoffnungsspendendes Licht inmitten der dunklen Schwärze der Nacht?
Dieser Interpretationsansatz würde ihm wohl nur wenig Aufschluss darüber liefern, was von dem Mädchen wohl zu erwarten sein musste. Und dennoch war es so ausschlaggebend, welcher Seite sie angehören würde. Dem Dunkel. Oder dem Licht. Wenn sie wirklich existiert – und demgegenüber hege ich keinerlei Zweifel – dann wird ihr Erscheinen das Schicksal Leyans besiegeln. Sie wird die lang ersehnte Erlösung sein, die uns von den Dämonen befreit.
Oder die alles vernichtende Zerstörung, mit der alles begonnen hat.
Schließlich war es Yin, der seine Hände grob aus ihrem Kreis riss und die Stille unterbrach. „Ich werde sie finden.“ Sein Tonfall klang dunkel und in den schwarzen Augen des Mýan sammelte sich selbst im Nebel keinerlei Licht. „Und ich werde sie töten. Früher oder später – das entscheidet die Zeit.“
Yin erhob sich entschlossen, ließ Soel mit einem kalten, nagenden Gefühl zurück, das sich so sehr nach besorgter Furcht anfühlte, als er sich in den kalten Onyxaugen verlor, die seinen Blick einen Herzschlag lang fesselten. Er wird sie wirklich töten. Er wird sich nicht die Mühe machen und abwarten, auf welcher Seite sie steht.
Und als hätte Yin Soels Gedanken mitbekommen, salutierte er ihm spöttisch und wandte sich anschließend mit wallendem Mantel zum Gehen, verschwand wie ein Dämon in den Schatten, die er seine Heimat nannte. Wo immer der Mýan mit dem geisterhaften Nebel in Berührung kam, wich dieser zurück vor der flammenden Energie, die der Feyj ganz bewusst ausstrahlte; eine stumme Demonstration seiner Macht. Er hat pompöse Auftritte schon immer geliebt. Und an Selbstbewusstsein fehlt es ihm definitiv nicht.
Soel ließ einige Zeit verstreichen, nutze die Minuten, um seine eigenen Gedanken zu ordnen, bevor er sich schließlich an die weißblonde Schamanin wandte: „Ich danke dir für deine großzügige Hilfe, Lejha. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen.“ Er wartete ab, bis das überirdische Funkeln aus ihrem Blick gewichen war und ihre Pupillen ihn wieder zu fokussieren vermochten. Kurz zuckte sie unter seinem eindringlichen Blick zusammen. „Ich werde mir … die Prophezeiung durch den Kopf gehen lassen. Du wirst von mir hören.“
Ruckartig erhob er sich ebenfalls und strich sich mithilfe von ein wenig Magie die Wassertropfen von der Hose, die seine Kleidung hatten steif werden lassen.
Mit einem Kopfnicken nahm das Mädchen schließlich seinen Dank an und sammelte einige Kräuter zusammen, bevor sie mit ruhiger, etwas ausgelaugt wirkender Stimme erwiderte: „Ich werde deine Dankbarkeit an die Göttin weiterleiten.“ Auf einmal blickte sie ihn wieder direkt an und ihre ungeteilte Aufmerksamkeit auf ihm löste einen Schauer in seinem Rücken aus. „Die Geister Leyans mögen dich auf deinem Rückweg begleiten.“
Beinahe hastig wandte sie sich von ihm ab und wandte sich mitsamt der Steintafel ihrer Höhle zu, in der sie verschwand. Aus der Entfernung stellte Soel besorgt fest, dass sie ein klein wenig schwankte; die Kontaktaufnahme mit den Geistern hatte sie offenbar mehr Kraft gekostet, als sie hatte zugeben wollen.
Auch er wandte sich schließlich um, ließ ein letztes Mal seinen umwölkten Blick über das Land schweifen, das er so verzweifelt zu beschützen versuchte. Und was, wenn sie wirklich die Erlösung ist? Was, wenn Yin sie umbringt, bevor sie uns alle erretten kann?
Schweren Herzens machte er sich auf den Rückweg und war sich der Tatsache bewusst, dass er keinen blassen Schimmer davon hatte, wie diese Sache zwischen ihnen dreien einmal ausgehen würde.
Er trieb sein Pferd an, raste pfeilschnell durch die Nacht; noch vor dem Morgengrauen wollte er wieder bei seinem Clan sein; der bereits unruhig auf ihn warten würde. Gemeinsam mit all den Problemen, mit denen er selbst als Anführer und Mýan konfrontiert wurde. Göttin – wird dieser verzweifelte Kampf nach Frieden jemals ein Ende nehmen?
Die lebendigen Augen des Mädchens gruben sich in seine Erinnerungen, waren eine stumme Verheißung auf eine Zukunft, die hinter Rauchwolken verborgen lag.
❖ Teil 1 ❖
Fremde Welten
Deine Aura so warm,
deine Lippen wie Blut,
doch dein eisiger Kuss
erstickt jede Glut
1. Kapitel
„Beeil‘ dich, Sulay – bei dem Tempo werden wir garantiert zu spät kommen.“ Mitten im Lauf hatte sich meine beste Freundin zu mir umgedreht und warf mir nun einen vorwurfsvollen Blick zu – der mich, um ehrlich zu sein, herzlich wenig interessierte. Denn ich will da sowieso nicht hin.
„Ist ja gut …“, erwiderte ich nüchtern und gab mir Mühe, nicht allzu desinteressiert zu wirken, als ich mit wenigen Schritten zu ihr aufschloss. Noch immer konnte ich es nicht fassen, dass sie mich mal wieder zu einer Feier überredet hatte, auf der ich nicht einmal willkommen sein würde. Befänden wir uns gerade nicht mitten auf der Straße … wahrscheinlich hätte ich mich selbst geohrfeigt.
Ich stieß einen langen Seufzer aus und beschleunigte widerwillig meine Schritte, ganz entgegen meines ursprünglichen Vorhabens – denn je später wir ankamen, desto früher konnten wir logischerweise auch wieder gehen. Und vor allem wäre ich nicht länger als nötig gezwungen, Zeit in der Nähe des Gastgebers zu verbringen. So ein oberflächlicher Macho-Idiot. Was fand Acoya nur an ihm?
Sebastian hatte – zumindest für meinen Geschmack – viel zu kurze Haare, eine Knubbelnase und eine äußerst befremdliche Art, jemanden zum Lachen zu bringen. Allein schon der Gedanke an ihn reichte, um mich auf die Palme zu bringen – und selbst wenn böse Zungen das Gegenteil behaupten mochten: Sonst gelang es nur wenigen Menschen, mich derart aus der Fassung zu bringen.
Noch einmal stieß ich gedehnt die Luft aus, als ich mich an einen weiteren Grund erinnerte, warum dieser Abend in meinen Augen keinesfalls eine Wertung über akzeptabel erlangen konnte: Und selbiger Grund manifestierte sich in einem hellgrünen, wogenden Traum aus Samt, wie Coya es auszudrücken pflegte, inklusive acht Zentimeter hohen Stilettos – zweifelsfrei mein Untergang in dieser Nacht. Denn. Ich. Kann. In. High Heels. Nicht. Laufen. Fairerweise sei angemerkt: Oder zumindest nicht, ohne am nächsten Tag mit mindestens fünf Blasen am Fuß, sprich pro Zeh eine, aufzuwachen.
Und bei aller Liebe … was zu viel war, war zu viel. Denn wenn es zwei Dinge auf dieser Welt gab, die ich abgrundtief hasste … dann waren es Sebastian, der vor meinen Augen meine Freundin verführte und Schuhe, mit denen man gut und gerne am Flughafen wegen versuchten Waffenschmuggels festgehalten werden konnte.
Ein weiterer Seufzer stahl sich von meinen Lippen – wenigstens aufgrund von Atemnot werde ich heute Abend nicht kollabieren.
„Ach, Sulay“, meine Freundin grinste mir amüsiert entgegen, „so schlimm, wie du tust, wird es nun auch wieder nicht. Es handelt sich um eine harmlose Feier.“ Ich sah ein neckisches Funkeln in ihren Augen aufblitzen; mittlerweile kannte sie mich gut genug, um zu wissen, wie viel Überwindung mich eine Zusage gekostet hatte.
Dennoch war ich nicht bereit, auf ihre Aufmunterung einzugehen. Denn du hast ja keine Ahnung, wie schlimm es werden wird.
Missmutig kaute ich beim Gehen auf meiner Unterlippe. Meine modebewusste beste Freundin hatte mich nicht einmal mit schlicht offengelassenen Haaren aus dem Haus gelassen; die braun-blonden Strähnen meines mittellangen Haares waren zu einer zugegebenermaßen edel aussehenden Hochsteckfrisur arrangiert worden. Ein absoluter Hingucker – würden mich die lästigen Spängchen nicht bei jeder Kopfbewegung malträtierten wie pickende Vögel. Langsam aber sicher bereitete mir der ungewohnte Druck auf meiner Kopfhaut Schmerzen.
Um es zusammenzufassen: Ich konnte nicht ausdrücken, wie froh ich sein würde, wenn ich endlich wieder bequem vor dem Kamin saß und ein Buch lesen konnte. Nicht mehr und nicht weniger – aber am Tag vor meinem siebzehnten Geburtstag würde mir ein solch ruhiger Abend wie ein Geschenk des Himmels vorkommen. Stattdessen wurde ich mit bereits jetzt schmerzenden Füßen bestraft. Na wunderbar.
Inzwischen waren wir vor Sebastians Haus angekommen, Acoya öffnete das braune Gartentörchen und ließ zielstrebig ein kleines, gepflastertes Wegchen hinter sich. Da scheint sich jemand wie zuhause zu fühlen …
Ich hatte mich in der vagen Hoffnung zurückfallen lassen, dass sie mich vielleicht vergessen würde, wenn ich mich nur unauffällig genug verhielt, aber an der Haustür wartete sie auf mich und bedachte mich mit einem auffordernden Blick. Als ich sie erreicht hatte, schlich sich ein nervöser Ausdruck in ihre Miene.
„Sitzt meine Frisur noch?“, fragte sie mich nun, während sie vorsichtig ihr Haar betastete und ihre Stimme überschlug sich fast vor Aufregung. Ihre dunklen Augen funkelten im diffusen Licht der Lampe am Eingang und ich musste zugeben, wie atemberaubend sie doch aussah. Fast war ich ein wenig neidisch auf ihre dunklere, schokoladenfarbene Haut und ihre leicht schrägstehenden, grünen Augen – aber hastig ließ ich Gedanken dieser Art fallen. Heute werde ich sowieso niemanden zu Gesicht bekommen, der mich interessieren würde.
„Natürlich, Coya“, antwortete ich schließlich brav, auch wenn sie sich wirklich keinerlei Sorgen hätte machen müssen: Meine Mutter hatte auch ihre Haare zu einem geflochtenen Knoten hochgesteckt und diesen anschließend mit ein paar weißen Blüten verziert. Einige gelockte, dunkelbraune Strähnen waren bewusst aus dem Arrangement herausgehalten worden und kringelten sich ein kurzes Stück über ihren entblößten Schultern.
Mein Blick schweifte zu ihrem Gesicht, zu dem in Blautönen gehaltenen Augen-Make-up, das sich wunderbar frisch von ihrer algerianischen Hautfarbe abhob und perfekt zu ihrem gleichfarbigen Kleid passte.
„Kommst du nun?“, riss mich Acoya in die Wirklichkeit zurück, sichtlich erleichtert, dass mit ihren Haaren noch alles in Ordnung schien. Noch immer hörte ich aus ihrer Stimme ein kleines Zittern heraus und sie hielt ihre goldene Clutch wie einen Talisman umklammert.
Ich hingegen erwiderte nichts und schickte lediglich ein Stoßgebet gen Himmel, dass ich diesen Abend so schnell wie möglich hinter mich bringen würde – wenn möglich, ohne dass jemand Bier auf mein neues Kleid verschüttete.
Letztendlich folgte ich meiner Freundin widerstrebend in Sebastians Haus; es war beinahe ungemütlich in modern-kargem Stil eingerichtet und keinerlei Familienfotos, kaum persönliche Gegenstände waren im Hausflur zu erkennen – dafür schlug uns bereits hier wummernder Bass entgegen, der ab und an von lautem Gelächter übertönt wurde. Dubstep – womit hab‘ ich das verdient?
Die Wohnzimmertür stand einen Spalt weit offen und so konnten wir einige Gäste ausgelassen tanzen sehen. Eine Discokugel war an der hohen Decke angebracht worden und durch eine Fensterseite konnte man in den Garten blicken, wo im fahlen Mondlicht ein kleiner Teich auszumachen war.
Kurz drehte sich Acoya noch einmal mit blitzenden Augen zu mir um und ein nagendes Gefühl breitete sich in meiner Magengegend aus. Wenn du mit ihm nicht einen gewaltigen Fehler begehst, Coya …
Doch wieder schwieg ich und behielt meine Bedenken für mich – dieses Thema hatten wir schon so oft durchgekaut und zumindest in dieser Hinsicht besaß meine Freundin den wohl ausgeprägtesten Dickschädel der Welt, gegen den selbst ich, Meisterin der gewonnenen Diskussionen, nichts entgegenzusetzen hatte. Was Liebe nur alles anrichten kann.
Obwohl ich mich nicht wirklich auf den Abend freute, zwang ich mich zu einem matten Lächeln – aber Acoya hatte sich bereits wieder umgewandt und öffnete nach einem tiefen Atemzug schwungvoll die Tür. Mit souveränen, selbstsicheren Schritten betrat sie das Zimmer – mit einer Leichtigkeit, um die ich sie in ihren Peeptoes zugegebenermaßen beneidete. Außerdem hätte ich ihr einen solch forschen Auftritt gar nicht zugetraut.
Auch ich nahm mir noch einmal Zeit zum Atemschöpfen und folgte ihr dann anschließend mit nüchternem Gesichtsausdruck. Missmutig und nicht ganz so schwungvoll.
Wir hatten kaum den überfüllten Raum betreten, da stürmte Sebastian auch schon in Acoyas Richtung; mich hatte er nicht einmal wahrgenommen. Meine Meinung über sein mangelndes Betragen interessierte aber wohl niemanden.
„Acoya – da bist du ja endlich!“, rief der Junge freudig aus und schenkte meiner Freundin eines seiner billig wirkenden Zahnpastalächeln, mit denen er wohl schon die ein oder andere rumgekriegt hatte. Mich hingegen schien er noch immer nicht bemerkt zu haben, obwohl ich mich inzwischen hinter Acoya gesellt hatte; er wirkte viel zu sehr damit beschäftigt, meiner Freundin Komplimente über ihre makellose Erscheinung zu machen. Als ob nicht jeder hier im Raum erkennen könnte, wohin du ihr wirklich schaust.
Aber immerhin besaß ich noch Überlebensinstinkt genug, um in der Situation meine Chance zu erkennen: Verstohlen bewegte ich mich aufs Innere der Tanzfläche zu, um diesem Idioten möglichst aus dem Weg zu gehen. Angespannt hatte ich beinahe mein Ziel erreicht, da rief mir Acoya wild gestikulierend über den allgemeinen Lärm hinweg etwas zu. Die Botschaft war deutlich, auch wenn ich den genauen Wortlaut nicht vernehmen konnte.
Ich verkniff mir eine genervte Miene und setzte mich abermals in Bewegung – ich war mir nicht sicher, wie echt mein Lächeln wirkte, aber immerhin glaubhafter als Sebastians, dessen Mundwinkel bei meinem Anblick verräterisch zuckte. Wenigstens schien er nicht vergessen zu haben, wie ich ihn zur Schnecke gemacht hatte, als er es tatsächlich einmal gewagt hatte, Acoya anzufassen.
„Sulay …“, er legte den Kopf schief und musterte mich von oben bis unten, „ich hätte nicht erwartet, dass du sie begleiten wirst.“ Ich hatte ganz bestimmt keine Wahl.
Ich lächelte in mich hinein, als ich die Bedeutung hinter seinen Worten verstand: Keiner von uns beiden war von der Anwesenheit des jeweils anderen sonderlich begeistert.
„Ich scheine wohl stets für eine Überraschung gut zu sein“, entgegnete ich mit einem feinen Lächeln und beobachtete zufrieden, wie er ob dieser Anspielung getroffen zusammenzuckte – Acoya hingegen schien von meinen Worten alles andere als begeistert und rettete hastig den eigentlichen Gesprächsfaden: „Sie war sehr erfreut, als ich ihr von deiner Einladung berichtet habe.“ Ihr Seitenblick auf mich wirkte eisig und ich war nicht so bescheuert, ihr zu widersprechen, sondern nickte nur brav. Brachte sogar ein kleines, bitteres Lächeln zustande.
Offensichtlich zufrieden mit mir, wandte sich Acoya wieder Sebastian zu, der aufgrund meiner Anwesenheit wenigstens einen gebürtigen Abstand zu ihr hielt.
„Alles Gute“, gratulierte sie und umarmte den großen Jungen kurz, aber herzlich – immerhin besaß er den Anstand, ihr nicht allzu offensichtlich in den Ausschnitt zu starren. Und nur noch einmal zum Mitschreiben: Dieser Kerl nimmt sich wirklich die Frechheit heraus, einen Tag vor mir geboren zu sein.
„Von mir ebenfalls“, presste ich zähneknirschend hervor und schüttelte Sebastian etwas steif die Hand. Eine unleugbare Spannung knisterte zwischen uns beiden in der Luft, die ich einerseits genoss, aber auch fürchtete.
„Danke, Sulay“, erwiderte Sebastian; doch seine Augen lächelten nicht: Wir beide wussten, dass unser Gespräch lediglich darin bestand, um vor Acoya die Form zu bewahren, die wir nicht verletzen wollten. Und das war – igitt – noch eine Gemeinsamkeit zwischen uns.
Aber zumindest hatte ich meinen Sold für diesen Abend nun erfüllt und ich konnte mich nach einer hastigen Verabschiedung zurückziehen. Aus den Augenwinkeln bekam ich noch mit, wie Sebastian Acoya mit einem verwegenen Lächeln zum Tanzen aufforderte – und sie willigte mit einem seligen Gesichtsausdruck ein. Liebe muss wirklich blind machen. Und zudem ein oder zwei Hirnzellen zerstören, so viel steht jedenfalls fest.
Ich arbeitete mich zu einer stilleren Ecke des Raumes vor, in der ein Sofa zur Seite gerückt worden war. Verstimmt ließ ich mich auf das harte Leder fallen. Diese Feier kostete mich wertvolle Zeit, in der ich so viel andere, angenehmere Dinge hätte unternehmen können: Der Farblack meiner Nägel blätterte inzwischen ab und es gab noch eine Reihe CDs, die ich zu einem guten Zweck aussortieren wollte.
Irgendwann meldete sich vehement mein Magen und ich erinnerte mich daran, dass ich leichtsinnigerweise schon seit dem Mittagessen keinen Happen mehr zu mir genommen hatte. Entschlossen stand ich also auf und schlenderte zum Büffet, wo sich belegte Brötchen, Süßes und verschiedenes Obst in kunstvollen Pyramiden türmte. Letztendlich entschied ich mich für ein Paprika-Frischkäsebrötchen und ein paar Trauben – vom Alkohol ließ ich bei meiner geringen Größe lieber die Finger.
Insgeheim hoffte ich, dass es Acoya ebenfalls mit alkoholischen Getränken nicht übertreiben würde – ich hatte wenig Lust, sie den ganzen Weg mit sowieso schon schmerzenden Füßen nach Hause zu bugsieren.
Trotz meines kleinen Imbisses hatte meine Laune mittlerweile einen beachtlichen Tiefpunkt erreicht: Acoya schien Sebastian offensichtlich mir vorzuziehen und Lust zu tanzen verspürte ich in diesen Schuhen ebenfalls wenig. So schlenderte ich scheinbar ziellos zurück zu meinem Sofa und nippte gelangweilt an meinem Orangensaft. Immer wieder ertappte ich mich dabei, wie ich mein Smartphone hervorzog, um die Uhrzeit zu überprüfen. Kurz nach zehn.
Auf Dauer ließ mich das flackernde Licht der Diskokugel müde werden und ich lehnte mich ein wenig zurück, um mein Gewicht von den pochenden Füßen zu verlagern. Irgendjemand hatte langsamere Musik hervorgezogen und als ich einen prüfenden Blick zu Acoya hinüberwarf, lag sie mit einem feinen Lächeln in Sebastians Armen – dessen Hände lagen gerade noch so hoch, dass ich ihn nicht offen wegen Angrabscherei zur Rede stellen konnte.
Eilig sah ich weg – ihr eng umschlungener Anblick war sicherlich keine Wohltat für meinen Puls.
Der Sänger stimmte gerade endlich den letzten Refrain an, da trat ein Klassenkamerad auf mich zu und setzte sich mit einer solch anzüglichen Lässigkeit zu mir aufs Sofa, dass mir augenblicklich wieder die Galle hochkam. „Hast du Lust zu tanzen?“ Er legte einen Arm um mich und ich spürte seinen alkoholisierten Atem auf meiner Haut. „Nur wir zwei?“ Ganz sicher nicht.
Allem Anschein nach war er jedoch bereits so bedudelt, dass er meinen Gesichtsausdruck nicht richtig deuten konnte – denn im nächsten Augenblick hatte er mich bestimmerisch auf die Tanzfläche gezerrt, wo er abermals den Arm um mich legte.
Ich war mir nicht sicher, wie ich in diesem Moment dreingeblickt haben musste – aber meine Miene löste bei ihm offenbar enorme Erheiterung aus, denn er beugte sich grinsend zu meinem Ohr herunter und raunte: „Ganz locker, Süße. Ich beiße nicht.“ Der Geruch seines teuren Parfüms stieg mir in die Nase und obwohl wirklich wenig Platz um uns herum war, drückte er sich unnötig eng an mich. Du beißt möglicherweise nicht – aber vielleicht tue ich das ja.
Gerade so beherrschte ich mich und presste scheinbar gequält hervor: „Tut mir leid – mir ist schwindelig.“ Vehement machte ich mich von ihm los. „Ich werde draußen ein wenig nach Luft schnappen.“ Es handelte sich zugegebenermaßen um keine sonderlich glaubhafte Ausrede – aber darauf hatte ich auch gar nicht erst Wert gelegt. Soll dieser Kerl ruhig merken, wie wenig ich von seiner Gesellschaft halte.
Schleunigst bahnte ich mir einen Weg zur Terrassentür, die ich ohne zu zögern aufschob.
Kühle und klare Nachtluft umstrich mein Gesicht und ich atmete zittrig ein; die verbrauchte, stickige Luft im Wohnzimmer hatte mir üble Kopfschmerzen beschert und meine Füße brannten wie nach einem Dauerlauf.
Langsam folgte ich dem Verlauf eines kleinen Gartenpfades um das Haus herum, bis ich an einem mit Rosensträuchern umrandeten Kirschbaum anlangte, ganz in der Nähe des Zauns. Erschöpft lehnte ich mich gegen den Stamm und schloss, geschützt unter den ausladenden Zweigen, für einen Moment die Augen. Ein kleines Lächeln schlich sich in meine Mundwinkel. Ich bin schon immer eine Einzelgängerin gewesen. Und die Stille des Gartens ist mir tausendmal lieber als das Gedränge in Sebastians Wohnzimmer.
Hier draußen war die Musik nur noch als ein fernes Wummern zu vernehmen und der aufgegangene Vollmond tauchte die etwas zerzaust wirkenden Rosensträucher und den rostigen Springbrunnen in ein kühles, silbriges Licht – ein klein wenig Magie. Dies könnte einer dieser Momente sein, in dem etwas passieren wird. Irgendetwas Außergewöhnliches.
Einem kindlichen Drang folgend lauschte ich, aber nichts als das leise Plätschern des Teiches durchbrach die Stille um mich herum.
Gelangweilt schloss ich abermals die Augen und versuchte, nicht auf den pochenden Kopfschmerz zu achten – ein leises Rascheln erregte meine Aufmerksamkeit; es war nichts weiter gewesen als ein kaum vernehmbares Knacken, so als sei jemand auf einen Ast getreten. Dennoch durchrieselte mich ein Schauer und einen Herzschlag lang vibrierte eine ferne Ahnung durch die Luft – ich ließ den Blick schweifen, aber selbst nachdem ich einige Minuten lang angestrengt und überraschend furchtlos meine Umgebung inspiziert hatte, blieb alles ruhig. Bloße Einbildung. Als ob in unserem verträumten Städtchen etwas Spannendes passieren würde.
Dennoch stieg ein nervöses Kichern in meiner Kehle auf. Manchmal sah ich wirklich Gespenster – ein Umstand, den mir Acoya des Öfteren amüsiert und ein klein wenig spöttisch bestätigte.
Ich vergaß den Vorfall und lehnte mich abermals seitlich an den Baum hinter mir. Hoffentlich ist es bald vorbei – ich habe herzlich wenig Lust, mir hier die Füße –
Auf einmal vernahm ich einen zischenden Luftzug hinter mir.
Seitdem ich mich an den Baumstamm gelehnt ein wenig ausgeruht hatte, musste bereits eine geraume Zeit vergangen sein – irgendwann weckte mich eine vor Unglaube schrill klingende Stimme: „Oh, mein Gott, Sulay – was ist denn passiert?!“ Acoya.
Verwirrt blinzelte ich und mit Verwunderung stellte ich fest, dass meine Pupillen einige Sekunden benötigten, um das besorgte Gesicht meiner Freundin fokussieren zu können. „Gar nichts, ich –“, versuchte ich es mit einer Antwort, doch sie ließ mich gar nicht erst zu Wort kommen: „Sulay – du blutest!“ Vorsichtig strich sie mir mit dem Finger über den Nacken – als ihre Finger abermals in mein Gesichtsfeld gerieten, waren sie tatsächlich rot befleckt. Was …?
Mehr verwirrt und benommen als entsetzt griff ich mir nun selbst an meinen hinteren Halsansatz und erspürte eine raue Wunde, die trotz ihrer geringen Größe gehörig blutete und mein neues Kleid mit leuchtenden, verräterischen Tropfen durchnässte. Meine Mutter wird begeistert sein.
„Wie hast du das denn wieder hingekommen?“ Energisch packte mich Acoya an den Schultern und zwang mich so, sie direkt anzusehen; ein klein wenig Wut verdunkelte ihre hellen Augen und es tat mir ein wenig leid, ihr mal wieder Sorgen bereiten zu müssen.
„Ich werde sofort Sebastian hierher holen – er wird uns einen Verbandskoffer besorgen“, verkündete sie mir nun und sie schob meine Proteste mit einer herrischen Handbewegung fort, „dreh‘ dich mal zu mir her.“
Mit unwohlem Gefühl in der Magengegend kam ich ihrer Aufforderung nach – nicht, ohne einmal zusammenzuzucken, als das wilde Pochen in meinem Nacken urplötzlich einem stechenden Schmerz wich. Er zog sich fort, mein Rückgrat entlang, setzte meinen Rücken in Brand, bis ich mich fühlte, als sei das himmlische Feuer persönlich in mich gefahren.
Acoya hinter mir stieß einen missbilligenden Laut aus. „Das muss sofort desinfiziert werden. Komm!“ Ohne mir auch nur den geringsten Hinweis auf den Zustand meines Nackens zu geben, stiefelte sie auch schon voran und zog mich entschlossen mit sich ins Haus. Geschickt umrundete sie mit mir im Schlepptau die Tanzenden, bis wir vor der Tür, die in den Flur führte, kurz innehielten.
„Warte hier – ich bin gleich wieder da.“ Sie wandte sich hastig um und verschwand abermals inmitten der anderen Gäste, während mir nichts Gutes schwante. Ich könnte Sebastians gehässiges Gesicht nicht ertragen.
Nach einigen Minuten, in denen der Schmerz in meinem Nacken alles andere als nachließ, kehrte sie gemeinsam mit Sebastian zurück und ich war drauf und dran, auf dem Absatz kehrtzumachen. Immerhin schien sich meine Freundin im Haus mittlerweile so gut auszukennen, dass es die Hilfe des Gastgebers nicht benötigt hätte, um den Verbandskoffer ausfindig zu machen.
„Folgt mir“, wies Sebastian uns an; selbst in meinem benebelten Zustand fiel mir auf, wie wichtigtuerisch sein Gang auf mich wirkte – und wie sehr ich seine bloße Anwesenheit doch verabscheute.
Wir wurden in ein kleines, im mediterranen Stil gehaltenes Bad geführt, das mit einigen Muscheln und stilisierten Meerestieren, die die Wände schmückten, seltsam einladend wirkte im Vergleich zu den kargen Möbeln im Eingangsbereich und dem modernen Wohnzimmer.
„Setz‘ dich.“ Geschäftig wies Acoya auf den Rand der Badewanne und ich nahm etwas schwindelnd Platz; mein Kopfschmerz hatte sich inzwischen ins Unermessliche gesteigert, ganz zu schweigen von dieser seltsam nebeligen Trägheit, die meine Glieder befallen hatte. Wäre ich mir nicht ganz sicher, lediglich Orangensaft getrunken zu haben – ich hätte vermutet, dass mir jemand etwas ins Glas hinzugegeben hat.
Als ich Sebastian mit wachsender Gereiztheit dabei zusah, wie er einige Zeit lang in einem kleinen Badschrank herumkramte, hoffte ich inständig, dass die ganze Prozedur so bald wie möglich vorüber sein würde. Endlich hatte er einige Salben und Pflaster hervorgekramt und ich drehte ihnen den Rücken zu, damit sie besser sehen konnten. Ich konnte hören, wie sie beide scharf die Luft einsogen.
„Dein gesamter Nacken wirkt aufgeschrammt, Sulay“, begann Acoya nun und die anfängliche Wut über meine Unvorsichtigkeit war vollkommen blanker Sorge gewichen, „und dein Kleid ist vollkommen hinüber.“
Ungläubig runzelte ich die Stirn – es war bereits öfters vorgekommen, dass ich die Ursache meiner Verletzungen nicht hundertprozentig zuordnen konnte – aber das hier schien selbst mir unerklärlich.
Gedankenverloren ließ ich den Abend Revue passieren, wie ich mich von meinem Klassenkamerad losgemacht hatte und in den Garten geflüchtet war – da war dieses Rascheln in den Büschen gewesen, ein eisiger Hauch einer stillen Furcht in meinen Knochen – aber ich hatte nichts bemerkt.
Mir kam der Kirschbaum in den Sinn. Vermutlich habe ich mich an der Rinde verletzt, als ich mich angelehnt habe. Vermutlich bin ich vor Erschöpfung eingeschlafen und habe mir irgendwo die Haut aufgerissen.
In diesem Moment streckte mir Acoya einen kleinen Spiegel entgegen und hielt ihn so, dass ich meinen blutigen Rücken wie zum Beweis selbst betrachten konnte. Tiefe Schnitte hatten eine faustgroße Wunde gerissen, aus der noch immer Blut strömte – es wirkt, als habe man mir etwas willentlich ins Fleisch getrieben. Und anschließend mit voller Wucht herausgerissen.
Ich fröstelte, als die Kopfschmerzen an Bedeutung zunahmen, ein Wispern … – ich vertrieb den Gedanken, verbannte meine blühende Fantasie in einen Winkel meines Selbst, wo sie mich nicht von der Realität ablenken konnte. Ich werde mir später den Baum und seine Umgebung noch einmal genauer ansehen. Denn nichts ist unerklärlich.
„Das wird jetzt gleich ein bisschen brennen“, informierte mich Sebastian nüchtern – ich war so sehr in meine Gedanken vertieft gewesen, dass mich das heiße Brennen des Desinfektionsmittels vollkommen unvorbereitet traf. Ein zweites Mal zuckte ich zusammen, biss die Zähne aufeinander, als der Alkohol sich tief in die Wunde grub.
„Schmerzt es sehr?“, sprach mich Acoya sanft an und ich erkannte Mitgefühl in ihren grün schimmernden Augen, als sie sich zu mir vorbeugte und eine Hand in meine Richtung streckte – aber ich wich aus. Vor Sebastian würde ich keine Schwäche zeigen.
„Nein, es … geht schon“, presste ich deshalb tapfer hervor, obwohl ich spürte, wie heiße Wundflüssigkeit den Saum meines Kleides benetzte – es fühlt sich nicht an wie eine normale Wunde. Es wirkt wie bloßes Feuer, durchzogen von einem Fluch aus Schmerz.
Unwohl rutschte ich auf dem Rand der Badewanne hin und her – inzwischen war mir die Situation wirklich unangenehm. Noch nie bin ich von einer Party mit einer Verletzung solchen Ausmaßes zurückgekommen.
„Trotzdem bin ich der Meinung, wir sollten die Wunde mit etwas abdecken – nicht, dass sie sich noch entzündet“, lenkte Acoya meine hinfort geglittene Aufmerksamkeit auf sich – beinahe musste ich schmunzeln, als ich erkannte, dass sie herausfordernd die Hände in die Hüften gestützt hatte und mich von oben herab anfunkelte, als erwartete sie weitere Proteste meinerseits. Sie sieht so sehr aus wie ihre Mutter Shila – sie wird einmal eine hervorragende Ärztin sein.
Mit derselben Strenge wandte sich meine Freundin anschließend an Sebastian, der etwas verloren in der Nähe der Tür von einem Fuß auf den anderen trat: „Vielen Dank – aber warte jetzt bitte draußen.“
Offensichtlich erleichtert verschwand der Junge auf den Flur und erst jetzt erlaubte ich es mir, meine Schultern zu entspannen, dem Schmerz nachzugeben, der mich in seinem Bann hielt.
Behutsam klebte Acoya meine Wunden ab und wir versanken beide in nachdenklichem Schweigen; ihre intensiven Seitenblicke sprachen jedoch Bände – irgendwie fühlte ich mich schuldig, weil ich ihr die Ursache für meine Verletzung nicht zu erklären vermochte.
Endlich traten wir zurück auf den Flur – und fanden ihn zu Acoyas Enttäuschung leer vor; Sebastian musste des Wartens leid gewesen und deshalb schon vorgegangen sein.
Gemeinsam traten wir den Weg zum Wohnzimmer an und obwohl sie Eskapaden dieser Art von mir gewohnt war, spürte ich ihren Blick diesmal länger und bohrender auf meinem Rücken ruhen; es wirkte wie eine Erlösung, als wir endlich vor der Tür stehen blieben. Zu meinem Glück zwang mich Acoya nicht dazu, ihr auf die Tanzfläche zu folgen, um sich zu verabschieden. Durch die Verletzung in meinem Rücken und die Blasen an meinen Zehen war ich für den Abend bereits genug gestraft. Auf Geläster und wilde Spekulationen kann ich gut und gerne verzichten.
Ich verspürte allerdings wenig Lust, im stickigen Hausflur zu warten und dabei doch noch einem der Gäste zu begegnen und so schlug ich entschlossen den Weg zum Kirschbaum ein, der sich still und unschuldig vor mir in den Nachthimmel erhob.
Aufmerksam beugte ich mich vor und begutachtete die Rinde des Baumes von oben bis unten, strich wachsam mit den Fingern über die kalte, raue Oberfläche – wirklich: Ungefähr auf der Höhe meines Rückens befand sich ein Nagel. Verkehrt herum in der Rinde steckend. Was –?!
Ich zog die Augenbrauen zusammen und verkniff mürrisch den Mund: Irgendwie wirkte die Situation wenig real auf mich, seltsam verzerrt – wer bitte steckte einen Nagel mit der Spitze nach außen zwischen die Rinde eines Baumes?
Dennoch war ich wild entschlossen, der schleichenden Furcht, die mich bei dieser Entdeckung befallen hatte, Herrin zu werden und so sah ich suchend nach oben – und entdeckte ein kleines Vogelhäuschen, das versteckt zwischen einigen Zweigen angebracht worden war. Vielleicht war jemand zu faul gewesen den übrig gebliebenen Nagel aufzuräumen – Sebastian würde ich wirklich alles zutrauen.
Ich schnaubte entrüstet, wenngleich mitsamt meines Atems ein klein wenig Angst von mir glitt, die Raum ließ für meinen rationalen Verstand. Es wundert mich nicht, dass doch letztendlich er schuld daran ist, wenn mein Nacken mir nun mindestens während der kommenden vierzehn Tage gehörige Schmerzen bereitet.
Verstimmt entfernte ich den Nagel aus der Rinde, an dessen Spitze ich im fahlen Mondlicht wirklich ein klein wenig Blut ausmachen konnte. Gut sichtbar platzierte ich ihn auf einem Fensterbrett des Hauses; vielleicht würde er Sebastian irgendwann an seine Unaufmerksamkeit erinnern.
Merklich erleichtert durch die plausible Erklärung meiner Verletzung wandte ich mich um, als auch schon Acoyas aufgebrachtes Rufen zu mir herüberschallte. Offenbar hatte sie ihre Verabschiedung beendet und war inzwischen auf der Suche nach mir und so antwortete ich ihr hastig.
In einiger Entfernung sah ich sie fröstelnd am Gartentor stehen und ich eilte durch den stillen Garten zu ihr hinüber; eine kleine Freude hatte mich erfasst: Endlich konnte ich den Lärm und den Trubel hinter mir lassen, konnte mich darauf konzentrieren, den Schmerzen keine Beachtung mehr zu schenken.
Ich bemerkte das grüne, kastanienförmige Etwas nicht, das nur einen Fuß vom Stamm des Kirschbaumes entfernt lag – genauso wenig wie die schwarz behandschuhten Finger, die blitzschnell nach ihm griffen, sobald ich mich abgewandt hatte.
Als wir die gepflasterte Straße in Richtung meines Hauses einschlugen, beruhigten mich der volle Mond über mir und die nächtliche Stille um uns herum im Laufe der Zeit. Die allgegenwärtige Ruhe schien selbst die Wunde an meinem Nacken ein wenig zu kühlen – aus irgendeinem Grund hatte mich diese Tageszeit schon immer in ungekannter Weise fasziniert: Sie forderte Aufmerksamkeit, Feingefühl – verursachte ein adrenalingeschwängertes Kribbeln auf meiner bloßen Haut.
Aber die Stille sollte nicht lange währen: Bald begann Acoya in den höchsten Tönen von der Feier zu schwärmen: „… und als er mich dann an sich gezogen hat –“
Ich hörte nicht mehr zu, konnte diese Sebastian-ist-ja-so-unglaublich-toll-Schwärmerei nicht länger ertragen – es würde mich in diesem Moment sicherlich den letzten noch vorhandenen Nerv kosten. Es mag banal erscheinen, aber … der verwunschene Anblick unseres kleinen Städtchens bei Nacht vermag mich mehr zu beruhigen als alles andere.
Leicht verstimmt ließ ich mich mit der Intention, ihrem Redeschwall endlich zu entkommen, einige Meter zurückfallen – aber Acoya schien gar nicht zu bemerken, dass die Wörter, die von ihren Lippen glitten, einem unaufhaltsamen Wasserfall glichen. Sie erzählt zu viel. Vom falschen Thema.
Nach einigen Minuten schaltete mein Hirn vollkommen ab und die Silben verklangen ungehört in der Luft vor meinen Ohren – meine Sinne schweiften ab, wandten sich den Schatten um uns herum zu, der Dunkelheit und der Nacht, die mich zu sich zu rufen schien. Was sind wir Menschen doch für armselige Geschöpfe; schwächlich am Tag und blind bei Nacht.
Beinahe wäre ich gestolpert – der Gedanke erschreckte mich, wühlte mich merkwürdigerweise auf – abermals zuckte ich zusammen, diesmal jedoch aus einem anderen Grund.
Wir hatten eine schmale Seitenstraße passiert und wandten uns diesmal der Hauptstraße zu – als ein sanftes Leuchten in der Dunkelheit hinter mir meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Misstrauisch kniff ich die Augen zusammen, starrte in das undurchdringliche Dunkel hinter mir – zwei nahe beieinander liegende Lichtpunkte, ein grimmiges Starren – der Blick zweier Augen. Auf mir.
Mein Herz begann wie mit eingesperrten Schwingen zu flattern, aber als ich weiterhin in die Gasse hinter mich starrte, erkannte ich nichts als fließende Schwärze, erfüllt von geschlucktem Licht. Ob diese eingebildeten Gespenster ein Omen sind für mein neues Lebensjahr?
„Sulay – was machst du denn schon wieder?“, riss mich Acoyas verärgerte Stimme aus meiner Trance; in ihrem Tonfall lag Argwohn. „Warum bleibst du stehen?“
Ihr Blick verdeutlichte mir, dass ich für heute wohl bereits für genügend Trubel gesorgt hatte – und so schloss ich hastig zu ihr auf und ignorierte das Prickeln in meinem Nacken, das Gefühl eines Blickes, der meine Haut in Brand setzte. Irgendetwas trieb mich fort von der Abgeschiedenheit, die ich zuvor noch genossen hatte: Eine hauchdünne, kaum vernehmbare Stimme riet mir, dass es gefährlich war, Licht in jegliches Dunkel zu bringen. Weil manche Geheimnisse zu meiner eigenen Sicherheit ihr Sein als diese wahren mussten.
Bei meiner Freundin angekommen erkannte ich, dass diese sich fröstelnd die Schultern rieb und unruhig auf den Zehenspitzen auf und ab wippte; inzwischen war eine frische Brise aufgekommen und auch ich verspürte den Drang, endlich wärmende vier Wände betreten zu können.
Mit fahrigen Fingern legte ich mir meine Jacke um und kaschierte damit zudem gekonnt das weiße Pflaster in meinem Nacken, den befleckten, leicht eingerissenen Stoff an meinem Rücken.
Plötzlich spürte ich Acoyas musternden Seitenblick auf mir. „Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, du würdest in deiner eigenen Welt leben, Sulay. Als würdest du in den Schatten etwas erkennen, was für uns andere verborgen bleibt …“ Ihr nachdenklicher, distanzierter Gesichtsausdruck behagte mir nicht, machte mich unruhig – „Komm‘ jetzt“, meinte sie schließlich nur. „Wenn wir nicht um halb zwölf zuhause sind, werden deine Eltern nicht gerade froh darüber sein. Du weißt doch, dass sie uns morgen früh wecken werden, um dir zu gratulieren.“
Kurzentschlossen ergriff sie meinen Arm und zog mich beinahe im Stechschritt hinter sich her – den Blasen an meinen Füßen tat dieses hohe Tempo gar nicht gut, aber ich schwieg beharrlich; es schien mir nicht der geeignete Zeitpunkt für eine Diskussion.
Noch einmal wandte ich den Kopf zu der kleinen Gasse; eine dunkle Vorahnung schien über mir zu schweben, machte mir die Kehle eng – aber nichts wies auf etwaige Verfolger, auf eine stumme Bedrohung hin und so stieß ich resigniert einen Seufzer aus. Ich sollte meiner blühenden Fantasie wirklich weniger Beachtung schenken.
Nach wenigen Minuten gelangten wir am Dorfrand an und blieben nach einigen Metern vor einem großen, eisernen Tor stehen, auf dem in verschnörkelten Buchstaben Hohenstein Manor geschrieben stand.
Mit einem Anflug von Stolz ließ ich meinen Blick über das anmutige, mit rötlichen Backsteinen errichtete Gebäude schweifen und die Stallungen, die sich dahinter in den Himmel erhoben.
Ich drückte die Klinke herunter und betrat den sandigen Pfad, der zum Anwesen führte. Im silbrigen Mondlicht schälte sich ein kleines Wäldchen aus der Dunkelheit heraus, der See, den ich auf dem gesamten Anwesen am liebsten hatte. Das Land mitsamt dem Adelstitel hatten meine Großeltern bereits von ihren Eltern geerbt; mein Stammbaum reichte mütterlicherseits bis ins späte achtzehnte Jahrhundert.
Dennoch machte ich mir wenig aus meinem Adelstitel, Sulay, Fürstin von Hohenstein, den weiträumigen, teuer eingerichteten Zimmern oder dem Geld, das meine Familie ihr Eigen nannte; wir alle verbrachten unsere Zeit am liebsten in Stallklamotten bei unseren Zuchtpferden oder aber in lockerer Freizeitkleidung, während wir am nahe gelegenen Weiher picknickten. Was würde mir das ganze Geld nützen ohne eine Familie, die bedingungslos zu mir hält?
Mein wahrer Schatz war jedoch mein kleines, hellbraunes Quarter Horse Cochiti, das ich wirklich über alles liebte. Es war das einzige Pferd, das nicht zum Verkauf bestimmt worden war, nachdem ich es liebevoll mit der Flasche aufgezogen hatte – seine Mutter war bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Gemeinsam mit meiner besten und auch wohl einzigen, wirklichen Freundin Acoya liebte ich es, im Frühling im Wald auszureiten, nur zu zweit und mit den Tieren.
Inzwischen ließen wir die sorgfältig gestutzten Rosensträucher zu beiden Seiten des Weges hinter uns und an der Eingangstür angekommen angelte ich nach dem Schlüssel, den ich mit den kalten Fingern kaum aus meiner Jackentasche befördern konnte.
Im nächsten Moment wurde die Tür jedoch schwungvoll geöffnet und unser Butler James empfing uns mit seinem üblichen, herzlichen Lächeln. „Fräulein Hohenstein – schön, dass Sie von der Feier zurück sind.“
Er wich zur Seite, damit wir eintreten konnten und ich warf ihm im Vorbeigehen einen mahnenden Blick zu. „Ich habe dir bereits tausendmal eingebläut, dass du mich nicht siezen sollst, James!“ Herausfordernd stützte ich die Hände in die Hüften, um bei meiner geringen Grüße von einem knappen Meter sechzig wenigstens halbwegs autoritär zu wirken – was bei James jedoch noch nie auf fruchtbaren Boden gefallen war. „Und ein Fräulein bin ich erst recht nicht.“
In seinem warmen Blick erkannte ich, dass ich für ihn wohl immer die kleine, süße Lady bleiben würde, als die er mich im zarten Alter von fünf Sommern kennengelernt hatte. Schon seit ich denken konnte, war der mittlerweile altersgraue Herr bei meiner Familie angestellt und ersetzte mit einer beruhigenden Selbstverständlichkeit den Opa, den ich niemals kennengelernt hatte.
„Nein, das bist du wirklich nicht – viel zu temperamentvoll.“ Obwohl James‘ Entgegnung als Tadel gedacht war, blitzten seine grauen Augen auf und ein kleiner Schimmer trat in seinen Blick, als sich Amüsement in seine Züge legte.
„Womit du unbestreitbar Recht hast, James“, kommentierte Acoya und ich war froh, dass sie den Vorfall von heute Abend mittlerweile mit Humor zu nehmen schien.
Im Anschluss bat uns James darum, uns die Jacken abnehmen zu dürfen – doch ich hielt ihn hastig davon ab, um das blutige Kleid zu verbergen und dem armen Mann zu solch später Stunde eine unnötige Aufregung ersparen zu können.
Ich hatte mich bereits dem Treppenhaus zugewandt, als uns der Butler noch einmal mit einem feinen Lächeln zurückhielt: „Habt ihr beiden vielleicht noch Hunger? Ich habe einige Snacks vorbereitet.“ Wortlos verschwand er in der Küche und kehrte kurz darauf mit einigen Schüsseln und Tellern zurück, die er uns schmunzelnd überreichte.
Nach einem kurzen Dank machten wir uns auf den Weg nach oben, wo sich im zweiten Stock meine gesamte Etage ausbreitete, mitsamt einem eigenen Bad und einem Fitnessraum, den ich rege nutzte. Im dritten Stock mussten meine Eltern bereits schlafen – das Untergeschoss verfügte zudem noch über einige öffentliche Säle, die ab und an von Vereinen oder Hochzeitsgesellschaften als Treffpunkt genutzt wurden.
Inzwischen hatte Acoya die Tür zu meinem Zimmer aufgestoßen und ließ sich mit einem genüsslichen Seufzer aufs Bett fallen. „Sulay – einen Tag lang einmal du sein, das wäre der Himmel auf Erden.“





























