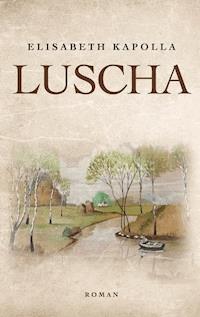
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aus einfachen Verhältnissen stammend wagt Luise Dröhm, genannt Luscha, den Aufstieg in die höheren Kreise. Diese Frau birgt ein düsteres Geheimnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 932
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wer nie sein Brot mit Tränen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.
Ihr führt ins Leben uns hinein,
Ihr lasst den Armen schuldig werden,
Dann überlasst ihr ihn der Pein,
Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.
Johann Wolfgang Goethe
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Erstes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Zweites Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Drittes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Prolog
Ich erwache im Halbdunkel und habe einen schrecklichen Durst. Wo bin ich? Ist das ein Krankenzimmer? Ich rufe „Wasser“ oder „Woda“. Eine Schwester sitzt an meinem Bett. Ihr freundlicher Blick flößt mir Vertrauen ein. Sie reicht mir ein Glas.
„Der Kapitan“, frage ich noch „ist er tot?“
„Pssst“, sagt die Frau, „Sie sind im Krankenhaus in Gleiwitz, ich bin Schwester Johanna. Sie müssen ganz ruhig liegen bleiben, denn Sie sind schwer verletzt. Noch mehr Wasser?“ Fragt sie.
Ich verneine. Dann lässt sie mich allein und ich versuche meine Gedanken zu ordnen.
Ja, Gleiwitz, der Bahnhof, Myslowitz, meine Heimatstadt. Meine Jugend im Haus Stoklowski zusammen mit Andi, meiner großen Liebe. Meine geliebte Mutter, die mir immer zur Seiten stand und mein Sohn Hajo, den ich nicht davon abhalten konnte zum Militär zu gehen. Dr. Stoklowski, Andis Vater, er drängt uns zur Abreise, ja uns, mich und Reni, die ich retten will.
„Du musst weg, denn du stehst auf der Liste, sie wissen, dass sich dein Sohn freiwillig zur SS gemeldet hat“, hat er mir eingeprägt.
Stocklowski bringt uns zum Zug. Der Zug fährt ab, hält aber nach ein paar Stunden in Gleiwitz. Die Sirenen gehen los, Fliegeralarm. An eine Weiterfahrt ist nicht zu denken.
Wir treffen Grete Breuer. Sie lädt uns ein, bei ihr zu übernachten. Ihr Haus liegt etwas abseits in einer stillen Straße und ist halb zerstört.
Grete kocht zuerst einen Tee. Köstlich warm rinnt er durch unsere kalten Kehlen. Wir öffnen unsere Lebensmittelpakete aus den Rucksäcken und lassen es uns schmecken.
„Wir sollten uns duzen“, schlägt Grete vor und wir tauschen unsere Vornamen aus.
Dann haben wir nur einen Wunsch, zu schlafen und die Erlebnisse dieser Nacht vergessen zu können.
Noch halb im Schlaf spüre ich das Beben des Raumes, die Erschütterung einer Granate. Ich bin sogleich hellwach und weiß, was los ist: Die Russen sind da, der Kampf um die Stadt hat begonnen. Der Krieg hat uns eingeholt.
Zwei Tage und zwei Nächte warten wir in banger Ungewissheit. Dann wagen wir uns auf die Strasse. Wir treffen andere Frauen und hören fassungslos ihre unglaublichen Erzählungen von Mord und Vergewaltigung. Wir glauben sie übertreiben oder sie haben es nicht verstanden, sich zu wehren. Unser verstecktes Haus werden sie nicht finden, außerdem spreche ich doch russisch!
Eines Abends donnern heftige Schläge gegen unsere Haustür. „Aufmachen!“ Schreit jemand auf russisch, „Aufmachen!“
Wir sehen uns ganz erschrocken an.
„Mach auf“, sage ich zu Grete, „sonst schlagen sie uns die Tür ein!“ Es nützt nichts, sie auf Russisch zu begrüßen. Es nützt nichts, uns als Polen auszugeben. Der Anführer –ein russischer Kapitan- lässt sich davon nicht beeindrucken.
„Ob German oder Polake, einerlei. Wir sind die Sieger“. Die Narbe im Gesicht gibt ihm ein teuflisches Aussehen. Er ergreift Reni. „Lass sie los!“ schreie ich erbost und zerre das Mädchen zurück. „Sie ist eine Jüdin und erst vierzehn Jahre alt.“ „Na und?“ machte er spöttisch, beinahe ruhig. „Gerade das richtige Alter, heute gehört sie mir!“ Ich gebe nicht auf und werfe ihm alle Schimpfwörter an den Kopf, die mir einfallen.
Da richtet er seine Pistole auf mich. Wie gelähmt bleibe ich stehen und lasse Reni los. Eine unbegreifliche Angst erfasst mein Herz. Ist es Todesangst? Ich starre auf dieses kleine runde Loch, das so grauenvoll auf mich zielt. In Sekundenschnelle zieht mein Leben an mir vorüber und die Schuld, die auf mir lastet. Mit bleichen Gesichtern stehen meine Ehemänner vor mir: Andi, meine große Liebe, den ich im Streit erschlagen habe, Franz, habe ich in den Krieg geschickt und Hans, den ich mit meiner Lüge zur Verzweiflung getrieben habe. Sie haben die gleiche Todesangst durchstehen müssen. Dazu habe ich sie gebracht, genau wie der Russe jetzt mich. „Das Gericht“, dachte ich schaudernd, „das Gericht!“
Da senkt der Kapitan die Pistole. Er lacht zynisch: „Na, siehst du, wie schwer es dir fällt, zu sterben. Ganz blass bist du geworden. Nur, weil du so gut russisch schimpfen kannst, verschone ich dich und außerdem brauchen wir dich. „Ivan“ ruft er einem der Bande zu, „schnappt sie euch!“ Einer packt Grete. Dann komme ich an die Reihe. Einer reißt mir das Kleid vom Leib und schmeißt mich auf einen Teppich und drückt mir die Beine auseinander.
Als alles vorbei ist, finden wir Reni tot auf dem Sofa. Der Kapitan hat auch sie vergewaltigt und dann mit einem Kissen erstickt.
In mir lodert Hass und der Gedanke an Rache weckt neue Energien in mir.
Durch die gemeinsamen furchtbaren Erlebnisse sind Grete und ich gute Freunde geworden. Aber meinen Hass versteht sie nicht! Sie ist nur von einem Wunsch beseelt, glücklich nach Westen zu kommen, aber nicht ich. Hier will ich bleiben, hier will ich sterben, aber vorher habe ich noch eine Rechnung zu begleichen!
Und dann finde ich ein dolchartiges Messer und übe wie in meiner Kindheit.
Es ist an einem Sonntag. Wir wollen zu Kirche gehen. Ich spüre, dass sich eine Wende meines Geschickes anbahnt. Nur aus Gewohnheit stecke ich das Messer in die Tasche. Die Straßen sind voller Leute, die auf dem Weg zur Kirche sind. Ich blicke weit über die Köpfe hinweg die Straße entlang. Da sehe ich eine russische Uniform, und mit untrüglicher Sicherheit weiß ich, dass mir der Kapitan entgegenkommt. Ein Gefühl von Hass und Glück zugleich spüre ich in mir aufwallen. Er kommt langsam auf uns zu. Mit gesenktem Kopf schreitet er an den Leuten vorbei. Noch ist er weit von mir entfernt, aber ich halte das Messer bereits wurfbereit unter meinem Mantel. Gespannt beobachtete ich jede seiner Bewegungen. Mit schlenkernden Händen, die Missmut und Langeweile verraten, nähert er sich. Ich bemerke, dass die vor uns Gehenden einen Bogen um ihn schlagen, selbst Grete ist nicht mehr an meiner Seite. Nur noch ein paar Schritte! Da, er hebt seinen Kopf. Unsere Blicke kreuzen sich. Nun hat auch er mich erkannt, vielleicht an dem Hass in meinen Augen. Noch ist er unschlüssig. Seine Hand fährt in die Tasche. Ich schleudere mein Messer.
Er schreit auf, taumelt zurück und zieht seine Pistole. In derselben Sekunde spüre ich einen Schlag auf der Brust. Meine Knie sacken zusammen, ich sehe noch, wie er die Leute zur Seite stößt und versucht davon zu rennen. Eine rasende Wut tobt in mir. Habe ich ihn verfehlt? Ich spüre nur den Schmerz der Enttäuschung, bis mich eine tiefe Bewusstlosigkeit befreit. Johanna, die Krankenschwester kommt zu mir und reißt mich aus meiner Erinnerung. Sie erzählt mir, dass Grete mich ins Krankenhaus gebracht hat. Ich soll morgen von dem russischen Militärarzt operiert werden, dass hat sie durchgesetzt, denn die Kugel muss raus.
Sie erzählt mir noch, dass ein russischer Kapitan mit einem Messer in der Brust tot aufgefunden wurde. Die Nachricht trifft mich unerwartet. Ich habe ihn also getroffen und bin wieder schuldig geworden. An meinem Gesichtsausdruck erkennt sie, dass ich ihn auf dem Gewissen habe. „Warum hast du das getan?“ fragt sie. „Ich bin Polin.“ sage ich. „Das heiße polnische Blut meines Großvaters pulsiert in mir. Ich kann nicht verzeihen, sowie Andi mir nie verziehen hat.“
„Wer ist Andi?“ fragt sie. Ja, sie ahnt was in mir vorgeht, sie weiß, dass ich etwas loswerden muss, noch vor der Operation. „Bitte setzt dich an mein Bett“. Und ich kann endlich jemandem meine Schuld beichten. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa!!
Erstes Buch
1. Kapitel
An einem kalten Novembertage des Jahres 1890 bin ich in der winzigen russisch-polnischen Ortschaft Nifka nahe der deutschen und der österreichischen Grenze zur Welt gekommen, und zwar in einem Schloss. Nicht etwa als Prinzessin – nein – so gut hatte es das Schicksal nicht mit mir gemeint, sondern als Tochter der Köchin und des Kutschers.
Das Schloss war ein großes, graues Steinhaus. Einmal vor langer Zeit sollte es der Wohnsitz einer polnischen Adelsfamilie gewesen sein. Die Leute dieser Ortschaft nennen es bis auf den heutigen Tag „Das Schloss.“
Vom Schlossgesinde waren meine Eltern die einzigen, die lesen und schreiben konnten. Sie wurden vom ganzen Dorfe deswegen bewundert. Denn wer konnte damals in Russisch-Polen schon lesen und schreiben? Höchstens die Juden! Die Amtssprache war russisch, also auch der Unterricht in der Schule. Schulen gab es nur in größeren Orten und ihr Besuch kostete Geld. Den Luxus eines Schulbesuches konnten sich nur wenige erlauben. Die Leute waren arm. Sie hatten kaum das Notwendigste zum Leben. Die Kinder mussten sehen, dass sie so früh wie möglich etwas dazu verdienten, um zu ihrem Lebensunterhalt beizusteuern.
Ein russischer Bergwerksdirektor bewohnte das Schloss, in dem meine Eltern bedienstet waren. Von den Kindern der Schlossbewohner lernte ich Russisch. Das Gesinde sprach nur polnisch mit mir. Meine Eltern hörte ich nur deutsch miteinander reden. So kam es, dass ich mit vier Jahren drei Sprachen sprach. Sie schienen fest verankert in mir, als wäre ich mit ihnen auf die Welt gekommen.
Gleich hinter dem Schloss lag das Bergwerk. Der Rauch und das Gedröhne der Förderanlage umgaben uns Tag und Nacht und begleiten die Erinnerungen an meine frühe Kindheit.
Als ich viereinhalb Jahre alt war, änderte sich unser Leben schlagartig. Mein Vater starb. Ein Gewitter überraschte ihn beim Heueinbringen, und als er sich schutzsuchend unter einen Baum stellte, wurde er vom Blitz getroffen.
Nie vergaß ich den Schrei mit dem sich meine Mutter über meinen toten Vater warf. Ich begriff nicht, was sich ereignet hatte und weshalb meine Mutter schrie. Niemand kümmerte sich um mich. Alles drängte sich um die Mutter und jenen Mann auf dem Boden, dessen blauschwarzes Gesicht ich nicht erkannte. Voller Angst und Schrecken lief ich in unsere Stube. Ich verkroch mich im Bett und schlief ein.
Die Beerdigung war ein einziger Tränenstrom. Die Mutter weinte und schluchzte, wie ich es noch nie an ihr erlebt hatte. Das Gesinde klagte laut. Ja sogar die Schlossbewohner fuhren sich unentwegt mit dem Taschentuch über die Augen.
Unglücklich stand ich neben meiner Mutter, die meine Hand fest in der ihren hielt. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Meine Augen brannten, aber ich konnte nicht weinen. Fortwährend küsste ich die Hand meiner Mutter und bat: „Höre auf zu weinen, Mutter, höre auf zu weinen!“ Sie hörte es nicht.
Die Beerdigung ging vorüber, Wochen verstrichen, aber sie weinte immer noch.
In diesen Tagen bin ich still und nachdenklich geworden. Wo war mein Vater geblieben? Warum kam er nicht wieder? Hatten sie ihn wirklich in dieses hässliche Loch gesteckt und mit Erde zugeschüttet? Konnte er sich daraus nicht mehr befreien? Gern hätte ich mit Mutter darüber gesprochen, aber das war nicht möglich. Sie fing sofort zu weinen an und zeigte auf den Himmel. Warum ging er in den Himmel, dachte ich bitter. Hatte er vergessen, dass er mich ins Bett bringen musste? Wer sollte mit mir beten, wer mir Geschichten erzählen oder ein Liedchen singen, wenn ich abends nicht einschlafen konnte?
Mutter hatte keine Zeit. Sie musste kochen, immer kochen. Spät abends verließ sie die Küche, wenn ich schon schlief. Bei Tag durfte ich wohl zu ihr hinein, aber ich tat es ungern. Ganz still musste ich dann in einer Ecke sitzen. Selten beantwortete sie mir meine Fragen. Spielen in der Küche gab es schon gar nicht. Sie rannte immer hin und her: Vom Tisch zum Ofen, vom Ofen in die Speisekammer, von der Kammer zum Tisch. Es kochte, schmorte, brodelte und dampfte den ganzen Tag in der Küche. Nein, es gefiel mir dort nicht, jetzt, wo sie immer nur weinte, schon gar nicht.
Da war es in den Ställen doch viel schöner. Ich wollte meinen Vater wiederhaben. Denn was sollte ich allein in den Ställen? Jeden Abend betete ich:
„Lieber Gott, lass ihn wiederkommen!“ Jeden Abend glaubte ich:
„Morgen kommt er bestimmt. Heute war ich so brav. Allein habe ich mich gewaschen und so fromm gebetet. Er muss doch sehen, wie artig seine Luscha ist. Sicher ist er morgen wieder da.“
So wartete ich jeden Tag in einer Ecke des Hofes, von der ich die Einfahrt und ein Stück der Straße übersehen konnte. Ich glaubte felsenfest, er müsste mit den Pferden vom Felde heim kommen. Ich wollte ihm, wie so oft, entgegenlaufen. Er würde mich auf den Rücken eines Pferdes setzen und in den Stall reiten lassen. Mein Herz hüpfte vor Freude bei dieser Vorstellung. Sie tröstete mich und ich spann sie weiter aus. Beim Herunternehmen wollte ich mich fest an seinen Hals klammern und ihm sagen:
„Vaterle, ich will immer brav sein, aber geh nicht mehr weg von uns!“
Oh, ich wusste, er würde mich hinterher in die Luft werfen, wie er es immer tat. Auf den Hals würde er mich beim Auffangen küssen, und ich würde lachen und jauchzen. Ach, ich wurde immer stiller und artiger. Die Kinder mochten mich locken, soviel sie wollten, ich spielte nicht mit ihnen. Ich fürchtete, jeden Augenblick zu verpassen, in dem mein Vater heimkam. Ich warf nicht mehr mit Steinen nach den Hühnern, riss keine Blumen von den Beeten, ich tat nichts Verbotenes mehr. Tag für Tag saß ich auf einer Kiste im Hof und wartete. Aber er kam nicht wieder.
Der Sommer verging und es wurde Herbst. Das Gesinde machte meiner Mutter auf mein stilles Herumsitzen im Hof aufmerksam. Da besann sie sich. Ihre Tränen versiegten und sie wurde wieder mein gutes Mütterchen und kümmerte sich von nun an mehr um mich. Immer öfter kam Mutter aus der Küche, um nach mir zu schauen, herzte und küsste mich, ja, sie brachte mich abends sogar ins Bett. Waren wir allein, sprachen wir nur deutsch miteinander. Ich musste ihr alle Kinderreime und Geschichten, die Väterchen mir vorgetragen hatte, wiederholen.
„Wir dürfen Vaters Sprache nicht vergessen“, sagte sie oft zu mir. „Wenn du allein bist, musst du alles, was du kannst deiner Puppe erzählen. Eines Tages wirst du in die Schule gehen, dann sollst du deutsch sprechen können!“
So redete ich mit meiner Holzpuppe, die Vater für mich geschnitzt hatte nur noch deutsch. Ich begriff allmählich, dass ich ein vaterloses Kind geworden war und bleiben würde.
Mein Leben veränderte sich immer mehr. Wir zogen in eine Kammer. Der neue Kutscher bewohnte unsere schöne Stube. Aus der Küche drang immer öfter Zank und Streit bis in den Hof hinaus. War es, weil Mutter sich mehr Zeit für mich nahm, oder weil Vater nicht mehr schützend hinter ihr stand? Nun, sie sagte es mir nicht.
Einmal, als es wieder laut zuging, hörte ich die Stimme meiner Mutter bis in die Ecke dringen, in der ich saß: „
Jetzt habe ich genug! Ich gehe! Suchen Sie sich zum Ersten eine neue Köchin!“
Sogleich wurde es in der Küche still. Mutter trat gleich darauf in den Hof, winkte mich zu sich heran und führte mich in die Kammer.
„Die sollen machen, was sie wollen!“, sagte sie erbittert. „Heute habe ich meinen Ausgang!“ und sich zu mir herabneigend: „Wir müssen zusehen, dass wir von hier fortkommen!“
Sie kleidete mich und sich in unsere besten Kleider. Juchei, es ging ins Dorf!. Fröhlich sprang ich um sie herum, denn es geschah höchst selten, dass sie mit mir ins Dorf ging.
„Gehen wir über die Grenze, Mutter?“, fragte ich erwartungsvoll.
„Nein, heute nicht.“, antwortete sie. „Aber in 14 Tagen gehen wir, da kaufe ich dir etwas Schönes!“ „
Wohin gehen wir heute?“, wollte ich wissen.
„Zum Isidor Süßwein. Heute will ich endlich tun, wozu Vater stets gedrängt hatte. Ach, ein Jahr früher hätte ich diesen Schritt tun sollen und Vater würde heute noch leben!“
Die Tränen traten ihr in die Augen.
„Was wollen wir beim Süßwein kaufen?“, fragte ich schnell, um sie abzulenken.
„Das wirst du sehen!“, seufzte sie. „aber schön brav sein und nicht dazwischen reden, wenn ich etwas kaufe!“
Da waren wir auch schon im Dorf. Die Leute grüßten uns freundlich. Jeder kannte uns. Als Köchin des Schlosses war Mutter eine geachtete Person. Oh, ja, es war schon etwas, Köchin zu sein.
Das Dorf bestand aus einer langen Straße. Zu beiden Seiten standen verrußte Ziegelhäuser, in denen die Grubenarbeiter wohnten. Dann mündete die Straße auf einen Platz. Einige Lehm- und Holzhäuser standen dichtgedrängt zusammen. Auf eines der größten Häuser gingen wir zu. Wir betraten einen seltsamen Laden. Darinnen war es dämmrig und ich konnte nicht viel sehen. Bald aber hatten sich meine Augen an das Halbdunkel gewöhnt. Überrascht schaute ich mich um. Was gab es nicht alles zu sehen: Uhren, Vogelkäfige, Vasen, Bilder, Figuren, ja Schuhe, Kleider und Tücher lagen und hingen da herum.
„Guten Tag!“, krächzte eine Stimme aus dem Hintergrund. „Was steht zu Diensten?“.
Ein alter Jude mit langem weißen Bart und Ohrlöckchen -Paiki genannt - trat aus dem hinteren Teil des Ladens auf uns zu.
„Ach, Martha!“, rief er erstaunt. „Was verschafft mir die Ehre Ihres seltenen Besuchs?“
„Ich brauche ein paar Möbel,“ sagte Mutter. „Gut, billig und haltbar, denn ich habe nicht viel Geld!“ „Was brauchen sie Geld
beim alten Isidor?“ Er wies auf den Kram mit prahlerischer Geste
„Nehmen Sie, was Sie wollen. Ich weiß, Sie werden bezahlen auf Heller und Pfennig eines Tages!“
Er trat an ein Fenster und schob eine Holzlade weg.
„Was dachten Sie denn, dass Sie brauchen?“, fragte er dabei. Mutter machte „Hm!“ und sah sich um. „Einen Schrank, einen Tisch, Stühle und ein Bett.“
„Kommen Sie weiter nach hinten, das hier ist nichts für Sie!“ Und er ging voran.
Auf einem schmalen Weg, der zwischen dem Gerümpel freigelassen war, folgten wir ihm. Wieder öffnete er eine Fensterlade. Es wurde hell im Raum. Da standen Möbel: Schränke, Tische, Kommoden. Alles mit einer dicken Staubschicht bedeckt, als hätten sie hundert Jahre dagestanden.
Der Alte griff zu einem Lappen und wischte geschwind den Staub von einem Tisch. Braunes, glänzendes Holz kam zum Vorschein.
„Sehen Sie!“, rief er lächelnd, „der Staub hat nichts zu sagen. Aber was unter dem Staub hervorkommt ist gut. Der alte Isidor weiß, was er kauft, Martha. Er kauft und verkauft nur anständige Ware!“
Wieder putzte er einen Stuhl blank.
„Ich soll nicht gesund sein, wenn ich nicht mache mit Ihnen ein Geschäft, Martha!“
Der Mutter schien nichts zu gefallen. Sie ging hin und her und beäugte dies und jenes.
„Es ist alles zu alt!“
Geringschätzig verzog sich ihr Mund. Dann blieb sie vor einem Kleiderschrank stehen. Verdreckt und versteckt stand er in einer Ecke. Ein Tisch lag umgekehrt oben auf. Als sich die Tür einen spaltbreit öffnete, sah man die Außenwände eines Bettes darin stehen.
Eilfertig rückte der Alte die Möbel ab, die das Öffnen des Schrankes verhinderten. Schnell holte er ein Tuch und schlug die dichten Spinngewebe hinweg, in denen das Bett wie in Watte ruhte. „Wie Sie sehen, keine Holzwürmer!“ sagte der Alte.„Gesundes kerniges Holz!“
Die Mutter bückte sich und sah, dass der Schrank keine Füße mehr hatte. „Die lasse ich anbringen, nur keine Bange!“, beschwichtigte er. „Zwei Stühle sind auch dabei!“
Und schon holte er sie aus der Ecke hervor, wischte und putzte daran herum und präsentierte sie gewandt.
„Alt, nicht viel wert!“, sagte Mutter und rümpfte die Nase.
„Bei meiner Seele!“, gelobte der Alte, „es ist das Beste, was ich habe. Ich garantiere die Möbel werden überleben Sie.“ Sein Gesicht legte sich in geheimnisvolle Falten.
„Ich habe gekauft sie von einem vornehmen Herrn. Den Namen kann ich nicht nennen, Martha! Sie verstehen, Geschäft ist Geschäft. Aber Sie werden sein zufrieden, sehr zufrieden!“
„Was sollen sie kosten?“ fragte die Mutter. „Aber übertreiben Sie nicht!“ Auf ihrem Gesicht stand ein Lächeln, das dem des alten glich, „Sonst gehe ich zum Nathan Löbele!“
„Gott der Gerachte! Wird die Frau mir nennen den Namen eines Ganevs. Aber Sie wissen genau, dass er ist ein Ganev. Darum kommen sie zum Isidor Süßwein, was ist ein ehrlicher Mann. Die Möbel kosten für Sie, aber nur für Sie, weil ich weiß, was sie haben erlitten für einen Verlust: Sechs Rubel, Martha!“
Die Mutter lachte. „Wenn ich sechs Rubel hätte, ginge ich zum einem Tischler und ließe mir machen, was ich brauche. Zwei Rubel gebe ich für diesen Trödel und keine Kopeke mehr!“
„Das ist Ihr Ernst nicht. Nehmen Sie an Vernunft! Für zwei Rubel wollen Sie kaufen diese vornehmen Möbel? Das ist nicht möglich! Aber ich will entgegenkommen Ihnen, weil Sie sind eine Witwe und alte Kundin von mir. Vier Rubel, Martha. Schlagen Sie ein!“
Er strecke seine Hand aus.
„Zwei Rubel“, entgegnete die Mutter fest und wandte sich zum Gehen.
„Sie ruinieren mich“ rief der Trödler verbittert. „Also gut, ich gehe runter auf drei!“
„Zwei“, wiederholte Mutter streng und schlängelte sich, mich hinter sich herziehend, dem Ausgang zu.
„Bei meinem Leben, ich kann nicht heruntergehen mehr!“ schwor der Alte. “Sie werden bereuen, nicht gekauft zu haben diese schönen Möbel!“
Er folgte uns dicht auf dem Fuß. „Warum laufen Sie weg? Wie sollen wir machen ein Geschäft? Wir wollen uns einigen, Martha!“ Er ergriff Mutters Umschlagtuch und hielt sie daran fest. Ich gehe herunter einen halben und Sie werden zulegen einen halben Rubel.“
Sie drehte sich scheinbar unwillig um: „Ich bleibe bei zwei, mehr kann ich nicht geben.“
Sie wollte die Tür öffnen. Der Alte hielt den Fuß davor.
„Zweieinviertel, wollen Sie geben oder wollen Sie nicht geben?“ Aufgebracht schrie es der Jude hinaus, und ich begann mich zu fürchten. Die Mutter lachte laut.
Da nahm der Alte den Fuß von der Tür.
„Also, gut“ einigte sich Mutter. „Sie nehmen mir mein letztes Geld ab. Zweieinviertel und keine Kopeke mehr! Aber alles fein in Ordnung gebracht und zusammengeleimt!“
Auf dem verstaubten, verwelkten Gesicht des Trödlers erschien ein breites Grinsen.
„Aber sicher, Martha. Habe ich nicht gesagt, wir werden machen ein Geschäft? Soll ich bringen die Möbel ins Schloss?“
„Nein“, entgegnete die Mutter. „Ich bin auf dem Wege nach Modrzejow. Ich möchte mich dort nach einer Stube umsehen!“
Erstaunt strich sich der Alte den Bart. Fragte aber nicht warum, weshalb, sondern sagte nach kurzem Überlegen:
„Gehen Sie zu Abraham Nüßel, was ist mein Schwager. Der wird besorgen Ihnen eine Wohnung!“
„Schön“, nickte die Mutter „auf dem Rückweg komme ich herein, und wir besprechen das Weitere!“
Wir machten uns auf den Weg nach dem einen halben Kilometer entfernten Modrzejow. Es war ein sonniger Herbsttag. Die Luft war klar und durchsichtig, so dass das Dorf zum Greifen nahe schien. Ein Marktplatz, von einigen Häusern umrahmt, das war der Grenzort Modrzejow. Auf dem Markplatz wurde zweimal in der Woche Vieh gehandelt und über die Grenze getrieben. Man raunte sich heimlich zu, dass die Bewohner hauptsächlich vom Schmuggel lebten.
Die Straße lief gerade auf den Ort zu, und gerade verließ sie ihn, um in die breite Holzbrücke zu münden, die die Grenze zwischen Russland und Deutschland bildete.
Abraham Nüßel stand vor seinem Haus, als hätte er auf uns gewartet.
„Guten Tag!“ grüßte er freundlich. „Wollen Sie über die Grenze nach Myslowitz, Martha?“
Mit einem Kopfnicken erwiderte Mutter den Gruß und trat an ihn heran. „Nein“, entgegnete sie „ich will zu Ihnen. Man hat mir gesagt, dass Sie vielleicht eine Wohnung für mich hätten.“ Überrascht und verlegen zugleich stecke er die Hände in die Taschen seines schmierigen Kaftans und sagte langsam:
„Eine Stube hätte ich schon.“ Skeptisch wiegte er den Kopf.
„Ich hole den Schlüssel.“.
Wir gingen zusammen durch eine Einfahrt, die an das Nebenhaus grenzte. Ein langer Hof nahm uns auf. Zuerst sah ich die große Kastanie, die mitten darin stand und mich mit ihren bunt gefärbten Blättern willkommen zu heißen schien. Mir gefiel der Hof mit der Kastanie. Auf der linken Seite befand sich ein Holzhaus.
Davor saßen vier spielende Kinder, die sogleich aufsprangen und auf uns zuliefen. Auf der rechten Seite war eine halb hohe Mauer, dahinter ein Steinhaus, das unbewohnt war. Geradeaus am Ende des Hofes stand ein Schuppen mit zwei Türen, der die beiden Seiten verband und den Hof nach außen hin abschloss. Auf diesen Schuppen gingen wir zu. Nüßel schloss auf. Ein leerer, schmutziger Raum tat sich vor uns auf. Mutter ging ans Fenster und öffnete es. Die Sonne schien herein. Der liebliche Ausblick, der sich uns bot, veranlasste sie nach dem Preis der Miete zu fragen. Wieder setzte ein Handeln und Feilschen ein. Diesmal aber wurden sie sich schnell einig.
Die Kinder hatten ihre Eltern alarmiert. Die Mütter traten zu uns in den Raum.
„Martha, willst du weg vom Schloss?“, fragte die eine ungläubig. „Gewiss“, antwortete die Mutter, „wenn man den Mann verloren hat, ist man rechtlos und wird oft unsanft behandelt.“
„Das ist wahr“, entgegneten die Frauen mitleidig und boten ihre Hilfe zum Aufräumen an.
Nüßel brachte indes einen Eimer Kalk aus seinem Haus. Einer der Ehemänner der hilfsbereiten Frauen fand sich bereit, die Wände zu streichen. Ein geschäftiges Treiben begann. In ein paar Stunden war der Raum frisch gekalkt, die Fenster geputzt und der Fußboden gescheuert Man bestreute ihn gerade mit weißem Sand als der alte Wagen von Süßwein mit den Möbeln in den Hof rasselte. Abraham Süßwein hatte seinen Schwager schleunigst benachrichtigt Es stellte sich heraus, dass die Sachen ramponierter waren als es zunächst schien. Ein Brett in der Hinterwand des Schrankes fehlte. Die Schublade wollte sich nicht öffnen lassen, Füße waren nicht vorhanden. Alles war schäbig und grau vor Staub.
„Nur keine Angst!“, sagte Süßwein zuversichtlich. „Hier ist der Mann, der Ihnen bringt die Möbel in Ordnung.“
Er wies auf den Mann, der das Anstreichen der Wände besorgt hatte, drückte ihm einige Kopeken in die Hand und der Mann grinste zustimmend.
Er holte aus Nüßels Laden Nägel, Leim, Hammer und Säge und machte sich an die Arbeit. Unter seinen geschickten Händen öffnete sich die Schublade des Schranks. Alle fehlenden Teile lagen darin. Nun leimte, nagelte und hämmerte der Mann daran. Bald stand alles auf festen Füßen.Mutter hatte inzwischen mit Süßwein abgerechnet. Mit Jammern und Schimpfen über die schlechten Möbel hatte sie noch herausgepresst, dass er unsere Sachen am Ersten vom Schloss abholen sollte. Brummend fuhr er fort, aber lustig ließ er die zweieinviertel Rubel in seiner Tasche klimpern. Die Frauen hatten die Möbel von innen und außen gereinigt. Sie sahen jetzt schon besser aus. Aber dem Mann gefielen sie nicht.
„Ich brauche Essig und Öl“, sagte er zur Mutter und zu seiner Frau gewandt: „Hole die Asche vom Bügeleisen herunter!“. In Polen bügelte man damals noch mit Holzkohleeisen.
Als alles beisammen war, mischte er aus Asche und Essig einen Brei. Damit wurde jedes Stück sorgfältig eingerieben. Die Frauen gingen ihm dabei zur Hand. Sie lachten, denn die Möbel, nun mit einer grauen Schicht überzogen, sahen viel schlechter aus als vorher. Nach einiger Zeit wischten sie den grauen Belag ab. Jetzt wurde jede Stelle mit Öl eingerieben und glatt poliert. Ich stand dabei und staunte wie dunkel und glänzend die Möbel wurden.
Mutter war auf einen Sprung über die Grenze gegangen, um Insektenpulver zu holen. Als sie wieder kam, sagte der Mann, stolz über sein Werk: „Sehen Sie sich jetzt die Sachen an!“.
„Oh“, wunderte sie sich, „sie sehen aus wie neu!“
„Das sind auch gute Möbel“, behauptete der Mann. „Vor Jahren habe ich bei einem Tischler in Sosnowitz gearbeitet. Da haben wir oft alte Möbel von reichen Leuten ausbessern müssen. Ich muss sagen, diese Möbel sehen genau so aus!“
Die Mutter lächelte schwach. „Wenigsten ein Lichtblick in dieser traurigen Umgebung!“
„Martha, du brauchst einen Strohsack!“, erinnerte die eine der Frauen. „Der Groschka hat gestern gedroschen, da bekommst du frisches Stroh ohne Flöhe. Soll ich einen Fuder holen? Er gibt es für zwei Kopeken ab.“
Ja, ein Strohsack war wichtig, den mussten wir haben. Während die Frau das Stroh holte, handelte Mutter beim Nüßel einen Bezug aus Sackleinen dafür ein.
Die Dämmerung brach herein als die Möbel aufgestellt wurden. Mutter hatte in jedes Eckchen mit Insektenpulver gestreut. Das roch so komisch und kitzelte in der Nase. Einer nach dem anderen begann zu niesen, was allgemein belustigt aufgenommen wurde. Es war dunkel geworden als wir uns auf den Heimweg machten.
„Ich freue mich, auf so gute Nachbarn gestoßen zu sein. Wenn ich erst hier wohne, werde ich mich erkenntlich zeigen!“ verabschiedete sich meine Mutter von den Leuten, die uns noch ein Stück des Weges begleiteten. Ja, das war für uns ein ereignisreicher Nachmittag!
Vierzehn Tage später waren wir auf Süßweins Heuwagen mit Sack und Pack eingezogen. Das ganze Dorf sprach davon. Es gab einen regelrechten Auflauf im Hof. Alle waren bereit, uns zu helfen, um die näheren Einzelheiten über Mutters Auszug aus dem Schloss zu erfahren. Aber Nüßel und Süßwein verstanden es, die Neugierigen zu vertreiben.
Mit Hilfe unserer Nachbarn aus dem Hofe brachten wir unsere Habseligkeiten in unsere neue Wohnung. Viel war es nicht, was wir damals besaßen und doch war es mehr, als jeder der polnischen Dorfbewohner hatte. Man akzeptierte es neidlos. Wir kamen aus dem Schloss, Mutter war Köchin und konnte lesen.
Als sie sich im Schloss verabschiedete, war der Direktor freundlich zu ihr.
„Es tut mir leid, Martha, dass du von uns gehst. Da du aber nicht zu halten bist, möchte ich dir etwas mit auf den Weg geben! Hast du einen Wunsch?“ Ohne sich lange zu besinnen, hatte Mutter geantwortet:
„Eine Fuhre Kohle!“
„Aber gern!“, hatte er erleichtert geantwortet, denn sie kostete ihn keinen Heller.
„Eine große Fuhre sollst du haben und dazu einen Wagen Holz!“
Er hielt Wort. Schon am nächsten Tag kamen die Kohlen. Die zweite Tür unseres Häuschens wurde geöffnet. Das war ein Stall. Dort wurden die Kohlen und das Holz untergebracht und verschlossen.
„So!“ meinte Mutter, „vor Kälte sind wir geschützt. Für Ernährung will ich schon sorgen. Aber erst wollen wir uns einleben und etwas gemütlich machen.“
Ja, gemütlich machen, das verstand Mutter großartig. Aus der Truhe, die wir mitgebracht hatten, wurden unsere Schätze hervorgeholt. Für den Tisch hatte sie eine gehäkelte Decke, für das Bett einen gehäkelte Überwurf. Auf die Truhe kam ein handgestickter Läufer.An den Fenstern brachte sie gelbe Vorhänge und an den Scheiben weiße Gardinen an. Aus einer Holzkiste wurde ein Waschtisch, den sie mit buntem Baumwollstoff bespannte. Das ganze Dorf geriet darüber in Aufregung. Niemand hatte Gardinen an den Fenstern, nur wir.
„Ist es wahr, dass ihr es so schön wie im Schloss habt?“ wurde ich oft gefragt.
„Pah, noch viel schöner“, antwortete ich stolz. Ich war so glücklich, dass die Mutter jetzt immer bei mir war, dass sie viel Zeit für mich hatte und hielt aus diesem Grunde die kleine Bude für den schönsten Ort der Welt. Manchmal kam jemand vom Schlossgesinde Mutter besuchen. Der Klatsch vom Schloss wurde aufgetischt. Die neue Köchin tauge nichts, hieß es. Zum ersten müsse sie wieder gehen. Ja, so eine Köchin wie Mutter, gab es nicht zum zweiten Mal.
„Sie werden dich zurückholen, Martha“, prophezeiten sie. Ich schaute dann ängstlich zur Mutter hin, aber sie schüttelte entschieden den Kopf.
„Und wenn mir die Gnädige die Troika schickt. Ich muss meinem Kind ein besseres Leben aufbauen, als ich es hatte!“ Sie drückte mich an sich und ich war beruhigt. Leichten Herzens widmete ich mich meiner Umgebung.
Wir bekamen oft Besuch. An einem sonnigen Nachmittag kam Frau Süßwein auf einen Sprung herüber.
„Ich habe gehört, Martha, dass man erzählt in ganz Nifka, wie schön sie wohnen beim Nüßel“.
Sie drehte sich bewundernd im Kreis. „Bei Gott, es ist schöner noch als die Leute sagen. Ich bringe Ihnen ein Geschenk. Es soll geben Ihnen Glück in der Wohnung.“ Sie legte den Finger an den Mund. „Aber nicht reden darüber, sie wissen, mein Mann!“ Sie deutete auf mich: „Gewachsen ist die Kleine. Das Kind wird immer hübscher, Martha! Komm her zu mir, wie heißt du?“ Der Kopf mit der Perücke wackelte hin und her.
„Luscha“, antwortete ich zaghaft und trat auf sie zu. Das alte faltige Gesicht, der zahnlose Mund, die dunklen, tief in den Höhlen liegenden Augen muteten mich fremd und unheimlich an.
„Luschka!“ wiederholte sie zärtlich und legte ihre Hand auf meinen Kopf und murmelte: „Der Gott meiner Väter beschütze dich, du vaterloses Kind!“
Dann wandte sie sich zur Mutter: „Haben sie Acht auf ihr Kind. Es ist nicht leicht allein. Ich habe verloren drei!“, dann war sie traurig gegangen.
Wir öffneten neugierig das verschnürte Päckchen. Ein altes Marienbild kam zum Vorschein. Die schwarze Mutter Gottes von Tschenstochau in Öl gemalt.
Der Rahmen war verschmutzt und beschädigt. Trotzdem sah man an seiner Breite und Schwere wie kostbar er war.
Die Mutter brachte es zum Nachbarn. Kunstgerecht besserte der Mann den Rahmen aus, säuberte das Bild mit Öl und hängte es an einen Haken über unserem Bett auf.
Für mich war es das schönste Stück in unserer Wohnung. Wo ich auch hinging, die Augen der Madonna schienen mir zu folgen. Immer sah sie zu mir.
„Sie lebt, Mutter“, sagte ich ehrfürchtig, und die Mutter nickte ernst:
„Sie beobachtet dich. Wenn du immer brav bist,
dann wird sie dich beschützen, wo immer du auch bist.“ Jeden Morgen und jeden Abend beteten wir zu dem Bilde. Ach, das Leben war um so vieles schöner geworden!
Wenn ich mich zum Fenster hinauslehnte, lag die weite Grenzwiese vor mir, an deren Rand der Grenzfluss, die Przemsa, sich dahinschlängelte. Oft trat sie über die Ufer und überschwemmte die Wiesen.
Vielleicht war sie deswegen so grün und so saftig. Zu meiner Rechten lag die lange Holzbrücke, über die der Grenzverkehr abgewickelt wurde. Meine Aufmerksamkeit galt dieser Brücke. Was gab es da nicht alles zu sehen! An Markttagen, zweimal pro Woche, wurde Schlachtvieh über die Grenze getrieben. Das ‚Hüh und Hoh‘ der Treiber war schon von Weitem zu hören.. Den ganzen Tag sah man Wagen, Ross und Reiter, Handund Eselkarren und manche vornehme Troika donnerten vorüber. Ja, es war schon aufregend, das alles zu beobachten.
Aber auch die linke Seite gefiel mir. Ganz in der Ferne durchschnitt ein silbernes Band die Wiese und verlor sich im Grenzfluss. Ein Stück dahinter stand wieder eine Brücke. Von unserem Fenster aus erschien sie mir klein und schmal, wie ein Lineal, das auf sechs Bleistiften stand. Dreimal am Tag näherte sich diesem Lineal eine schwarze Raupe. Wenn sie es berührte, gab es ein donnerndes Getöse.
„Das ist der Zug, der über die neue Brücke nach Österreich fährt!“, erzählte meine Mutter. „Das flimmernde Band ist die weiße Przemsa. Sie trennt Russland von Österreich. Und dort wo die weiße Przemsa in die schwarze fließt, ist die berühmte Dreikaiserreichsecke. Drei große Länder werden hier von den beiden Flüssen getrennt!“
„Und wo liegt Polen?“ fragte ich.
„Ja“, sagte Mutter, „das ist eine lange Geschichte. Alles was du siehst, war einmal Polen, aber es wurde unter die drei Ländern aufgeteilt.“
Das verstand ich damals noch nicht. Ich schaute und schaute. Gab es noch einen schöneren Ort, als den, in welchem wir wohnten? Ich konnte es mir nicht vorstellen.
Öffnete ich am Morgen die Tür, traf mein erster Blick die Kastanie. Weit über die kleine Behausung hinaus, reckten sich ihre breiten Äste. Ihre Blätter und Früchte warf sie in den Hof hinab. Es war ein Vergnügen, in den braunen harten Blättern herumzuwaten, die glänzenden Kastanien zu sammeln und mit ihnen zu spielen.
Gleich am ersten Tag hatte ich mit den Kindern Freundschaft geschlossen. Fünf Kinder wohnten im Seitenhaus, drei kamen aus dem Nachbarhaus hinzu, darunter auch Nüssls Kinder, Moses und Ruth.
Unser Hof war der größte. Verschönt durch die Kastanie war er der Anziehungspunkt aller Kinder des Dorfes. Aber wir ließen nicht alle rein.
Drei Kastanien wuchsen im ganzen Ort. Eine stand vor dem Zollhaus. Dort saßen die Zöllner. Im Sommer, stellten sie Tische und Stühle in ihrem Schatten und stempelten hier die Pässe der Grenzgänger.
Auf der anderen Seite der Straße, genau gegenüber, reckte sich der zweite Baum in den Himmel. Im Frühling, wenn die Bäume voller Blüten standen, berührten sich ihre grossen Äste und bildete einen Eingang. Ein Tor in eine fremde Welt, so schien es mir damals. Dahinter lag die Brücke. Hatte man dieses einfache Gerüst aus Holz betreten, so war man auf dem Wege in eine kleine Stadt, in der es so anders aussah als bei uns. Bei uns gab weit und breit keinen Baum, keinen Strauch nichts grünes außer den Grenzwiesen, die man nicht betreten durfte. Kein Wunder, dass wir uns glücklich schätzten, denn wir hatten beides, die Aussicht auf die Wiese und den dritten Baum im Hof.
Kamen wir von einem Grenzgang heim, sahen wir die Kastanien von weitem. Unsere war die höchste.
„Sie ist die schönste, nicht wahr, Mutter?“, sagte ich jedes Mal. „Sie winkt mir, Mutter, sie winkt mir!“. Und ich winkte fröhlich zurück.
Es waren glückliche Kindertage, die ich in diesem öden, schmutzigen Ort verlebte. Man warb um meine Freundschaft. Ich wurde Mittelpunkt aller Spiele, die die Kinder aufführten und das gefiel mir. Jeden Abend freute ich mich auf den nächsten Tag, denn jeder Tag brachte ein neues Erlebnis.
Von den Mädchen lernte ich Seilchenspringen, Knobelspiele. Raufen, Messerwerfen und Kartenspiele brachten mir die Jungen bei.
„Wir leben im Krieg mit der anderen Seite des Marktplatzes!“ informierte mich Sbinju aus dem Seitenhaus, das älteste der Kinder. „Jetzt gehörst du zu uns, da musst du lernen, dich zu verteidigen, wenn man uns angreift.“
Man zeigte mir, wie ich eine Schleuder zu bedienen hatte oder einem nahekommenden Feind ein Bein stellen konnte. Das erstere lernte ich schnell, aber ein Bein stellen war ziemlich schwierig. Immer hatte ich blaue Flecken am Schienbein. Nur weil man mich auslachte übte ich weiter daran. Moses Nüßel war es, der es mir mit viel Geduld und Geschicklichkeit beibrachte.
Messerwerfen gefiel mir besser. An der Wand ihres Holzhauses hatten sie einen Kreis mit Kreide gezeichnet. Das Messer wurde an der äußersten Spitze der Schneide hin und her geschaukelt. Schnell warf man es durch die Luft, dann musste es genau im Kreis landen. Aber nicht bei mir, was bei den anderen lautes Gelächter hervorrief. Es dauerte sehr lange bis ich endlich den Schwung raus hatte. Wieder war es Moses, der es mir beibrachte. Aber dann hatte ich es raus. Nach und nach wurde ich immer besser. Ich malte einen kleinen Kreis an die Wand und traf fast immer. Ich war bald besser als meine Lehrmeister.
„Heute ist Schabbes!“, sagte Moses eines Freitags traurig zu mir. Seine Schwester Ruth sah mit ängstlichen Augen an uns vorüber.
„Ja, ja, ja“ meckerte Manja, Sbinjus Schwester schadenfroh. „Heute werden sie gewaschen. Da kannst du was erleben, Luscha!“
Im Laufe des Nachmittags vergaß ich den Schabbes, nicht aber die Judenkinder. Als die Sonne sich neigte, gingen sie nach Hause. Auch das schönste Spiel hielt sie nicht zurück. Nach kurzer Zeit ertönte ein lautes Geschrei aus dem Nebenhaus.
„Hörst du sie?“, rief Manja lachend. Zum Schabbes müssen sie sauber sein. Sie werden in ein großes Fass gesteckt. Mit grüner Seife und einer Bürste abgeschruppt. Das zwickt vielleicht. Ich wollte es nicht erleben!“
Die Sonne war untergegangen, als Manja mich in den Hausflur des Seitenhauses zog.
„Wir wollen sehen wie die Juden Schabbes feiern!“, meinte sie listig. Durch ein Fenster konnten wir in Nüssels Hof und Küche hineinschauen. Die Familie saß um einen weiß gedeckten Tisch.
Zuerst fiel mir der Leuchter mit sieben Kerzen auf. Moses und Ruth sahen so verändert, so vornehm aus. Ruths Haare waren glatt gekämmt. Das Gesicht blühte im Kerzenlicht. Sie trug eine weiße Schürze. Moses hatte ein weißes Hemd an und trug einen Hut auf dem Kopf. Auch sein Vater trug einen Hut. Sie schienen zu beten, denn sie verbeugten sich mehrere Male, was sehr feierlich wirkte. Dann brach der Vater das Brot. Barches wurde das jüdische Brot bei uns genannt. Jeder bekam ein Stück auf den Teller. Die Mutter legte gebratenen Fisch dazu. Neben jedem Teller stand ein Glas Tee.
„Ja, ja, die Juden sind reich!“, flüsterte Manja in mein Ohr. „Sie haben alles, sogar mit Gabeln essen sie. Wir haben nicht einmal genug Löffel, um zusammen zu essen. Erst kommen meine Eltern dran und dann wir Kinder!“ Traurig wandte sie sich ab. „Einen Hunger habe ich!“, bekannte sie. Und das bekam ich oft zu hören.
„Weshalb ist Manja immer hungrig?“, fragte ich Mutter. “Der größte Teil des polnischen Volkes ist hungrig“, antwortete sie. “Es ist ein armes Volk. Aber diese Armut ist oft selbst verschuldet. Die Männer vertrinken zuviel, dann müssen Frau und Kinder hungern.“
Ja, so war es. Oft drang aus dem Seitenhaus Streit und lautes Geschrei. Die Männer waren an Lohntagen betrunken nach Haus gekommen. Vorwürfe der Frauen ließen sie nicht gelten und verprügelten sie obendrein.
„Sind die Juden reich, Mutter?“ fragte ich wieder.
„Nun, reicher als wir sind sie schon, weil sie klug sind. Sie trinken nicht und halten jeden Groschen zusammen. Sie arbeiten nicht schwer, sie handeln lieber. Es ist ein besonderes Volk. Wenn du älter bist, wirst du es selbst erkennen!“
„Wir sollten auch handeln, Mutter!“ schlug ich vor.
Sie lachte. „Sehr gut gedacht, aber erst muss man das Geld für den Anfang eines Handels haben!“ Ich machte Pläne, wie wir zu Geld kommen könnten und vergaß sie wieder.
„Am Sonntag wird getanzt!“, riefen die Kinder und sprangen fröhlich um den Baum herum.
„Wo denn?“ fragte ich. Sie zeigten auf das leere Haus hinter
der Mauer. „Dort tanzen die Großen, wir tanzen hier um die Kastanie. Kannst du tanzen, Luscha?“ Ich musste verneinen.
Moses flüsterte mir zu: „Wenn du mit mir tanzt, lernst du es am schnellsten. Ich bin der beste Tänzer.“
Mutter lachte als ich davon aufgeregt berichtete. „Ja, Sonntag wird der Herbst mit fröhlichem Tanz eröffnet. Da könnt ihr im Hof tanzen. An Schlaf wird bei diesem Lärm doch nicht zu denken sein!“
Ungeduldig wartete ich auf den Sonntag. Sobald es dämmerte, wurden die Petroleumlampen im Saal angezündet. Ihr Licht fiel in unseren Hof und beleuchtete die Kastanie auf eine traumhafte Art. Die Blätter raschelten geheimnisvoll, als erzählten sie sich wispernd die kommenden Ereignissen des Abends. Wir kletterten auf die Mauer und sahen in den Saal hinein. Der füllte sich rasch mit jungen Leuten und dann begann die Musik.
„Polka!“ rief Moses, dann „Walzer“ und sie summten die Melodie mit. Beim dritten Tanz schrien sie „Mazurka!“ und sprangen von der Mauer.
Sie stellten sich paarweise auf. Moses versuchte mich von der Mauer herunterzuziehen, aber ich wollte erst einmal zusehen. So griff er nach Ruth, seiner Schwester. Eine Hand wurde in die Hüfte gestemmt, die andere hielt die des Partners. Sie tanzten wirklich wie die Erwachsenen im Saal. Einmal stampften sie auf den Boden, dann hüpften sie leichtfüßig davon, drehten sich zierlich im Kreise, verneigten sich und richteten sich auf. Bewundernd schaute ich zu. Die Mütter standen im Hof herum und beobachteten den Tanz der Kinder. Hin und wieder korrigierten sie einen Schritt oder einen Sprung. Moses und Ruth tanzten am besten. An ihnen war nichts auszusetzen. Leicht und sicher schwebten sie dahin. Ob ich es auch mal lernen würde?
Oh ja! Ich lernte es bald. Denn mein liebstes Spiel war plötzlich der Tanz. Geduldig brachten mir die Kinder jeden Schritt bei. Die ganze Woche wurde fleißig geübt und Sonntag war ich mit von der Partie. Hei, war das schön mit Moses oder Sbinju dahinzufliegen!
Der Herbst eilte davon. Der Winter zog ins Land. Die Kälte mochte klirren. Wenn die Musik erklang, kamen die Kinder herbei. Die Mädchen in Umschlagtücher gewickelt, die Knaben in ihren geflickten Joppen.
Wir tanzten, bis uns die Mütter scheltend ins Bett holten. Alle Tänze lernte ich: Walzer, Polka, Rheinländer, Mazurka und sogar den Kosatschok, den russischen Nationaltanz. Zwar konnte ich die Füße aus der Hockestellung nur sechsmal nach vorn werfen, aber es genügte vollauf. Moses war der einzige, der es zwanzigmal fertigbrachte. Dafür wurde er von allen bewundert. Fünf Jahre zählte ich damals. Niemand wollte es glauben. Ich war für mein Alter groß und stark. Meine Spielgefährten waren älter, aber nicht größer als ich. Moses war acht Jahre alt. Keinen Zentimeter überragte er mich. Ruth war auch sechs, dafür aber einen halben Kopf kleiner. Meine Größe war schon ein Vorteil. Wäre ich kleiner gewesen, hätten sich die Kinder bestimmt nicht so um mich bemüht.
Ab und zu wurde Mutter in die Umgebung geholt. Kochen sollte sie, für eine Taufe, eine Hochzeit, eine Verlobung oder was gerade gefeiert wurde. Immer kam sie mit vollen Taschen zurück. Die übriggebliebenen Speisen wurden ihr als Entgelt geschenkt. Das Beste behielten wir für uns, der Rest wanderte ins Seitenhaus. Dort wurde sogleich ein fröhlicher Schmaus abgehalten. Auf diese Weise bedankte sich Mutter bei den Nachbarn für die Unterstützung, die wir immer hatten, und wir erhielten uns die Freundschaft.
Verbot der Winter ein Spiel im Hof, saß ich mit Mutter am warmen Ofen und versuchte mich mit ersten Handarbeiten. Wie zwei Freundinnen klatschten wir ein bisschen über unsere Umgebung, sprachen von der Vergangenheit und träumten von einer schönen Zukunft.
Manchmal erfand sie eine Geschichte. Ein gutes frommes Kind spielte gewöhnlich eine Rolle darin. Ich merkte damals nicht, dass sie mich mit den Geschichten erziehen wollte.
Einmal erzählte sie mir folgendes: „Wenn ein Mensch stirbt, kommt er erst ins Fegefeuer. Denn jeder Mensch hat einige Sünden begangen, die er abbüssen muss. Das Fegefeuer ist ein weiter, steiniger Weg zum Himmel hinauf. Zu beiden Seiten dieses Weges brennen Flammen. Lang, sehr lang und beschwerlich ist der Weg zum Himmel!“ sie machte traurige Augen. „Nur ganz gute Menschen kommen gleich in den Himmel!“
Ich wurde unsicher. „Väterchen war ein guter Mensch. Er ist gleich in den Himmel gekommen. Nicht wahr, Mutter?“ Sie aber schüttelte verneinend den Kopf: “Nein, auch er ist auf dem Weg dahin. An uns liegt es, ob er schnell oder langsam hinaufkommt.“
„Hat er auch gesündigt?“, fragte ich erschrocken. Sie nickte. „Als Erwachsener nicht, aber als Kind. Eine seiner Sünden hat er mir gestanden. Er wollte nicht in die Schule gehen. Deswegen ist er von zu Hause weggelaufen und Pferdejunge geworden. Er hat es bereut, aber zu spät. Sünde ist Sünde!“
„Hat er denn noch einen weiten Weg?“, wollte ich wissen.
Sie wiegte den Kopf bedächtig hin und her. „Es kommt darauf an. Jedes Gebet bringt ihn einen Schritt vorwärts, eine gute Tat drei. Wenn du ihn nie im Gebet vergisst, immer brav alles tust was ich dir sage, wenn du vor allem draußen bei den Kindern nicht erzählst, was ich dir zu erzählen verbiete, wird er schnell in den Himmel kommen. Ist er erst einmal im Himmel, wird er für uns beten. Dann wird Gott uns reich und glücklich werden lassen. Aber denke daran, eine Sünde bringt ihn fünf Schritte zurück!“
Ich seufzte unbehaglich. „Mutter“, gestand ich schließlich, „ich habe auch schon gesündigt. Oft habe ich die Katze im Schloss aus dem Fenster geworfen. Du weißt doch, sie hat mich immer gekratzt. Die Enten und Gänse habe ich mit Steinen vom Wasser getrieben. Ich habe Fliegen gefangen und sie den Hühnern zum Fressen hingeworfen!“
Mutter blickte mit zusammengepressten Lippen in ihren Schoss.
Dann meinte sie: „Da warst du noch zu klein. Du hast nicht gewusst, dass es Sünde ist. Jetzt weißt du es und wirst es in Zukunft lassen!“ Ich küsste ihr die Hand. „Nie mehr will ich so etwas tun!“ versprach ich.
Wenn es an mir lag, sollte Väterchen so rasch wie möglich in den Himmel kommen. Ich lief nicht mehr so wild herum, gehorchte auf jedes Wort, betete abends andächtig für den Vater und beschwor die Madonna, mir zu helfen, ein gutes Kind zu werden.
Nach einigen Tagen erzählte mir Mutter, Väterchen hätte ihr im Traum gesagt, er wäre ein gutes Stück dem Himmel näher gekommen. Das macht mich unendlich froh.
Der Schnee schmolz. Der Frühling war mit Regen und viel Schmutz im Anzug. Der Marktplatz glich einem Schlammbad. Wer Wasser aus dem Brunnen holte, der mitten auf dem Marktplatz stand, musste barfüßig hingehen. Seine Stiefel wären unweigerlich im Schlamm stecken geblieben. Die Männer aus dem Seitenhaus holten für uns das Wasser.
Ja, es war ein Vorteil, Köchin zu sein und den Leuten hin und wieder einen Leckerbissen abgeben zu können. Das zahlte sich in vielen Gefälligkeiten aus und erhöhte die Achtung. Wir kamen dank Mutters Kochkunst gut durch den Winter. Ein Mädchen, mit dem sie einige Zeit im Schloss zusammen gearbeitet hatte und das nun in der deutschen Grenzstadt diente, vermittelte Mutter öfter als Aushilfe.
Das war es auch, was Mutter in die Nähe der Grenze gezogen hatte. Sie wollte ganz hinüber, musste sich aber erst einen Wirkungskreis sichern. Immer öfter holte man sie nun herüber. Frau Professor empfahl sie der Frau Doktor, die Frau Doktor der Frau Amtsrichter und so weiter und so fort. „Noch ein Jahr, dann musst du in die Schule!“, pflegte sie zu sagen.„Und wir müssen bis dahin drüben sein! „Wieder war das Mädchen gekommen, um Mutter zum Kochen zu holen.
„Martha“, ganz aufgeregt klang ihre Stimme, „heute sollst du beim reichsten Mann der Stadt kochen. Beim Stadtrat Mühl. Du weißt doch, der Mann der die Million in der Lotterie gewonnen hat. Seine Köchin ist plötzlich erkrankt. Gerade heute hat er ein Fest, ein Jubiläum. Zwanzig Herren sind zum Essen eingeladen. Da gibt es bestimmt eine Menge Trinkgelder!“ Erfreut setzte sich die Mutter dem Mädchen gegenüber und fragte: „Wann soll ich dort sein?“
„Gegen fünf. Um acht Uhr soll das Essen beginnen!“ Mutter warf einen Blick aus dem Fenster. Ganz hinten sah man den Kirchturm von Myslowitz, der kleinen Stadt. Mutter sah auf die grosse Uhr, wenn sie die Zeit wissen wollte. „Vier Uhr ist es eben“, bemerkte sie, „in einer Stunde bin ich an Ort und Stelle!“
Das Mädchen erhob sich. „Gut, Martha, ich laufe schnell zurück, man wartet auf deine Zusage! Sie beschrieb Mutter noch das Haus und verschwand. Während Mutter sich sorgfältig vorbereitete, gab sie mir wie jedes Mal Verhaltungsmaßregeln: „Gehe nicht mehr hinaus! Schließ dich ein! Lass niemanden herein! Zünde nicht die Lampe an, sondern geh zu Bett, wenn es dämmert! Iß, was ich zurechtgemacht habe! Schlafe nicht ein, denn du musst mich hereinlassen! Denk an Väterchen und erzähle dir seine Geschichten!“
Ach, ich wusste ja schon alle auswendig. Ich setzte mich ans Fenster und winkte ihr so lange, bis das andere Ende der Brücke sie verschlungen hatte. Bis es dämmerte blieb ich am Fenster und schaute dem Treiben auf der Brücke zu. Viel war nicht zu sehen, denn es regnete. Die Dunkelheit würde rasch hereinbrechen. Ich tat, wie Mutter befohlen hatte, aß, wusch mich sauber und legte mich in das aufgeschlagene Bett.
Nach einem innigen Gebet für meinen Vater, fing ich an zu singen. Alle Lieder, die ich kannte sang ich in Deutsch, Polnisch oder Russisch. Die Zeit verging beim Singen am schnellsten und es hielt mich wach. Als ich kein Lied mehr wusste, sagte ich alle Kinderreime auf, die Vater mich gelehrt hatte. Noch war es Zeit an Mutters Rückkehr zu denken. Dann erzählte ich meiner Holzpuppe Märchen und Sagen. Das waren nicht wenige, aber Mutter kam immer noch nicht.
Moses hatte mir das Zählen an den Fingern beigebracht. So zählte ich auf und ab meine Finger durch. Ich spürte wie ich müde wurde, aber ich durfte nicht einschlafen. So versuchte ich, mir eine Geschichte auszudenken. „Es war einmal ein armes vaterloses Kind, das im Bett lag und nicht einschlafen durfte!“, erzählte ich laut der Puppe. Eine Weile überlegte ich wie es weiter gehen sollte, aber mir fiel nichts ein. Da hörte ich die schnellen Schritte meiner Mutter im Hof. Ich sprang aus dem Bett. Bevor sie die Tür erreichte rief ich ihr entgegen:
„Bist du es, Mami?“
„Ja, mein Kind!“, rief sie zurück und schon hatte ich die Tür für sie geöffnet. Meine Müdigkeit war weg.
Sie schlüpfte herein, die Lampe wurde angezündet.
Ihr Tuch triefte vor Nässe, aber ihr Gesicht strahlte.
„Geh zurück ins Bett, Luscha. Es ist kalt im Raum. Erzähle mir wie du den Abend verbracht hast!“ Das tat ich ausführlich. Als ich zu meiner Geschichte kam, sagte sie ernst:
„Das ist ein guter Gedanke, eine Geschichte zu erfinden. Ich bin gespannt wie sie weiter gehen wird. Heute ist Väterchen bestimmt zehn Schritte dem Himmel näher gekommen!“ Diese Worte beglückten mich mehr als jedes Lob.
Dann erzählte Mutter, was sie erlebt hatte. Das Essen war ihr gut gelungen. Die Schüsseln und Platten waren leer geworden und es hatte reichlich Trinkgelder gegeben.
Unter den Gästen war der Direktor Kaschkiewicz und noch einige Herren, die Mutter vom Schloss her bekannt waren, da sie dort auch verkehrt hatten. Wie üblich waren sie in die Küche gekommen, um der Köchin ein Lob für das gelungene Essen und ein Trinkgeld zu spendieren.
Dr. Stoklowski, ein bekannter Rechtsanwalt aus der kleinen Grenzstadt hatte erstaunt ausgerufen: „Ja, Kaschkiewicz, das ist doch ihre Köchin! Kein Wunder, dass das Essen so ausgezeichnet geschmeckt hat!“ und Kaschkiewicz hatte mit einer Stimme, als wäre ihm ein Unglück widerfahren, geantwortet. „Sie hat mich verlassen!“
Daraufhin hatte der Rechtsanwalt die Mutter für nächsten Samstag in sein Haus bestellt.
„Was hast du verdient, Mutter?“ fragte ich neugierig. Sie lächelte froh: „Sechs Mark, mein Kind. Vier Mark sind Trinkgelder. Eine Mark gab mir die Frau als Lohn. Zum Schluss kam noch der Herr Rat in die Küche und legte eine Mark dazu. Er sagte, das Essen sei eine Glanzleistung gewesen!“ Sie lachte glücklich. „Ich habe die jüdische Leberspeise als ersten Gang gewählt. Die Wiener Nusscreme als Dessert. Die Frau Rat wollte unbedingt das Rezept für beides haben. Aber welche Köchin verrät schon ihr Geheimnisse?“
„Sind sechs Mark viel Geld, Mutter?“ wollte ich wissen.
„Sehr viel, mein Herz. Im Schloss musste ich für sechs Rubel das ganze Jahr arbeiten, das sind genau zwölf Mark. Sicher gab es auch Trinkgelder, aber soviel wie heute an einem Abend gab es noch nie.“ Sie legte den Finger an den Mund: „Kein Wort draußen erzählen! die Leute sind missgünstig und schlecht. Wenn man dich fragt, dann antworte einfach: Fragen sie meine Mutter! denk an Väterchen, der bestimmt ein Stück zurückgehen müsste, wenn du was ausplapperst!“
So lernte ich die Worte abzuwägen und meine Zunge im Zaum zu halten.
Immer öfter wurde Mutter über die Grenze geholt. Wenn sie wiederkam wurde die Truhe geöffnet, der Sparstrumpf hervorgeholt und ein Geldstück unseren Ersparnissen hinzugefügt.
Dann kam ein Abend an dem sie mit nachdenklichem Gesicht nach Hause gekommen war.
„Denk dir, Luscha! erzählte sie schließlich, „der Dr. Stoklowski hat mir die Stelle als Köchin in seinem Haus angeboten. Mit fünfzehn Mark im Monat!“
„Und ich?“ fragte ich entrüstet. „Na, du kommst selbstverständlich mit. So wie im Schloss, ein Zimmer für uns beide!“ „Oh, Gott“, jammerte ich „dann müssen wir von hier fort und du wirst nie Zeit für mich haben!“
„Ja,“ nickte sie, „deswegen habe ich abgelehnt. Und dabei bleibt es!“ Erleichtert atmete ich auf, aber es blieb nicht dabei. Noch einen Sommer verlebten wir in unserer Kate. Für mich war es ein Sommer voller unbeschwerten Kinderglücks. Das ganze Dorf kannte und liebte mich. Sogar die russischen Grenzler hatten sich mit mir angefreundet. Sahen sie mich über den Marktplatz laufen, so tönte ihr gellendes „Jeluscha“ hinter mir her. Ich sang ihnen meine Lieder vor. Aber noch öfter musste ich vortanzen. Ei, das gefiel ihnen. Sie klatschten in die Hände und feuerten mich durch Zwischenrufe an „Hullai noschka, nie pretain!“ (Tanze Füßchen, hör nicht auf) sangen sie im Chor. Ein Stück harter Zucker war mein Lohn, den ich mit den anderen Kindern teilte. Meinen Triumph war, ich wurde zum Vortanzen aufgefordert.
War es heiß, liefen wir zum Schwimmen in die weiße Przemsa. Ihr Wasser war klar, wie das unseres Brunnens am Marktplatz. Moses brachte mir das Schwimmen bei. Seine Sanftmut und Gedult hatten ihn zu meinem liebsten Spielkameraden werden lassen. Nie gab es Streit, wie mit den anderen. „Wenn ich groß bin, lass ich mich taufen und heirate dich!“, bekannte er öfters. „Ich habe es satt, Jude zu sein. Alle Kinder nennen mich einen ‚Meusche‘. Ich will kein Meusche sein!“, zornig stapfte er mit dem Fuß auf die Erde.
„Gut, gut“, besänftigte ich ihn, „lass dich taufen, ich heirate dich bestimmt!“
Hänselten uns die anderen wegen unseres guten Einvernehmens, gab es eine kleine Prügelei. Nun, das gehörte zu unserem Spiel wie Messerwerfen und Kobeln.
Der Herbst setzte in diesem Jahr sehr früh ein. Es regnete Tag und Nacht. Der Fluss stieg beängstigend. „Es wird doch keine Überschwemmung geben?“, befürchtete meine Mutter.
Das Dach war undicht geworden. Die Kohlen waren alle. Wir kauften eimerweise, was wir benötigten. Die Mutter machte sich Sorgen, das spürte ich genau. Nicht nur das Wetter bedrückte sie. Endlich brach eines Morgens die Sonne wieder durch. Wir standen am Fenster und schauten auf die Brücke. Die Sonne hatte den Verkehr aufleben lassen. Viele Menschen waren unterwegs. Hin und her fuhren die Wagen über den Steg.
„Da fährt der Dr. Stoklowski in seinem Wagen vorbei,“ sagte die Mutter und wies mit dem Kopf auf eine vorübereilende Kutsche. „Sicher ist er beim Kaschkiewicz zum zweiten Frühstück eingeladen.“
„Vielleicht kommt er zu uns,“ bemerkte ich leichthin.
„Aber nein, zu uns wird er nicht kommen. Er hat doch seine Leute, wenn er mich braucht!“ Und vorüber war der Wagen. Wir schauten weiter zum Fenster hinaus und freuten uns, wie herrlich die Sonne die Welt verändern konnte. Der Fluss war zurückgegangen, die Wiesen trockneten und glänzten in den Sonnenstrahlen. Neuen Mut schien sie überall zu verbreiten, denn auch Mutter schaute zuversichtlicher drein. Es klopfte, erstaunt trat Mutter vom Fenster zurück und öffnete die Tür. Da stand wirklich der Dr. Stoklowski. Sie ließ ihn eintreten. Neugierig musterte ich ihn. Was wollte er bei uns?
Er blieb einen Augenblick an der Tür stehen und schaute sich überrascht um. „Von außen ein Stall und von innen ein Schloss! Wie im Märchen!“ sagte er langsam. „Ich hätte nicht geglaubt, dass es in Modrzejow so etwas gibt. Aber es passt zu dir. Ich freue mich, hierher gekommen zu sein, deine Einrichtung und Ordnung überzeugt mich. Das ist mehr Wert als alle Empfehlungen!“ Er setzte sich, sah die Mutter an und fragte: „Na, Martha, hast du dir überlegt, ob du kommen willst?“ Indessen hatte Mutter Zeit gewonnen sich von ihrer Überraschung zu erholen.
Sie antwortet abweisend. „Ich habe das Kind, eines Tages wird es Ihnen im Wege sein!“
„Red kein Unsinn! ich habe auch ein Kind. Das haben wir schon alles besprochen. Aber du musst noch einen anderen Grund haben, die Stellung in meinem Hause abzulehnen. Sag mir klipp und klar, was du befürchtest!“
Sie kämpfte einen Augenblick mit sich, ehe sie antwortete:
“Ich habe Angst, mir in zwei Monaten wieder eine Wohnung suchen zu müssen. Jede Köchin, jede Wirtschafterin oder Hausdame bleibt bei Ihnen nicht länger als zwei Monate. Sagen Sie mir, warum?“
„Warum, warum?“ Er hieb mit der Hand auf den Tisch. “Weil sie nicht kochen können, zum Teufel noch einmal! Glaubst du, ich fresse ihre preußischen Tunken? Ich bin halt an unsere polnische Küche gewöhnt.“ Er sah Mutter zornig an. „Und wirtschaften können sie nicht, sie können nicht selbständig arbeiten. Immerfort belästigen sie mich mit Fragen. Ich will meine Ruhe haben.“ Ich lief an Mutters Seite, denn ich fürchtete den zornigen Herrn. Der aber beachtete mich kaum und sprach weiter: „Martha, ich frage dich ein letztes Mal und nicht mehr wieder!“





























