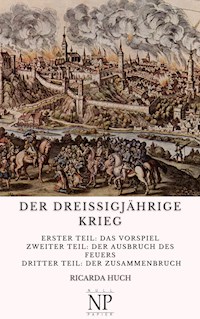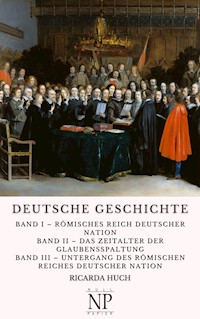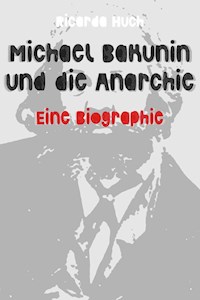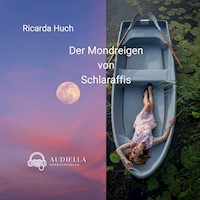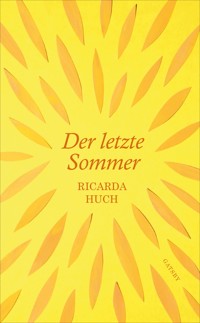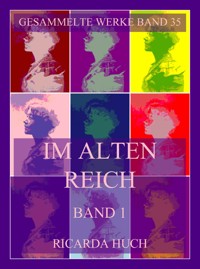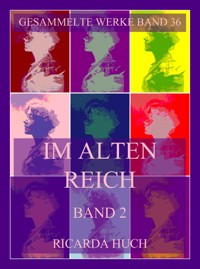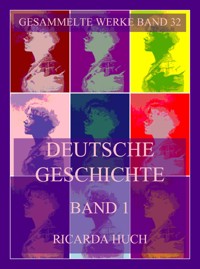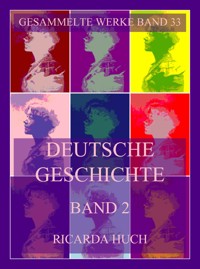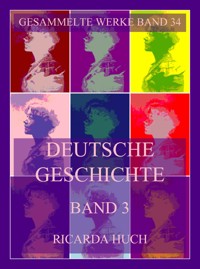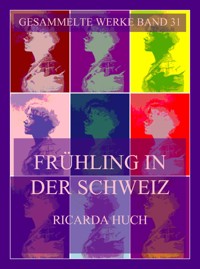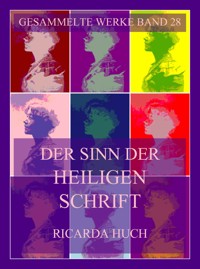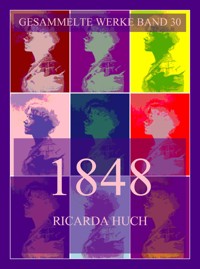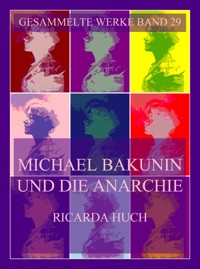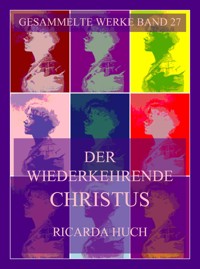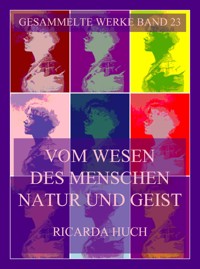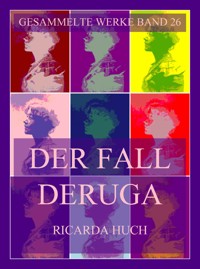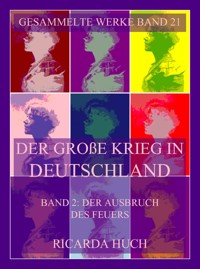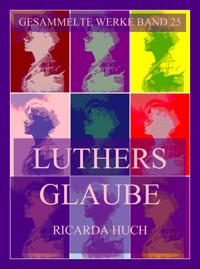
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Erinnerungsjahr der Reformation 1917 wurde eine Flut von Schriften über den Volkshelden veröffentlicht, der trotz Goethe, Bismarck und anderer Koryphäen noch immer einer der einflußreichsten Männer der Deutschen ist. Aber kein Buch lässt sich mit diesem hier vergleichen, denn es ist, wie weiland Schleiermachers Reden, an die Gebildeten unter den Verächtern der Religion gerichtet, und sein Verfasser ist Ricarda Huch. Das bedeutet zum ersten, dass seltenerweise ein Laie in der Theologie über Luther schreibt, und zwar nicht über den geschichtlichen Menschen, sondern über seinen Glauben; sodann, dass der Altmeister deutscher Sprache hier eine meisterhafte Sprecherin gefunden. hat, die ihn den Menschen unserer Tage deutet. Denn es läßt sich nicht leugnen, und davon geht die Dichterin aus, dass zwar Luther wie ein eherner Riese noch heute unter uns steht, doch elbst viele Protestanten mit achtungsvollem Gruß an ihm vorübergehen, ohne ihn kennen zu wollen; dass er auch unzähligen Kindern an Alter und Bildung noch immer der väterliche Lehrmeister in der Religion ist, dass aber der,,moderne Mensch" dem Sohn des Mittelalters entwachsen zu sein sich einbildet. Und dies will Ricarda Huch erweisen: daß Luthers Glaube auch der unsere sein kann, ja, sein sollte, gleichviel, welcher Konfession wir seien. Sie übersezt ihn darum in die Sprache der Gegenwart, doch ohne - und dies ist das Merkwürdigste daran - diesen Glauben zu verdünnen, um ihn schmackhaft zu machen. Sie nimmt ihn in der ganzen ursprünglichen Tiefe und prophetischen Kraft des religiösen Offenbarers. Sie kritisiert ihn nicht, sondern bekennt sich zu ihm, freilich mit einem höchst persönlichen Verständnis seiner Gotteslehre, die den Kennern des geschichtlichen Luther nicht selten ein Kopfschütteln verursachen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Luthers Glaube
RICARDA HUCH
Luthers Glaube, Ricarda Huch
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988682215
Quelle: https://www.gutenberg.org/cache/epub/39430/pg39430-images.html#inhalt.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
I1
II7
III11
IV.. 17
V.. 21
VI27
VII33
VIII44
IX.. 52
X.. 61
XI68
XII73
XIII85
XIV.. 94
XV.. 102
XVI108
XVII121
XVIII128
XIX.. 133
XX.. 141
XXI146
XXII154
XXIII159
XXIV.. 168
I
In seinen Kritischen Gängen macht F. Th. Vischer folgendermaßen seiner Begeisterung für Luther Luft:
„Goethes Epigramm gegen das Luthertum meint die Einseitigkeit, womit sich Luther selbst und mit ihm seine Nation rein auf die inneren inhaltsvollen Interessen des Geistes warf, allem schönen Schein, aller sanften, menschlich schönen Bildung zunächst den Rücken kehrte, so dass die bildende Kunst, die Poesie stockte, die Grazien ausblieben und erst im Lauf der Jahrhunderte eine ästhetische Bildung eintrat, welche bei den romanischen Völkern in ununterbrochener Fortentwickelung mit oder nicht allzu spät nach dem Abschluss des Mittelalters ihre Blüte feierte. Und er vergisst sich zu fragen, ob er je einen Egmont, einen Faust, eine Iphigenie, ja, ob er je eines seiner Worte, ob Schiller je eines seiner Werke geschrieben hätte, wenn nicht jene unsere derben Ahnen mitten durch die Welt des bestehenden schönen Scheins mit grober deutscher Bauernfaust durchgeschlagen und so eine Krisis der Zeiten herbeigeführt hätten, eine ethische Krisis, für welche nie und nimmer die ästhetische Bildung ein Surrogat sein kann, welche vielmehr einer echten, tiefen, wahren Kunst und Poesie, wie die neuere es ist, vorausgehen musste. Wohl uns, dass unsere Vorfahren überhaupt gar die Versuchung nicht kannten, gegen das ethisch Überlebte sich ästhetisch zu verblenden; dass sie solche Tendenzbären waren, dass der schöne Schein sie nicht bestechen, der Glanz der Belladonna sie nicht blenden konnte; wohl uns, dass sie nicht mit der Phantasie umfassten, was der grobe Verstand, die Vernunft und der moralische Sinn zu entscheiden hat.“
So spricht ein bekannter und geachteter Schriftsteller über Luther, dessen Lebenswerk darin bestanden hat, die Moral zu bekämpfen, der Poesie sprach, wenn er den Mund auftat. Er nennt Luther einen Tendenzbären, ihn, der jede Tendenz im Leben und in der Kunst als teuflisch entlarvt hat, ohne darum in den Irrtum zu verfallen, als sei die Kunst oder sonst irgendetwas um seiner selbst willen da, da nur Gott oder, wenn du lieber willst, das Weltganze um seiner selbst willen da ist. Der Kampf gegen die Moral oder Werkheiligkeit nämlich war der Ausgangspunkt und Mittelpunkt von Luthers Lehre. Als ich diese Vischersche Predigt las, begriff ich, was für ein Zorn, ja was für eine Raserei Luther manchmal ergreifen musste, wenn ihn trotz seiner klaren und glühenden Worte niemand verstehen wollte oder meinetwegen konnte. Er gab sich ganz hin, und ihm grinste immer nur engherzige oder verstockte Persönlichkeit entgegen. Auch Goethe also, der ohne Luther nicht zu denken wäre, ein Sohn aus Luthers Geiste wie Lessing, Schiller und überhaupt jeder große Deutsche nach ihm, hat ihn verkannt und verleugnet; wiewohl ich glauben will, dass davon mangelhafte Kenntnis die Ursache war.
Mein erster Gedanke war, wie dumm es ist, den Menschen Meinungen seines Herzens mitzuteilen; denn kraftvoller, packender, reiner ausgeprägt sich auszusprechen als Luther ist nicht möglich, und es ist doch nicht möglich, noch gründlicher missverstanden zu werden, noch dazu von seinem eigenen Volke. Im Grunde ist das noch schlimmer, als gekreuzigt und verbrannt zu werden. Aber Luther streute den Samen seines Wortes trotz Hass und Missverständnis aus, denn er tat es ja nicht aus Tendenz, sondern weil er musste, und deshalb ging der Samen auch auf und nährte alle, selbst wider Wissen und Wollen. Ich glaube, es gibt keinen Dichter, dem es weniger um seinen Namen zu tun war, als Luther. Erinnerst du dich der schönen Worte des Marquis Posa: ihn, den Künstler, wird man nicht gewahr; bescheiden verhüllt er sich in ewige Gesetze. Was für ein Mensch war Luther, dass man auf ihn anwenden kann, was von Gott gesagt ist. Er würde aus Vischerschen und anderen Missverständnissen jedenfalls nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass man sich schweigend in sich zurückziehen, und noch viel weniger die, dass man seine Person ins hellere Licht ziehen sollte, sondern dass seine Ideen wiederholt und verständlicher gemacht werden müssten.
Wenn ich sie gerade dir verständlich zu machen suche, so ist das, weil ich nun einmal so gern dir sage, was ich weiß, wie wenn es dir gehörte. Nehmen wir an, du seiest der König, in dessen Dienst ich stehe, und dem ich deshalb meine Lieder, oder was es sonst ist, widmen muss. Ob das Sinn und Berechtigung hat, zeigt sich vielleicht am Schlusse; einstweilen hoffe ich, dass du deiner Scheherazade ebenso gern zuhörst, wie sie dir erzählt, und beschränke meine Vorrede auf die Bitte, dass du nicht ungeduldig wirst, wenn ich etwas sage, was du schon weißt. Es ist ein Unterschied, etwas zu wissen und es von einem anderen, vielleicht in einem anderen Zusammenhange, zu hören.
Ich will mit dem Begriff der Werkheiligkeit anfangen. Luther bemühte sich im Kloster, vermittelst der Vorschriften des Mönchslebens die Seligkeit, den inneren Frieden, zu erlangen, oder, wie er es oft nennt, einen gnädigen Gott zu bekommen. Diese Vorschriften bestanden in Gebeten, Nachtwachen, Kasteiungen, kurz in allerlei Übungen zum Zwecke der Selbstüberwindung; Luther fand aber, dass er sich, je ernstlicher er in ihrer Ausführung war, desto weiter von dem ersehnten Ziel entfernte. Je tadelloser, je heiliger er am Maße der Werke gemessen wurde, desto dunkler, kälter und leerer fühlte er sein Inneres. Was er auch tat, um sich gewaltsam Gott zu nähern, das Ergebnis war, dass er ihm immer ferner rückte, bis an den Rand der Hölle. Unter Verzweiflungsqualen machte er die Erfahrung, dass man zugleich in seinen Handlungen gut und in seinem Innern unselig sein kann; dass zwischen Handeln und Sein eine unüberbrückbare Kluft besteht, solange die Handlungen aus dem bewussten Willen fließen, dass ein Zusammenhang zwischen Handeln und Sein nur da ist, wenn die Handlungen aus dem unbewussten Herzen, eben aus dem Sein entspringen, kurz, dass nur die Taten der Seele zugutekommen, die man tut, weil man muss. Alles Guthandeln, das nicht mit Notwendigkeit aus dem Innern fließt, sondern das der bewusste Wille macht, rechnete Luther unter die Werkheiligkeit, eine Vollkommenheit, die nur Schein ist, weil sie auf das Sein des Menschen gar keinen Bezug hat. Er wies alle derartige Handlungen als ungöttlich, d.h. nicht aus dem Sein fließend, aus dem Gebiet der Religion in das Gebiet der Moral, womit nur die Welt, aber nicht Gott zu tun habe; ja, er trennte nicht nur die Moral vom Reiche Gottes ab, sondern behauptete und wies nach, dass sie in einem feindlichen Gegensatz zu Gott steht.
Dass sogenannte Zeremonien, nämlich kirchliche Vorschriften, als Wachen, Fasten, Beten, Kasteien und ähnliches, die Seligkeit nicht geben können, leuchtet den meisten Menschen ein; man könnte indes bezweifeln, ob moralische Handlungen unter denselben Begriff gehören. Auch hat schon in den ersten Jahrhunderten der Kirche ein kirchlicher Denker es bestritten; aber Augustinus stellte fest, dass Paulus durchaus nicht nur die Zeremonien, sondern auch die moralischen Handlungen, diese sogar vor allen Dingen, zu den Werken rechnete, die vor Gott nicht rechtfertigen oder gerecht machen.
Unter Guthandeln versteht jeder Mensch ein Handeln, welches das Wohl des Nächsten, nicht das eigene Wohl bezweckt; gut ist gleichbedeutend mit selbstlos, böse gleichbedeutend mit selbstsüchtig. Luther sagt nun, der Wille des Menschen sei nicht imstande, von sich aus etwas anderes anzustreben als das eigene Wohl, das Gute wirke nur Gott im Menschen; jeder also, der seine Handlungen so einrichte, als ob er das Wohl des Nächsten anstrebe, sei ein Heuchler und Gleisner. Er nahm damit den Kampf gegen die Pharisäer wieder auf, den Christus gekämpft hat.
Es versteht sich, dass es auch zu Luthers Zeit Pharisäer in Menge gab, die sich über seine Lehre moralisch entrüsteten. Es entspann sich der berühmte Streit um den freien Willen, von dem Luther, auf Augustinus und Paulus sich stützend, behauptete, dass er der Sünde oder dem Teufel verknechtet sei, und aus dieser Knechtschaft nur durch die Gnade Gottes befreit werden könne. Es ist höchst interessant nachzulesen, wie sich Luthers Gegner wanden und drehten, um ihn in diesem Punkte zu bekämpfen. Auf dem Tridentiner Konzil bemühte sich jeder, eine Formel zu finden, durch welche der freie Wille des Menschen gerettet und doch Gott nicht zu nahe getreten würde. Denn man musste zugeben, dass Gott, wenn überhaupt Gott sei, allmächtig, allwissend, allumfassend sein, dass folglich jede menschliche Kraft von ihm ausgehen müsse; trotzdem glaubte man um jeden Preis an der freien Selbstbestimmung des Menschen festhalten zu müssen, wenn man es auch nur so ausdrückte, dass der Mensch der göttlichen Gnade ein klein wenig entgegenkommen könne, ohne dass ihm das aber als Verdienst anzurechnen sei. Solche Ausflüchte in Worten waren Luthers Sache nicht, da er eine klare und unerschütterliche Überzeugung hatte. Seine Meinung war, dass Gott, Teufel und Mensch im tiefsten Grunde eins sind, Teufel und Mensch von Gott ausgehend, in Gott wurzelnd, und so versteht es sich von selbst, dass alles von Gott, dem einzig wahrhaft Seienden, abhängt, und dass, soweit der Mensch eine Selbsttätigkeit hat, auch diese von Gott verliehen sein muss und nur von Gott wieder zurückgenommen werden kann. Luthers Gegner hingegen hatten die dunkle Vorstellung, als wäre der Mensch eine selbständige Person, die von zwei mächtigeren selbständigen Personen, Gott und dem Teufel, vielmehr die nur von einer mächtigeren Person, Gott, beeinflusst oder beherrscht würde; denn an den Teufel glaubten die wenigsten so recht. Jetzt würde vielleicht mancher sagen, dass das Sein des Menschen, im Allgemeinen Sein wurzelnd, verschiedene Entwickelungsphasen mit verschiedenen Bewusstseinsgraden durchläuft; aber diese Begriffe fehlten Luther, obwohl er die Idee hatte. Übrigens blieb er auch absichtlich bei den alten, geläufigen Symbolen und mied die Begriffe, die sich so leicht verflüchtigen, wie er von den Scholastikern wusste. Andererseits trennen sich die Symbole leicht von den Ideen, die sie decken, und sinken zu Hülsen herab; darum ist es in unserer Zeit, so scheint es mir, notwendig festzustellen, was wir uns eigentlich bei Luthers Worten denken können und sollen.
Luther geht davon aus, ganz anders als Rousseau, dass der natürliche Mensch nur sich selbst und sein Wohl wollen kann, und dass, wenn sein Handeln andern zugutekommt, etwa sogar auf seine Kosten, seine Absicht dabei nur auf den Erwerb einer Belohnung oder die Vermeidung einer Strafe gerichtet ist. Ob er den Lohn und die Strafe von Gott in einem vermuteten jenseitigen Leben erwartet, oder ob es ihm um das Ansehen in der Welt zu tun ist, oder ob er die eigene Billigung und Missbilligung sucht und fürchtet, das eigene Selbst ist immer der Endzweck. Wir unterliegen, solange wir wollend sind, einem inneren Gesetz der Schwere, und Luther gebraucht darum den Ausdruck, dass wir fallen, wie auch, dass wir wohl nach unten, aber nicht nach oben frei sind.
Du wirst sagen, dass Luther demnach die Freiheit des Willens nicht überhaupt leugne, und vermutlich, dass diese seine Ansicht dadurch erst recht unbegreiflich würde. Nun also, dass alles, was geschieht, notwendig geschieht, ist selbstverständlich, da ja alles geprägte Form ist, die sich entwickelt; aber darum streitet Luther hier nicht. Es fragt sich, ob der Mensch das Gute wollen kann, und dagegen behauptet Luther, dass er wollend stets nur alles auf sein Selbst beziehen könne, das Gute wolle er nur durch Gnade, mit anderen Worten, das Gute wolle er nicht, sondern es werde in ihm gewollt. Ein Ausspruch der Heiligen Schrift, den Luther öfters anführt, heißt: Der Mensch ist wie ein Tier, Gott und Satan können ihn lenken. Vielleicht klingt es dir verständlicher oder sympathischer, wenn ich sage, der Mensch sei Werkzeug in der Hand Gottes oder in der Hand des Teufels. Nun gibt Luther zwar zu, dass der Mensch auch selbst wollen könne, und er grenzt dies Gebiet ab als das der Moral; aber er nennt es auch teuflisch, obwohl es sich dem Teufel gewissermaßen entgegensetzt. „Da ja dies das höchste Streben des freien Willens ist, in moralischer Gerechtigkeit und Werken des Gesetzes sich zu üben, durch die seine eigene Blindheit und Ohnmacht befördert wird.“ Zunächst scheint es allerdings weit verdienstlicher zu sein, das Gute zu tun, weil man will, als weil man muss; ja, wenn man muss, so ist gar kein Verdienst dabei. Das soll es nach Paulus und Luther aber auch nicht; Werke, Verdienste, eigenen Willen vor Gott zu haben ist nach ihnen teuflisch. Was Gott nicht geboten hat, das ist verdammt, heißt es in der Bibel. „Du sollst nicht tun, was dir recht dünkt.“ Luther führt eine Geschichte aus dem Alten Testament an, wo einer aus keinem anderen Grunde von Gott gestraft wird, als weil er etwas Gutes getan hatte, was nicht von Gott geboten war. Das scheint absurd, wenn man nicht bedenkt, dass es sich nur um eine Strafbarkeit vor Gott handelt. Dass Werke und Verdienste vor der Welt nützen, bestreitet Luther nicht; nur dass sie „einen gnädigen Gott machen“.
Es hat etwas Überraschendes, wenn Luther sagt, eine Jungfrau, die ehelos bleibe in der Meinung, dadurch etwas Verdienstliches, Gottgefälliges, Heiliges zu tun, sei teuflisch; wenn sie aber ledig bleibe, weil sie keine Neigung zur Ehe habe, auch weil sie vielleicht durch die Pflichten der Ehe von anderen Dingen abgehalten zu werden fürchte, die ihr mehr am Herzen lägen, so handle sie wie eine rechte, christliche Jungfrau. Die also, welche ihre natürlichen Triebe mit großer Anstrengung überwinden, wird Gott nicht nur nicht belohnen, sondern strafen. „Und Matth. , 31 spricht es auch, dass Huren und Buben werden eher ins Himmelreich kommen, denn die Pharisäer und Schriftgelehrten, welche doch fromme, keusche, ehrliche Leute waren.“ Aus dieser Stelle siehst du, dass Luther unter Pharisäern nicht nur schlechte Menschen verstand, die sich verstellten, sondern „fromme, ehrliche, keusche“ Leute, deren Schuld nur darin bestand, dass sie absichtlich nicht sündigen wollten. Zu den Zöllnern und Sündern ist, wie du weißt, Christus gekommen, sie nennt er sein teuer erarntes Eigentum. Besser sündigen als gut handeln weil man will, nicht weil man muss; denn das heißt eine Maske vorbinden, hinter welcher das lebendige Gesicht verschwindet. „Sei Sünder und sündige kräftig“, schreibt Luther an den werkheiligen Melanchthon, „aber noch kräftiger vertraue auf Christus und freue dich seiner, der ein Überwinder der Sünde ist, des Todes und der Welt: wir müssen sündigen, solange wir hier sind.“ Das bewundere ich besonders an Luther, dass er begriff, dass der Teufel und die Sünde zwar nicht sein sollen, aber sein müssen, während die meisten Menschen nicht auf die Idee des Guten kommen können, ohne dass sie die Idee des Bösen aus der Welt schaffen möchten. Es muss aber beides sein.
Denke nicht, geliebter Freund, du wärest kein Werkheiliger, wenn du kein Pharisäer, wenn du nicht tugendstolz bist. Du hast zu viel Geschmack, um mit Tugenden zu prahlen, die du nicht besitzest; aber du bist zu stolz, um von einem andern als dir selbst einen Tadel ertragen zu können. Dabei ist doch eine verkappte Heuchelei, denn es erscheint nicht alles, was du bist, wenn auch nichts erscheint, was du nicht bist. Du verstellst dich nicht, aber du verbirgst dich. Diejenigen, die keine andere Belohnung suchen, als sich selbst zu genügen, sind, gerade weil sie gottähnlich sein wollen und sind, am allermeisten ungöttlich; sie sind wie Luzifer, der schönste unter den Engeln, der durch seine Schönheit zum obersten Teufel wurde. „Gleichwie vom Anbeginn aller Kreaturen“, sagt Luther, „das größte Übel ist allezeit gekommen von den Besten.“ Dein Unglück, du Liebster und Schönster unter den Menschenkindern, scheint mir zu sein, dass dir nichts und niemand schön genug scheint, um dich zur Sünde zu verführen; darum betest du dich selbst an und verführst, du, der selbst nicht sündigen will, andere dazu, die Sünde, dich anzubeten, mit dir zu teilen. Fast, fast hättest du auch mich dazu verführt; aber ich bin nun einmal in der Gnade und kann dich lieben, ohne Schaden an der Seele zu nehmen, ja ich kann sogar mit dir schelten, und du musst mir zuhören. Runzle nicht die Stirn und hebe nicht warnend den Finger: ohnehin bricht der Morgenstern durch die erste Nacht und lächelt.
II
Darauf war ich vorbereitet, dass du mit einer ablehnenden Gebärde, die alles glatt vom Tisch streicht, was ich dir vorgelegt habe, antworten würdest. Da ich nun einmal deine Scheherazade oder dein Kanzler bin, mein König, finde ich mich hinein, zuweilen auch einem ungnädigen Herrn Vortrag halten zu müssen, und hoffe, dass diesmal entweder ich mich deutlicher ausdrücke oder er mir ein geneigteres Ohr schenkt.
Du schreibst mir, das wissest du wohl, dass ein guter Baum gute Früchte trage und ein schlechter Baum schlechte, und dass es am schönsten sei, wenn einer das Gute tue, weil er müsse; es hätte dich interessiert zu erfahren, wie aus einem schlechten Baum ein guter werden könne, und solange du kein Mittel dafür wüsstest, zögest du gute Früchte, wenn auch durch Eigenwillen hervorgebracht, schlechten vor. Auf die Gnade warten, die vielleicht nie käme, sei im Grunde eine Schlamperei, und du hieltest dich einstweilen an das Wort Goethes: Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.
Nebenbei bemerkt liebe ich es nicht, wenn man Goethe wie einen Wandschirm benützt, um sich dahinter zu verstecken; denn nicht alle Worte Goethes sind Worte Gottes und an sich beweiskräftig. Mit diesem Ausspruch indessen erkläre ich mich einverstanden; denn die Engel sagen es von Faust, der gläubig war. Erinnere dich, dass er Mephisto stets zur Seite hat, und wer an den Teufel glaubt, der glaubt auch an Gott. Die ganze Faustdichtung ist überhaupt auf Luthersche Lehre gegründet, wenn auch im zweiten Teile Absicht und Wollen zuweilen störend hervortritt. Gerade Faust sündigt ja gründlich; aber er könnte mit den Worten der Bibel sagen: Wenn wir auch sündigen, so sind wir doch die Deinen und wissen, dass du groß bist. Sein Streben nach dem Guten ist nicht moralisch, sondern aus dem Innern geboren und ihm notwendig, und es macht sein Gesicht schön, anstatt ihm mit einer Maske auszuhelfen. Faust musste zwar auch erst zum Sündigen aufgefordert werden; aber es glückte doch ziemlich rasch, ja die Aufforderung ging eigentlich von ihm selbst aus; unsere Zeit hingegen ist voll von Melanchthons, die erst nicht sündigen wollen und es schließlich nicht mehr können. Die meisten können es schon von Geburt an nicht mehr, sie liebäugeln nur mit der Sünde; denke aber nicht, dass ich dich zu diesen kalten Koketten zähle. Immerhin bist du des Sündigens wohl so entwöhnt, dass du es nicht ohne weiteres richtig anpacken würdest, und da du außerdem die Ordnung liebst und das letzte Warum von allen Dingen haben willst, so werde ich mit einer Untersuchung der Sünde anfangen.
Man sollte, um eine Idee recht zu verstehen, das Wort betrachten, in dem sie sich ausprägt. Res sociae verbis et verbis rebus: die Substanz ist dem Wort gesellt und das Wort der Substanz. Mir scheint es hier am besten, die Dinge mit Substanz zu übersetzen. Die Sprache, sagt Luther, ist die Scheide, darin das Messer des Geistes steckt. Nun kommt das Wort Sünde von Sondern, und im Begriff des Sonderns, der Absonderung, ist auch der Begriff der Sünde gegeben. Die erste Sünde des Menschen ist die Absonderung von Gott: anstatt im Gehorsam Gottes zu bleiben, sonderte er sich von Gott ab und wollte selbst Gott sein; es ist die Erbsünde, die jedem Menschen anhaftet und seinen Willen knechtet, so dass er nur sich selbst wollen kann. Der selbstische Mensch erkennt nicht, dass er Teil eines Ganzen ist, sondern er hält sich selbst für ein Ganzes und den Herrn oder Mittelpunkt seiner Umwelt, die er für sich ausnützt, anstatt dem All-Mittelpunkt, dem Ganzen zu dienen. Die Erbsünde ist also zugleich eine Sünde gegen Gott und gegen die Menschen, was sich von selbst versteht, da Gott in der Menschheit sich offenbart. Um die Erbsünde oder die Selbstsucht – nimm auch das Wort Sucht bitte in seiner eigentlichen Bedeutung, nämlich Seuche, Krankheit – zu bekämpfen, richtete Gott das Gesetz auf, und die Verfehlungen gegen das Gesetz nennen wir im engeren Sinn Sünde, sie sind gewissermaßen die angewandte Erbsünde.
Indessen habe ich mich unrichtig ausgedrückt, indem ich sagte, Gott habe durch das Gesetz die Sünde bekämpfen wollen; zunächst wenigstens gab er das Gesetz, um die Sünde zu mehren, „damit die Sünde überhandnehme“, wie Paulus sagt. Das Gesetz sollte den Menschen zeigen, was für Sünder sie sind, also handeln sie der Absicht Gottes entgegen, wenn sie nicht sündigen. Gott ruft uns im Gesetz zu: Zeige dich, wie du bist; aber der moralische und luziferische Mensch verbirgt sich hinter dem Feigenblatt der guten Werke, in der Meinung, Gott zu hintergehen. Wenn Luther jemand ermahnt zu sündigen, so will er, dass er sich so selbstsüchtig zeige, wie er ist; ordentliche, kräftige Sünden, auf die kommt es an, offene und offenbare, die der Welt und einem selbst unwiderleglich zeigen, dass man ein Sünder ist. Ich denke, hier spenden die modernen Psychiater Gott, Luther und mir Beifall und sagen: ja, die Sünde muss geäußert, nicht nach innen verdrängt, sie muss begangen und bekannt werden, sonst vergiftet und zerfrisst sie das Innere. Es geht sonst wie Luther sagt: „Auswendig hats eine gute Gestalt, inwendig wirds voll Gift“; und zuletzt hat es auch auswendig keine gute Gestalt mehr. Nur ist dabei zu bemerken, dass auch das Sündigen nicht hilft, wenn es gewollt wird; es muss, wie das Gute, gemusst werden, wenn es fruchten soll.
Neben jener ersten Absonderung von Gott gibt es auch eine im entgegengesetzten Sinne, also eine vom Selbst ab zu Gott zurück. Wie aber jene erste Absonderung zugleich eine Sünde gegen die Menschen war, so muss auch die Wiedervereinigung mit Gott zugleich eine Vereinigung mit den Menschen sein; wer sich mit Gott zu vereinigen glaubt, indem er sich von den Menschen absondert, befindet sich auf einem Irrweg und versinkt anstatt in Gott nur immer tiefer in sein Selbst. „So jemand spricht: Ich liebe Gott! und hasset seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis.“ Dies ist, was gerade dem hochstehenden Menschen am wenigsten eingeht, dass er Gott nicht nur, aber doch vorzüglich in den Menschen lieben muss; denn gerade Absonderung von den Menschen verlangt seine luziferische Vorzüglichkeit, weil es ihn vor ihrer Gemeinheit ekelte, veredelte er sich, von ihnen abgewendet. „Hüte dich, dass du nicht so rein seiest, dass du von nichts Unreinem berührt sein willst“, schrieb Luther einem seiner Freunde. Die schon erwähnten Psychiater können dir bestätigen, dass es eine bekannte Zwangsvorstellung Geisteskranker ist, überall Staub oder andere Unreinlichkeit zu wittern, die ihnen Angst und Abscheu einflößt. Dabei fällt mir ein, dass ich einen Menschen kenne, der am liebsten den ganzen Tag an sich herumwaschen würde, der einen sehr feinen Geruchssinn hat und unter schlechten Gerüchen und Schmutz besonders leidet; aber er würde jede menschliche Ekelhaftigkeit, Pest, Krebs, Seuche, Verbrechen anrühren, wenn er den damit Behafteten helfen könnte, und zwar ohne dass es ihn Überwindung kostete. Das ist aber auch ein Sünder und Liebling Gottes. Der natürliche, naiv egoistische Mensch sündigt gegen das Gesetz, und das ist leidlich; der Werkheilige, sei er Pharisäer oder Luzifer, sündigt gegen die Liebe; das ist die Sünde, die Gott verdammt.
Luther unterschied nach den Entwickelungsstufen des Menschen – denn ich sagte dir ja schon, dass er der Sache nach die Idee der Entwickelung schon hatte – drei Stufen der Sünde. Der Teufel, sagt er, versucht den Menschen dreifach, wie er auch Christus tat: durch das Fleisch, durch die Welt und durch den Geist. „Das Fleisch sucht Lust und Ruhe, die Welt sucht Gut, Gunst, Gewalt und Ehre, der böse Geist sucht Hoffart, Ruhm, eigenes Wohlgefallen und anderer Leute Verachtung.“ Die erste betrifft wesentlich die Jugend, die zweite, die mit Reichtum, Ehre, Geltung unter den Menschen lockt, das Mannesalter, die letzte erleiden die alternden, die reifen, die höchstentwickelten Menschen, es ist die Versuchung des Luzifer zur Selbstvergötterung. Wie die Entwickelung der einzelnen ist die der Familien, der Völker und der Menschheit: die Sünde des Luzifer tritt in Zeiten des Verfalls auf. Anfangs verleiht sie wohl eine Schönheit, deren Wirkung sich niemand entzieht; aber allmählich zeigen sich die Folgen des inneren Giftes. Dann kommen die gott- und glaubenslosen Zeiten, wo die Menschen das bisschen Kraft, das ihnen geblieben ist, in sich selbst zurückziehen, um mühsam eine edle Haltung und schöne Gebärden zu tragieren. Es ist eine Verengung, die auf eine starke Erweiterung folgt.
Es kommt dir vielleicht so vor, als zielte ich mit der Luzifer-Versuchung auf dich; vielleicht sagst du auch, du hättest sämtliche Stufen der Versuchung durchgemacht und machtest sie noch durch, und ich müsste das wissen; warum ich dir denn den Vorwurf machte, du sündigtest nicht? Weil ich, geliebter Luzifer, noch nie eine rechte, ordentliche, greifbare Sünde von dir gesehen habe und auch bestreite, dass du eine begangen hast. Natürlich bist du unendlich selbstsüchtig, unendlich ehrgeizig, unendlich stolz, unendlich begehrend. Du gehörst nicht zu den Guten, von denen die Bibel sagt, dass sie von sich selber gesättigt werden, sondern du zehrst dich von Begierde zu Begierde und wirst durch alle verschlungene Beute nur noch hungriger. Aber du verschlingst nur im Geiste, alle deine Sünden gehen nicht in Taten noch in Worten vor sich, du stehst still, um nicht irrezugehen.
Treibt dich nun dein Herz nicht zu guten Handlungen, so sollte es dich wenigstens zu bösen treiben, oder man müsste schließen, dass du überhaupt keins hast. Herrgott, eben überläuft es mich ordentlich. Wenn es nun so wäre, und du hättest kein Herz? Wenn du nicht, wie ich bisher angenommen habe, deinen Willen zu sündigen unterdrückt hättest, sondern wenn dieser Wille nur eine Wallung oder Willenszuckung wäre, weil dein Herz zu eng oder zu schwach ist, um einen richtigen, zwingenden Trieb aufzubringen? Nicht einmal zu Worten? Ich weiß, du wärest zu stolz, um etwas zu tun oder zu sprechen, was nicht aus dem Herzen kommt. Du machst nie Redensarten; aber du schweigst auch. Du bist kein Lügner; aber ehrlich bist du auch nicht: du schweigst. Es ist doch nicht möglich, dass du gar nichts zu sagen hättest! Bist du ein lauer Neutralist, der ebenso gut das eine wie das andere tun und sagen könnte? Ich gebe zu, bei vielen Dingen, namentlich weltlichen Dingen, ist das natürlich. Aber irgendetwas muss dir doch wichtig sein, wenn sonst nichts, doch du! Gut, wenn du dann nur von dir sprächest, die abscheulichsten, verdammenswertesten, von dir selbst verdammten Gedanken und Wünsche aussprächest, das wäre hunderttausendmal besser, als wenn gar kein Ich da wäre, oder nur so ein fades, schleichendes, tröpfelndes.
III
Der Kanzler hält heute seinen Vortrag mit dem frohen Bewusstsein, dass ihm ein gnädiger König zuhört. Du willst wissen, und darin sehe ich das Gnädige, was du eigentlich bei dem Sündigen gewinnst; denn nur um zu beweisen, dass du ein Herz habest, ließest du dich auf eine so heikle und dir ungewohnte Sache nicht ein. Du schreibst, ich müsse doch zugeben, dass Sünde an sich hässlich sei, beflecke, entstelle; wenn nun ein Mensch aus Stolz, um eines großen Namens willen, das Unreine von sich abwehre, warum das Gott nicht sollte leiden wollen? Ob du dir Gott so eifersüchtig vorstellen müsstest, dass er allen Ruhm für sich allein und den Menschen nicht gestatten wollte, aus eigener Kraft göttlich zu werden? und ob es, von Gott ganz abgesehen, nicht groß und schön sei, aus eigener Kraft etwas Vollendetes in sich darzustellen?
Ja, eifersüchtig ist Gott allerdings, wenn du zum Beispiel das eifersüchtig nennst, dass der Mensch den Anspruch erhebt, die Organe seines Körpers selbst zu regieren. Du musst doch immer daran denken, dass wir Teile Gottes oder in Gott sind. Sehen wir aber ganz von Gott ab, so dürftest du immerhin aus eigener Kraft göttlich oder vollendet werden, wenn du es könntest. Die Frage ist eben, ob du es kannst, und damit komme ich wieder auf deine erste Frage, was du gewinnst, wenn du sündigst, die zugleich einschließt, was du verlierst, wenn du nicht sündigst.
Durch Sündigen gewinnst du Kraft, und durch gewaltsames Nichtsündigen entkräftest du dich. Es ist eine Kraftfrage, wie überhaupt die Religion eine Kraft- und Lebensangelegenheit ist, da Gottes Wesen in Kraft besteht. Und Kraft zu gewinnen, das ist doch das erste Interesse der Menschen; denn wer Kraft hat, hat alles. Die Alten drückten die Wahrheit, dass man durch Sündigen Kraft gewinnt, in der Sage vom Riesen Antäus aus, der unbesiegbar war, solange er, besiegt, vom Sieger auf die Erde geworfen wurde, denn aus seiner Mutter Erde strömte stets neue Kraft in ihn ein; erst in die Luft gehalten konnte er erwürgt werden. So verendet der Mensch, wenn er in einem naturlos geistigen Klima existieren will, das ein Nichts ist. Nun sind wir zwar nicht mehr in der Lage der Griechen, die Sünde in unserem Sinn noch gar nicht kannten, für die Gott und Natur noch eins waren und die ihre Kraft unmittelbar aus der Natur beziehen konnten; wir können es im Allgemeinen nur mittelbar durch den Glauben. Bestimmen wir also zuerst den Begriff des Glaubens.
Schalte bitte aus deiner Vorstellung aus, was man gewöhnlich unter Glauben versteht, nämlich ein Fürwahrhalten. „Glauben ist nicht der menschliche Wahn und Traum, den etliche für Glauben halten … Das macht, wenn sie das Evangelium hören, so fallen sie daher und machen sich aus eigenen Kräften einen Gedanken im Herzen, der spricht: Ich glaube. Das halten sie dann für einen rechten Glauben. Aber wie es ein menschliches Gedicht und Gedanke ist, den des Herzens Grund nimmer erfährt: also tut er auch nichts und folgt keine Besserung hernach.“ Und an anderer Stelle sagt Luther: „Sie heißen das Glauben, das sie von Christo gehört haben, und halten, es sei dem wohl; wie denn die Teufel auch glauben und werden dennoch nicht fromm dadurch.“
Das Fürwahrhalten ist eine Tätigkeit des selbstbewussten Geistes, deren der Glaube nicht, die höchstens umgekehrt des Glaubens bedarf.
Man kann häufig Glauben und Wissen gegenübergestellt lesen, wie wenn das eine das andere ausschlösse, und oft auch wie wenn das Glauben die Sache der Kinder und Träumer, das Wissen die Sache vernünftiger Männer wäre. In Wirklichkeit ist Glauben die Bestätigung und Besiegelung des Wissens, nicht umgekehrt. Was wir wissen, wird uns vermittelst unserer Sinne gelehrt: wir wissen zum Beispiel, dass dort ein Stuhl steht. Was hilft dir das aber, wenn du es nicht glaubst? Deine Sinne können dich ja betrügen. Im Traume kommt es dir oft so vor, als stände da ein Stuhl, wo doch nichts ist. Bevor du nicht glaubst, was du weißt, bleibt dein Wissen unsicher. Gewiss, fest, unerschütterlich, ein Fels, der nicht wankt, ist nur was du glaubst. Mit anderen Worten: das Wissen bezieht sich auf die Erscheinung, der Glaube auf das Sein.
Luther pflegte den Begriff des Glaubens mit den Worten des Paulus aus dem 11. Kapitel des Briefes an die Ebräer zu erklären: Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hoffet, und nicht zweifelt an dem, das man nicht siehet. Sage mir nun bitte nicht, dass das Unsichtbare für dich nicht gelte, dass das Hirngespinste wären, dass du nur deinen Sinnen traust. Das ist ja, wie schon gesagt, Selbsttäuschung. Du traust deinen Sinnen, weil sie sich auf Übersinnliches beziehen. Was heißt es zum Beispiel, wenn du sagst, du glaubst an einen Menschen? Du deutest damit offenbar auf etwas, was deine Sinne, deine Erfahrung dir nicht von ihm mitteilen können, denn sonst würdest du es ja wissen. Du willst damit sagen, dass du im Wesen dieses Menschen eine Kraft voraussetzest, zu der du dich alles Guten und Großen versiehst. Da ja nun alle Kraft, alles Wesen und Sein, wie und wo es auch erscheint, Gott ist, so bezieht sich der Ausdruck Glauben immer auf Gott, wenn wir ihn auch auf Menschen anwenden.
Nun offenbart sich Gott niemals unmittelbar und kann also nur durch die Sinne wahrgenommen werden, von dem naiven Menschen namentlich durch den Gesichtssinn in der Schöpfung. Der Glaube aber, heißt es bei Paulus, kommt durch das Gehör, das heißt, das Gehör muss das Wort, das Gott von sich redet, aufnehmen. Um nun Schall hören, wie um Licht sehen zu können, muss etwas in uns sein, was der tönenden und leuchtenden Kraft entspricht, eine Hörkraft und Sehkraft. Wär nicht das Auge sonnenhaft, sagt Goethe, die Sonne könnt es nie erblicken. Du kannst, als moderner Mensch, statt Glauben auch Vernunft setzen, die geistige Kraft im Menschen, die, weil sie Geist, also Gott wesensgleich ist, Gott vernehmen kann.
Die Hörkraft und Sehkraft verhält sich zu Schall und Licht wie das Passive zum Aktiven, so dass wir zunächst nicht von einer Kraft, sondern von Schall- und Lichtempfänglichkeit reden sollten. Wie der Schoß der Frau den Samen des Mannes empfängt, so empfangen Auge und Ohr Licht und Schall und bringen durch sie Gesichts- und Gehörsbilder hervor. Die Empfänglichkeit beruht wieder auf der Empfindlichkeit für die betreffende Kraft, sei es Schall, Licht oder die göttliche Kraft selbst. Handelt es sich um diese, müssen wir sagen, dass wir gottempfindlich sein müssen, um Gottes Wort empfangen zu können, und in diesem Sinne lässt sich der Ausdruck Glauben mit Gottempfindlichkeit, Gottempfänglichkeit, Gottverwandtschaft übersetzen. „Gott und Glaube gehören zu Haufe“, sagt Luther. Sie gehören zusammen wie Mann und Weib, und es hat sich deshalb unwillkürlich, um das Verhältnis zwischen Gott und der gläubigen Seele zu bezeichnen, das Bild von Bräutigam und Braut eingestellt.
Befragen wir die Sprache, so finden wir, dass Glauben mit Geloben, Hören mit Gehören und Gehorchen zusammenhängt. Darin vollendet sich der Glaube, dass man Gott, der uns durch sein Wort ruft, hört und ihm gehorcht: Glaube ist Hingebung und Gehorsam. Der Gläubige hört Gottes Stimme, wie das Schaf die Stimme seines Hirten, wie der Liebende die Stimme der Geliebten hört. Alle Stellen in Luthers Werken, die vom Glauben handeln, sind Gedicht, ja Liebesgedicht, wie im Grunde jedes echte Gedicht Liebesgedicht ist, handle es sich nun um Liebe zu Gott oder zu den Menschen. Zwischen Glauben und Liebe ist der Unterschied, dass sich der Glaube auf das Unsichtbare, die Liebe auf das Erscheinende bezieht; aber es ist ja keins ohne das andere. An Gott glauben wir nicht nur, sondern wir lieben ihn in der Erscheinung, und an alle Menschen, die wir wahrhaft lieben, glauben wir auch, d. h. wir lieben ihre Idee oder Gott in ihnen.
Die meisten Menschen sind so geartet, dass sie Gott selbst, ohne Vermittlung, nicht gehorchen können, und Gott hat deshalb eine Vertretung in der Welt eingesetzt: im Staate die Obrigkeit, in der Familie Eltern und Ehemann. Wenn die Kinder ihren Eltern, die Frauen ihren Männern, die Männer ihren Vorgesetzten gehorchen, so gehorchen sie Gott, vorausgesetzt dass die Vorgesetzten Gott gehorchen. Der Gläubige, der Gottes Stimme hört und Gott selbst gehorcht, ist von jedem Gehorsam in der Welt frei, jenseits von Gut und Böse; aber er gehorcht auch den Menschen freiwillig, um sich nicht abzusondern. Eine glaubenslose Zeit ist eine Zeit ohne Gehorsam, richtiger gesagt eine Zeit, in der die Menschen nur sich selbst gehorchen wollen.
Während der Gehorsam der Welt erzwungen werden kann und muss, kann der Glaube, dessen Quelle das Herz ist, nur freiwillig sein. Dass Gott erzwungene Dienste nicht gefallen, wird in der Bibel oft wiederholt. Du kennst vielleicht die berühmte und wundervolle Stelle aus Luthers Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, wo er vom Glauben als vom Brautring der Liebenden spricht; ich führe sie deshalb hier nicht an. Im Sermon von den guten Werken heißt es so: „Wenn ein Mann oder Weib sich zum anderen Liebe und Wohlgefallen versieht und dasselbe fest glaubt, wer lehrt sie, wie sie sich stellen, was sie tun, lassen, sagen, schweigen, denken sollen? Allein die Zuversicht lehrt sie das alles und mehr denn not ist. Da ist ihnen kein Unterschied in Werken; sie tun das Große, Lange, Viele so gern als das Kleine, Kurze, Wenige, und dazu mit fröhlichem, friedlichem Herzen und sind ganz freie Gesellen. Wo aber ein Zweifel da ist, da sucht jedes, welches am besten sei. Da beginnt es sich einen Unterschied der Werke auszumalen, womit es Huld erwerben möge, und geht dennoch mit schwerem Herzen und großer Unlust hinzu, ist gleich befangen, mehr denn halb verzweifelt, und wird oft zum Narren darüber.“ Dann geht es nach dem Spruche Salomonis: „Wir sind müde geworden in dem unrechten Wege und sind schwere, saure Wege gewandelt, aber Gottes Weg haben wir nicht erkannt, und die Sonne der Gerechtigkeit ist uns nicht aufgegangen.“ Im Gegensatz zu den schweren, sauren Wegen der Werke spricht Luther von dem königlichen Weg des Glaubens.
Sobald der Glaube schwer und sauer fällt, ist es gar kein Glaube; Glaube ist nur, was frei aus dem Herzen kommt. Etwas im Glauben tun heißt etwas tun, weil man nicht anders kann, und du begreifst nun, welchen lieblichen Sinn die Worte des Paulus haben, dass, was nicht im Glauben geschieht, Sünde ist. Allerdings der, dem nichts von Herzen kommt, der Ungläubige, der kein Herz hat, dem ist es leichter, Brandopfer als sein Herz darzubringen.
Um dem Begriff des Glaubens noch näher zu kommen, lass uns auch seinen Gegensatz, den Unglauben, ins Auge fassen. Luther sagt gelegentlich: der Ungläubige, der nur sich selbst anbetet; und das scheint mir das deutlichste Licht auf das Wesen des Unglaubens zu werfen. Ferner: „Gott ist den Sündern nicht feind, nur den Ungläubigen, das sind solche, die ihre Sünde nicht erkennen, klagen, noch Hilfe dafür bei Gott suchen, sondern durch ihre eigene Vermessenheit sich selbst reinigen wollen.“ Und: „Das muss wohl folgen aus dem Unglauben, der da keinen Gott hat und will sich selbst versorgen.“
Der Ungläubige ist also mein Freund Luzifer, der, weil er sich an Gottes Stelle setzt, sich selbst lenkt, für sich selbst sorgt, selbst Gesetze gibt, denen seine passive, sinnliche Hälfte gehorchen soll. Natürlich muss diese auch alle Kraft aus seinem Ich, seiner aktiven Hälfte, beziehen, die aber beschränkt, endlich ist, und wenn sie sich nicht aus Gott ersetzt, sich bald erschöpft. Beständiges Selbstwollen muss zu vollständiger Entkräftung führen, wenn es sich nicht im Zustande des Nichtwollens erholen kann. Glauben ist Nichtselbstwollen, stattdessen Gott in sich wollen lassen. Die Überspannung der eigenen Kraft zeigt sich in unserer Zeit in der großen Anzahl von Menschen mit überspanntem Nervensystem; sie gehen an ihrer Eigenwilligkeit, an ihrer Unfähigkeit, durch vorübergehende Selbstaufgabe Kraft zu schöpfen, zugrunde. Es wäre ja gegen den schönen Luzifer nichts einzuwenden, wenn er glücklich wäre; aber sein Selbst ist ihm keine Freuden- und Kraftquelle, kein Herrscherthron, sondern ein Marterpfahl, an den er gebunden ist. Die Frucht des Glaubens ist der Friede, heißt es im Evangelium des Johannes; daraus folgt, dass die Frucht des Unglaubens Unfriede ist, innere Zerrissenheit, Kraftlosigkeit. Die Frage: Wie werde ich selig? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? lässt sich auch so fassen: Was verschafft mir inneren Frieden und damit Kraft? Die Antwort lautet: Aufgabe deines Selbst und Hingabe an Gott. Nicht nur selbstbewusst, sondern zugleich gottbewusst oder unbewusst leben.
Was der Mensch durch vollständige Aufgabe des Selbstbewusstseins vermag, das hat die Hypnose gezeigt. In dem seines Selbstwollens beraubten Menschen wirkt der Hypnotiseur Wunder: er verfügt über seinen Körper nach Belieben, über das Vermögen des Selbstwollenden hinaus. Fast erschrak man über diese Entdeckung, weil man meinte, sie könne von bösen Menschen zu grässlichen Verbrechen benutzt werden. Aber erstens gibt es in unserer Zeit sehr viel Nervöse, und die Nervösen können ihr Selbst nicht hingeben und darum auch nicht hypnotisiert werden; und dann gibt es ebenso wenig Teufelsgläubige, also im Bösen kraftvolle Menschen, wie Gottgläubige. In früheren Zeiten wurde die Hypnose von Bösen und Guten als schwarze und weiße Magie ausgeübt.
Im Hinblick auf die ihm durch den Glauben zu Gebote stehende Kraft war der Christ für Luther wesentlich der starke, freudige, trotzige Held. „Ein solcher Mann muss der Christ sein, der da könne verachten alles, was die Welt beides, Gutes und Böses, hat, und alles, damit der Teufel reizen und locken oder schrecken und drohen kann, und sich allein setzen gegen alle ihre Gewalt, und ein solcher Ritter und Held werden, der da wider alles siege und überwinde.“ Es ist der Ritter, den Dürer gemalt hat, der gelassen, des Sieges gewiss, an Tod und Teufel vorüberreitet. Luther übersetzte das Wort „Israel“ mit Herr Gottes: „Das ist gar ein hoher, heiliger Name und begreift in sich das große Wunder, dass ein Mensch durch die göttliche Gnade gleich Gottes mächtig wurde, also dass Gott tut, was der Mensch will … Da tut der Mensch, was Gott will, und wiederum Gott, was der Mensch will; also dass Israel ein gottförmiger und gottmächtiger Mensch ist, der in Gott, mit Gott und durch Gott ein Herr ist, alle Dinge zu tun und vermögen.“
Es war Luthers feste Überzeugung, dass der Mensch Berge würde versetzen können, dass ihm nichts unmöglich wäre, wenn er nicht zu schwach im Glauben wäre. Über Schwäche des Glaubens klagt er oft schmerzlich; er hatte Zeiten, wo sein Selbst sich dafür rächte, dass er meistens so gar nicht zu sich selbst kam, wie man sehr richtig zu sagen pflegt. Wie er aber zuweilen Gottes mächtig war, konnte er zeigen, als er den sterbenden Melanchthon ins Leben zurückrief. Der ungläubige, durch seine Zwitterstellung zwischen Gott und Welt stets in Zwiespalt und Unwahrhaftigkeit verstrickte Melanchthon starb, wie ein beleidigtes Kind sich vom Spiel in einen Winkel zurückzieht; wie er dann das Wort des mächtigen Freundes zuerst widerwillig vernimmt, dann doch sich beugt und im alten Gehorsam seine Kraft in sich überströmen lässt, das stellt sich wie ein Abbild des Verkehrs der menschlichen Seele mit Gott dar. Nicht Abbild, sondern die Sache selbst: denn Luther hatte zuvor durch sein Gebet Kraft in sich gezogen, und diese Gotteskraft, nicht Luthers bewusstes Selbst war es, die den Sterbenden weckte.
Ich weiß, du sagst jetzt, du habest keinen Glauben, aber Übermaß von Selbstwollen und Selbstvertrauen könne nicht daran schuld sein, denn das habest du erst recht nicht. Dann hatten es deine Vorfahren; dass es auf die Dauer ohne Glauben schwinden müsse, sagte ich ja. Es fällt mir aber ein, dass Luther überzeugt war, man könne mit seinem Glauben für den fehlenden oder schwachen Glauben anderer eintreten, und so werde ich einstweilen für dich glauben, an dich und für dich.
IV
Du willst mir augenscheinlich dartun, dass du wirklich kein Herz habest, indem du mit vernichtender Übergehung meines gefühlsbetonten Briefschlusses tadelst, ich schriebe chaotisch, was du am allerwenigsten vertragen könnest. Vollständige Dunkelheit sei weniger schädlich als Zwielicht voll undeutlich auftauchender Gestalten. Ich behandle, sagst du, Gott, Teufel und ähnliche Phänomene als selbstverständliche Voraussetzung; das sei wohl in religiösen Zeiten unter religiösen Menschen erlaubt, welchen diese Namen etwas Bekanntes bezeichneten, jetzt seien sie aber leer und ich hantierte damit herum wie jene listigen Betrüger mit des Kaisers neuen Kleidern. Ich sollte dir einmal schreiben, wie wenn du ein in der Wildnis aufgelesenes, zwar sehr gescheites, aber ganz unwissendes Botokudenkind wärest. Du wissest, dass Gott sich nicht vorrechnen lasse wie ein Exempel, ich solle auch nicht von ihm sprechen, wie einer von seinem Freund, dem Geheimen Kommerzienrat Soundso, spreche; aber auf einen klaren, verständlichen Ausdruck müsse etwas Seiendes sich bringen lassen, wenn auch nicht auf einen erschöpfenden.
Ich werde gehorsam versuchen, den König mit dem gescheiten Botokudenkinde zu verschmelzen und meinen Vortrag danach einzurichten. Die Verbindung ist auch gar nicht so paradox, wie es zuerst scheint. Das Kind sagt zu seiner Mutter: Gib mir die Sterne! Philipp III. befahl Spinola: Nimm Breda! Ich, der König. Du schreibst: Erkläre mir Gott! Es soll mich nicht abschrecken, dass Spinola, wenn eine dunkle historische Erinnerung mich nicht trügt, am Gram über die Ungnade seines Königs gestorben ist.