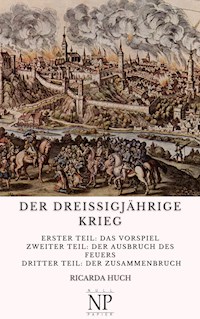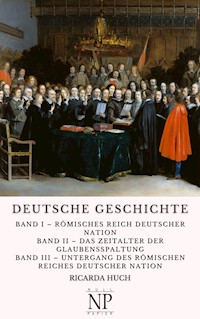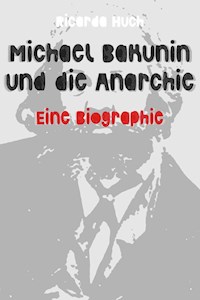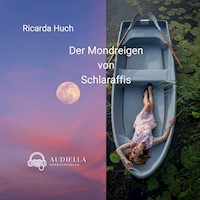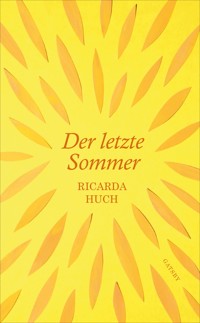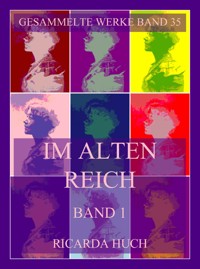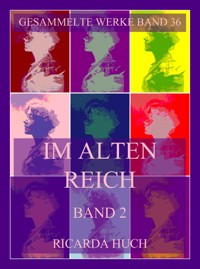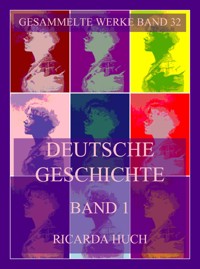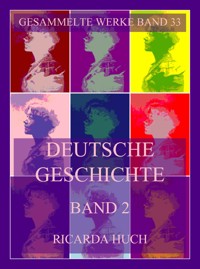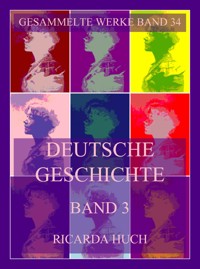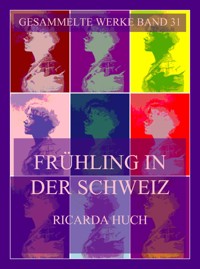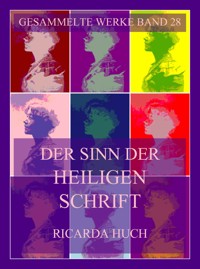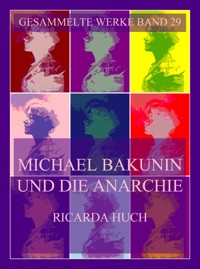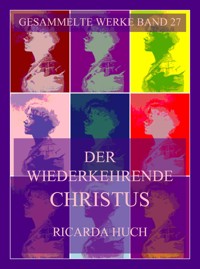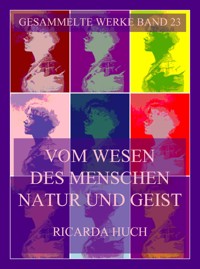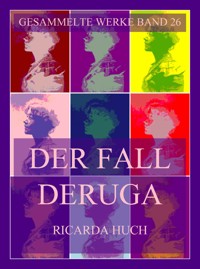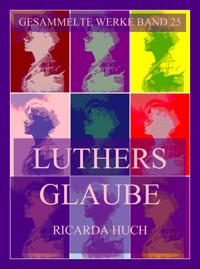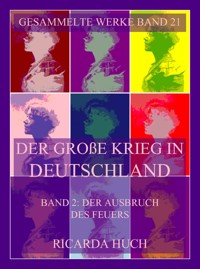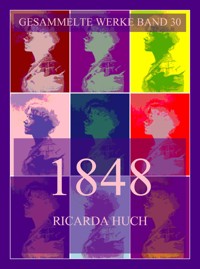
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Absicht der Autorin ist es nicht, die Geschichte der revolutionären Bewegungen zu schreiben, die in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts stattfanden und mit den Ausbrüchen des Jahres 1848 endeten, sondern deren Zusammenhang mit der umfassenderen allmählichen Umwälzung zu beleuchten, die das wesentlich agrarische Deutschland in ein wesentlich industrielles verwandelte, was zugleich eine Verwandlung der Weltanschauung bedeutete. Ricarda Huch beschränkt sich dabei nicht nur, insofern sie die Geschichte der übrigen europäischen Staaten so viel wie möglich außer Betracht lässt, sondern auch dadurch, dass sie hauptsächlich die Menschen zu begreifen und darzustellen versucht, die diese Umwälzung teils herbeiführten, teils ihr widerstrebten oder von ihr mitgerissen wurden. In der Geschichte, dem Werk der handelnden Menschen und göttlich-natürlicher Kräfte, die durch Menschen wirken, ist der Mensch in seinem persönlichen Denken und Verhalten meist das Wichtigste und Interessanteste, das, was unvergänglich lebendig und Leben erzeugend bleibt, wenn die Verhältnisse, in denen er sich bewegt, gleichgültig oder unverständlich geworden sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 726
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
1848
Die Revolution des 19. Jahrhunderts in Deutschland
RICARDA HUCH
1848, R. Huch
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988682260
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
VORWORT.. 1
STEIN... 2
UNLÖSBARE PROBLEME.. 12
ARNDT UND JAHN... 15
LUDEN... 22
REVOLUTIONÄRE FAMILIEN... 24
REVOLUTIONÄRE ANDERER DEUTSCHER LÄNDER.. 31
FRANKFURT.. 37
HALLGARTEN... 45
DIE FAMILIE GAGERN... 48
STÜVE.. 54
DAHLMANN... 60
FRIEDRICH HARKORT.. 62
FRIEDRICH LIST.. 67
RHEINLÄNDISCHE MAGNATEN.. 73
TOD UND PERSÖNLICHKEIT FRIEDRICH WILHELM III.84
DIE BÜROKRATIE UND DIE GEGNER IN ÖSTERREICH.. 90
FRIEDRICH WILHELM IV.94
BUNSEN... 101
RADOWITZ.. 109
DER REGIERUNGSANTRITT FRIEDRICH WILHELMS. 115
DER ERSTE ANGRIFF. 120
WIEDERAUFLEBEN DER TENDENZEN DES SECHZEHNTEN JAHRHUNDERTS124
AM RHEIN... 129
FEUERBACH.. 140
SAINT-SIMON UND WEITLING... 146
STIRNER.. 153
BURCKHARDT UND DEUTSCHLAND... 156
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN... 162
HERWEGH UND FREILIGRATH.. 166
DIE UNTERIRDISCHEN... 171
DIE LAGE DER ARBEITENDEN KLASSEN IN ENGLAND... 175
RADOWITZ.. 182
INDUSTRIALISMUS UND ARMUT.. 188
DAS BANK-GESPENST.. 191
VICTOR AIMÉ HUBER.. 193
EMIGRANTEN... 196
RELIGIÖSE OPPOSITION... 201
BADISCHE POLITIKER.. 207
SCHWABEN UND UHLAND.. 213
DER VEREINIGTE LANDTAG... 219
DAS KOMMUNISTISCHE MANIFEST.. 228
MONARCHIE ODER REPUBLIK.. 236
ÖSTERREICH.. 243
DIE REVOLUTION IN BERLIN.. 250
DIE NATIONALVERSAMMLUNG IN FRANKFURT.. 257
DIE HILFSKRÄFTE DER DEMOKRATIE.. 268
DAS HANDWERK.. 272
ARBEITERORGANISATION... 279
WINKELBLECH UND DER FÖDERALISMUS. 284
SACHSEN... 292
DIE FREMDEN NATIONEN.. 301
DIE BERLINER NATIONALVERSAMMLUNG.. 307
DIE WENDUNG.. 316
KRISIS IN BERLIN... 320
UHLAND UND DER KAISERGEDANKE.. 325
GROSSDEUTSCH UND KLEINDEUTSCH.. 330
MACHT UND RECHT.. 340
STÜVE.. 343
RADOWITZ UND DER KÖNIG.. 347
DIE NATIONALVERSAMMLUNG NACH DER ABLEHNUNG.. 355
ENGELS. 362
STÜVE.. 367
RADOWITZ' ENDE.. 370
VICTOR AIMÉ HUBER.. 377
VAE VICTIS. 380
WALDHEIM... 389
DIE SIEGER.. 393
ENDE.. 402
VORWORT
Es war nicht meine Absicht, die Geschichte der revolutionären Bewegungen zu schreiben, die in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts stattfanden und mit den Ausbrüchen des Jahres 1848 endeten, sondern ich wollte ihren Zusammenhang mit der umfassenderen allmählichen Umwälzung beleuchten, die das wesentlich agrarische Deutschland in ein wesentlich industrielles verwandelte, was zugleich eine Verwandlung der Weltanschauung bedeutet. Ich beschränkte mich dabei nicht nur, insofern ich die Geschichte der übrigen europäischen Staaten so viel wie möglich außer Betracht ließ, sondern auch dadurch, dass ich hauptsächlich die Menschen zu begreifen und darzustellen suchte, die diese Umwälzung teils herbeiführten, teils ihr widerstrebten oder von ihr mitgerissen wurden. In der Geschichte, dem Werk der handelnden Menschen und göttlich-natürlicher Kräfte, die durch Menschen wirken, scheint mir der Mensch in seinem persönlichen Denken und Verhalten das Wichtigste und Interessanteste zu sein, das, was unvergänglich lebendig und Leben erzeugend bleibt, wenn die Verhältnisse, in denen er sich bewegte, gleichgültig oder unverständlich geworden sind.
Es ist natürlich, dass der Erzähler hauptsächlich auf die Menschen angewiesen ist, die im Vordergrund der Geschichte standen, von denen eine unmittelbare, vernehmliche Wirkung ausging: Staatsmänner, Fürsten, Schriftsteller, revolutionäre Führer, solche, die Zeugnisse ihrer Wirksamkeit hinterlassen haben. Gerade an der Revolution des vorigen Jahrhunderts indessen haben sich auch eine große Anzahl von Privatpersonen beteiligt, die kennenzulernen uns leider dadurch erschwert ist, dass infolge der politischen Entwicklung die Angehörigen, Freunde und Nachkommen derselben ihren Anteil an der nunmehr verfemten Bewegung eher zu verbergen als zu erhellen suchten, damit ihnen kein Schaden erwüchse oder ihr Andenken geschändet würde. Es ist zu wünschen, dass die Dokumente und persönlichen Erinnerungen, welche Bezug auf die Revolution haben, gesammelt werden, bevor sie in Verlust und Vergessenheit geraten. In manchen Familien namentlich Süddeutschlands mögen noch Briefe und andere Aufzeichnungen, mögen auch mündliche Überlieferungen bewahrt werden, die unsere Kenntnis von der Verbreitung der revolutionären Ideen in jener Zeit erweitern und uns um das Bildnis denkwürdiger Menschen bereichern könnten. Die Einschätzung der Persönlichkeiten, die im öffentlichen Leben hervorgetreten sind, wechselt wohl nach der jeweils herrschenden politisch-sozialen Richtung; schließlich aber gilt als rühmlich, was als echt und seiner inneren Berufung treu sich erwiesen hat.
STEIN
Der erste große deutsche Revolutionär des neunzehnten Jahrhunderts, der Freiherr vom Stein, war zugleich ein Wiederhersteller. Es ist sinnvoll, dass, nachdem Sickingens gegen das anschwellende Fürstentum geplante Revolution gescheitert war und drei Jahrhunderte lang die Sieger Deutschland geteilt, entnervt, geknechtet und endlich selbst den Namen Deutschland vertilgt hatten, ein Ritter es war, der über sie Gericht hielt. Als Napoleon Frankreich gegen das Reich führte, erwies es sich trotz der Heimatliebe und Tapferkeit vieler seiner Bewohner als faul und morsch und brach zusammen; die Fürsten benützten die Fremdherrschaft gern, um das letzte bisschen Unabhängigkeit zu erlangen, das ihnen zur vollen Souveränität noch fehlte, der Kaiser legte willig die Krone Karls des Großen nieder, nach der es den Fremdling verlangte, alle suchten durch Vermittlung des korsischen Emporkömmlings Stücke von Deutschland an sich zu bringen. Hätte jemand daran gezweifelt, so wäre ihm jetzt bewiesen, dass Ehre, Pflicht, Vaterlandsliebe dieser Menschenklasse nichts bedeutete gegenüber der Sorge für ihr persönliches Wohlergehen und der Erhaltung oder Verbesserung ihrer Stellung, nicht einmal Stolz besaßen sie, der sie verhindert hätte, vor dem Eroberer zu kriechen, der sie verachtete. Der fürstliche Absolutismus hatte damit abgewirtschaftet, er hatte, wennschon es unter seinen Vertretern, wie sich von selbst versteht, auch wohlmeinende Personen gab, Deutschland aufgelöst und das einst wegen seiner kriegerischen Kraft gefürchtete Volk zu einer ohnmächtigen Masse herabgewürdigt.
Indem der Freiherr vom Stein die Aufgabe ergriff, das gedemütigte Preußen wieder aufzurichten, schwebte ihm das Reich vor, das soeben zu existieren aufgehört hatte, mit dem sein eigenes eigentümliches Dasein zusammenhing. In den Reichsstädten und Reichsrittern lebte die Erinnerung an jene Zeit fort, wo es einen mächtigen deutschen Körper gegeben hatte, dessen wehrhafte Glieder die Grenzen schützten und über sie hinaus wirkten und herrschten. Die Fürsten hatten dem Volk die Wehr aus der Hand genommen und sie stehenden Heeren gegeben, die das entwaffnete im Zaume hielten; ein anderes Heer, die Beamten, führte des Volkes Geschäfte, die es früher selbst besorgt hatte. Die alte Volksfreiheit wiederherzustellen vermochte kein Gesetz, aber die Hindernisse wegzuräumen und den Boden zu bereiten, damit eine neue keime, das unternahm der neue Minister. Gegen das stehende Heer richtete sich die Reformation, die Scharnhorst durchführte, gegen die Beamten das berühmte Edikt vom Jahre 1807, welches die Erbuntertänigkeit der Bauern aufhob und sie zu freien Eigentümern des von ihnen bebauten Bodens machte, und das andere, welches die Selbstverwaltung der Städte einführte. Den Mittelpunkt des Staates griff er dadurch an, dass er die leitenden Entschlüsse, die bis dahin im Kabinett des Königs abgefasst wurden, von einem dem König zugeordneten Ministerrat ausgehen ließ. Damit war die oberste Leitung aus dem Dunkel ans Licht gezogen und die Selbstherrschaft und Unverantwortlichkeit der Regierung erschüttert. So einschneidend waren diese Eingriffe, so tödlich das Wesen des Absolutismus treffend, dass seine Vertreter, König, Aristokratie, Offiziere und Beamte, sie so, in diesem Zusammenhang, freiwillig nicht geduldet hätten. Stein tat dem König Gewalt an, was der König verbissen ertrug, weil er, den Untergang des Staates vor Augen, keine andere Hilfe sah und weil Stein ihn beherrschte. Zu beeinflussen war der beschränkte und engherzige Autokrat nicht, was um ihn her vorging, bewirkte nicht, dass er die Dinge in reinerem Lichte sah; aber er fürchtete seinen Minister. Die Art, wie große Menschen auf die Taten, die sie tun wollen, vorbereitet werden, um im rechten Augenblick zur Stelle zu sein, hat etwas Schicksalhaftes. Als im Jahre 1806 der Rheinbund gegründet und Preußen vernichtet wurde, das Reich zerfiel, der Eroberer seine Unterjochung zu vollenden im Begriff stand, trat Stein aus der Burg seiner Väter hervor, wie ein Barbarossa aus unterirdischen Höhlen, um die Schuldigen zu strafen und sein Volk zu sammeln. Der Kaiser konnte nach seiner Meinung wohl die Krone niederlegen, aber nicht das Reich auflösen, nicht einmal sein Land vom Reiche trennen; denn das Volk habe ein unveräußerliches Recht auf sein Dasein als eine Gesamtheit; das Reich blieb für ihn als Idee bestehen, und wenn es hundertmal vernichtet war. Von großen Erinnerungen beseelt, verzehrt von unerklärlicher Ungeduld, war er den höfischen Menschen seiner Zeit unverständlich und schreckhaft durch seine Leidenschaftlichkeit und seinen schneidenden Befehl. Seine Äußerungen trugen oft das Gepräge des Hasses und Zornes, wenn sie gegen die Fürsten und ihren Anhang gerichtet waren, das Gepräge erbarmender und bewundernder Liebe, wenn er vom deutschen Volke sprach. Es ist ihm das Volk über alle Völker, das treue, geduldige, arbeitsame, opferwillige, besonnene; die Fürsten sind ihm das Lumpengesindel. Er trennte nicht, wie andere Staatsmänner, die innere und äußere Politik nach entgegengesetzten Grundsätzen; das Volk, Träger und Zweck des Staates, sollte frei sein innen und außen. Während er den Sturz Napoleons herbeizuführen sich bemühte, arbeitete er zugleich am Freiwerden des Volkes im Innern. Er und sein Volk sollten nicht die Fürsten retten, sondern das Reich, das alte Reich, das selbständig, blühend, fruchtbar gewesen war. Diese für einen einzelnen, einen Privatmann, der er wieder war, seit Napoleon ihn geächtet hatte, übermäßige Aufgabe konnte er nur lösen, indem er die Mächtigen durch die Macht seines Geistes und Charakters beherrschte. Er richtete Denkschriften an die von Napoleon bedrohten Monarchen, in denen er sie zu einem großen Verzweiflungskampf, zu heroischem Untergang, wenn es nicht anders sein könne, anfeuerte, wobei sie sich nicht allein auf ihr Heer, sondern vor allen Dingen auf das Volk verlassen sollten. Der Gedanke einer Insurrektion war dem König von Preußen unerträglich; ihm schien es annehmbarer, Vasall Napoleons zu sein, als Waffen in die Hände des Volkes, der Untertanen, zu geben. Waffen in der Hand des Volkes, das war seit Jahrhunderten in den Augen der Fürsten etwas Verbrecherisches; Stein, der geradezu die Mittel lehrte, um eine Insurrektion herbeizuführen und zu leiten, erschien dem König als Rebell. Diese Gesinnung, die von den Höfen in alle Kreise gedrungen war, stand dem Plane Steins im Wege; er scheiterte, wie er selbst sagt, an dem Phlegma, der Weichlichkeit und Genusssucht der oberen Stände, an dem Mietlingsgeist der Beamten, an der allgemeinen Niedertracht, von der auch die unteren Schichten angesteckt waren. Es glückte ihm jedoch, Einfluss auf den nächst Napoleon mächtigsten Monarchen zu gewinnen, auf den Zaren Alexander von Russland; er wurde das Mittel, durch das er Deutschland von der napoleonischen Herrschaft befreite und durch das er es auch im Innern frei und groß zu machen hoffte.
Während seiner Verbannung hatte Stein Musse, die Linien des neuen Reiches zu ziehen, das er schaffen wollte; sie haben sich niemals wesentlich verändert, da ihm von Anfang an ein Bild vor Augen stand, dem er nach Möglichkeit nahe zu kommen suchte. "Könnte ich einen Zustand wieder herzaubern ", schrieb er im Jahre 1811 dem Grafen Münster, "unter dem Deutschland in großer Kraft blühte, so wäre es der unter unseren großen Kaisern des zehnten bis dreizehnten Jahrhunderts, welche die deutsche Verfassung durch ihren Wink zusammenhielten und vielen fremden Völkern Schutz und Gesetze gaben." Oft hat er es wiederholt: Ein mächtiger Kaiser, von ihm abhängige Fürsten, ein freies, in Stände geteiltes Volk, von denen jeder seine eigene Ehre hätte und die der anderen anerkennte; Besseres ließe sich nicht ersinnen. Wie wäre es aber möglich gewesen, einen Zustand wiederzubringen in einem Lande, das durch zerstörende Kräfte so verwandelt war, dass das Volk in allen seinen Teilen ihn kaum noch als die eigene Wurzel kannte? Zwischen den Kaiser und die reichsunmittelbaren Freien hatten sich die Fürsten geschoben, Stein pflegte sie Mittelmächte zu nennen, die von Anfang an die lästige Oberaufsicht des Kaisers abzuwerfen trachteten, um ungehindert ihrer Herrschsucht zu frönen, und die nicht geruht hatten, bis sie die Einheit des Reiches durchbrochen und das Volk als eine Herde unschädlicher Schafe in ihre Ställe verteilt hatten. In drei Hauptteile war das Reich zerfallen: die alten Marken, die Nordmark Preußen und die Ostmark Österreich und das eigentliche Reich, das sich vom Rhein bis an die Elbe erstreckte. Gemäß ihrer Bestimmung hatten sich die Marken zu Militärstaaten entwickelt, während der unkriegerische Westen dem Einfluss Frankreichs widerstandslos geöffnet war. Diese drei Einzelteile galt es zu einer Einheit zu verschmelzen.
Stein wollte das Problem so lösen, dass ein Teil des Reiches Preußen, ein anderer Teil Österreich angegliedert würde und dass der daraus entstehende Staatenbund als Ganzes durch Kaiser, Bundestag und Reichsstände vertreten wäre. Die Rheinbundfürsten sollten ihr Dasein verwirkt haben, dagegen wünschte Stein die Wiederherstellung der Mediatisierten, weil er glaubte, dass für die Ruhe und den Frieden kleine Herrschaften vorteilhafter wäre als mittelgroße, wie etwa Sachsen, Bayern, Hessen, die durch ihre Eifersucht und ihren Wunsch, sich zu vergrößern, beständig Verwickelungen herbeiführten. Das Kaisertum sollte bei Österreich bleiben, weil die Überlieferung dafürspreche.
Wenn Stein von den Rheinbundfürsten mit unnachsichtigem Hohne sprach und sie wie Schuldige behandelt wissen wollte, die alle Rechte eingebüßt hätten, Preußen und Österreich dagegen die Hauptrolle im künftigen Reiche zudachte, so scheint darin eine Ungerechtigkeit zu liegen, da ja besonders der König von Preußen nicht viel mehr Ehrgefühl und Vaterlandsliebe gezeigt hatte als jene; dies erklären die Umstände und Steins Art, die Dinge aufzufassen. Er konnte, das betonte er immer wieder, das mittelalterliche Reich der Ottonen oder der Hohenstaufen nicht wiederbringen, er musste aus dem, was sich inzwischen herausgebildet hatte, in Eile einen Notbau zimmern. Ohne eine Macht als Grundlage, eine kriegstüchtige Macht, konnte Deutschland zwischen Frankreich und Russland nicht bestehen; Deutschland bedurfte der Macht, es kam nur darauf an, sie zum Heil für das Ganze tätig zu machen. Das Mächtige, Kraftvolle war Stein sympathisch, weil nur das Kraftvolle großartig handeln und wirken kann; er hatte nie das Bestreben, das Mächtige ohnmächtig zu machen, nur ihm große Ziele anzuweisen. Damit ist nicht gesagt, dass er voreilige Eroberungssucht gebilligt hätte, die er vielmehr Frankreich zum Vorwurf machte. Mit Bedacht wünschte er für das neue Reich die Form des Staatenbundes, dessen lockeres, gesättigtes Wesen ihm besser geeignet schien, die Mitte, den Ruhepunkt Europas zu bilden, als ein angespannter Großstaat. Er hoffte, dass einem so gestalteten Reich die stammesverwandten Grenzländer, Schweiz, Holland, Elsass, sich freiwillig angliedern würden.
Um überhaupt zu bestehen neben Frankreich, dem ewigen, unermüdlichen, zerstörenden Feinde" Deutschlands, hielt es Stein für nötig, zuerst eine widerstandsfähige Macht zu konstituieren; dann aber sollte dem Volke ein ihm gemäßes Dasein, eine Möglichkeit zur Entfaltung seiner Kräfte gewährleistet werden. Das Volk zu bilden, zu veredeln, hielt er für die wichtigste Aufgabe des Staates. Feierlich wurde sein Wort, wenn er, nachdem Napoleon gestürzt war, die Ansprüche für sein Volk zusammenfasste. "Es ist von der größten irdischen Angelegenheit die Rede", sagte er in einer Denkschrift des Jahres 1813. "Fünfzehn Millionen gebildeter, sittlicher, durch ihre Anlagen und den Grad ihrer Entwicklung achtbarer Menschen, die durch Grenzen, Sprache, Sitten und einen inneren, unzerstörbaren Charakter der Nationalität mit zwei anderen großen Staaten verschwistert sind. Der Gegenstand der Erwägung ist also wichtig, der Moment verhängnisvoll, Zeitgenossen und Nachwelt werden strenge diejenigen beurteilen, die, zu der Lösung der Aufgabe berufen durch ihre Stellung im Leben, ihr nicht alle Kraft und allen Ernst widmen!" Mit ganzer Seele war er bemüht, den oberflächlichen, gleichgültigen, zum Teil frivolen Staatsmännern und Diplomaten, von denen das Geschick des Volkes abhing, etwas von seinem sittlichen Ernst, seinem Verantwortungsgefühl, seiner Liebe einzuhauchen. Er malt den Zustand von Freiheit und Ehre der Deutschen im Mittelalter und vergleicht damit ihre Lage in der Gegenwart: "Fünfzehn Millionen Deutsche sind der Willkür von 36 kleinen Despoten preisgegeben, und man verfolge die Geschichte der Staatsverwaltung in Bayern, Württemberg und Westfalen, um sich zu überzeugen, wie es einer Neuerungssucht, einer tollen Aufgeblasenheit und einer grenzenlosen Verschwendung und tierischen Wollust gelungen ist, jede Art des Glücks der beklagenswerten Bewohner dieser einst so blühenden Länder zu zerstören!" Als das mindeste für die Untertanen fordert er eine Habeaskorpusakte zur Sicherung von Freiheit und Eigentum; keine Abgaben als solche, die für die Länder auf den Landtagen, für das Reich auf den Reichstagen verwilligt worden wäre; keine willkürlichen Eingriffe in das Eigentum der einzelnen und der Korporationen, Sicherheit der Ehre und des Lebens; über das Leben dürfe nur durch die ordentlichen Richter erkannt werden. Das Oberhaupt des Bundes, möge man es Kaiser oder wie sonst immer nennen, hat die Unterdrückten zu schützen.
Die Volksvertretung dachte Stein sich ständisch, so aber, dass der seit dem Mittelalter veränderten Schichtung der Bevölkerung Rechnung getragen würde. Dass namentlich der Bildung und Intelligenz eine angemessene Vertretung eingeräumt werden müsse, sah er ein und lobte die Einrichtung der Notabeln in den alten französischen Generalständen. Wie er immer, schon vor der Revolution, für die Stände als für eine den Despotismus beschränkende und die Menschen zu Selbsttätigkeit erziehende Einrichtung Partei genommen hatte, so wollte er auch, dass sie nicht zu kärglich mit Rechten ausgestattet würden. Nur beratende Stände, wie Humboldt und Hardenberg sie wollten, fand er lächerlich. Nach seiner Meinung müssten ihnen die drei altbewährten Rechte zustehen: Steuerbewilligung, Teilnahme an der Gesetzgebung und periodische Einberufung. Das Gerichtsverfahren sollte öffentlich sein, das Institut der Geschworenen sollte Ehre und Freiheit der Bürger gegen Willkür sicherstellen, die Richter sollten unabsetzbar sein, außer durch richterliche Erkenntnis, die Beamten dagegen absetzbar.
Neben den Provinzial- und Reichsständen sollte die Selbstverwaltung der Gemeinden dazu dienen, den gemeinsamen Feind", den "wahren Widersacher der guten Sache", das Beamtenheer von seinem "geheimnisvollen Schreiberwerk" zu verdrängen, es zu ersetzen. Immer wieder erhebt er unerbittliche Anklage gegen die "zentralisierende Bürokratie", die Büralisten, die das Volk um Geist und Mut gebracht haben. Die Erbitterung ganzer geknechteter Geschlechter scheint in den Worten zusammenzuströmen, die zischend wie Peitschenhiebe fallen: "Und dass sie fernerhin von besoldeten, buchgelehrten, interesselosen, ohne Eigentum seienden Büralisten regiert werden, das geht, solange es geht. Diese vier Worte enthalten den Geist unserer und ähnlicher geistlosen Regierungsmaschinen; besoldet, also Streben nach Erhalten und Vermehren der Besoldeten; buchgelehrt, also lebend in der Buchstabenwelt und nicht in der wirklichen; interesselos, denn sie stehen mit keiner der den Staat ausmachenden Bürgerklassen in Verbindung, sie sind eine Kaste für sich, die Schreiberkaste; eigentumslos, also alle Bewegungen des Eigentums treffen sie nicht, es regne oder scheine die Sonne, die Abgaben steigen oder fallen, man zerstöre alte hergebrachte Rechte oder lasse sie bestehen, man theoretisiere alle Bauern zu Taglöhnern und substituiere an die Stelle der Hörigkeit an die Gutsherren die Hörigkeit an die Juden und an die Wucherer, alles das kümmert sie nicht - sie erheben ihr Gehalt aus der Staatskasse und schreiben, schreiben, schreiben im stillen, mit wohlverschlossenen Türen versehenen Bureau, ohnbekannt, ohnbemerkt, ohngerühmt, und ziehen ihre Kinder wieder zu gleichen brauchbaren Schreibmaschinen auf!"
Den Adel dagegen behandelte Stein verhältnismäßig schonend und legte Wert auf seine Erhaltung als auf die einer Klasse, die durch den Grundbesitz unzertrennlich mit dem Lande verbunden und durch materielle Unabhängigkeit berufen sei, der Nation durch Wahrnehmung der öffentlichen Interessen zu dienen. Die Auswüchse der Adelsherrschaft allerdings sollten ausgemerzt werden, wie ja Stein die Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit zu bewirken sich bemühte. Auch gegen die kastenartige Abgeschlossenheit des Adels war er und wies darauf hin, dass es im blühenden Mittelalter eine solche durchaus nicht gegeben habe. Einen Aufstieg tüchtiger Elemente in den Adel fand er notwendig, wie er überhaupt der Ansicht war, dass ein fortwährendes Hinaufströmen aus den unverdorbenen unteren Schichten die durch Weichlichkeit, Luxus, verdorbenen oberen reinigen müsse. Vor dem Streben nach Gewinn und Luxus wollte er den Adel nach Möglichkeit dadurch schützen, dass er ihm die gewerblichen Berufe verschloss; außer dem öffentlichen Leben sollte ihm noch die Betätigung in Kunst und Wissenschaft offenstehen.
Ein alter deutscher Spruchvers heißt: Ein Wolf war krank - Da er genas War er ein Wolf, als er eh was. So verhielt es sich mit den Fürsten nach dem Sturze Napoleons. In der Zeit der Gefahr hatten sie sich verkrochen, gute Worte gegeben, Versprechungen gemacht; kaum der Gefahr entronnen, waren sie wieder die alten, hochfahrend, aufgeblasen, ohne anderes Interesse als für die eigene Sicherheit und Macht. Kaiser Franz, von Metternich beraten, weigerte sich, die Kaiserwürde wiederaufzunehmen, die ihm keine Vermehrung seines Ansehens, nur Schwierigkeiten bringen würde; soweit er Einfluss auf Deutschland zu haben wünschte, ermöglichte ihm das seine Stellung im Deutschen Bunde. Dass die Rheinbundfürsten Steins Verachtung mit Abneigung erwiderten, war selbstverständlich. Auch Alexander von Russland hörte auf, seine Forderungen zu unterstützen; vielleicht war zum Teil daran die Erwägung schuld, dass ein Verfassungsstaat ihm als Nachbar unbequem wäre, sicherlich verstimmte ihn Steins Sympathie für die Freiheitsbestrebungen der Polen. Der König von Preußen war aufrichtiger gewesen als der Zar, insofern er seinen Widerwillen gegen die volkstümlichen Neuerungen, gegen den Krieg, gegen Stein selbst niemals verhehlt hatte, während Alexander liberale Grundsätze auf den Lippen hatte, weltbeglückende Absichten ausposaunte und dem Freiherrn persönliche Verehrung bezeugte. Vergebens erhob Stein beschwörend, warnend, prophetisch seine Stimme: seine Worte fielen unbeachtet zu Boden, man brauchte ihn nicht mehr und nicht mehr das Volk. Er musste es erleben, dass in der Friedensakte des Wiener Kongresses Frankreich als Sieger behandelt wurde: Seine Grenzen blieben unangetastet, und es bekam eine Verfassung. Zur Erfüllung der deutschen Volkswünsche geschah nichts, als dass ein Paragraph eingerückt wurde, welcher lautete: In allen deutschen Ländern werden Verfassungen eingeführt werden. Die Fassung war absichtlich undeutlich, zu nichts verpflichtend, gewählt worden.
Herr von Schön, einer von Steins jüngeren Mitarbeitern, sagte Stein, er habe in hohem Grade den Horror miserabilitatis gehabt; man kann ermessen, wie schrecklich er gelitten hat. Bei allen seinen Verfassungsplänen hatte Stein ein agrarisches Reich im Sinne. Er selbst fühlte sich immer als der große Grundbesitzer, das Leben auf dem Lande, der Umgang mit der Natur war das ihm angemessene. Bei aller Würdigung der Wissenschaft und des gewerbetreibenden Bürgertums, das er in seinen Bestrebungen durchaus unterstützte, gehörte sein innigster Anteil doch den Bauern, und es war ein Glück und entscheidendes Erlebnis für ihn gewesen, in Westfalen eine freie Bauernschaft vorzufinden, die nach uralten Formen ihre Angelegenheiten selbst verwaltete. Von dem gesunden Menschenverstande, der Besonnenheit, der Heimatliebe der Bauern hoffte er in Bezug auf die Volksvertretung am meisten. Nach mittelalterlicher Anschauung war ihm der Eigentümer zugleich der Inhaber politischer Rechte und das Eigentum gleichbedeutend mit Grundbesitz; nur Überlegung und Einsicht bewirkte, dass er auch andere Maßstäbe gelten ließ. Eigentum war ihm ein Beweis von Leistungsfähigkeit, von Tüchtigkeit; er verachtete den Armen nicht, aber er war der Ansicht, dass der Schwache, als welcher der Arme sich erwiesen hatte, nicht geeignet für die Mitwirkung am öffentlichen Leben sei. Aus diesem Grunde erfüllte ihn das Eindringen des Prinzips der Teilbarkeit der Bauerngüter mit lebhafter Besorgnis. Durch die unbedingte Teilbarkeit und Veräußerbarkeit entstehe, so meinte er, auf der einen Seite Anhäufung von Grundbesitz in den Händen einiger großer Eigentümer, wie das zum Schaden der Allgemeinheit im Kirchenstaat und in England der Fall sei, auf der anderen Seite eine Menge ärmlicher Kleinbauern und ganz eigentumsloser Taglöhner, Zunahme des Proletariats und der Verbrechen. Den Kampf für die Unteilbarkeit der Bauerngüter kämpfte Stein während seiner letzten Lebensjahre mit größter Leidenschaftlichkeit und fast alleinstehend; denn die allgemeine Meinung war, dass nicht in die Rechte des Bauern eingegriffen werden dürfe. Ebenso wenig Verständnis fand sein Eintreten für die Zünfte. Er hatte selbst, dem Zuge der Zeit folgend, Gewerbefreiheit eingeführt, bereute es aber später und wünschte sie wiederherzustellen, nachdem sie von Missbräuchen gereinigt und der Zeit angepasst wären. Auch wenn sie technisch und zur Vermehrung des Nationalreichtums weniger zweckmäßig sein sollten als Gewerbefreiheit, hielt er sie für ersprießlicher. Ob durch Zünfte mehr oder weniger Schuhe, Wagen, Bürsten erzeugt würden, sei ihm ganz gleichgültig, sagte er, ihm sei der Staat kein Verein zur Hervorbringung und Verarbeitung roher Produkte, keine landwirtschaftliche und Fabriken-Verbindung, sondern sein Zweck sei moralische, geistige und körperliche Entwicklung des Volkes. "Es ist mir sehr wohl bekannt", schrieb er einem Freunde, "dass diese Meinung der Ansicht derjenigen widerspricht, denen Bevölkerung und Erzeugung von Nahrungsmitteln der Hauptzweck des Staates ist, mir ist es aber religiös-moralische, intellektuelle und politische Vollkommenheit, und diese wird verfehlt, wenn die Bevölkerung sich in Tagelöhner, kleine ärmliche Grundeigentümer, Fabriken-Arbeiter und in ein Gemenge von christlich-jüdischen Wucherern, Fabriken-Verleger und Beamte aufgelöst hat, die durch Genuss und Erwerbsliebe durch das Leben gepeitscht werden!"
Die volkswirtschaftliche Lehre, die zuerst in Frankreich ausgesprochen, dann in England durch Adam Smith und seine Anhänger ausgebildet wurde, dass das Erwerbsleben nicht durch den Staat geregelt noch durch Korporationen gebunden werden darf, sondern dem Belieben und den Kräften der einzelnen überlassen werden muss, in welchem Falle es sich auf Grund natürlicher Gesetze, welche im wirtschaftlichen Leben so gut herrschen wie in der Natur, von selbst am besten ordnen werde, war in Deutschland ziemlich allgemein angenommen worden. Stein setzte diesem wirtschaftlichen Liberalismus mit Nachdruck seine Auffassung entgegen, wonach das Erwerbsleben sittlich-religiösen Geboten und Zwecken untergeordnet werden müsse. Es war die mittelalterliche Anschauung, die das göttliche, von Christus verkündete Gebot in den Mittelpunkt der gesamten Lebensäußerungen des Volkes stellte. Im Maße, wie der mittelalterliche Gottesglaube verblich, wurde die Sonne eines unerschütterlichen himmlischen Rechtes, dessen Strahlen das irdische Recht durchleuchteten, ersetzt durch die Wissenschaft und ihre wechselnden Ergebnisse. In Stein war die mittelalterliche Anschauung noch lebendig. Allerdings war er in der Jugend durch die Lehrmeinungen seiner Zeit beeinflusst worden und hatte selbst die Gewerbefreiheit eingeführt; aber wie er in den Kämpfen des Lebens Einblick in die Lebensverhältnisse bekam und sich eine Überzeugung bilden konnte, kehrte er zu dem Gedankenkreise zurück, der die ihm auch politisch vorbildliche Zeit geleitet hatte.
Stein überlebte den Sturz Napoleons und den Zusammenbruch seiner Hoffnungen um 17 Jahre, er sah noch die Julirevolution. Während dieser Jahre begriff er allmählich, dass zwischen der Staatsbildung, die ihm vorschwebte, und der Gegenwart eine Kluft war, die ihre Verwirklichung auch unter günstigeren Umständen erschwert hätte. Die allgemeine Auffassung vom Staat als einer Anstalt zur Erzeugung von Nationalreichtum entsprach der Auffassung von der Bestimmung des Menschen zum Glück, zum Genuss, die in allen Schichten verbreitet war. Seiner hohen Auffassung von den Aufgaben des Adels widersprach die Erfahrung, die er beständig machte, dass der Adel ungebildet, hohl, vergnügungssüchtig war, nur auf Erhaltung der materiellen Vorteile seines Standes bedacht, mühelosen Geldgewinn durch Spekulation der Ehre voranstellend. "Leerheit, Unbeholfenheit und Egoismus ", schrieb er einem befreundeten Standesgenossen, "geben keinen Anspruch auf Einfluss und Achtung." In der protestantischen Kirche fand er entweder pietistische Sentimentalität mit "langweiliger, idyllenartiger Phraseologie", die ihn abstieß, oder Rationalismus, der ihm verhasst war." Warum soll man das Unerklärliche erklären, das Geheimnisvolle enthüllen mit unserem zerstückelten Wissen, unseren beschränkten Kräften!" Ihm selbst war die Bibel Offenbarung, eine Stimme von oben, an der er nicht deutelte. Er sah, dass ein neues Zeitalter angebrochen war, in dem er sich fremd fühlte und dessen Wesen er verwarf: "ein wissenschaftliches, industrielles, kommerzielles, politisierendes, geschwätziges, frech absprechendes und höchst eitles Zeitalter." Es ist, als stieße der scheidende Heros die ihn umgebende Welt mit einer Gebärde des Ekels von sich, wenn er die schrecklichen Worte sagt: "Unser ökonomisch-technologisch-populierendes System, durch eine zentralisierende, regierungssüchtige Bürokratie angewandt, frisst sich selbst auf wie Saturn seine Kinder; wir sind übervölkert, haben überfabriziert, überproduziert, sind überfüttert und haben mit Buchstaben und Tinte die Beamten entmenscht, die Verwaltung entgeistet, alles in toten Mechanismus aufgelöst!"
Er hatte die bittere Erfahrung gemacht, dass gegenüber Verhältnissen, die einer Erneuerung durchaus bedürfen, die Herrschenden sich weigern, die offenkundig notwendige Reform zu vollziehen, mag auch die Gelegenheit noch so günstig gegeben sein. Die Zeit erinnerte ihn so lebhaft an die, welche der Reformation des sechzehnten Jahrhunderts voranging, dass er sich nicht enthalten konnte, dem Erzbischof von Spiegel zu schreiben, wie beklagenswert es doch sei, dass sich damals der Papst nicht zu einer durchgreifenden Reform entschlossen habe, die von allen Seiten verlangt worden sei; dann wäre Luther nicht aufgetreten, die große Spaltung mit allen ihren zerreißenden Folgen wäre nicht eingetreten, die Entwicklung Europas hätte einen anderen Gang genommen. Aus der Feststellung, dass die Oberen eine notwendig gewordene Umwälzung nicht vollziehen, zog er nicht die Folgerung, dass er es mit Hilfe der Unterirdischen tun wolle. Selbst wenn er jung gewesen wäre, selbst wenn es sich mit seinen Ansichten vertragen hätte, wie hätte er, der so außerordentlich allein stand, daran denken können? Mit den wenigen Anhängern, die seine Ideen teilten, mit den Jünglingen, die ihm gefolgt wären, mit einem zahmen Volk, das man erst zur Freiheit und Stärke entwickeln will, ließ sich das Bestehende nicht stürzen, Neues, Lebensfähiges nicht gründen.
Selten hat ein großer Mann so tragisch geendet wie dieser Kaiser eines Reiches, das für immer untergegangen war. Die Einsamkeit lag bleiern auf ihm. Wie traurig klingt es, wenn er als das Erfreuliche seiner Zeit die Befreiung Griechenlands und die Bildung südamerikanischer Republiken hervorhebt! Noch im Sterben schlug sein Herz für die Polen, die um ihre Freiheit kämpften. Was in Deutschland geschah, erregte nur seinen Groll. Es missfiel ihm, dass Studenten sich mit Politik befassten, es ekelte ihn, dass Fürsten sich vor ihnen fürchteten und sich zu ihren Henkern machten. Er schied gern, kaum vermisst, durch kein Denkmal geehrt.
UNLÖSBARE PROBLEME
Es lag nicht nur an der Selbstsucht gewisser Menschen und Kasten, dass Steins Leben so wenig sichtbare Früchte trug, sondern auch daran, dass das Verwickelte seiner Ziele sie nicht leicht vielen fasslich machte. Er hasste den Machtstaat; sein Ideal war der Gesellschaftsstaat, der Volks- oder Rechtsstaat, wenn man so den Zustand des alten Reiches nennen will, das auf der freien, aber nicht ungeregelten, genossenschaftlichen Bewegung aller Glieder des Volkes beruhte. Im alten Reich waren Macht und Freiheit von der Gottheit ausströmende Kräfte, die sich bekämpften, aber einen Ausgleich fanden im Recht, das feststand, insofern es göttlich war, aber fließend war, insofern es von den Menschen gefunden wurde. Als die Träger dieses mannigfachen Lebens sich erschöpft hatten, trat eine Erstarrung ein, indem die Macht zur Herrschaft gelangte im eigentlichen Staat. Der Mittelpunkt des alten Reiches war der Kaiser, namentlich als Richter und Rechtsquelle, gewesen, eine Person, die nicht herrschte, sondern in der sich alle Kräfte des Volkes kreuzten wie die Blutströmungen des menschlichen Organismus im Herzen; der Staat war eine Maschine, die das Volk von außen bewegte, wie man denn auch in bester Meinung von der Staatsmaschine zu sprechen pflegte. Wie der dreieinige Gott, in dem alle Wesen leben und sind, zu dem Gott, der die Welt von außen bewegt, so verhält sich der Kaiser oder Fürst des Mittelalters zum absoluten Fürsten, zum Staat. Das Volk wurde zur Gesellschaft und hatte Privatinteressen und Privatangelegenheiten; abseits davon besorgte der Staat die Geschäfte des öffentlichen Lebens. Staat bedeutete Herrschaft, Volk war untertan. Wie dem König der Sage alles zu Gold wurde, was er berührte, auch das Brot, das ihn ernähren sollte, so wurde alles, was in den Bannkreis des Staates kam, zur Macht; auch das Recht wurde von ihm verschlungen. In dem Freiherrn vom Stein war noch Reichsgefühl lebendig, und er hätte mit tiefster Genugtuung die Staatsmaschine zerstört und ein freies Volk sich selbst verwalten lassen; aber er wollte deswegen nicht auf eine kräftige, zu durchgreifendem Handeln fähige Regierung verzichten. Die Gegner des Absolutismus wollten zum Teil sich selbst an die Regierung bringen, oder sie wollten die Regierung schwächen, ihr den Nerv persönlichen Lebens abbinden. Steins Absicht war das nicht: Er wollte ein kraftvolles Haupt, in das aus der Ursprungstiefe des Volkes beständig schaffende Kräfte einströmten. Macht war gerade damals erforderlich, um nur das Dasein des Volkes vor Vernichtung zu bewahren, würde gerade für Deutschland in seiner Lage zwischen Frankreich und Russland immer erforderlich sein, und Stein war überzeugt, dass eine mit dem Volke verbundene, vom Volke getragene Regierung kraftvoller sein würde als eine, die sich auf Bürokratie und stehendes Heer stützte. Wo aber waren die organischen Volkskräfte, die mit dem schweren Werk der Selbstverwaltung die Bürokratie hätten ersetzen können? Das alte Reich, dem Steins Gefühl gehörte, war ein agrarisch-handwerkliches; die genossenschaftlichen Kräfte, mit denen er es, soweit das möglich war, wiederherstellen wollte, waren die Adelskorporationen, die Stadtmagistrate, die Zünfte und vor allem die freien Bauerngemeinden. Die Bauern waren ihm die Hauptsache, sie sollten die Grundlage der Gesellschaft bilden.
Es ist eine vielerorts zu beobachtende Erscheinung, dass dem Aufblühen der Industrie die Befreiung der hörigen Bauern vorangeht. Die neuen Herren brauchen viele Sklaven, darum müssen die alten Herren die ihrigen freilassen. Diejenigen, welche die Befreiung zuerst herbeiführen, wissen davon nichts; eine allgemeine Veränderung der Gesinnung ist die Ursache, die Herrschaft allgemeiner Sätze in den Köpfen, die zu unabweisbaren Forderungen führen. Schon bevor Stein Minister wurde, hatten preußische Beamte den Plan der Bauernbefreiung gefasst, in diesem Punkte dem Adel entgegentretend, dem das Fürstentum die Bauern preisgegeben hatte, um es für seinen Staat zu gewinnen; aber erst Stein brachte die Energie auf, die notwendig war, um den Widerstand der herrschenden Klasse zu besiegen, und er handelte aus einer anderen Anschauung heraus als die Beamten. Er wollte die Bauern als Kraft gegen den absoluten Staat gewinnen, die Beamten wollten den Staat durch ihn stützen. Sie waren es, die ihren Zweck erreichten; denn tatsächlich hatte ja Stein sie im Namen des Staates befreit, und dem Staat schlossen sie sich dankbar an, bei ihm suchten sie Schutz vor dem Adel, der die verlorene Herrschaft über die Untertanen wiedergewinnen oder, soweit er sie noch besaß, sie erhalten wollte. Von nun an waren die Bauern der Teil des Volkes, bei dem der Absolutismus den sichersten Rückhalt fand. Das, was Stein vorschwebte, ein selbständiges Gemeindeleben der Bauern, entwickelte sich nicht. Nichts von allem, was der Minister unternommen hatte, war ganz ausgeführt worden, und was ausgeführt war, wurde von seinen Gegnern, die sofort nach seinem Abgang wieder zur Geltung kamen, durch Einschränkungen oder Zusätze seiner wohltätigen Kraft beraubt. Die Städteordnung wurde so beschnitten, dass die städtischen Behörden wieder überwiegend der Beamtenaufsicht unterstellt wurden, die Selbstverwaltung der unteren Verwaltungskreise kam überhaupt nicht zustande. Die Aufhebung der bäuerlichen Erbuntertänigkeit blieb allerdings unangetastet, ebenso eine Verschuldungsgrenze der Bauerngüter, die Stein erkämpft hatte, um den Bauern ihr Land zu erhalten; aber die Patrimonialgerichtsbarkeit blieb bestehen, und durch zugesetzte Edikte, durch die Einführung der Teilbarkeit der Bauerngüter und die Aufteilung des Gemeindelandes, der letzten Reste uralter germanischer Markgenossenschaft, wurde zugunsten des Großgrundbesitzes, der sich rasch vermehrte, der Bauer um das Land gebracht, das eben sein Eigentum geworden war. Ohnmächtig, dem Verderben zu wehren, sah Stein voll Verzweiflung zu, wie der Boden zur Ware, wie sein Volk von der Erde losgerissen wurde. Gerade in diesem Punkte wurde er von niemandem, auch von den Bauern selbst nicht, verstanden; sie sahen in dem Grundsatz der Unteilbarkeit der Güter das Bestreben, ihnen die Freiheit wieder zu nehmen, die ihnen eben gegeben worden war.
Es war die bitterste Erfahrung, die er machen musste, dass sein großer Plan nicht allein an der Gegnerschaft des Staates scheiterte, den er umwandeln wollte, sondern auch an den Kräften, für die und mit denen er ein neues Reich erbauen wollte. Adel, Städte, Bauern, Zünfte, sie ließen sich nicht aus dem starren System des Fürstenstaates herauslösen, und sie waren keine saftvollen Stämme mehr, sondern versteinerte Trümmer, die keine grünen Triebe mehr erzeugen konnten. Neue gesellschaftliche Kräfte gab es kaum, und als er sie in den späteren Lebensjahren wahrnahm, erschienen sie ihm fast ebenso verabscheuungswürdig wie der Staat. Im Beginn seiner Laufbahn hatte er den Aufschwung des Gewerbes und des Handels begünstigt, an der Einführung von Maschinen sich erfreut; dann sah er mit Industrie und Geldwirtschaft eine Gesinnung sich ausbreiten, die der seinigen ganz entgegengesetzt war und die alles verdrängte und überwucherte, was ihm heilig war. Anstatt dass das alte Reich wieder auferstand, wie es sein Wunsch gewesen war, sah er von fern her eine neue Macht sich heranwälzen, um es vollends zu zerstören. Sie schien sich mit dem herrschenden Militär- und Beamtenstaat verbinden zu wollen, aber wie dem auch sein mochte, er sah nichts als diesen Staat, den er hasste, und ein "industrielles, kommerzielles, geschwätziges Zeitalter", dem er fluchte. Wenn das Widerspruchsvolle in seiner Stellung und seinen Handlungen ihn beklemmte, äußerte er sich oft in leidenschaftlichen Ausbrüchen, fast nie in zusammenhängender Erklärung. Wie die Reste des alten Reiches so in den herrschenden Staat hineingebaut waren, dass die meisten Menschen sie gar nicht als etwas Gesondertes erkannten, so war er selbst zu sehr im Machtstaate verwurzelt, als dass er den Gegensatz immer in aller Schärfe hätte zur Darstellung bringen können. So hinterließ er kein klares Programm, das etwaige Nachfolger hätten als Leitschnur benützen können, aber doch etwas seinem Volke, was früher oder später wirksam werden musste: eine unvollendete Revolution. Waren es auch nur glimmende Späne, andere würden Fackeln daran entzünden, das Feuer aus ewiger Glut war da, das keine irdische Gewalt mehr löschen konnte.
ARNDT UND JAHN
Wie alles, was Stein geschaffen hatte, war auch sein Plan der Einheit Deutschlands und der Einheit Preußens Bruchstück geblieben; aber die Gedanken erhielten sich, sie namentlich waren das Glied, an das neue Umwälzungen sich anschlossen. Der Mangel einer Einheit, welche einst in der Person des Kaisers und des kaiserlichen Gerichtes zum Ausdruck gekommen war, hatte gleich nach dem Rücktritt des Kaisers beinahe zum Untergang Deutschlands geführt. Einheit bedeutete Einigkeit, Möglichkeit zielbewussten, einheitlichen Handelns und insofern Kraft an Stelle systematischer Ohnmacht; zugleich bedeutete sie aber in den Augen Steins und seiner Anhänger Freiheit, da der Vertreter der Einheit, der Kaiser, die Macht der Fürsten zugunsten des Volkes einschränkte. Der Kaiser war Vertreter des Ganzen, des gesamten Volkes und seiner Rechte, der Beschützer und Rächer jedes verletzten Rechtes, insbesondere der Rechte der Schwächeren. Aus diesem Grunde waren die Fürsten, die sich soeben völlige Unabhängigkeit errungen hatten, grimmige Feinde der Einheit und der Steinschen Kaiseridee; dass sie das Symbol für Volksfreiheit, Wiedereinsetzung des Volkes in seine Rechte war, machte sie volkstümlich und hochverräterisch. Ähnlich wie mit der Einheit Deutschlands verhielt es sich mit der Einheit Preußens, die sogar überwiegend Freiheit bedeutete. Der König von Preußen war nicht in dem Sinne Vertreter des Ganzen, wie der mittelalterliche Kaiser gewesen war, der überhaupt keine Macht hatte, außer die in den Rechten des Volkes lag, die er gewährleistete; die Fürsten hatten alle Macht und alles Recht eingezogen und waren nur insofern Vertreter der Gesamtheit, als sie behaupteten, zum Wohle ihrer Untertanen zu regieren, und verlangten, dass diese es glaubten. Glaubten sie es nicht, so war ihnen nicht zu helfen. In Steins Augen war die wichtigste Aufgabe, das Volk wieder selbsttätig zu machen; da aber der Staat einmal bestand, sollte doch eine staatliche Vertretung des Volksganzen eingerichtet werden und die absolute Macht im Mittelpunkt beschränken, und dazu sollten die Provinzialstände dienen, die im ausgehenden Mittelalter, zur Zeit, als das Territorialfürstentum sich bildete, entstanden waren und bedeutende Rechte besessen hatten, deren der Große Kurfürst und seine Nachfolger indessen sie gewaltsam beraubt hatten. Dies Organ sollte nach der Absicht Steins in das staatliche Leben Preußens wieder eingeführt werden, und Hardenberg, der nach ihm Minister war, hatte daran festgehalten. Während von der Einheit Deutschlands nur mehr das Wort, die Forderung da war, blieben von dem Gedanken der Einheit Preußens Dokumente. Unter den Aktenstücken, die in Bezug darauf zustande gekommen waren, gab es zwei besonders wichtige: die Verordnung über die zu bildende Repräsentation des Volkes vom 28. Mai 1815 und die Verordnung wegen der künftigen Behandlung des Staatsschuldenwesens vom 17. Januar 1820. In der ersteren heißt es nach längerer Begründung, der König habe die Bildung einer Repräsentation des Volkes beschlossen, die aus den teils noch bestehenden, teils neu eingerichteten Provinzialständen gewählt werden und in Berlin ihren Sitz haben sollte. In der zweiten Verordnung wurde die Aufnahme jedes neuen Darlehens an die Zuziehung und Garantie der künftigen Reichsstände geknüpft. Als der König bald darauf beschloss, keine Reichsstände zu berufen, ging er doch nicht so weit, sein Versprechen förmlich rückgängig zu machen; er behielt sich nur, wie er sagte, den Zeitpunkt vor, wann er es erfüllen wollte. In diesen Dokumenten war die Flamme der Revolution eingefangen; aber auch in lebendigen Gefäßen, im Gedächtnis einiger Verehrer und Mitarbeiter Steins. Bei keinem von ihnen haben Steins Ideen einen solchen Widerhall gefunden wie bei Ernst Moritz Arndt; aber es hat auch keiner so wie er auf Stein gewirkt. Der Freiherr und der Bauernsohn verstanden sich, weil sie beide noch mehr wie Glieder des Reiches als wie Untertanen eines Staates fühlten und dachten. Als Stein, während er im Jahre 1808, aus Preußen flüchtig, unter ungern gewährtem österreichischem Schutze in Prag lebend, zum ersten Male Arndts Hauptwerk, den "Geist der Zeit", las, war er tief ergriffen: Aus diesen Blättern loderte ihm die eigene Seele entgegen. Arndts Sprache hatte noch etwas von Lutherscher Fülle, Anschaulichkeit und Süßigkeit, seine Gedanken waren Visionen; es war da weder im Inhalt noch in der Form das Seichte und Verschwommene, was Stein in den Äußerungen der modernen Philosophie so widerwärtig war. "Der Geist der Zeit", geschrieben, um die Deutschen zum Hass und zum Kampf gegen das napoleonische Frankreich zu entflammen, rühmt Kraft und kraftvolles Empfinden als die erste Tugend der Völker. Bei der Beurteilung der Menschen und Ereignisse ging Arndt nicht von Schulbegriffen einer ausgedachten Vortrefflichkeit aus, sondern von der Natur, ihrem Reichtum, ihren Widersprüchen, woraus das Große und Schöne erwächst. Er sprach Urteile aus, die sogenannte Idealisten entsetzten. "Mittelmäßigkeit ist der Tod alles Großen und Heroischen. Gut oder böse und beides in Vortrefflichkeit, kann man mit der Welt spielen und herrschen. Was bekam Preußen dafür, Teutschlands alte Grenzen nicht zu retten? Einige kleine und elende Herrschaften, im ganzen Heiligen Römischen Reich zerstreut. Wollte es Krieg, so musste es mit Österreich und Russland sich über Teutschland vergleichen, wollte es Frieden, so musste Frankreich ihm Franken und Westfalen und die hessischen, sächsischen und mecklenburgischen Fürsten als seine Vasallen erlauben. Das war ein Preis, der ein Schelmstück in der Politik wert war. Sonst musste man schlagen, um mit den Seinen Ehre und Land zugleich zu gewinnen. Man verkaufte seine Ehre umsonst! Alle politischen Dummheiten sind Verbrechen. Wir haben uns durch eine schlechte Lehre einer empfindelnden Humanität und eines philanthropischen Kosmopolitismus einwiegen und betören lassen, dass Kriegsruhm wenig, dass Tapferkeit zu kühn, dass Männlichkeit trotzig und Festigkeit beschwerlich sei... Kurz, die höchste Männerkraft, welche verteidigen und rächen kann, sie allein ist es, welche Völker herrlich und Menschen groß macht. Dies ist nicht das Herrlichste selbst, aber der Grund alles Herrlichen, mit welchem es rettungslos zusammenstürzt, um nie wieder aufzustehen. " Er beklagt es, dass die Teutschen keinen zornigen Gott, keine heiße Liebe, keinen kühnen Hass, keinen brausenden und begeisterten Wahnsinn mehr haben, dass sie kein Leben mehr haben; dass sie gegen ihre Feinde demütig, gegen ihre Freunde gleichgültig, gegen alle Welt und alle Menschen gütig und gerecht, nur gegen sich selbst immer grausam und ungerecht sind."
In seiner Heimat, Pommern, hatte er Deutschland als ein agrarisches Land kennengelernt, dessen Bewohner, wenn nun die Eigenbehörigkeit aufgehoben war, im allgemeinen als kräftig, tüchtig zum Kampf und zur Arbeit gelten konnten. Wie Stein, sah er Schwäche als etwas Mangelhaftes an, etwas, was man womöglich stark machen müsse, das man aber nicht hätscheln, dem man vor allen Dingen nicht das Starke aufopfern dürfe. "Der eine", sagt er mit Bezug auf die Pazifisten seiner Zeit, "hat ein neues Rezept zu einem Kartoffel- und Eichelbrot, der andere ruft Knochensuppen, der dritte Gesundheitskatechismen und Kuhpocken, der vierte ein leichteres Pfluggestell aus, alle mit der roten Unterschrift: Heil der Menschheit. Für die Unmündigen, Halbtoten denkt und schreibt und schreit dies Volk in einem Augenblicke, wo es die Starken und Frischen mit Heldenmut entflammen und mit brennenden Herzen und rächenden Schwertern an die Feinde treiben sollte. Wer immer nur die Erbärmlichkeit und Verwesung der Welt sieht, wird ihre Wunden nicht heilen. "
Massenarmut, Proletariat, kannte er noch nicht. Er war, wie Stein, der Meinung, dass man der Verelendung des Volkes durch Acker- und Zunftgesetze vorbeugen müsse. Die unbedingte Teilbarkeit der Bauerngüter und die Gewerbefreiheit würden allzu große Bereicherung auf der einen Seite, Verarmung auf der andern zur Folge haben, ein Verhältnis, das dem germanischen Geiste ebenso zuwider sei wie die absolute Gleichheit. Während diese von den Franzosen proklamiert werde, suchten die Deutschen annähernde Gleichheit, den Ausgleich schroffer Unterschiede. Als später die Maschinen eingeführt wurden, die Fabriken sich vermehrten, der Staat selbst sich fabrikmäßig zu gestalten begann, erhob er mahnend, ganz im Steinschen Geiste, seine Stimme: Er lobe die Länder, wo über die Hälfte, ja wohl zwei Drittel aller Grundstücke an mittelmäßige Besitzer verteilt wären, wo viel freie Bauern wohnten: Schweden, Norwegen, Dithmarschen, Ostfriesland, die Grafschaft Mark, das Havelland, das Herzogtum Magdeburg. Fabriken gäben wohl Glanz und Reichtum, verderbten aber einen Teil des Menschengeschlechtes leiblich und geistig. Man bewundere England, aber seine Lage sei durchaus nicht so beneidenswert, wie man meine. Fast aller kleine und mittlere Landbesitz sei dort verschwunden, die Großen und Reichen besäßen das Land, Pächter bebauten es. "Jetzt trägt sich alles noch einigermaßen, weil England über den Handel und über die Schätze der Welt gebietet; aber Weltumwälzungen und vorzüglich Handelsumwälzungen können kommen - und sie sind vielleicht nicht so fern, als manche glauben -, wodurch die Engländer mehr auf sich selbst zurückgeworfen werden; dann werden sie die Verwirrung und Regellosigkeit der Verhältnisse in ihrer ganzen Hässlichkeit erblicken. " Bitter beklagt er die Zerstückelung der Bauerngüter, "also dass durch eine übel verstandene Freiheit das Verhältnis des Grundbesitzes, welches ein festes und ehrbares Verhältnis sein sollte, ein krämerliches und jüdisches und fast vagabundisches Verhältnis wird". Bauern und kleine Grundbesitzer müssten unmittelbare Lehensmannen des Staates sein. Es ist das uralte Recht des Moses: "Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen ewiglich, denn das Land ist mein", und: "Die Kinder Israel sind meine Knechte, die ich aus Ägyptenland geführt habe, darum soll man sie nicht auf leibeigene Weise verkaufen"; die Auffassung, die dem germanischen Rechtsgefühl entsprach, wonach alles Land dem Kaiser gehörte und alle Freien nur von ihm abhingen, reichsunmittelbar waren. "Und das ist noch das Schlimmste", so schließt er diese Betrachtung, dass diese ungebührliche Freilassung die verwünschte Fabriksüchtigkeit und Fabrikflüchtigkeit in die Menschen und ihre Einrichtungen gebracht hat und dass die ganze Erde und der Staat selbst vor vieler Staatsverwalterei und Staatseinrichterei fast nur wie eine Fabrikanstalt gewürdigt und verwaltet wird... Lieber wollen wir keine einzige Maschine als die Gefahr, dass dies Maschinenwesen uns die ganze gesunde Ansicht vom Staate und die alle Tugend, Kraft und Redlichkeit erhaltenden, einfachen, natürlichen Klassen und Geschäfte der Gesellschaft zerrütte. Wenn alle Handwerker Fabrikanten werden, wenn der Ackerbau selbst endlich wie eine Fabrik angesehen und betrieben wird, kurz, wenn das Einfältige, Stetige und Feste aus den menschlichen Einrichtungen weicht, dann steht es schlecht um das Glück und die Herrlichkeit unseres Geschlechtes. Wenn wir dahinkommen, dass Axt, Säge und Senkblei von selbst Häuser zuschnitten und aufrichteten, dass der Pflug und die Sense von selbst den Acker pflügten und abernteten, wenn wir endlich auf Dampfmaschinen über Berg und Tal fahren und auf Luftbällen in die Schlacht reiten könnten, kurz, wenn wir neben unseren künstlichen Maschinen, die alle Arbeit für uns täten, nur so hinzuschlendern brauchten - dann würden wir ein so entartetes, nichtiges und elendiges Geschlecht werden, dass die Geschichte auf ewig ihre Bücher vor uns schließen würde."
Als Professor in Greifswald beeinflusste Arndt den um neun Jahre jüngeren Jahn, einen selbständigen Geist und eine originale Persönlichkeit. Er stammte aus dem Dorfe Lanz an der hannoverschen und mecklenburgischen Grenze, wo sein Vater Prediger war; die Bewohner dieses Dorfes waren, eine Seltenheit in Deutschland, freie Bauern. In Jahns Denkweise spürt man den Untergrund altgermanischen Wesens. Für Geschichte und Sprache hatte er besonders viel Sinn und Begabung. Seine Ausdrucksweise ist immer originell und kräftig, wenn auch sein Bemühen, die Sprache durch Benützung alter Wortstämme aufzufrischen, zuweilen stört und wenn ihm auch die ambrosische Quelle nicht strömte, die durch Arndts Prosa und Verse perlte. Wie Arndt warf er die Theologie, zu der er bestimmt war, beiseite, so entschieden fühlte er sich zum Kampfe um die Herbeiführung eines einheitlich und volkstümlich gestalteten deutschen Reiches berufen. Wenn er das Volkstümliche in seinem Auftreten bizarr betonte, so war er doch keineswegs roh oder oberflächlich im Denken. Er erkannte das Einheitsstreben als das erste Sichselbstbewusstwerden einer Nation, es war ihm etwas Heiliges, von Gott Gewolltes; abgesehen davon zeigte die Not der napoleonischen Zeit die vernichtenden Folgen der Zerstückelung. Dadurch, dass er an Dr. Plamanns, 1805 in Berlin gegründeten, auf Pestalozzis Ideen fußendem Knabeninstitut angestellt wurde, bekam er Gelegenheit, auf die Jugend zu wirken, und wurde sich des Einflusses bewusst, den er ausüben konnte. Wie dem Rattenfänger liefen sie, groß und klein, dem seltsamen Zauberer und seiner Lehre nach. Er wollte durch Ausbildung des Körpers, durch Turnen und Wandern, die Jungen zu freigesinnten, furchtlosen Männern machen; deshalb fasste er sie hart an und mutete ihnen viel zu, aber er spielte auch mit ihnen und war ihnen ein gutgelaunter, an Einfällen unerschöpflicher Kamerad. Unter denen, die von 1810 bis 1814. Knaben und Jünglinge waren, gab es kaum einen, den er nicht, wenn er in seinen Umkreis geriet, bezaubert hätte. Alle, die an der Befreiung Deutschlands von der napoleonischen Herrschaft im geheimen arbeiteten, spürten in der neuen Kunst des Turnens eine Mithilfe und begrüßten sie freudig; grollend sahen der König und die Partei der Junker zu, die den Beginn der Insurrektion darin witterten. Jahn im Verein mit Friesen, der, nachdem er gefallen war, zu einem siegfriedähnlichen Heros verklärt wurde, begründete das Lützowsche Freikorps als ein Bild deutscher Einheit, als eine Vertretung Deutschlands neben dem preußischen Heer. Als Farben für die deutsche Legion wählte Jahn Schwarz, Rot und Gold, welches nach seiner Ansicht im Mittelalter die Farben der Sturmfahne waren. Das Banner, welches Berliner Mädchen und Frauen für die Lützower anfertigten, bestand aus roter und schwarzer, mit goldenen Fransen eingefasster Seide, worauf in Gold die Worte gestickt waren: Mit Gott fürs Vaterland. Mit verschiedenen Studenten, die Lützower gewesen waren, besprach Jahn die Gründung der Burschenschaft, welche die Idee der Freischar aufnehmen und fortführen sollte. Indem sie Studenten aller deutschen Universitäten umfasste, sollte die Burschenschaft ein Bild der Einheit aller deutschen Stämme sein, ein Vorbild und eine Vorschule; denn die Jünglinge, die während der Studienjahre die Einheit unter sich verwirklicht hätten, würden sie später ins staatliche Leben einzuführen suchen. Als Farben der Burschenschaft wurden, wie es nahelag, die Farben der Lützower übernommen. Als auf einem Burschentag im Herbst 1818 gleiche Tracht und gleiche Farben für die Burschenschaften aller Universitäten vorgeschlagen wurden, zog Robert Wesselhoeft, ein besonders angesehenes und tüchtiges Mitglied, Erkundigungen ein, und nachdem er berichtet hatte, Schwarz-Rot-Gold wären wirklich die alten Reichsfarben und die ersten Burschenschaften hätten sie geführt, entschied man sich für sie. Sie wurden das heiliggehaltene Symbol eines einheitlichen Reiches, von den Gegnern eines solchen verfolgt. Zugleich waren sie das Symbol der Freiheit, worunter ganz allgemein eine Beschränkung des fürstlichen Absolutismus durch Verfassungen verstanden wurde, wie die Bundesakte sie in Aussicht gestellt und der König von Preußen insbesondere sie versprochen hatte. Man dachte dabei an die Wiedereinführung der Stände, die es überall gegeben hatte, und an eine Neubelebung der Selbstverwaltung; seinen Abschluss sollte das wiederhergestellte Reich in der Kaiserwürde finden, die man sowohl als Ausdruck der Freiheit wie der Einheit auffasste, indem durch sie die fürstliche Macht beschränkt und das Recht aller Bürger gewährleistet wurde. Dass die Fürsten, die jahrhundertelang auf die Abwerfung der kaiserlichen Oberherrschaft hingearbeitet hatten, sich nicht gutwillig wieder Fesseln würden anlegen lassen, setzte man voraus, man rechnete sogar damit, dass eine Anzahl ganz verschwinden müsse. Jahn wies auf das Mittel des Hippokrates wider den Krebs hin: Was Arznei nicht heilt, heilt das Eisen, was Eisen nicht heilt, heilt das Feuer.
Neben Jahn war auch Arndt ein Ausgangspunkt für die Burschenschaft. Mit allen ihren Auswüchsen und Missbräuchen trat er energisch für die akademische Freiheit ein, er rühmt sie als einen Vorzug, den Deutschland vor allen europäischen Ländern voraushabe. In einer Zeit, wo auch in Deutschland die Universitäten Hochschulen waren oder dazu gemacht wurden, die, wie andere Schulen, vom Staate abhingen, pries er die Zeit, wo die Universitäten Staaten im Staate waren, und wünschte, dass dieser Zustand im Studentenstaat, wie er die Gemeinschaft der Studenten und ihre akademische Freiheit nannte, wenigstens einigermaßen erhalten bleibe. Die einstige Genossenschaft der Universitätsglieder nannte er eine majestätische Innung", die jeden Eintretenden, sei es auch ein Bauer oder Knecht gewesen, geadelt und ihm ein Rittertum gewährt habe, das ihn den Edelsten gleichgestellt habe. Als einen Ritterstand wollte er die Studenten immer noch aufgefasst sehen, denen ein genialisches Überschäumen und selbst übermäßige Wildheit gestattet sein müsse im Vertrauen auf ihre Ehre und die Kraft, mit der sie später ihre hohe Bestimmung erfüllen würden. Diese Gedanken wie überhaupt Arndts Ansicht vom germanischen Menschen, den er wesentlich heroisch sah, zu Ausgelassenheit, Torheit und Tollheit geneigt, aber auch der Keuschheit und Freundestreue ergeben und edelster Aufopferung fähig, haben in den nächsten Jünglingsgenerationen fortgewirkt.
LUDEN
"Unser Herzog Karl Augustus - Ist allein nach unserm Gustus ", sangen die Studenten in Jena. Karl August hatte seinem kleinen Lande eine Verfassung gegeben, durch welche die Pressefreiheit gewährleistet war. In Jena wirkte im Sinne der Stein, Arndt, Jahn der Historiker Professor Luden. Er war der Sohn eines Bauern aus dem Herzogtum Bremen, gehörte also dem niedersächsischen Stamme an, der sich von jeher durch unabhängigen Sinn hervorgetan hatte. Er hatte äußerlich nichts von einem Revolutionär, war gewählt in seiner Kleidung, gemessen in seinem Betragen, sein Wesen hatte das Aristokratische, was Bauern eigentümlich ist. Seine Furchtlosigkeit bewies er durch sein Agitieren gegen Napoleon in seinen Vorlesungen unter den Augen der französischen Besatzung, und revolutionär war auch die Art, wie er Geschichte vortrug. Es war seine Absicht, auf die Gegenwart zu wirken. Er las die Geschichte der Deutschen im Mittelalter und behandelte diese Epoche nicht als ein Zeitalter der Barbarei und des Irrtums, wie das namentlich in Preußen üblich war, sondern den Absolutismus als eine Unterbrechung der gesunden organischen Entwicklung, der das Volk geschwächt, seiner angestammten Rechte beraubt und es fremden Einflüssen überlassen, der alle Errungenschaften der mittelalterlichen Kultur vernichtet habe. Er fühlte sich durchaus im Gegensatz zu der weltbürgerlichen Anschauungsweise des achtzehnten Jahrhunderts. Wehrhaftigkeit des Volkes hielt er für Recht und Pflicht und wirkte in diesem Sinne auf die Studenten. Er war der geistige Führer der Vandalia, deren Mitglieder in großer Zahl in die Lützowsche Freischar eintraten. Mit Jahn stand er dauernd in Verbindung und nahm lebhaften Anteil an der burschenschaftlichen Bewegung. Die zurückkehrenden Lützower begründeten eine jenaische Wehrschaft, deren Leiter zwei der besten Schüler Ludens waren, Kaffenberger und Scheidler. Dem letzteren schrieb Luden 1816 ins Stammbuch: Das Schwert ist not, und not ist auch das Wort - Drumm willst du, Jüngling, nur das Vaterland - So suche Meisterschaft in Schwert und Wort. Vielleicht zum ersten Male hörten viele von den jungen Männern von Luden, dass die Deutschen vor der Konstituierung der jetzigen Staaten eine großartige Geschichte, eine reiche Kultur gehabt hatten, lernten sie das Bestehende als etwas dem deutschen Wesen Fremdes, Feindliches ansehen. An die Stelle der Territorialstaaten wollte Luden einen Nationalstaat, an die Stelle des absolutistisch regierten einen Rechtsstaat gesetzt sehen, einen lebendigen, organischen, dessen Wesen Freiheit sei. Wenn bisher Geschichtsprofessoren von Freiheit geschwärmt hatten, so bezogen sie sich auf die antiken Republiken; Luden hingegen sprach von der Vergangenheit des eigenen Volkes und von der Gegenwart. Als ideale Staatsform galt ihm die Republik oder die konstitutionelle Monarchie, zwischen den beiden machte er keinen Unterschied. Von Preußen wandte er sich ab, als die Reaktion begann, und wurde auch nicht als Professor nach Berlin berufen, wozu der Senat ihn schon vorgeschlagen hatte. Als im Auftrage Russlands der Wallache Stourdza die deutschen Universitäten als "gotische Trümmer des Mittelalters ", als "Staaten im Staat" und insbesondere die Burschenschaft als eine revolutionäre Verbindung angriff, die unter die Aufsicht der ordentlichen Behörden gestellt werden müsse, trat er für die Studenten ein. Ebenso unerschrocken bekämpfte er Kotzebue als den deutschen Spion im Dienste Russlands. Ende 1817 fiel ihm das Bruchstück eines Berichtes in die Hand, in welchem Kotzebue dem Kaiser von Russland anklägerisch und verleumderisch die Zustände an den deutschen Universitäten schilderte und auch Luden in beleidigender Weise angriff. Diesen Bericht druckte Luden mit kritischen Bemerkungen versehen in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift für Geschichte und Politik, der "Nemesis", ab, worauf Kotzebue die Weimarische Regierung zum Einschreiten veranlasste. Luden und einige andere wurden vom Leipziger Schöppenstuhl, daraufhin Schöpsenstuhl genannt, zu Gefängnis- und Geldstrafen verurteilt, vornehmlich "wegen öffentlicher Verletzung der schuldigen Ehrerbietung gegen das Oberhaupt eines fremden Staates", welches Urteil aber vom Oberappellationsgericht zu Jena aufgehoben wurde. Nun strengte Luden seinerseits Verleumdungsklage gegen Kotzebue an, der auch verurteilt wurde und widerrufen und zurücknehmen musste. Kurze Zeit darauf wurde Kotzebue ermordet; es konnte scheinen, als habe Luden die Schneide des mörderischen Messers geschärft. Einige Jahre später wurde von Berlin aus ein Gegenschlag geführt. Unter den beschlagnahmten Papieren eines Studenten wurde ein Kollegienheft gefunden, das der Vorlesung Ludens über Politik nachgeschrieben war. Es fand sich darin allerlei Staatsgefährliches, wie zum Beispiel die Lehre von der Volkssouveränität und vom Recht der Selbsthilfe wider Gewalt. Besonders verderblich und geradezu revolutionär fand man den Satz: "Die wahre geschichtliche Grundlage der Staatseinrichtungen ist das Bedürfnis der Zeit" und die Mahnung, gegen drei Dinge unaufhörlich zu streiten: Gleichgültigkeit, Selbstsucht und bösen Willen. Die Folge davon war, dass Luden das Kolleg über Politik nicht mehr lesen durfte; die "Nemesis" hatte schon 1818 zu erscheinen aufgehört. Was die Flamme dieses Geistes an Licht und Kraft zu geben hatte, war damit erschöpft, erstickt; ohne noch einmal hervorgetreten zu sein, starb Luden im Jahre 1847, nachdem er mehrere Jahre an Gehirnerweichung krank gewesen war.
REVOLUTIONÄRE FAMILIEN
Der Gegensatz zu der franzosenfreundlichen Politik der Rheinbundfürsten, die Sehnsucht nach einem kraftvoll geeinigten Deutschland, die Abneigung gegen die Beamten, die Organe der Willkürherrschaft, war so allgemein und stark, dass sich mit überraschender Schnelligkeit ein Netz gleichgesinnter Gegner des Bestehenden über Deutschland ausspannte, dessen feste Punkte die Universitäten und einige Familien bildeten, zwischen denen die Studenten hin und her wanderten. Auf ihren unendlichen Fußreisen fanden sie stets gastliche Aufnahme und Pflege bei Gesinnungsverwandten. In Süddeutschland waren besonders bemerkenswert die Snell, die mit den Münch, und die Follen, die mit den Vogt zusammenhingen. Die Snell und die Münch, dem Herzogtum Nassau angehörig, stammten von Pfarrern ab. Dr. Christian Wilhelm Snell war Rektor einer Schule in Idstein und verband die Schwärmerei für das deutsche Kaisertum mit der Vorliebe für die antiken Republiken; war doch das mittelalterliche Reich ebenso wohl republikanisch wie monarchisch gewesen. Als ein feuriger Pädagoge erfüllte er die Schüler mit seinen Überzeugungen, vor allem seine eigenen Söhne, von denen Wilhelm, Ludwig und Friedrich die bedeutendsten waren. Wilhelm studierte die Rechte, Ludwig Philologie, Friedrich Theologie; Ludwig wurde Rektor neben seinem Vater, später an eine Schule in Wetzlar berufen. Wilhelm und Ludwig traten in Beziehung zu Arndt und gründeten mit ihm die Deutsche Gesellschaft, welche bestimmt war, die Ideen Steins lebendig zu erhalten und ihre Ausführung vorzubereiten. In einer Denkschrift über die Deutsche Gesellschaft, die Ludwig Snell 1821 an den nassauischen Regierungspräsidenten Ibell richtete, benützte er einen Aufsatz von Luden: "Das Vaterland oder Staat und Volk". Bei der Feier der Leipziger Schlacht im Jahre 1814 hielt Wilhelm eine Rede, in der die Sätze vorkamen: "Der Kreis, den der Staat uns zum Wirken anweist, ist für einen tatvollen Mann oft zu öde und immer zu eng. Der Kreis der Familie und der Freunde ist nicht minder unbefriedigend, und es bleibt dem Herzen noch eine heiße Sehnsucht übrig, auch auf ein Ganzes mit ganzer Seele zu wirken und mit den Guten und Edlen seiner Nation vereint nach dem zu ringen, was sich im Herzen mit unendlicher Sehnsucht regt." Man spürt in diesen Worten den Geist Steins, der den beiden Brüdern seine Gunst und seinen Schutz zuwandte. Wilhelm erließ einen Aufruf zur Gründung einer deutschen Freischar, die im Frieden die Wache des künftigen Kaisers bilden und das Reichspanier führen sollte, und forderte zur Bildung von Männervereinen auf, die "jenen Geist des Handelns erzeugen, wodurch andere Völker in Zeiten der Not aus ihrer Mitte heraus so gewaltige Dinge taten, ohne dass sie, worauf der allzu treue Teutsche bisher stets zu warten pflegte, von oben herab geboten wurden". Beide Brüder waren in der Art ihres Vaters republikanisch esinnt, Ludwig entwarf eine republikanische Staatsverfassung, führte in der Schule eine republikanische Schulordnung ein, unterrichtete auch Knaben und Mädchen gemeinsam und erfreute sich besonders guter Erfolge mit den Mädchen. Ibell hassten sie schon deshalb, weil er Anhänger der Franzosenherrschaft gewesen war, und er gab ihnen den Hass wirksamer, als sie es konnten, zurück. In seiner Antwort auf Ludwigs Eingabe wegen der Deutschen Gesellschaft zeichnete sich folgender Satz aus: "Es ist eine ebenso unvernünftige als gesetzwidrige Idee, wenn Privatpersonen glauben mögen, berufen oder ermächtigt zu sein, einzeln oder auch in Verbindung mit anderen, selbständig oder unmittelbar, so jetzt als künftig zu den großen Nationalangelegenheiten Deutschlands mitzuwirken." Wilhelm gab zuerst Anlass, gegen ihn vorzugehen, indem er als Kriminalrichter in Dillenburg eine Petition für die Westerwalder an die Landstände schrieb, worin er sich über die Domänen, die der Herzog als Privatbesitz in Anspruch nahm, im entgegengesetzten Sinne aussprach. Er wurde seiner Stelle entsetzt, bekam die Professur in Bonn nicht, die der Freiherr vom Stein ihm verschafft hatte, ging als Professor nach Dorpat, wurde aber auch dort vom Zaren Alexander entsetzt und ausgewiesen. Mitten im Winter trat er trotz der Warnungen des Gouverneurs von Riga, der ihm wohlwollte, die Rückreise nach Deutschland an, hielt sich einige Tage in Berlin auf und ging dann auf heimlichen Wegen über das Gebirge, denn der Befehl, ihn zu verhaften, war schon ausgegeben, zu seinem Bruder nach Wetzlar, wo er kurz vor Neujahr 1820 ankam. Glücklich allen Gefahren entrinnend, gelangte er nach Straßburg, wo er zwei Freunde, Görres und Karl Follen, traf, mit denen er sich in die Schweiz begab. Bald darauf wurde auch Ludwig seines Amtes entsetzt, zunächst noch mit Beibehaltung seiner Besoldung, was aber aufhörte, als er nach England ging. Dort verkehrte er mit mehreren Flüchtlingen, besonders mit dem jungen Schwaben Bardili, der mit Karl Hase und anderen auf dem Asberg gesessen hatte und in Amerika einen frühen Tod fand. Im Jahre 1827 verließ er England und ging nach Basel, wo Wilhelm inzwischen Professor geworden war und wo Dahlmann, der damals gerade die Schweiz bereiste, das schöne und bedeutende Äußere und die gewinnende Liebenswürdigkeit der Brüder auffiel. Beide wurden so heimisch in der Schweiz, dem Lande, wo so vieles verwirklicht war, was ihnen als Ideal vorschwebte, dass sie sich mit dem ihnen eigentümlichen Feuer an den dortigen Verfassungskämpfen beteiligen konnten, bald siegend, bald unterliegend. Gegen das Ende des Lebens neigten sie sich sozialistischen Ideen zu, die ja, wie Wilhelm sagte, auch im Christentum lägen. Sie erlebten mit lebendigstem Anteil die Revolution von 1848 und starben im Beginn der fünfziger Jahre. Die Ideen und Bestrebungen der Brüder Snell lebten in der Heidelberger Teutonia fort, die von Ludwig ausgegangen war. Von ihnen beeinflusst waren auch die Brüder Follen, die eine besonders energische Strömung in der Burschenschaft hervorriefen. Die Gießener Familie Follen hatte etwas auffallend Genialisches. Der Vater, ein Jurist, blieb bis ins Alter höchst temperamentvoll, arbeitete und focht mit seinen Söhnen, steckte voll origineller Einfälle, ließ gern seinen Witz spielen; der Familienton war so, dass Freunde oft nicht unterscheiden konnten, was Scherz und was Ernst war. Wahrheitsliebe und unbedingtes Eintreten für das Recht schätzte er besonders hoch, Intelligenz und ein intensives Erfassen des Lebens waren selbstverständlich. Die Söhne, besonders August Adolf, der ältere, und Karl, der zweite, waren schön von Wuchs und Gestalt. Beide hatten dichtes blondes Haar, August Adolf soll so gewirkt haben, dass, wer ihn zuerst sah, fast vor seiner Schönheit erschrak. Trotz ausgeprägten Familiencharakters waren die Brüder sehr verschieden. August Adolf ließ sich gehen, gab sich zuweilen Ausschweifungen und trägem Genießen hin, was seinen Grundsätzen widersprach und ihn hernach quälte. Auch in seinen Plänen hatte er etwas Schwelgerisch-Ausschweifendes, wie einer, dem es mehr auf das Planen als auf das Ausführen ankommt. Seine poetische Begabung war bedeutend, er verfügte über einen reizvoll volkstümlichen, balladesken Ton in seinen Gedichten. Die Pracht seiner Erscheinung, sein leicht pathetisches Auftreten trug wohl dazu bei, dass er von den Freunden der Deutsche Kaiser genannt wurde. Als im Jahre 1815 Kaiser Franz, fadenscheinig und bürgerlich anzusehen, durch Heidelberg kam, fiel ihm, so wird erzählt, die königliche Gestalt seines jungen Nebenbuhlers auf; dieser fühlte sich vielleicht als Erwählter des Volkes dem verkümmerten Legitimen gegenüber.