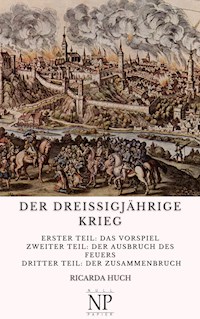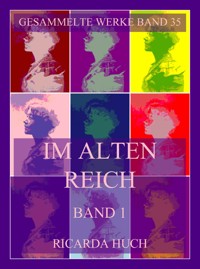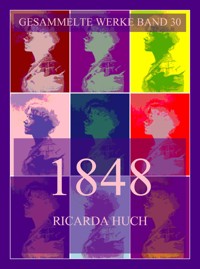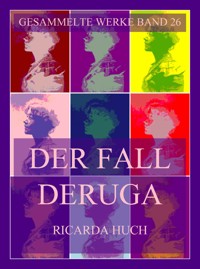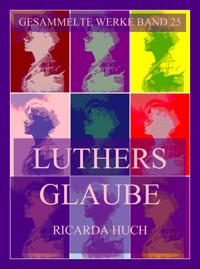5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die "groteske Erzählung" der Ricarda Huch stellt sich dem Leser zunächst zwischen den Großinquisitor Dostojewskis und Gerhart Hauptmanns Emanuel Quint. Aber sie ist im Grunde mit beiden nicht zu vergleichen. Gerhart Hauptmann erfaßt das Problem des Religiösen und sein Schicksal, wenn Gott im Leibe eines geistig armen Menschen, des Narren in Christo, sich offenbart. Die Spannungen zwischen den heterogenen Mächten der Gotteskindschaft und der irdischen Welt werden von ihm aus der Seele und Persönlichkeit des Narren entwickelt. Sein Sein und seine Wirkung in dem Zwiespalt zwischen Gotthaftigkeit und weltlicher Armseligkeit, und damit das Problem der Erscheinung des Göttlichen als des dem Irdischen gegenüber absolut Anderen, das ist das Problem des Buches. Auch bei Ricarda Huch - wie bei Dostojewski - spielt die Kirche und die Inquisition eine Rolle, und wie Hauptmann stellt sie einen Menschen mit mystisch-religiösen Kräften, eine Christusgestalt, in die Wirklichkeit des Tages hinein. Aber was sie an der Folie dieser Gestalt zeigen will, ist die Gräßlichkeit der Zivilisation. Hier liegt der ganze Nachdruck des Buches. Und hier auch seine Kraft und Wahrheit und seine ganze Ironie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der wiederkehrende Christus
RICARDA HUCH
Der wiederkehrende Christus, Ricarda Huch
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988682239
Quelle: https://www.google.de/books/edition/Der_Fall_Deruga_Der_wiederkehrende_Chris/W5wHAQAAIAAJ?hl=de&gbpv=1&dq=ricarda+huch+der+wiederkehrende+christus&pg=PA3&printsec=frontcover.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
I1
II7
III12
IV.. 16
V.. 23
VI28
VII34
VIII40
IX.. 42
X.. 46
XI52
XII58
XIII66
XIV.. 74
XV.. 78
XVI87
XVII91
XVIII94
XIX.. 102
XX.. 106
XXI110
XXII113
XXIII116
XXIV.. 120
XXV.. 125
XXVI129
XXVII135
XXVIII139
XXIX.. 152
XXX.. 163
XXI167
XXXII170
XXXIII174
XXXIV.. 178
I
Auf einer Bank an dem rasch und energisch fließenden Strome, der die große Stadt teilte, saßen zwei Männer, von denen der jüngere, die Augen bohrend auf das unregelmäßige Gesicht des anderen geheftet, das Bild eines Gottesreiches entrollte, wie er sich ein solches vorstellte. Er sprach von den Schrecken des Krieges, der Lieblichkeit des Friedens, davon, dass die meisten Zwistigkeiten auf Missverständnissen beruhten, dass die Menschen aufgeklärt, besser unterrichtet werden müssten, dass die Erde ausreichende Nahrung für alle böte, wenn jeder sich begnügte, und dass es nur darauf ankäme, die Menschen von der Wahrheit dieser Sätze zu überzeugen. "Und was machen wir mit den Bösen?" fragte der andere. "Die vermeintlich Bösen", entgegnete der erste in gereiztem Tone, "sind meist nur schlecht erzogen und schlecht unterrichtet. Wer keine Kameraden zu bösem Tun findet, wer satt und gekleidet ist, wer nichts um sich her sieht, was schändliche Lüste reizt, muss wohl oder übel gut sein."
"Etwas fade, dieses Gute, das du da aufgepäppelt hast", sagte der andere und lachte.
"Du hörst mir nicht aufmerksam zu, Luzius," sagte der erste, "weil du jenen Menschen im Soldatenmantel betrachtest, von dem du wohl weißt, dass er mir widerwärtig ist."
"Du solltest", sagte der, welcher Luzius angeredet wurde, belustigt, "mit deinen Grundsätzen friedfertiger sein. Dieser junge Mann war offenbar früher Offizier und hat jetzt nichts zu tun oder arbeitet gelegentlich. Er sieht arm aus, hält sich aber stolz aufrecht; das gefällt mir."
Er könne nicht begreifen, sagte der Jüngere, warum Luzius etwas gefiele, was eine Folge von Dressur wäre. Übrigens sei natürlich der einzelne, der diesem Stande angehöre oder angehört habe, nicht für dessen Verwerflichkeit verantwortlich zu machen. Obwohl es sichtlich seinen Gefährten ärgerte, fuhr Luzius fort, den jungen Mann zu beobachten, der mit unbeweglichem Ernst, näher am Fluss stehend als die Bank, auf der jene saßen, in den durcheinander wühlenden weißen Schaum starrte. Die Dämmerung, die jetzt fiel, begann ihn zu verhüllen, kaum unterschied man noch die kreuzförmige Narbe, die seine den beiden Beobachtern zugekehrte Wange zeichnete. Immer ungestümer wurde der Südwind, der seit einer Stunde wehte und an dem alten Soldatenmantel riss; die Wellen spritzten so hoch auf, dass zuweilen einige Tropfen die auf der Bank Sitzenden trafen. "Es wird kalt", sagte Luzius, ohne doch aufzustehen. Alle andern Bänke fingen an sich zu leeren, die zahlreichen Spaziergänger zerstreuten sich. Die Bewegung jedoch, die über die nahe bei der Bank mündende, den Fluss überspannende Brücke strömte, ließ nicht nach, nahm vielmehr zu. Durch das Pfeifen des Sturms und das Rauschen der Wellen hindurch hörte man Räderrollen und die scharfen Signale der Autos. Ab und zu orgelten abgerissene Gassenhauermelodien von Karussells dazwischen, die der Wind von einem nahen Platze herübertrug. Dieses gleichmäßige Getöse durchdrang plötzlich ein gellender Schrei: irgendein Unfall musste sich begeben haben. Gleichzeitig, bevor noch recht begriffen werden konnte, was geschehen war, sah man über das Geländer der steinernen Brücke etwas Dunkles ins Wasser fliegen und unmittelbar darauf den Mann im Soldatenmantel zur Rettung in den Strom springen. Ein Autoführer hatte einem Hund, der sich unversehens zwischen die Fahrzeuge gedrängt hatte, ausweichen wollen, wobei seine Maschine an einen Brückenpfeiler anprallte und der einzige Insasse des offenen Wagens herausgeschleudert wurde. Nun aber begab sich etwas Merkwürdiges: der junge Mann schwamm, den Verunglückten nach sich ziehend, ans Ufer, wo sich ihm viele hilfreiche Hände entgegenstreckten. Er selbst, der kaum erschöpft zu sein schien, half dem Geretteten, einem dicken, schwarzhaarigen, unbehilflichen Manne, hatte aber kaum den Juden in ihm erkannt, als er ärgerlich aufschrie: "Zum Teufel auch!" und den eben dem Tode Entronnenen wieder in den Fluss hinunterstieß. Während die Zuschauer zum Teil in Staunen erstarrt dastanden, zum Teil wütend auf den jungen Offizier einschrien, warf sich Luzius, der gleich zu Beginn des Vorfalls aufgesprungen war, in den Strom und rettete den dicken Mann zum zweiten Male. Da sich mehrere Leute anschickten, einen Arzt zu holen, denn der Mann lag bewusstlos da, hob Luzius abwehrend die Hand und sagte, das sei nicht nötig, der Mann lebe und werde sich bald erholen. Er kniete bei ihm nieder, richtete ihn in seinen Armen auf, öffnete ihm den Hemdkragen und drückte sein Gesicht gegen das bewegungslose; nur wenige Minuten vergingen, bis jener die Augen öffnete und sich angsterfüllt umsah. Obwohl er schwerer war als Luzius, trug dieser ihn zur nächsten Bank und wendete sich dann dem jungen Manne zu, der im Begriff war, seinen Mantel, den er abgeworfen hatte, als er ins Wasser sprang, sich wieder umzuhängen. "Schäme dich," sagte er zu ihm, "eine gute Tat, die du unbesonnen tatest, besonnen wieder aufzuheben. Um eines abgeschmackten Vorurteils willen wolltest du zum Mörder werden, hättest du fast nicht nur ein fremdes, sondern auch dein eigenes Leben zugrunde gerichtet. Geh in dich, werde dir bewusst, dass ein Herr über dir ist, dem du verantwortlich bist für dein Denken und Tun. Bitte diesen Mann, den du so gröblich beleidigt hast, um Verzeihung."
Mit dem jungen Manne, der die Ansprache zuerst halb trotzig, halb verlegen anhörte, ging eine Veränderung vor, als er seine dunkelblauen Augen zu dem Fremden aufschlug: er hatte einen solchen Menschen noch nie gesehen. Vor ihm stand ein mittelgroßer, gut gebauter Mann, der im Anfang der dreißiger Jahre sein mochte, mit einem Gesicht, das etwas Wildes und fast Erschreckendes hatte und doch zugleich einen unwiderstehlich hinreißenden Eindruck machte. Der Kopf erschien vielleicht noch größer, als er war, durch den dichten Haarwuchs, der einer Mähne glich, obwohl die Haare nicht lang in den Nacken fielen; sie waren wellig und hatten eine goldbraune Farbe, die an den Spitzen ins Rötliche überging, und kamen dem jungen Offizier in diesem Augenblick wie lodernde Flammen vor. Die Augen standen in seltsamer Verwandtschaft zu den Haaren, indem sie auch goldbraun waren und zuweilen rötliche Funken aus ihnen zu sprühen schienen. Nachdem er mit dem Offizier gesprochen hatte, wandte er sich zu dem Juden: "Danke du ihm, denn er hat dich immerhin aus dem Wasser gezogen, eh er dich wieder hineinwarf." Rasch, als fürchtete er, es könne ihn wieder gereuen, ging der junge Mann dem erhaltenen Befehl gemäß zu dem auf der Bank zitternden Juden hinüber und bot ihm die Hand. "Ich bitte um Verzeihung", sagte er dazu. "Ich habe nichts zu verzeihen, nur zu danken", sagte jener. "Umarmt euch!" befahl Luzius, und die beiden taten es. "Nun aber", fuhr er fort, "ist es Zeit, dass wir uns erwärmen und stärken, denn das Wasser ist noch sehr kalt; ich werde euch in ein gemütliches Gastzimmer führen, wo wir um ein offenes Feuer sitzen und uns trocknen können." Nicht dreihundert Schritte entfernt sei das Gasthaus Zur alten Brücke, eine zwischen den hohen neuen Häusern versunkene und übersehene Herberge, wo nur wenig Menschen verkehrten; dort wohne er mit seinem Freunde. "Kommst du nicht mit uns, Lindor?" sagte er zu seinem ersten Gefährten, der während des ganzen Auftritts hinter der Bank gestanden und nur mit dem dicken Juden einige Worte gewechselt hatte. Das hübsche feine Gesicht des Angeredeten leuchtete auf, indem er zu Luzius hinüberging und sich an seinen Arm hängte. "Ich dachte, du hättest mich vergessen", sagte er, schmollend wie ein Mädchen. Inzwischen war auch der Autoführer herangehinkt und begleitete die vier; er hatte an verschiedenen Stellen Schmerzen, die Luzius, nachdem er ihn flüchtig untersucht hatte, auf unerhebliche Quetschungen zurückführte.
In der Herberge war dem seltsamen Gast ein niedriges, braungetäfeltes Zimmer eingeräumt worden. Es befand sich darin ein altertümlicher Herd, auf dem jetzt ein offenes Feuer unter dem Kamin brannte, dessen lautlos bewegte Flammen huschende Lichter über die braungebeizten Wände, Tische und Stühle warfen. Die Gesellschaft richtete sich behaglich ein, die, welche im Wasser gewesen waren, zogen ihre Oberkleidung aus, hüllten sich in Decken, die der Wirt brachte, und ließen inzwischen das nasse Zeug am Feuer trocknen. Der Jude, welcher sich Simonetti nannte, blickte unschlüssig auf seinen Chauffeur und fragte ihn, ob er sich wohl genug fühle, um nach Hause zu fahren? Ja, sagte der, er empfinde kaum noch Schmerzen; aber die Maschine sei entzwei und für die nächsten Tage nicht benutzbar. Das sei ja ganz gleichgültig, sagte Simonetti, er solle jetzt irgendein Auto nehmen und heimfahren, damit die Familie sich wegen seines langen Ausbleibens nicht beunruhige. "Ich kann mich so schnell noch nicht von euch trennen", setzte er hinzu, indem er Luzius und die beiden andern mit einem zaghaften Lächeln ansah. Der Wagenführer schien damit nicht ganz zufrieden zu sein. "Was soll ich denn sagen," meinte er zögernd, "wenn die Gnädige fragt, wann Sie heimkommen?"
"Ihr Mann sei wohlauf," sagte Luzius bestimmt, "sie solle Gott dafür danken; er verbringe diese Nacht mit denen, die ihn gerettet hätten!" Er sah, während der Chauffeur sich unter mehreren Verbeugungen verabschiedete, Simonetti mit einem schelmischen Lächeln des Einverständnisses an. Sein Gesicht schien, solange es in Ruhe war, älter als seine Jahre und oft düster; seine Freundlichkeit, die manchmal die eines hohen Herrn war, der sich zu Untergebenen herablässt, manchmal die eines von Liebe berauschten Herzens, ließ es von Jugend, ja von Kindlichkeit glänzen. "Nun wollen wir", sagte er, "ein festliches Mahl auftischen lassen und uns miteinander erfreuen." Sie setzten sich um den Tisch, der mit Brot, Fleisch und Salat versehen wurde, auch zeigte sich, dass ein guter, feuriger Wein vorhanden war. "Das erste Glas", sagte Simonetti zu Luzius, "sei Ihnen gebracht und den Glücklichen, die Sie begleiten dürfen." Er erkundigte sich, ob Luzius Arzt wäre; er schiene sich ja vortrefflich auf die Behandlung von Kranken zu verstehen. "Ich bin kein Arzt in dem Sinne, dass ich die Heilkunde an Universitäten studiert hätte", sagte Luzius. "Mir ist eine gewisse Heilkraft angeboren, die ich hauptsächlich zugunsten der Armen anwende. So hielt es meine Mutter, von der ich die Gabe geerbt habe. Oft sagte sie: Die Armen haben keinen Arzt, der sich vertraulich an ihr Bett setzt und mit ganzer Seele ihre Qualen zu lindern sucht. Er denkt gemeinhin: für die paar Groschen, die sie mir einbringen, brauche ich sie nur mit der linken Hand zu kurieren. Die Reichen, du lieber Gott! wenn sie nicht zuweilen eine rechtschaffene Krankheit bekämen, würden sie sich vollends einbilden, Götter zu sein, und sind sie auch krank, so haben die Ärzte allerhand Kunststückchen bereit, damit sie es nicht spüren." – "Es ist wohl etwas daran," sagte Simonetti; "aber ist es die Schuld der Reichen, dass sie reich sind?" Die anderen lachten. "So wenig und so viel, wie es die Schuld der Armen ist, dass sie arm sind", sagte der Offizier namens Roland. "Sei ruhig," sagte Luzius, "ich helfe dem, der mich braucht; aber es sind zumeist Arme, die mich brauchen, und nur Arme können mich begleiten." So wäre er einmal froh, arm zu sein, sagte Roland, denn er könne sich nicht mehr von Luzius trennen. Wenn es Luzius recht wäre, möchte er sich ihm und Lindor anschließen und sie nie mehr verlassen. Er erzählte, dass er Offizier gewesen sei und nach der Auflösung des Heeres, um Geld zu verdienen, sich einem Bauern vermietet habe. Dies raue Leben sei ihm während der ersten Jahre ganz nach dem Sinne gewesen, ein wärmeres Verhältnis habe sich aber zwischen ihm und seinem Brotgeber nicht gebildet. Mit dem verdienten Gelde habe er, da man ihm das geraten, und da er zum Handwerk mehr Lust als zur Wissenschaft gehabt habe, die Töpferei erlernt, auch wohl Geschmack daran gefunden, ohne dass es ihn ganz befriedige. Als Bauernknecht habe er vielerlei erlernt, könne überall zugreifen und sein Brot verdienen, je nachdem die Gelegenheit es erfordere.
Der hübsche junge Mann, welcher Lindor hieß, hatte Chemie studiert, das Studium aber nicht vollenden können, weil seine Eltern zu den vielen gehörten, die ihr Vermögen einbüßten. Er beherrschte aber die französische und die englische Sprache und konnte sich mit Unterricht und Übersetzungen durchbringen. Er selbst, sagte Luzius, nähme für seine Heilungen keine Bezahlung an, außer dass dankbare Leute ihn und seine Gefährten etwa zum Essen einlüden oder ihm etwas Essbares brächten; aber er sei gelernter Schmied, wie sein Vater einer gewesen sei, und übe das aus, wenn es je einmal nötig sei. Es habe ihnen noch nie am Notwendigen gefehlt, sogar überflüssig hätten sie, um anderen mitzuteilen.
Ja, sagte Simonetti, sie wären gut daran, er verstände sich nur auf seine kaufmännischen Geschäfte. Er sähe auch nicht ein, warum man durchaus arm sein müsse, um zu ihnen zu gehören. "Was mich persönlich betrifft," sagte er, "so glaube ich, dass ich nirgends glücklicher sein könnte als in eurer Gesellschaft. Ich habe seit achtzehn Jahren ein eigenes Haus und Familie, aber ich habe mich noch nicht einen Augenblick zu Hause gefühlt. Meine Kinder hingen an mir, solange sie klein waren, jetzt bekümmern sie sich nur um mich, wenn sie Geld brauchen, sonst aber gehen sie mit meiner Frau ihren Gesellschaften, Theatervorstellungen und sonstigen Vergnügungen nach, ohne mich zu fragen oder mich dabei haben zu wollen. Auch begreife ich es wohl, denn ich kann in der Tat in Gesellschaft niemandem Ehre machen; ich weiß nicht, woran es liegt, aber es gelingt mir nicht, wie ein feiner Herr auszusehen, obgleich ich bei einem guten Schneider arbeiten lasse. Es ist kein Staat mit mir zu machen, ich sehe das ein. Zu Hause fürchte ich immer, etwas Ungehöriges zu sagen oder zu tun, gegen irgendeine Regel zu verstoßen oder sonst meiner Familie im Wege zu sein. Ihr würdet nicht nach dem Schnitt meines Rocks und meiner guten Manieren fragen, wenn ihr wüsstet, dass ich es gut meine." Luzius lachte und streichelte mit der Hand über sein dichtes, schwarzes Haar. "Wirf deinen Geldsack von dir und geh mit uns," sagte er, "dein Herz wird leicht und fröhlich werden." Der dicke Mann warf sich unruhig auf seinem Stuhle hin und her. "Ich weiß nicht, wie Sie es machen," sagte er, "Sie tauschen mir das Herz im Leibe und die Worte im Munde um. Die vernünftigsten Erwägungen verkehren sich in den einzigen Wunsch, in Ihrer Nähe zu bleiben."
Lass die vernünftigen Erwägungen hören", sagte Luzius lustig. "Gewiss hat der Aufsichtsrat irgendeiner Bank morgen eine Sitzung!" fügte Lindor hinzu. "Ganz richtig!" rief Simonetti eifrig aus. "Durch den Krach der Schwindelbank Brahmaputra sind mehrere hochsolide Institute an den Rand des Verderbens gezogen. Morgen um zehn ist eine Zusammenkunft von Finanzleuten, die Auskunftsmittel finden wollen."
"Lass die Toten ihre Toten begraben", sagte Luzius. "Die Haare auf dem Haupte dieser bedrohten Bankherren sind alle gezählt, die hohe Finanz wird auch ohne dich dafür sorgen, dass keins verloren geht."
"Ja, wenn jeder so denken wollte", sagte Simonetti kleinlaut. "Sie rechnen auf mich. Und an der Bank Brahmaputra sind mehrere Selbstmorde vorgefallen."
"Alle Achtung!" rief Roland. "Wie es in den Tunnel des Zuchthauses hineinging, sprangen sie rasch aus dem Zuge."
"Nun, sie haben aufrichtig betrogen", meinte Lindor. "Wären die Menschen nicht durch Habgier verblendet, würde ihnen keiner in die Falle gegangen sein. Ihre Opfer sind nicht zu beklagen. Eure sogenannten honetten Geldgeschäfte sind viel gefährlicher, weil sie den Schein der Ehrlichkeit haben. Sie verpesten das ganze Volk."
Simonetti wurde bleich. "Wo ist da die Grenze zu ziehen?" fragte er. "An diesen Geschäften nimmt doch ein jeder teil und Sie auch. Sie können doch nicht, wie die Bauern, Ihre verdienten Taler in einen Strumpf stecken!" – "Wenn ich Taler zurückzulegen hätte," antwortete Lindor, "würde ich sie lieber wie ein Bauer in den Strumpf stecken, als wie ein Jude sie auf Wucher leihen." Luzius trat zwischen die Streitenden. "Beleidigt euch nicht," sagte er, "oder, wenn ihr es getan habt, verzeiht und versöhnt euch. Misstraut euch aber nicht. Wer mir nachfolgt, ist guten Willens und fehlt nicht absichtlich. Freunde, wir haben den Geldgeschäften abgesagt, daran wollen wir uns genügen lassen und an der Hoffnung, zuweilen einen neuen Freund zu gewinnen wie diesen guten, feigen Simonetti." Simonetti umarmte ihn. "Was brauche ich Mut?" sagte er. "Du hast für uns alle. Wenn ihr mich haben wollt, bin ich euer. Mein Vermögen vermache ich meiner Frau und den Kindern, meine Person werden sie nicht vermissen." Man drückte ihm die Hand und bewunderte ihn, nannte ihn neckend den heiligen Franziskus. Ihn bedrückte nur das eine, dass er nichts könne, um sich sein Brot zu verdienen; aber Luzius meinte, das würde sich finden; inzwischen wurde er zum Säckelmeister ernannt.
II
Aus Düren war die französische Besatzung abgezogen. Luzius und die Seinen waren etwa noch drei Stunden von der Stadt entfernt, als ihnen ein Mann entgegenkam, der aus Krankheit oder Schwäche sich mühsam fortschleppte. "Was fehlt dir?" sprach Luzius ihn an. "Hast du Hunger? Ist dir schlecht? Ich will dir helfen." Der Mann spähte mit seinen matten, flachen Augen ängstlich wie nach einem Ausweg herum; die vier Männer schienen ihm eher Schrecken als Beruhigung einzuflößen; allein wie einer, der sich widerstandslos ergibt, weil er muss, sagte er: "Ich kann nicht weiter, ich habe seit zwei Tagen nichts gegessen." Sein graues Gesicht bedeckte sich mit Schweiß, er wäre zusammengebrochen, wenn die Männer ihn nicht unter den Arm gefasst und gestützt hätten. Simonetti förderte ein Stück Brot aus der Tasche und reichte es dem Ausgehungerten, der es verschlang. "Das genügt nicht", sagte Luzius. "Wir wollen nun doch in eins jener Bauernhäuser gehen und dort Mittag halten." Der Mann erschrak und beteuerte, dass er weitergehen könne, er sei gewohnt, mit wenigem auszukommen. "Man sollte meinen," sagte Luzius, indem er den Mann fest ansah, "du wärest ein Räuber oder Mörder und müsstest fürchten, von den Menschen erkannt zu werden."
"Ein Räuber oder Mörder bin ich nicht," entgegnete der Mann, "aber mehr gehasst und verfolgt als ein solcher. Warum? Weil ich arm bin. Es wäre den Armen besser, man bände ihren Neugeborenen einen Stein um den Hals und ersäufte sie, wenn es ihnen noch nicht weh tut."
"Man verfolgt niemanden, weil er arm ist", sagte Roland. "Du wirst es mit den Franzosen gehalten haben, und nun sie fort sind, fürchtest du Rache." – "Lasst ihn sprechen, wenn er gegessen und sich ausgeruht hat", sagte Luzius, indem er einen Seitenpfad einschlug, der zu einem ansehnlichen Gehöft führte. Der Mann, den er ansprach, lehnte die Zumutung, fünf fremde Männer zu bewirten, mit lautem Hohn ab. "Nun die fremden Heuschrecken abgezogen sind," sagte er, "möchten die einheimischen wegfressen, was jene übriggelassen haben. Ich wollte, der Teufel holte alle miteinander." – "Das ist ein sehr unchristlicher Wunsch," sagte Luzius, "oder wäre es, wenn es dir Ernst wäre. Habe ich gesagt, dass wir umsonst essen wollen? Wir wollen dir gern für deine Bewirtung leisten, was sie wert ist, in Geld oder in Arbeit." Damit stellte er seine Gefährten vor und zählte auf, was sie verständen; er selbst sei Arzt, und der Bauer könne ihm bringen, was er an Kranken, Mensch oder Vieh, im Hause habe. Während der Mann feindselig schwieg, kam ein etwa zehnjähriger kleiner Bursche gelaufen und sagte, die Mutter sei krank, der Herr solle doch zur kranken Mutter kommen und sehen, ob er ihr helfen könne. "Gute Ärzte pflegen nicht wie Wegelagerer von Haus zu Haus zu ziehen", brummte der Mann; der Knabe indessen sagte errötend, indem er seine klaren blauen Augen bittend auf den Fremden heftete, sein Vater sei unwirsch aus Kummer über die Krankheit der Mutter, meine es jedoch nicht böse. Er führte Luzius in ein helles und nettes Zimmer, wo eine noch junge, aber leidend aussehende Frau im Bette lag. "Es fehlt Euch wenigstens nicht an guter Pflege", sagte Luzius, indem er sich umsah und die roten Geranien bemerkte, die in grüngestrichenen Kästen am Fenster standen. "Das tut alles mein Fritz," sagte die Frau, "und er wird euch Herren auch ein Mittagessen herrichten, wenn ihr nur ein Viertelstündchen Geduld habt."
"Hilfstruppen sind gekommen", rief Roland draußen. "Weise uns an, Bübchen, dass wir das Festessen zur Genesung bereiten." Das Bübchen sprang hierhin und dorthin, griff unter die Hühner, zeigte, wo die Eier zu finden wären, und lief in Keller und Stall, hinterdrein laut scheltend der Vater, der einmal sogar dem Eifrigen, als er seiner habhaft wurde, schnell eine Ohrfeige versetzte, ohne dass dieser sich stören ließ. Indessen saß Luzius am Bette der Frau und ließ sich von ihr erzählen, dass sie vor einem Jahre an der Grippe erkrankt sei und, als sie wieder habe aufstehen wollen, die Beine nicht mehr habe gebrauchen können. Einmal wäre ein Arzt dagewesen, dessen Arznei aber nicht geholfen hätte; ihr Mann sei leider geizig, wolle nichts von den Ärzten wissen und sehe scheel auf sie wegen der Krankheit, als ob sie sie mutwillig auf sich gezogen hätte. Trotzdem habe sie es gut, weil der Fritz für sie sorge und immer um sie her sei, so dass ihr oft zumute sei, als wäre sie im Himmel. "Ich bin froh," sagte sie, "dass ich den widrigen Mann habe; denn es ist doch wohl nicht Gottes Wille, dass wir auf Erden schon im Himmel leben." Luzius sagte: "Er lässt die, die ihn lieb haben, schon auf Erden davon kosten. Der Himmel ist mit der Erde verbunden durch unsichtbare Gänge, und an manchem Ort, wo es niemand ahnt, sind Pforten, die hineinführen. Da weht eine süßere Luft von den himmlischen Gärten, und es mag sein, dass eine solche hier in der Nähe ist." Wenn dem so wäre, sagte die Frau, wolle sie sich darein schicken, krank zu sein und auch zu sterben, obwohl sie gern dem Fritz zur Seite bleiben möchte, wenigstens bis er ein Jüngling wäre. Sie könne ja aber vielleicht nach dem Tode noch um ihn sein, und vielleicht werde auch ihr Mann wieder zugänglicher, wenn er keine Kranke mehr zu unterhalten habe. "Es ist Gottes Wille," sagte Luzius, "dass Ihr wieder gesund und kräftig werdet; deshalb hat er mich dieses Weges geführt." Damit ging er ans Fenster und rief dem Bübchen zu, es müsse warmes Wasser gerichtet werden zu einem Bad für die Mutter, worauf es wie der Blitz in die Küche sprang und dann mit Lindors Hilfe eine Badewanne in das Schlafzimmer schleppte. Nachdem er sie abgestellt hatte, lief der Kleine zu Luzius hin, der am Bett saß, und fragte: "Soll ich gleich für die Mutter mit decken?" – "Tu das," sagte Luzius, "und eile dich mit dem Essen, damit sie gleich zu Tisch gehen kann, wenn sie aufsteht." Der Junge verbeugte sich und flog davon. "Ich weiß es, ich weiß es," sagte er zu Simonetti, der eben die geschälten Kartoffeln in einen großen Topf schüttete, "ihr seid Engel, obwohl ihr keine Flügel habt, und obwohl ich mir als Kind die Engel ganz anders vorstellte." Er maß Simonetti mit einem interessiert forschenden Blick. "Aber die Engel, die zu Abraham kamen, hatten auch keine Flügel, denn er merkte zuerst nicht, dass es Engel waren." Der Bauer, welcher dies gehört hatte, während er einige Kartoffeln aus dem Kochtopf wieder herauszufischen suchte, rief zornig: "Ha, nicht genug, dass ich eine Kranke mitschleppen muss, macht ihr mir auch einen Narren aus dem Jungen!" Fritz schüttelte seine Ohrfeige ab, warf die vom Vater zurückgenommenen Kartoffeln wieder in den Topf und sagte zu Simonetti: "Du musst ihn entschuldigen, er hat zu viel zu arbeiten, um die Heilige Schrift zu lesen. Mutter sagt, er sei wie Martha und meine es nicht böse." Dann trug er Simonetti leise auf, am Herd stehen zu bleiben und die Kartoffeln vor dem Vater zu schützen, und lief wie ein Pfeil in den Garten, um jungen Salat unter der Hülle hervorzusuchen.
Als das Essen aufgetragen auf dem langen eichenen Tische stand, tat sich die Tür auf, und die Frau trat mit langsamen, noch ein wenig unsicheren Schritten herein. Sie hatte um den Halsausschnitt ihres schwarzwollenen Kleides ein seidenes Tüchlein gelegt, die großen blauen Augen strahlten, und ihr Mund lächelte lustig. Sie gab allen, die sich auf sie zu drängten, die Hand und sagte: "Gott hat ein Wunder an mir getan. Ich gelobe es hier vor euch allen, dass ich es nie vergessen werde, sondern versuchen will, es zu verdienen." Der Bauer, der im ersten Augenblick vor Staunen starr dagestanden hatte, brach in lautes Grollen aus: "Habe ich's nicht immer gesagt, wenn du nur wolltest, könntest du? Es war ja kein äußerlicher Schaden da. Die Überraschung hättest du mir auch eher machen können." Die Frau errötete vor Unwillen, und es sprang ihr ein heftiges Wort auf die Lippen, aber sie bezwang sich und sagte ruhig, indem sie sich zu Luzius wendete: "Der eine sieht es so, der andre so an. Ich weiß, was ich Ihnen verdanke, und Sie haben's ja nicht um den Habedank getan. Nun setzt euch alle und nehmt vorlieb!" Als jeder einen Platz gefunden hatte, antwortete Luzius: "Ihr sagt sehr richtig, dass es auf unsere Augen ankommt, in welcher Welt wir leben. Die Welt ist nicht wie ein Kieselstein, den man auf den Tisch wirft, und da liegt er und so ist er, sondern ein großer Teppich, an dem alle mit weben." "Ja," rief die Frau lebhaft aus, "das ist wahr, und sonderbar ist es, wie die rechten Farben immer zur Hand sind, wenn man sie brauchen will, und dass zuletzt die herrlichen Bilder entstehen, obwohl viel faule und dumme Weber dabei sind, denen nichts Gescheites einfällt." Ihre leuchtenden Augen folgten dem kleinen Fritz, der behände um den Tisch lief und die Gläser und Teller füllte. Einzig der Bauer und der fremde Arbeiter beteiligten sich nicht an dem Gespräch, das zwischen den andern fröhlich hin und her ging.
Als sie aufbrechen wollten, sagte Luzius zu der Frau, er und seine Begleiter hätten nichts nötig, wenn sie aber dem Fremden eine Wegzehrung mitgeben wollte, so möchte das angebracht sein, da er vielleicht nicht so bald Arbeit fände. "Ich habe ihm schon allerlei in ein Bündel geschnürt," sagte die Frau, "um Euretwillen. Er hats wohl mit den Franzosen und den Kommunisten gehalten, und seine Freundin kann ich nicht sein, aber zur Richterin hat mich ja Gott auch nicht bestellt. Und wenn er noch einen oder ein paar Tage bei uns bleiben und auf dem Hof arbeiten will, so soll er nicht wohlgelitten, aber doch gelitten sein." Indessen der Mann wollte nicht, drängte vielmehr zum Weggehen. Simonetti zog vor dem Abschied das Bürschchen in eine Ecke und steckte ihm etwas Zuckerwerk zu. "Es ist für dich," sagte er, als Fritz damit in seine Tasche fuhr, "Erwachsene machen sich nichts daraus."
"Oh," sagte der Kleine, "so erwachsen ist meine Mutter nicht. Ich spare aber nicht nur für sie, sondern auch für die Pferde, die Kühe mögen es nicht." Er lud seinen Freund ein, mit ihm in den Stall zu kommen, und gestand ihm, er würde sehr glücklich sein, wenn der Meister das Vieh segnete, aber er habe nicht den Mut, ihn darum zu bitten. Simonetti vermittelte den Wunsch, worauf Luzius durch den Stall ging, wo es warm und wohlig war, Schwalben aus und ein flogen, und das leise in seinem Futter rauschende Vieh bewunderte und streichelte.
"Wichtiger wäre es gewesen," sagte Roland, als sie wieder auf dem schmalen Pfade der Landstraße dahingingen, "du hättest dem andern Vieh, dem Bauern, einen nachdrücklichen Segen gegeben, damit er der Frau und dem Buben das Leben nicht so sauer macht." Luzius meinte lachend, die beiden hätten das Übergewicht, sie könnten ihn allein in den Himmel schleppen. Der Arbeiter hielt sich an Lindor, weil er gemerkt hatte, dass der kein Gegner der Franzosen war. Er war nun einigermaßen gekräftigt und bedankte sich. "Ich habe nichts," sagte er, im Begriff sich zu verabschieden, "womit ich mich erkenntlich zeigen könnte als einen Rat. Der ist: geht nicht in die Stadt, heute nicht und morgen nicht." Man drang in ihn, sich näher zu erklären, er zögerte und sagte endlich: sie hätten ihm vielleicht das Leben gerettet, deshalb halte er sich verpflichtet, zu sprechen. Er habe einen Franzosen gekannt, dem er öfter gefällig gewesen sei und der deshalb Vertrauen zu ihm gehabt hätte. Eines Tages sei der Franzose, der sehr auf Weiber erpicht gewesen sei, von einem schönen Mädchen zu einem Stelldichein in ein Wäldchen vor der Stadt bestellt gewesen; als er hingekommen sei, hätten ihn zwei maskierte Männer überfallen und verprügelt, dass er halbtot liegen geblieben sei. Er habe nie herausbekommen, wer die beiden gewesen wären, und sich geschworen, an der ganzen Stadt Rache zu nehmen. Noch heute oder am folgenden Tage werde er vom Flugzeug eine neue Art von Bomben auf die Stadt herunterwerfen, die in Frankreich erfunden wäre, wodurch die Luft vergiftet würde, so dass die Menschen im weiten Umkreise durch Erstickung oder im Wahnsinn sterben würden, umso mehr, als sie unvorbereitet wären. "Bist du deshalb heute fortgegangen, um dem Gruss deines Freundes und Beschützers auszuweichen?" fragte Roland. Der Mann zuckte die Achseln. "Ich hätte mich auch sonst nicht halten können", sagte er. "Wer sich von den Franzosen hat anstellen lassen, den verfolgen sie jetzt wie einen tollen Hund." – "Du wirst wissen, warum sie dich verfolgen", entgegnete Roland scharf. Luzius schnitt den Wortwechsel ab, indem er dem Arbeiter Lebewohl sagte, der dann den rüstig Zuschreitenden noch eine Warnung nachrief.
III
Es war zwischen vier und fünf Uhr, als die Wanderer am äußersten Rande von Düren ankamen. Ein Durcheinanderschwirren von Karussellmusik zeigte an, dass ein Jahrmarkt gefeiert wurde; der Abzug der Franzosen sollte auf die verschiedenste Art und jedem Geschmack entsprechend festlich begangen werden. Bald erklang es: Puppchen, du bist mein Augenstern, und gleich daneben: Auf in den Kampf, Torero! Die abgerissenen und durcheinanderschwirrenden Melodien verbanden sich wunderlich zu einem anregenden Getöse. Ein großer Platz zwischen den Ausläufern hässlicher Vorstadtstraßen, auf einer Seite in freies Feld mündend, war erfüllt von Menschen, die trotz der Kälte auf und ab wogten. Die blutrot untergehende Sonne warf Bündel von Licht auf die mit dünnem Schnee bedeckten, schon frühlingsgrünen Bäume, die den Platz umgaben, und auf die flittergeschmückten Dächer der Karussells, so dass eine verzauberte Stadt unter einem Behang von Kostbarkeiten zu glitzern schien. Junge Burschen und alte Frauen trugen Büschel von roten und blauen Luftbällen, kletternde Affen und gellende Instrumente umher. Ein knisterndes Feuer, von Bänken umgeben, wo Bier und Kaffee gereicht wurde, schien farbensprühend mit dem starken Strom des letzten Sonnenlichtes wetteifern zu wollen. Simonetti steuerte mit Vergnügen und Sachkenntnis mitten in das Gedränge, sich unbewusst im Takte der jeweilig aufgefassten Musik bewegend. Er war ein Kinderfreund und erinnerte sich der glücklichen Zeit, wo er seine eigenen Kinder, die damals noch anhänglich und dankbar gewesen waren, auf die Spielplätze geführt hatte. "Seht", sagte er, "den Kranz sehnsüchtiger armer Kinder um die Karussells herum; das ist die Melancholie der Jahrmärkte." – "Mich stimmen Jahrmärkte überhaupt traurig," sagte Lindor, "und ich habe sie deshalb immer gemieden." – "Auch im Zuschauen liegt ein Vergnügen", sagte Luzius. "Ihr müsst nicht meinen, dass es nur auf den Genuss ankomme. Das Wünschen und Hoffen ist ein großer Reiz, und was wir nicht haben können, erstattet uns die Phantasie hundertmal so schön." – "Sie sehen aber mager und traurig aus", meinte Simonetti, nicht überzeugt. Lindor sagte, die Phantasie sei wie das Feuer und könne leuchten, aber auch verzehren. Indessen erwog Simonetti, der außer der gemeinsamen Kasse heimlich eigenes Geld bei sich trug, ob er davon nehmen sollte, um die Kinder fahren zu lassen, zögerte aber aus Besorgnis, es möchte auffallen, denn die Gefährten hatten ihn schon geneckt, weil er immer die Taschen voll Süßigkeiten hatte. Da legte Luzius ihm die Hand auf die Schulter und sagte: "Heute, weil wir gerade hier sind, soll ein Kinderglückstag sein. Verdienen wir rasch ein paar Groschen und lassen wir die Kleinen fahren." Er habe, sagte er, schon einen Zahnwehkranken mit verbundener Backe bemerkt, den wolle er heilen, Lindor könne aus den Händen wahrsagen und die anderen je nach Erfindungsgabe treiben, was sie wollten. Nach einer halben Stunde fanden sie sich wieder zusammen: Roland hatte in den Schießbuden nach dem Ziele geschossen, gewonnen und seine Gewinne wieder verkauft; seine Augen blitzten, er war von einer Schar Knaben umgeben, die ihn anstaunten. Lindor hatte das meiste Geld. "Sie würden ihr Hemd geben, um etwas über sich selbst und ihre Zukunft zu hören", sagte er mit einem Zuge von Verachtung um die schmalen Lippen. "Du hast ihnen wohl keine Rosen auf den Pfad gestreut?" fragte Roland lachend. "Ich habe ihnen gesagt, dass sie heute einer großen Gefahr entgehen würden", sagte Lindor. Simonetti war schon mitten im Betriebe; während er und Luzius die Kinder in die Wagen und auf die Pferde setzten und aufpassten, dass jedes an die Reihe kam, kauften Roland und Lindor Pfeffernüsse, Schokolade und dergleichen, damit auch diese Sehnsucht befriedigt werde. Die Kinder begriffen schnell, dass Wundermänner erschienen waren, um sie zu beglücken, und drängten sich zu ihnen, wie von einem Magneten gezogen. Ein Teil war bescheiden und geduldig, zufrieden fast mehr über die Gegenwart der hilfreichen Männer als über das Karussellfahren; andere drängten sich lärmend und knuffend vor und streckten zudringlich die Hände hin. "Gerade diese", sagte Simonetti entrüstet, "haben Geld und zu essen genug und möchten den Armen noch ihr Almosen abdringen, um doppelt zu genießen." Auch halbelegante Pärchen mit verschwärmten Gesichtern wollten fahren, je mehr die Dunkelheit hereinbrach, und schoben die Kinder beiseite. Einer der Karussellführer, ein hinkender und schielender Bursche, der gewandt wie ein Affe über die Wagen und Pferde im vollen Schwunge leicht hin gaukelte, setzte sich mit Luzius ins Einvernehmen. "Ich sehe," sagte er, "dass Sie den armen Kindern eine Freude bereiten wollen. Das ist schön, das ist nobel, und darum will ich Ihnen entgegenkommen. Ich nehme von Ihnen nur fünf Pfennige anstatt zehn, der Meister, der ein Mann ohne Grundsätze ist, braucht es nicht zu erfahren." – "Du bist ein guter Bursche," entgegnete Luzius, "dafür will ich dir grade Augen machen, wenn du willst." – "Danke, danke," rief der Mensch, "die wollen wir lieber lassen, wie sie sind. Die Mädchen laufen mir nach wie die Narren, meine Mutter meint, das Schielen habe es ihnen angetan, und sie muss es ja wissen." Unterdessen war es ganz dunkel geworden, die Feuer in der Mitte des Platzes schlugen mit scharlachroter Flamme empor, wenn die Umsitzenden Holzscheite oder Tannenzapfen und Mist hineinwarfen. Plötzlich fasste Roland Luzius am Arm, der eben ein kleines Mädchen aus dem langsamer fahrenden Karussell hob, und flüsterte ihm zu: "Ein Flugzeug! Der Mann hat recht gehabt!" Luzius trat vom Karussell weg und folgte Rolands Blick nach dem Himmel. Lindor und Simonetti sahen nichts; man hörte auch nichts, wie angestrengt man auch hinhorchte. "Der Lärm ist zu groß," sagte Roland; "außerdem sollen sie in Frankreich lautlos gleitende Flugzeuge erfunden haben. Das würde beweisen, dass es wirklich ein Franzose ist." – "Du hast Augen wie ein Falk," sagte Luzius; "aber jetzt habe ich es auch gesehen. Auf jener dunkelgrauen Wolke sieht man die metallenen Schuppen blitzen." Auch die anderen glaubten es nun zu bemerken. "Hat der Mann darin recht gehabt," sagte Lindor, "so wird auch das übrige stimmen. Luzius, Luzius, verhüte das Unglück!" – "Du wirst es doch tun?" bat Simonetti, "denke an die vielen unschuldigen Kinder." Deutlich sahen sie es jetzt aus einer dunklen Wolke, die sich wetterdrohend zusammengezogen hatte, hervorschimmern; der Punkt schien größer zu werden. "Blickt nicht hin," sagte Luzius, "damit die Leute nicht aufmerksam werden; es könnte eine Panik entstehen, die ebenso gefährlich wäre wie das Flugzeug selbst. Beschäftigt euch mit den Kindern, lasst mich allein." Er kniete nieder und verbarg das Gesicht in den Händen; hätte ihn jemand im Gedränge bemerkt, würde er gedacht haben, der Mann suche etwas. Die drei Freunde waren nicht imstande, das Spiel mit den Kindern weiterzutreiben; sie starrten atemlos auf Luzius, der unbeweglich blieb, nur dass sein ganzer Körper sich immer tiefer gegen den Boden zu beugen schien. "Es donnert von ferne", sagte Roland leise. Die andern schüttelten den Kopf; sie hätten nichts gehört und glaubten es nicht. Eine unendlich lange Zeit schien ihnen vergangen zu sein, als Luzius aufstand. "Die Knie zittern mir," sagte Simonetti, auf ihn zugehend; "sind wir tot oder lebendig?" – "Wir leben," sagte Luzius, "jener stürzt ab." – "Er stürzt?" rief Lindor entsetzt. "Du lässt ihn stürzen?" Alle blickten nach der Wolke: man sah den blitzenden Punkt nicht mehr. "Nicht ich tue es," sagte Luzius, "sein böser Wille hat ihn gestürzt." Inzwischen war beim Karussell nach der Entfernung der vier Männer ein Krawall entstanden. Für die zuletzt eingestellten armen Kinder war noch nicht bezahlt worden, ein paar größere Jungen wollten sie gewaltsam entfernen, der Besitzer des Karussells beschimpfte den Schielenden, der das Gesindel zugelassen habe, eine allgemeine Prügelei war im Gange. Durch den Lärm aufmerksam gemacht, wandte Luzius sich um und war mit einem Satz unter den Zeternden. "Ihr Bestien," rief er, "könnt ihr euren Neid und eure Habgier nicht einen Augenblick im Zaume halten!" Er hatte keine sehr starke Stimme, aber sie schwang sich wie ein musikalischer Ton über die andern, die daneben trocken zu Boden fielen. Der Schielende stand mit untergeschlagenen Armen vor seinem Brotherrn und ließ dessen Schimpfreden auf sich niederprasseln. "Ein gutes Gewissen hat eine harte Haut", sagte er lächelnd. "Wer hat sich geärgert? Wer hat sich aufgeregt? Wer hat sich blamiert? Ich bedaure nur, dass diese noblen Herren Zeugen eines so ungebildeten Auftritts werden mussten." Während Simonetti bezahlte, sagte Luzius zu den Kindern, sie sollten eilig heimgehen, es sei ein Gewitter im Anzuge, und ihre Eltern würden sich um sie sorgen. Sie gehorchten, nachdem sie Simonetti umarmt und ihn hatten versprechen lassen, er werde am folgenden Tage wiederkommen. Hörbar rollte jetzt ein Donner im Bogen über den schwarzverhangenen Himmel und erregte allgemeines Erstaunen. Ein Gewitter im Frühling, während noch Schnee lag! "Wir müssen eine Herberge aufsuchen, wenn wir nicht nass werden wollen", sagte Luzius. Lindor ging langsam und warf immer wieder einen Blick nach der Wolke, durch die jetzt weiße Blitze jagten. "Der unglückliche Flieger!" sagte er. "Wo mag er sein? Was mag aus ihm geworden sein?" – "Bedauerst du etwa den französischen Meuchelmörder?" fragte Roland empört. "Wer weiß, ob er feindliche Absichten hatte!" sagte Lindor. "Jener Mann kann auch gelogen haben." Luzius legte seinen Arm um Rolands Schulter und zog ihn mit fort. "Ich bin müde", sagte er; er war in der Tat sehr blass im Gesicht und fast verfallen.
IV
Ein paar Tage später beschloss Luzius, eine große Strumpffabrik zu besuchen, die am Rande der Stadt lag. Er hatte nämlich mehrere der Kinder auf dem Jahrmarkt nach der Beschäftigung ihrer Eltern gefragt und öfters zur Antwort erhalten, sie arbeiteten in Strowischs Strumpffabrik, was sie in einem feierlich stolzen Tone sagten, als wäre vom Hofe eines Monarchen die Rede. Durch Erkundigung erfuhr er leicht, dass Strowisch der reichste Mann Deutschlands, vielleicht Europas, eine höchst bedeutende Persönlichkeit sei, und dass seine Fabriken musterhaft geordnet wären. Die Schilderung aller der Vorzüge Strowischscher Betriebe machte ihn begierig, eine solche Anstalt in Augenschein zu nehmen. Dort ging es gerade an diesem Vormittag unruhig zu im Zusammenhang mit dem Abzuge der Franzosen, indem gegen verschiedene Arbeiter die Beschuldigung erhoben wurde, es mit dem Feinde gehalten zu haben. Ganz frei von diesem Verdacht waren zwei Damen, Frau Heim und ihre Tochter Hero, die überhaupt eine Ausnahmestellung unter den Arbeiterinnen einnahmen. Frau Heim und ihre Tochter sahen sich gezwungen, da sie ihr Vermögen verloren hatten, zu verdienen, und sie ergriffen auf gut Glück die Gelegenheit, die sich ihnen durch gesellschaftliche Beziehungen bot. Verhältnismäßig rasch gewöhnten sie sich an die regelmäßige, ununterbrochene Tätigkeit und wussten sich eine vergleichsweise angenehme Stellung zu schaffen. Frau Heim war eine schöne majestätische Erscheinung mit gleichmäßig ruhigem, etwas kühlem Wesen; sie rückte bald zur Aufseherin einer Gruppe junger Anfängerinnen vor. Ganz von ihr verschieden war Hero, die sich, obwohl ihr, ohne dass sie es wusste, eine sie von den meisten Menschen unterscheidende Würde angeboren war, mit den Arbeitern und Arbeiterinnen freundschaftlich stellte, als wäre sie mit ihnen aufgewachsen, und den Ton traf, der ihr die Herzen gewann. Immer fiel ihr zur rechten Zeit etwas Spaßhaftes ein, womit sie alle ins Lachen brachte, das größte Entzücken aber erregte sie, wenn sie mit wohllautender Stimme, die wie ein Glöckchen durch das Gesurre der Maschinen hindurchläutete, Lieder sang, deren sie unendlich viele wusste. Sie kannte volkstümliche Lieder und die neuesten Berliner Gassenhauer und Wiener Schlager, und sie sang auch Arien mit einem Pathos, das komisch wirken sollte und doch zuweilen rührte. Während die meisten Mädchen mit Begeisterung an ihr hingen, gab es doch auch Neidische und Eifersüchtige, und eine solche war besonders Notburga, allgemein Burgi genannt, ein dunkelhaariges Mädchen von gedrungener Erscheinung und leidenschaftlichem Wesen. Ihre Eifersucht wurde dadurch gesteigert, dass ein Werkmeister, den sie liebte, Hero offensichtliche Huldigungen darbrachte; und der Umstand, dass Hero mit gänzlicher Nichtbeachtung darüber hinwegging, reizte sie nur noch mehr, denn einerseits argwöhnte sie, die gefallsüchtige Feindin wolle ihn dadurch anfeuern, anderseits schien ihr darin eine empörende Verachtung dessen zu liegen, was sie über alles hochhielt und begehrte. Hero, der das Mädchen leidtat, suchte sie durch Freundlichkeit und Scherz zu gewinnen. "Sie könnten ein hübsches Mädchen sein, Burgi," pflegte sie zu ihr zu sagen, "wenn Sie nicht ein so böses Gesicht machten. Venus selbst hätte wie eine Kröte ausgesehen, wenn sie ihren Mund so aufgeworfen hätte, wie Sie es tun." Dabei versuchte sie mit ihrem lieblichen Gesicht Burgi nachzumachen, was sich so lustig ausnahm,