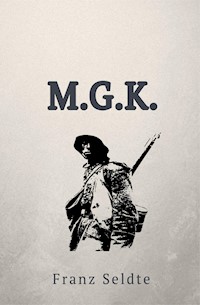
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Nüchtern, ohne Pathos aber mit drastischen Darstellungen berichtet der Autor vom Kriegsalltag einer Maschinengewehrkompanie während des Ersten Weltkrieges. Die anfängliche Begeisterung wich bereits bald einer großen Ernüchterung. Aus dem Vorhaben Weihnachten 1914 zu Hause zu sein wurde nichts. Alles kam anders. Stattdessen versucht jeder auf seine Weise mit den täglichen blutigen Bildern fertig zu werden und erfüllt trotzdem seine Pflicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
M.G.K.
von
Franz Seldte
_______
Erstmals erschienen im:
K. F. Koehler Verlag,
Leipzig, 1929
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2018 Klarwelt-Verlag, Leipzig
ISBN: 978-3-96559-123-3.
www.klarweltverlag.de
Auf den Opfern und auf den Waffen beruht der Sieg
Franz Seldte
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
1. Kapitel. Mobil!
2. Kapitel. Die Schutzschilde
3. Kapitel. Vormarsch.
4. Kapitel. Löwen
5. Kapitel. Feuertaufe
6. Kapitel. Le Cateau.
7. Kapitel. Marsch auf Paris.
8. Kapitel. Die Schlacht vor Paris (Marne-Schlacht)
9. Kapitel. Der Rückzug.
10. Kapitel. An der Aisne.
11. Kapitel. Die Arras-Schlacht.
12. Kapitel. Weihnachten bei der MGK.
13. Kapitel. Der Neujahrsbefehl.
Vorwort
Neuenmühle, den 9. November 1928.
Post Letzlingerheide (Kr. Gardelegen)
Mein lieber Junge!
Es ist heute gar nicht wie November. Nicht wie ein neunter November, der seit 1918 für uns immer wie in ein trübes Grau getaucht zu sein scheint.
Auf meinen Schreibtisch und auf die alten Kriegspapiere malt die Mittagssonne eines späten Indianersommers ihre Kringel, und draußen vor meinem Fenster tobt Ihr Jungens froh und lärmend durch den Garten und versucht Euch am stählernen Reck.
Ich will an diesem freien Sonnabend und Sonntag mein Kriegsbuch abschließen. Es soll nun doch gedruckt werden, lesbar sein für andere, obwohl es eigentlich für Dich allein geschrieben und gedacht war.
Heute, wo ich Euch so fröhlich tummeln sehe, kommt mir der Gedanke, ob Ihr Jungens uns, Eure Väter, einstmals überhaupt verstehen werdet. Uns, die wir aus der Welt des Friedens und des Krieges kommen, aus einer Welt, die Ihr ja nicht kennt.
Wird nicht eine große Lücke des Nichtverstehens zwischen unseren Generationen klaffen, ein tiefes Tal, ohne dessen überbrücken es einen gesunden Fortgang deutscher Geschichte nicht geben kann?
Ich will mit versuchen zu helfen, diese Brücke zu schlagen.
Wenn Ihr wisst, was wir im Kriege erlebten und wie uns dieses Erleben traf und formte, dann werdet Ihr uns später doch verstehen.
Dann reichen sich doch zwei Geschlechter die Hände.
Ihr müsst Euer Leben selber leben, Eure Erfahrungen selbst machen. Die Unzulänglichkeit dieser Erde und dieses Lebens lässt es wohl nicht zu, Erfahrungen und Wissen richtig zu vererben und so zu vermitteln, dass man das Lebensrezeptbuch der Vorfahren ohne weiteres benützen und weiterleben könnte. Neue Menschen müssen neue, eigene Erfahrungen gewinnen.
Trotzdem bemüht sich immer wieder jede ältere, starke Generation, der kommenden zu helfen.
In China gibt es ein Buch der Weisheit, in das Könige viertausend Jahre lang das Erlebte mit klugen Folgerungen zu Nutz und Frommen ihrer Nachfahren eintragen ließen. Und so hohes Ansehen gewann dieses geheimnisvolle Buch, dass die Japaner vor dem Ausbruch des Russisch-Japanischen Krieges seine alten Weisheiten befragten.
Uns Deutschen hinterließ Bismarck seine Gedanken und Erinnerungen mit der Widmung: „Den Söhnen und Enkeln zum Verständnis der Vergangenheit und zur Lehre für die Zukunft“
Mein Kriegsbuch, mein lieber Junge, ist kein Buch der Weisheit, kein Roman, keine schwungvolle Dichtung.
Es ist der Bericht von dem, was wir draußen in vier Jahren erlebten.
Es ist nichts Sentimentales und Nachträgliches hineingeheimnist worden.
Es ist ein Auszug aus meinen Kriegsbriefen, aus den Befehlsbüchern der Maschinengewehrkompanie des Infanterieregiments Altmark und aus meinem Tagebuch.
Manchmal kostete es große Mühe und Überwindung, sich dazu zu zwingen, täglich und nächtlich seine Eintragungen zu machen. Aber wenn Müdigkeit und Erschöpfung sich auflehnten, die Stichpunkte niederzuschreiben, dann habe ich daran gedacht, dass vor Jahren einmal ein junger Geschäftsreisender auch abends und nachts so manchmal todmüde die Zähne zusammenbeißen und die Augen aufreißen musste, um sich zu zwingen, seiner Firma den täglichen Reisebericht und die Aufträge zu überschreiben.
Das alles wirst Du sehen, wenn Du einmal einen Blick in die Briefe, Skizzen, Karten und Papiere wirfst, die in den Kriegskoffern und -kisten wohl gebündelt liegen. Genauso wie Du noch in den Archiven der Firma die handschriftlich geschriebenen Briefe und Geschäftsbücher Deines Großvaters und Urgroßvaters nachlesen kannst.
Das Wort Firma, mein lieber Junge, ist ja in unserer Familie immer ein bestimmter und bestimmender Begriff gewesen. Über Erziehung und Werdegang stand das Wort „Firma“ wie unser Schicksal, und es wird auch über Deinem Leben stehen.
Das begleitete mich auch im Kriege, und Familie und Altmärker Blut taten das ihrige.
Davon kann man sich nicht frei machen, und lächelnd wirst Du einmal später empfinden, dass vielleicht ein Kapitel Kriegsbericht etwas von einem Geschäftsbericht der Firma an sich hat. Dann wirst Du aber auch wohl weiter die Wandlung merken, die in diesen vier Kriegsjahren in uns Frontsoldaten vor sich ging. Wir Reservisten oder Aktiven des Feldheeres von 1914 standen mitten im Leben. Wir waren gediente Soldaten und hatten unsern Lebensberuf. Wir setzten voll unsere Kräfte ein, mit klarem Blick Gewinn und Verlust erwägend. Mit vollem Empfinden dessen, was wir beim Ausrücken in den Verteidigungskrieg in der Heimat zurückließen.
Wir waren bis Ende 1914 von der großen deutschen Begeisterung getragen. Wir begriffen Anfang 1915, dass die Begeisterung verflogen war und die Pflicht als oberster Begriff an ihre Stelle zu treten hatte.
Und dann — nach der großen Sommeschlacht — wurden wir die harten Frontsoldaten, die vollendeten Beherrscher der Kriegsmaterie, deren Einblicke, Sorgen, Zweifel und eigene Ansichten schon damals jene innere Wandlung vorbereiteten, die uns in der Nachkriegszeit zum bewussten deutschen Staatsbürger werden ließ.
Der Krieg ist ganz anders gewesen, als wir ihn uns gedacht hatten.
Wir gingen mit Schwung hinein. Wir wollten siegen und wir wollten Weihnachten 1914 wieder in der Heimat sein. Alles ganz einfach gedacht.
Es ist alles anders gekommen.
Der Krieg hat uns Frontsoldaten bis ins Mark getroffen, aber er hat uns nicht gebrochen.
Er konnte es auch nicht, denn wir waren zwar seine Söhne, aber auch seine Meister.
Er konnte uns nicht zerbrechen, denn durch ihn sind wir Frontsoldaten ja erst zu dem geworden, was und wie wir sind — durch ihn: den Vater aller Dinge.
Wir Frontsoldaten haben den Krieg bestanden.
Der Krieg ist uns zum Erlebnis geworden. Der Krieg und die Kameradschaft.
Der Krieg hat uns Frontsoldaten zu neuen Menschen, zu einem Volk im Volke gemacht.
Wir, die wir seine ganzen Schrecken kennengelernt haben, wollen keinen neuen Krieg. Aber wir sind bereit, wenn es sein muss, mit der Waffe unser Vaterland zu verteidigen und seinem Lebensrecht Geltung zu verschaffen.
Solange die Front stand, war Deutschland frei und frei vom Feinde. Deutschland wird wieder frei sein, wenn das deutsche Volk seinen Frontsoldaten vertraut — und der deutschen Jugend.
Gott sei mit Dir!
Dein Vater.
1. Kapitel. Mobil!
Von St. Marien schlug die Turmuhr 4 Uhr morgens. Die Augustsonne kam hoch, und das Licht der elektrischen Lampen verblasste im Kontor. Helmuth Stahl schob den Sessel zurück und ging langsam an das offene Fenster.
Der Ausschnitt der gegenüberliegenden Dächer ließ ein gutes Stück Himmel frei, und in diesem atlasblauen Morgenhimmel standen scharf und nah die beiden Doppeltürme des Domes.
Hell und klar zeigten die großen, goldenen Zeiger der Turmuhr die Stunde. Auf den beiden Turmspitzen spielten die goldenen Wetterfahnen im leichten Winde, drehten so gleichmäßig ab und schwenkten ein, als wenn sie eine wohleinexerzierte Infanterierotte wären, und die zackigen Fahnenspitzen grüßten wie zwei funkelnde Morgensterne den Hinaufschauenden.
Durch das offene Fenster schlug die frische Morgenkühle in den Raum hinein, und von der Gasse wurde das anschwellende Summen des Marktes, auf dem die Händler ihre Stände aufbauten, hinaufgetragen.
Stahl kehrte an seinen Arbeitsplatz zurück.
Vor ihm lagen die Geheimbücher der Firma über die letzte Geschäftsbilanz, die mit dem 1. Juli befriedigend abschloss. Vor ihm stand die Kasse und vor ihm lagen geschlossen die letzten Briefe, die ein Mann schreibt, wenn er in den Krieg geht.
Stahl stützte das Kinn auf die Faust und sann.
Es geht heute in den Krieg. Das bisherige bürgerliche Leben ist abgeschlossen, und ein neues Konto wird eröffnet. Was wird dieses neue Konto an Eintragungen aufweisen? Abgeschlossen ist das bürgerliche Konto des Kaufmannslebens. Jetzt gibt es kein Festangebot für die Zukunft. Freibleibend, dieses kaufmännische Wort hat einen neuen, geheimnisvollen Sinn erhalten. Heute Mittag wird die Verladung des Infanterieregiments Altmark beginnen. Und dabei ist auch seine Maschinengewehrkompanie, und noch früher wird mit einem Sonderauftrag der Leutnant Stahl, also er selbst, mit seinen Waffenmeistergehilfen dem Regiment voraus nach Westen, nach Essen zu Krupp fahren. Helmuth Stahl schlug die Bücher zu. Legte sie und die Briefe in das Geheimfach des doppeltürigen Geldschrankes, schloss das Hauptschloss mit dem Steckschlüssel, richtete die beiden Drehschlösser und legte den altertümlichen Sicherungsriegel vor.
Als er das gewichtige Schlüsselbund abzog, sah er auf den mattglänzenden Stahlplatten des Schrankes sein Spiegelbild. Sah die langen, braunen Reitstiefel, die weiten Reitbeinkleider, den Uniformrock und dachte an den Gegensatz von Kaufmann und Soldat und daran, dass drei Kaufmannsgenerationen der Familie Stahl diesen alten Geldschrank geöffnet und geschlossen hatten.
Würde eine vierte Generation ihn dereinst benützen? Würde es das letzte Mal sein, dass er ihn selbst schloss?
Stahl füllte mit einem tiefen, langen Atemzug die Brust und umfasste mit einem Blick sein altes Privatkontor.
Vaters Bild, Fabrikbilder, Geschäfts- und Ehrendiplome und das große Doppelpult, an dem sie alle gesessen. Auch seine alte Mutter.
Und nun wird von morgen ab wiederum die kluge alte Frau dort sitzen und ihr gegenüber die junge Frau Stahl, seine Frau, Gerta. Und wieder, wie schon einmal, wird die Leitung der Firma in Frauenhänden liegen.
Herrgott im Himmel, schütze sie. Schütze sie und die Kinder!
In der Kehle kam ihm etwas hoch. Nicht weich werden. Noch einmal sah er ringsum und ging dann ruhigen Schrittes hinaus.
Er schritt langsam die Treppen hinunter durch die langen Gänge der Drogen- und Lagerböden bis zum Erdgeschoss in die Maschinenräume und in den großen Destilliersaal, wo die beiden großen Viertausender aufgestellt waren, um Kräuter und Öle zu destillieren. Dieser Raum mit seinen Apparaten war sein Stolz. Er hatte ihn selbst entworfen nach den Vorbildern der großen elsässischen Brennereien.
Stahl klopfte mit dem Knöchel gegen die blitzende, kupferne Rundung. Die Brennblasen waren voll beschickt und für die Arbeit fertig.
Der frische Duft der Pfefferminze erfüllte die Fabrik, begleitet, gewürzt von jenem eigentümlich starken Drogenaroma, ohne das sich Stahl Haus und Hof, Fabrik und Apotheke von Kindheit an nicht denken konnte.
Bilder der Jugend, Bilder der Vergangenheit stiegen auf.
Herrgott, wie schnell die Folge der Jahre.
Harte Kaufmannslehre, frohe Studentenjahre, fremde Stellungen im Inland und Ausland, Reisetätigkeit und dann die sieben Jahre nach des Vaters und des Bruders Tod, und harte Aufbauarbeit, bis die Firma wieder oben war. Nach diesen schweren Jahren sollten nun schönere kommen. So hatten er und Frau Gerta geplant. Neben der Berufsarbeit wieder mehr Sport und Bücher, Reisen und Berg- und Skifahrten. Ja, so hatten sie gedacht, ferienfroh im schönen Egern am Tegernsee, bergfroh in den Ötztalern, wo sie das Telegramm erreicht hatte: „Drohender Kriegszustand !“
Die wenigen Tage nach der Rückkehr waren vorbeigerast. Mobilmachung. Beschleunigter Abschluss der Jahresbilanz der Firma und die Beratungen: Wie stellen wir uns auf die Zukunft ein, wenn alle kriegsdienstpflichtigen Männer der Firma ins Feld gehen?
„Sollen denn alle meine vier Jungens ins Feld gehen! Können wir nicht einen für die Firma dabehalten?“
„Nein, Mutter“, hatte Helmuth Stahl auch für seine Brüder mit geantwortet, „wir wissen, wie schwer ihr Frauen daran tragt, aber von uns kann keiner zurückbleiben, wenn der Kaiser ruft. Mutter, wir sind nun einmal Altmärker. Stahls haben schon unter den Brandenburgern und Hohenzollern gefochten. Wir haben Altmärkerblut in uns. Wir sind nicht nur Potsdamer Wachtparade und Sommerleutnants. Wir müssen mit. Und, Mutter, wir sind ja Weihnachten spätestens wieder zurück.“
Das alles war gestern Abend, als die alte Frau Doktor Stahl in ihrer Wohnung die Familie noch einmal versammelt hatte, noch einmal durchgesprochen worden. Dann hatte sich Stahl von Frau Gerta auf eine kurze Stunde beurlaubt, um seine letzten Sachen oben im Büro zu ordnen.
Daraus waren Stunden geworden, unbemerkt, bis die alte Uhr von St. Marien ihn gemahnt hatte. —
Durch den Fabrikraum hallten Schritte. Das alte Faktotum Meister Jakobs trat auf Stahl zu.
„Na, Jakobs, so früh schon auf? Sie sollten noch in den Federn liegen. Wenn wir weg sind, wartet aus euch viel Arbeit und auf Ihre Schulter, lieber Jakobs, wird ein schwerer Sack von Mühe gelegt — Und Verzollung sicher Brutto für Netto.“
„Ich weiß, Herr Helmuth — entschuldigen — Herr Leutnant heißt es ja jetzt. Aber haben Sie keine Sorge. Ich verlasse die Damen nicht. Wir werden schon alles in Schuss halten, bis Sie wiederkommen.“
Stahl fasste des Alten Schulter.
„Ich weiß es, lieber Jakobs. Wir bleiben zusammen, auch wenn wir räumlich getrennt sind“ — Stahl musste lachen — „nun haben Sie ja reichlich Gelegenheit, Ihren Altmärker Dickschädel als Fabrikleiter für die Firma einzusetzen. — Ich will jetzt hinaufgehen und noch zwei Stunden schlafen. Ich habe über den Büchern die Zeit vergessen. Wir sehen uns wohl noch, wenn nachher die Reise losgeht. Und wenn es auch dieses Mal auf eine ernste Tour geht — ich denke doch, dass wir in einigen Monaten zurück sein werden.“ „Jawoll, Herr Leutnant, ich meine auch, Sie werden schon wiederkommen. Aber mancher wird nicht wiederkommen, und ob es so schnell geht, das weiß man nicht. Wir wollen es hoffen.“
Als Stahl oben im Vorderhaus seine Wohnung erreichte, war er nicht im Geringsten müde, sondern eher überwach. Er überlegte, ob es noch Zweck hätte, das Bett aufzusuchen. Dann aber sagte er sich, dass wohl die nächsten Tage viel Arbeit und wenig Schlaf bringen würden, und entkleidete sich in seinem Turnzimmer im Vorraum.
Leise ging er durch das Kinderzimmer und spürte den feinen, leichten Atem seiner beiden Töchter, als er sich über die kleinen Schläfer beugte. Dann trat er in das gemeinschaftliche Schlafzimmer.
Die Lampe am Bett seiner Frau brannte. Frau Gerta war eingeschlafen und das Buch, in dem sie gelesen, war ihren Händen entglitten. Stahl sah auf die Schlafende, dann hob er das Buch auf, das offen am Boden lag.
Es zeigte die letzte Seite von „Kim“, und Stahls Blick fiel auf die Schlussworte: „Er kreuzte die Hände auf seinem Schoß und lächelte, wie ein Mensch lächeln mag, der Erlösung gewonnen hat für sich und die, die er liebt.“
Das Wort berührte ihn seltsam.
Reglos stand er lange und sann darüber nach.
Dann löschte er das Licht. —
2. Kapitel. Die Schutzschilde
Durch die Stille des heißen Sommernachmittags erscholl plötzlich eine schmetternde Trompetenfanfare: So leben wir, so leben wir!
Erstaunt sahen einige Köpfe aus den Fenstern der Straße in Jülich, in der das Generalkommando des Armeekorps lag. Um die Ecke bog ein Auto, das sich um das mächtig große Schild „Straße gesperrt“ nicht kümmerte, sondern bei dem großen Hause vorfuhr, dessen Kommandoflagge den Standort des Generalkommandos anzeigte.
Oben öffnete sich ein Fenster, ein Stabsoffizier sah empört heraus: „Was ist denn das für ein unerhörter Lärm?“
Leutnant Stahl, der als Beifahrer neben dem Lenker saß, sprang vom Sitz herunter und verbeugte sich mit äußerlich höflicher Miene gegen das strenge Gesicht da oben: „Ich darf mich sofort melden.“
Während er aber die blaue weiche Manövermütze mit dem Helm vertauschte, brummte er zur Freude seiner beiden Maschinengewehrmänner: „Wenig feiner Empfang da oben. Der innere Krieg hat ebenso seine Schärfen. Erst schießen sie uns bei Brandenburg als feindliches Goldauto an, dann haben wir die Schlacht mit dem Benzinoberleutnant, und nun begrüßen sie hier die vornehmen Vertreter der Maschinengewehrkompanie in dieser Tonart. Kinder, ich glaube, ihr macht ein Maschinengewehr klar und heizt die Pistolen schon langsam an, während ich oben die friedlichen Verhandlungen führe.“
Stahl hatte sich nicht geirrt. Zuerst begrüßte ihn das Donnerwetter eines Generalstabsoffiziers wegen des unerlaubten Vorfahrens. Als er jedoch kurzen Bericht erstattete und sich den Standort seines Truppenteils für die Weiterfahrt erbat, wurden die hinzugetretenen Stabsoffiziere sehr interessiert und liebenswürdig und luden ihn zu einer Tasse Kaffee ein.
Nachdem Stahl die Regimentsquartiere in Loverich und Floverich erfahren hatte, drängte es ihn, weiterzukommen.
Beim Durchfahren einer kleinen Ortschaft zeigte Albis plötzlich auf einen großen Torweg: „Herr Leutnant, da liegen ja woll die schweren Fußer?“
„Donnerwetter, das ist ja sogar die zweite Batterie, bei der mein Bruder steht“, rief Stahl.
Stahls Bruder, der Artillerist, war aber nicht im Quartier, sondern mit einer Furagekolonne unterwegs. Stahl hinterließ Grüße für den Bruder und für die Batteriekameraden, mit denen er früher zusammen Hockey gespielt hatte.
Bei Abenddämmerung erreichte der Wagen Loverich. Die Posten verlangten die Parole, von der natürlich die Autofahrer keine Ahnung hatten. Obwohl es Mannschaften des eigenen Regiments waren, ließ man sie nicht passieren, und erst als der Infanteriekompanieführer nach einem sehr frischen Gespräch zwischen Posten und Autobesatzung herbeigerufen war, konnte man weiterfahren.
Auf dem Kirchhof des Dorfes war gerade Appell der Maschinengewehrkompanie.
Die bekannte Stimme des Hauptmanns Seebach knarrte herüber: „Ich bitte mir aus, Jungs, dass die Schützen auch nach den Anstrengungen des Marsches sich tadellos in Waffenpflege und Haltung führen, und dass die Maschinengewehrkompanie ihr altes Renommee hochhält. — Wegtreten! — — Feldwebel Bach !“
Während die Kompanie wegtrat und der Kompaniefeldwebel sich vor dem Hauptmann aufbauen wollte, ließ Stahl gewaltig die Hupe tönen.
Sofort war die ganze Kompanie wie ein Bienenschwarm um den Wagen versammelt und begrüßte mit Hurra die Ankömmlinge.
„Ein Maschinengewehroffizier, zwei Waffenmeistergehilfen und Schutzschilde zur Stelle“, meldete Stahl.
„Na, habt ihr eure Klempnerarbeit fertig? Wir freuen uns sehr, dass Sie richtig angekommen sind. Seien Sie herzlich im Kreise der Familie willkommen“
Die beiden Leutnants Redern und Rose waren hinzugetreten und ließen die Schutzschilde sofort herausnehmen und auspacken. Alles war aufs höchste gespannt, teils neugierig, teils skeptisch. Inzwischen war der Waffenmeister Dicksch zur Übernahme herangekommen und ging mit seinen beiden wiedergewonnenen Gehilfen an das Verpassen der Schilde und an die Verteilung auf die einzelnen Maschinengewehre.
Die Schilde passten bis auf Kleinigkeiten ausgezeichnet. Bei dem Verpassen am Gewehr aber zeigte sich erst, aus welchem zähen Stahl sie bestanden. Obwohl das Kruppwerk besonders gute Feilen und Durchschläge für den zähen Chromnickelstahl mitgegeben hatte, arbeitete die Waffenmeisterei, unterstützt von Wielands Feldschmiede, die halbe Nacht, bis der letzte Schild exakt am Gewehr saß.
In der Zwischenzeit übernahm Leutnant Stahl seinen Zug, den bis dahin der älteste Vizefeldwebel Jäckel vertretungsweise geführt hatte. Darauf besuchte er die Pferde im Stall, sprach mit den Pferdeburschen und Gefechtsordonnanzen, revidierte sein Gepäck und fand Menschen, Tiere und Dinge, wie es sich bei den Preußen gehört, in bester Ordnung.
Stahl hatte sich gerade in dem ihm zugewiesenen freundlichen Bürgerquartier gewaschen, rasiert und wieder menschlich gemacht, als sein Kompaniekamerad Leutnant Rose mit dem Feldartilleristen Leutnant Landmann erschien, um ihn zum gemeinschaftlichen Abendbrot abzuholen.
Die drei Leutnants standen sich persönlich nahe. Stahl kannte Rose durch seine Übungen beim Regiment. Landmann war der Sohn einer Freundin von Stahls Mutter.
So hatten sie viel Gemeinsames und hatten sich viel zu erzählen. Zuerst berichteten Rose und Landmann über den Ausmarsch ihrer Truppenteile aus der alten lieben Garnison. Stahl hörte sinnend zu. Das hatte er ja genau so erlebt.
Dann sprachen sie über ihre Familien, über den Abschied, über Brüder und Verwandte, die alle mit der gleichen Begeisterung zu den Fahnen geeilt waren.
Die Dunkelheit war schnell hereingebrochen.
Sie saßen auf der überdachten Terrasse von Roses Quartier. Die Zigarren glühten auf, und vor ihnen stand das Glas, gefüllt mit der Spende des Quartierwirtes, mit köstlichem deutschem Rheinwein.
„Und nun, mein lieber Landmann“, sagte Rose, „jetzt müssen Sie entschuldigen als Artillerist, jetzt müssen wir Maschinengewehrleute einmal etwas fachsimpeln. — Unser Stahl kommt nämlich alleine dem Regiment nachkutschiert von einem Spezialauftrag. Dieser Kerl, frech und unverschämt, wie die Reserveoffiziere nun einmal sind, hat sich erlaubt, in letzter Minute noch eine Maschinengewehrerfindung zu machen, hat Schutzschilde entworfen und bei Krupp gebaut und hat die Dinger tatsächlich heute herangeschleift. Ich brenne darauf, zu hören, wie er sie gemacht hat, wie das bei Krupp in diesem Kriegsbetrieb überhaupt noch möglich war, und was er alles während seiner Exkursion erlebt hat.“
„Donnerwetter nochmal“, lachte der Artillerist, „das hört sich ja riesig interessant an. Schießen Sie los, Stahl.“
„Ja, mein lieber Landmann, natürlich ist das interessant. Besonders für einen Artilleristen. So einfach, wie bei euch, wo man bloß einem Jaul ‘ne Kanone an den Schwanz bindet und mit schlechter Marschordnung durch das Manövergelände trottet und der Infanterie das Leben schwer macht, so einfach ist das bei der Intelligenzwaffe, beim Maschinengewehr, nicht.“
Alle drei Leutnants schmunzelten, und Rose trank Stahl zu.
„Na also gut. — Wie Rose weiß, kam mir plötzlich der Gedanke, unsere Maschinengewehre mit leichten zerlegbaren Schutzschilden zu versehen. — Unser famoser Häuptling war sofort dafür, der Regimentskommandeur auch, und der gab mir volle Bewegungsfreiheit. Dr. Streit, unser alter, gemeinsamer Tennisgegner, half mir die Skizzen und ein Pappmodell herstellen, und ich fuhr mit einem Auto nach Berlin, um dort mit den Stahlwerken wegen schneller Anfertigung zu sprechen. Der ganze Chromnickelstahl des Lagers war aber von der österreichischen Heeresleitung gekauft worden. Guter Rat war teuer. Schließlich kam ich darauf, an die Kruppwerke nach Essen ein langes Brieftelegramm zu schicken.
In Berlin erlebte ich durch diese Fahrt einen Mobilmachungstag. Kinder, ich sage euch, es war fabelhaft, es riss einen nur so mit. Unser Auto wurde mit Blumen bombardiert. Man hielt uns wahrscheinlich für ganz was Feines. Meine beiden Maschinengewehrschützen und Gewehrschlosser Albis und Schwarz strahlten vor Begeisterung. Albis hatte seine Trompete mitgenommen, und wenn ich ihn Unter den Linden seine Fanfare „So leben wir, so leben wir“ blasen ließ, dann winkte und jubelte uns alles wie toll zu.
Über Brandenburg und Genthin ging es zur Garnison zurück. Unterwegs kamen wir zum ersten Mal ins feindliche Feuer. Wie ihr wisst, war alles verrückt auf feindliche Spione und Goldautos. Uns schrie ein Bäuerlein an, zu halten, und ballerte zu gleicher Zeit seinen Vorderlader auf unser Auto los. Na, wir haben schnell gehalten, und ich habe ihm sanft eine zur Belehrung geklebt. An der nächsten Station hatten sie die Brücken nachts mit Ochsenketten gesperrt. Ein uralter Major mit Epauletten wie Dachziegel, wehendem Rauschebart und wahrscheinlich Inhaber der Tapferkeitsmedaille aus den Freiheitskriegen, war tief gekränkt, dass wir von seiner Parole keene Ahnung hatten und seine Scheißketten einfach kaputt fuhren. Na, wir kamen also mit heiler Haut durch, und als wir in der Garnison ausgepennt hatten, traf von Krupp das Rücktelegramm ein, dass die Schilde sofort noch gemacht werden könnten, wenn genaue Modelle und Spezialarbeiter mitgebracht würden.
Kinder, da hättet ihr unsern Waffenmeister Dicksch sehen müssen, wie dem die Augen vor Kummer übergingen, dass er nicht selber mitdurfte, sondern seine Assistenten mitgeben musste.
Na und dann ging die Reise los. Ich konnte gerade noch unser wundervolles Liebesmahl und Abschiedsmahl im Regimentskasino mitmachen, und dann saß ich schon im Zug nach dem Westen. In meiner Ungeduld fuhren mir natürlich die Transportzüge mit ihrem 40-Kilometer-Tempo zu langsam, aber Langeweile haben wir doch keinen Augenblick gehabt.
Überall der Jubel und die Liebestätigkeit der Bevölkerung. Kinder, was mussten unsere Leute alles essen und trinken. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass Albis und Schwarz Maschinenschlosser und Mechaniker von Beruf waren, so hätte ich geglaubt, sie wären Rekordfresser einer Jahrmarktbude.
Und dann hatten wir noch einen Riesenspaß dadurch, dass die Militärbehörde uns drei Maschinengewehrmännern nicht einen Extrazug wie sonst jedem gewöhnlichen Bataillon oder jeder einfachen Artillerieabteilung gestellt hatte, sondern dass wir uns nach Essen auf die verschiedenste Art durchwürgen und durchmogeln mussten.
Zuerst fuhren wir mit einem Infanteriebataillon, dann mit einem Pferdetransport, und endlich erwischten wir den Zug der Königshusaren. Donnerwetter, die waren in Stimmung, sag ich euch. Und wisst ihr, wie ich so unter diesen eleganten Bengels saß und mir ihre scharfen Rassegesichter ansah, da empfand ich es immer wieder: Blut und altes Geschlecht ist doch ‘ne Sache.
Und dann Essen und der Industriebezirk. Die Feuer der Hochöfen und Fabriken in der dunklen Sommernacht. Das Leben auf den Bahnhöfen und in den Straßen. Und überall der Jubel der Bevölkerung und der Arbeiter. Besonders bei Krupp selbst. Im Essener Hof gab es für uns Maschinengewehrleute ein picobello Essen nebst Umtrunk und zwei Fürschtenzimmer, wie sich es meine Maschinengewehrmänner in ihren kühnsten Phantasien nicht hatten träumen lassen. Das hättet ihr sehen müssen, Kinder, wie die beiden in ihren blütenweißen Betten unter den roten, seidenen Steppdecken pennten. Und daneben die ausgepackten Tornister und die nägelbeschlagenen Knobelbecher, einfach großartig.
Und dann erst die Arbeit bei Krupp, wo die Lampen der Nachtschicht glühten, Gepoch und Gehämmer und Gesause von Transmissionsriemen zu einer Melodie der Arbeit und der Kraft zusammenklangen, dass wir Maschinengewehrmänner selbst mit davon erfasst wurden — —“
Stahl lehnte sich in seinen Korbsessel zurück. Das Bild des arbeitsdröhnenden Essen sah er noch einmal leibhaftig vor sich. „Großartig“, sagte Rose, „man könnte Sie um dieses Erlebnis beneiden. Prost Kinder! Mensch, Stahl, erzählen Sie weiter.“ „Nun also kurz, wir haben viel gesehen, viel erlebt und verflucht scharf gearbeitet. Die Meister und die Arbeiter der Fahrzeugabteilung, wo unsere Schilde gemacht wurden, stimmten nach den üblichen fachmännischen Bedenken und Erwägungen zu. Wir einigten uns nach einem Vorschlag von fünf Tagen Lieferzeit auf anderthalb bis zwei Tage. Raus aus der feinen neuen feldgrauen Kluft — rin wir dreie in den blauen Monteuranzug, und dann gab‘s nichts zu lachen.
Erst haben wir gemeinsam die richtigen Chromnickelstahlplatten ausgesucht. Danach haben wir sie mit großen Schneidemaschinen nach dem Modell geschnitten und die nötigen Löcher hineingestanzt. Mit heißen Walzen bekamen die flachen Schilde die leicht gewölbte Form. Einmal flogen sie ins Feuer und dann wieder ins Wasser, und sie schrien hell auf und dampften und zischten, als sie danach stundenlang von Spezialarbeitern mit langgestielten Federhämmern hart und zäh geschlagen wurden.
Und ein Tönchen, Kinder, bei der Arbeit, großartig. Wir waren im Nu mit den Ingenieuren, Meistern und Arbeitern ein Herz und eine Seele.
An Schlaf war trotz unserer Fürstenzimmer natürlich nicht viel zu denken. Man hatte ihn vielleicht auch in dieser Spannung gar nicht nötig. Denn was haben wir alles gesehen in den paar Tagen! Auch die Verladung einer 42er Batterie. Ich glaubte erst, mein lieber Landmann, man wollte mir als gelerntem Infanteristen einen Bären aufbinden, als man mir von der Konstruktion und der Munition dieser Dinger erzählte. Aber sie haben ja bei Lüttich recht behalten.
Endlich, das heißt eigentlich rasend schnell, sind wir fertig geworden. Man half uns ein Auto requirieren, packte uns und die feingebündelten Schilde und vom Krupphotel noch einen riesigen Fresskorb hinein, und dann sind wir unter Hurra der Belegschaft losgebraust. Durch das Industriegebiet. Bei Düsseldorf über den Rhein. Dreimal Hurra. Im Breidenbacher Hof Fünf-Uhr-Tee und offizieller Abschied von der Kultur. Dabei leichtes Gefecht mit einem Benzinoberleutnant, der sich nur langsam davon überzeugen ließ, dass man einen Maschinengewehrleutnant und zwei Maschinengewehrschützen natürlich zuerst grüßt. Ich vorher noch an unsern Alten telegraphiert, der mir Jülich als Standquartier des Armeekorps zurückdrahtet. Na, da bin ich dann fein, wie sich das für die Maschinengewehrkompanie Altmark schickt, mit Tätterätä vorgefahren, hab mir den üblichen Anschiss und die Auskunft über euer Verbleiben geholt und sitze nun hier.“
Rose hob den Römer: „Prost, alter Stahl, auf Ihr Wohl! Das haben Sie verdient. Das habt ihr fein gemacht.“
„Ja, Donnerwetter“, nickte Landmann. „Ich glaube, die Idee mit den Schutzschilden kann sich sehr segensreich für euch auswirken.“
„Ich glaube es auch“, sagte Stahl, „ich glaube überhaupt an das Maschinengewehr. Und“, er lächelte zu dem alten Rennreiter Landmann hinüber, „und ich bin auch um des Maschinengewehrs willen und nicht etwa nur wegen der Pferde als Reservetiger zur MGK. gegangen.“
Bis gegen Mitternacht saßen die drei noch zusammen. Sie hatten sich festgeredet, und die Sitzung wäre wohl noch lange nicht aufgehoben worden, wenn nicht schließlich dem Leutnant Landmann ein Meldereiter den Befehl zum Antreten der Artillerie um 3 Uhr morgens gebracht hätte.
Man richtete die alte, aber immer schöne Frage an den Artilleristen: „Wann fahrt ihr morgen früh los?“ Und die Antwort erfolgte satzungsgemäß: „Wir reiten um 3 Uhr ab.“ —
Die drei Kameraden trennten sich mit festem Händedruck. Landmann ging zu seiner Batterie. Stahl nahm den Heimweg über den Parkplatz der Kompanie. Es trieb ihn zu seinen Schutzschilden.
Prüfend strich er über den Stahl und fühlte seine Härte. — Die Schilde waren gut.
3. Kapitel. Vormarsch.
„Verflucht, dieses frühe Werken, es kann einem den ganzen Feldzug verleiden“, brummte Stahl, noch halb schlafend, vor sich hin, um dann laut fortzufahren:
„Herein, wenn‘s kein Schneider ist!“
Es war nicht der erwartete Schütze Bremer, Bursche und Gefechtsordonnanz in einer Person, sondern der Vizefeldwebel Jäckel, der auf einer Meldekarte seinem Zugführer einen tadellos geschriebenen Etat- und Mannschaftsbestand des ersten Zuges übergab.
„Donnerwetter, Jäckel, da haben Sie ja die reine Geschäftsinventur aufgenommen. Danke schön! Haben Sie schon Kaffee getrunken? Kommen Sie mit ran und frühstücken Sie mit. Und vorher, während ich mich wasche, haben Sie die Freundlichkeit, mir das ganze Schauspielerpersonal des ersten Maschinengewehrzuges zu erklären. Bitte kriegen Sie keinen Schreck. Ich pflege morgens zu müllern, aber ich denke, Sie werden schon Menschen in ihrem Urzustande gesehen haben.“
Während nun Stahl einen kurzen Müller-Übungsgang machte und sich in seiner Gummibadewanne kalt mit Hilfe eines großen Schwammes abduschte, stand Jäckel am Fenster und hielt einen begeisterten Bericht, dass der erste Zug der Maschinengewehrkompagnie Altmark aus einem Führer, nämlich dem Leutnant Stahl, aus zwei Maschinengewehrbedienungen, aus soundso viel Reserveschützen, soundso viel Pferden, soundso viel Fahrzeugen usw. bestände.
Dass weiter die tüchtige Kompaniemutter, der Kompaniefeldwebel Bach, ein Ostpreuße, von den Leuten „Der Russe“ genannt, und der in seinem Fache gewaltig tüchtige Fahnenschmied, der Sergeant Wieland, dem ersten Zuge zugeteilt wären.
Stahl hatte an der frischen Weise des Vizefeldwebels, der der erste Gewehrführer des Zuges war, seine helle Freude, und diese Freude steigerte sich, als er nachher vor seinem Zuge stand und sich nach Jäckels Plan jeden einzelnen Mann ansah und sich mit jedem einzelnen, nach Namen, Stand und Familienverhältnissen und Heimatsort fragend, bekannt machte.
Den größten Teil der Unteroffiziere und Mannschaften kannte Stahl schon von seiner letzten Übung aus dem Jahre 1913 her, die er bei der Maschinengewehrkompanie aus dem Truppenübungsplatz abgeleistet hatte.
Es waren alles ausgezeichnete, kräftige norddeutsche Jungen, meist Söhne der engeren Heimat, Altmärker. Und auch die eingezogenen Reservisten schienen sich gut einzupassen.
Der Zugführer sah dann sorgfältig die Geschirre, Fahrzeuge und Ausrüstung der Mannschaft durch, und als er den Eindruck gewonnen hatte, dass alles gut im Schwung war, versammelte er Schützen und Fahrer um sich und sagte ihnen, dass er den Dienst streng, korrekt und gerecht auffassen wolle, dass er in und außer Dienst für jeden da sein wolle und dass er nicht nur Vorgesetzter sein, sondern zu jedem jederzeit in kameradschaftlichem Verhältnis stehen wolle.
Stahl glaubte den richtigen Ton getroffen zu haben, als er Vertrauen und Verständnis in den ruhigen Mienen dieser Männer aus Altmärker Stadt und Land las, und gelobte sich innerlich selbst, alles, was in seinen Kräften stände, für seine Leute zu tun.
Aus diesen Gedanken weckte ihn die scharfe Kommandostimme seines Kameraden, des Leutnant Richard Redern, der den zweiten Zug führte und der älteste der Zugführer war. Redern forderte Meldung des Zuges und teilte ihm mit, dass der Hauptmann befohlen habe, der in der Kompanie jeweilig älteste Offizier hätte beim Antreten die Kompanie zu revidieren und dem Führer zu melden.
5.20 Uhr erschien der Hauptmann, nahm die Meldungen des ältesten Offiziers und den Rapport des Feldwebels entgegen und ließ Punkt 5.30 Uhr antreten, um die Maschinengewehrkompanie in die Marschkolonne des Regiments einzufädeln.
In langem Kriegsmarsche, eingereiht in die Marschordnung laut Divisionsbefehl, zog das Regiment in südlicher Richtung.
Es war ein wundervoller Sommermorgen. Die Frische des Morgens ließ aber unter der aufsteigenden Sonne bald nach, und die noch nicht marschgewohnte Truppe hatte keinen Blick für das taufrische Land, sondern empfand die zunehmende Hitze quälend und war froh, als um 11 Uhr Ortsunterkunft bezogen wurde.
Die Müdigkeit aber war vergessen, als ein deutscher Flieger eine Meldung abwarf, die die Mitteilung vom Siege bei Lunéville brachte. Großer Jubel brauste durch die Reihen.
Nach der Mittagsrast wurden die Schutzschilde hervorgeholt, und die Züge exerzierten zum ersten Male mit ihnen. Hierbei machte man die Erfahrung, dass die Schilde sich trotz ihrer Kleinheit von der Umgebung durch ihre metallische Farbe zu sehr abhoben.
Richard Redern aber bewies, dass er nicht nur ein guter Kroki- und Kartenzeichner war, und ließ die Schilde mit einem buntgemaserten Anstrich versehen. Er traf damit instinktiv die in den letzten Kriegsjahren übliche Aufteilung der Flächen an Fahrzeugen und Geschützen in unregelmäßige farbige Ornamente.
Am Morgen des 13. August, 1.45 Uhr, wurde das Regiment alarmiert und begann, zum Gros gehörend, den Vormarsch über Aachen. Die Sonne meinte es bald wieder besonders gut.
Auf den überfüllten Straßen geht der Marsch. Das Gelände beginnt hügelig zu werden. Der Marsch ist anstrengend, und aufatmend begrüßt die Truppe einen langen Halt von 2 ½ Stunden vor der Stadt. Dann folgt der lange und anstrengende Marsch durch Aachen, wo der kommandierende General des Armeekorps den Vorbeimarsch abnimmt.
Die Bevölkerung Aachens begrüßt begeistert die durchmarschierenden Truppen und überschüttet sie mit Liebesgaben und Blumen. Früchte, Schokolade, Gläser mit Wein werden den Soldaten gereicht. Man muss aufpassen, dass es des Guten nicht zu viel wird, und muss überhaupt Obacht geben. Das wurde dem Leutnant Stahl schnell und eindringlich beigebracht. Beim Reiten auf einer abschüssigen Straße hatte er mehr Augen für die Bevölkerung als auf sein Pferd, und mit einem Male wurde er aus der Begeisterung jäh zur Erde zurückgeführt, als er aus dem Sattel seines hochbeinigen Braunen, der über eine Apfelsinenschale ausrutschte, mit der Verlängerung des Rückens auf dem nicht sehr elastischen Straßenpflaster landete.
Er hörte die Engel im Himmel pfeifen, und es war ihm, als ob die Sonne außer ihrer Wärme auch noch einige Kugelblitze von sich gegeben hätte.
Wäre ihm der Sturz zu Hause passiert, so hätte er sicher alle Viere von sich gestreckt und sich reif für eine Tragbahre empfunden. So aber, angesichts seiner Leute und der jubelnden Bevölkerung, riss er das Pferd hoch, sprang mit einem Satz und mit einem stummen Fluch hinauf und ritt weiter, als ob nichts geschehen wäre.
Als Aachen endlich durchschritten war, kreuzte sich das Regiment mit Truppenteilen, die von Lüttich, das sie erobert, zurückkamen. Man sah in den Marschkolonnen Leute mit leichten Verwundungen und sah auch gefangene Belgier.
Mit starkem Interesse, auch mit einem Anflug von Eifersucht, blickten die frischen Regimenter auf ihre Kameraden, die schon die Feuertaufe hinter sich hatten. Aus den Marschkolonnen flogen von den Altmärkern Rufe und Fragen zu den siegreichen Kameraden hinüber. Vor allem die Frage: „Na, wie war‘s denn?“ Und die Antwort kam zurück: „Das werdet ihr alleene schon früh jenug merken!“ —
Hinter Aachen teilten sich die Straßen. Ein Pionierkommando wies die Wege an, und als Leutnant Stahl die scharfe Stimme des über und über mit Staub bedeckten Pionieroberleutnants veranlasste, näher hinzuschauen, erkannte er in ihm seinen alten Korpsbruder und sein Konsemester Friedrich Wilhelm Keil aus Oker am Harz wieder. Scharf leuchteten aus dem gesunden Gesicht des alten Herrn Kilian die beiden pfündigen Durchzieher. Die scharfe Nase ragte wie immer trotzig in die Luft, und beim Kommandieren rollte die Zunge mit altgewohntem Schlage des Harzer Edelrollers, wie es sich für einen alten Mensursekundanten geziemt.
„Grüß Gott, alter Sankt Kilian!“
„Grüß di Gott, alter Bazi Tobias, und das Leben noch frisch und der altgermanische Durst?“
„Jawoll, altes Konsemester. Schwingt Ihr den Humpen noch wie sunst?“
„Umsunst.“
Lachend trennten sie sich. Wie der Igel zur Zylinderbürste, dachte sich Stahl, passt dieses fröhliche Umtrunkswort in diese gottverdammte, staubige Hitze, wo man nicht Pfungstädter Heiles, sondern Sand in der Kehle hat.
Die Hitze wurde immer drückender, und die Truppe musste einen bemerkbaren Ausfall an Marschkranken abgeben. Rechts und links in den Chausseegräben sah man sie mit geöffnetem Waffenrock liegen. Das Gros marschierte unaufhaltsam vorwärts. Das Ziel für das Regiment waren für heute die drei Orte an der Grenze: Neutral-, Preußisch- und Belgisch-Moresnet.
Belgisch-Moresnet sollte unbedingt vor dem Einmarsch der Feinde besetzt werden und die Marschstraße gesichert sein, weil sich mehrende Anzeichen von der Aufhetzung belgischer Zivilbevölkerung und hinterlistige Franktireurüberfälle auf deutsche Soldaten bemerkbar machten.
Vom Hauptmann, der vorn beim Regimentsstabe ritt, wie es als Kompanieführer der Maschinengewehrkompanie seine Bestimmung war, kam ein Radfahrer, um die beiden Leutnants Stahl und Redern nach vorn zu holen. Beide trabten an der Kolonne vorbei und meldeten sich beim Kompanieführer. Dieser ritt mit ihnen zum Regimentskommandeur vor, und hier bekamen die beiden Maschinengewehroffiziere den Auftrag, mit einer starken Husarenpatrouille nach Belgisch-Moresnet vorauszureiten und das dort in der Nähe befindliche feste Schloss zu besetzen.
Das war der erste kriegerische Auftrag, und den Leutnants wurde es gehörig warm um das Herz, als sie zur Kompanie zurückkehrten und den Befehl und die Führung ihrer Züge ihrem dienstältesten Vizefeldwebel übertragen. Dann wechselten beide die Pferde, befahlen ihre Reitburschen zu sich und begaben sich wieder zum Regimentsstabe. Nach kurzer Zeit trabte ein Halbzug Husaren heran, dessen Führung Leutnant Redern übernahm.
Um Zeit zu gewinnen, ließ Redern trotz der Hitze Trab und Galopp reiten und legte nur die unbedingt nötigen Schrittpausen für die Pferde ein. Rechts der Straße tauchte nach kurzer Zeit das erwartete schlossartige Gebäude auf. Der Führer ließ halten und besprach die Lage. Man kam überein, dass das Schloss im Halbkreis umstellt werden sollte. Mit einer kleinen Patrouille von wenigen Mann sollte der Leutnant Stahl durch das offene Tor einreiten und, falls er das Schloss unbesetzt fände, den Rest der Reiter nachholen.
Als die Umgehung ausgeführt war, wurde den Reitern noch eine kurze Pause zum Verschnaufen gegeben. Dann erklang das Pfeifensignal, der Leutnant Stahl zog die Parabellum-Pistole, seine Husaren legten die Lanzen ein und mit einem scharfen Hurra brachen sie aus dem Hinterhalt heraus auf die Chaussee, scharf rechts ab über die Brücke in das Schloss ein. Vor einer Freitreppe rissen sie die Pferde hoch, und dampfend und schnaubend tanzten die erregten Tiere auf dem Hofe.
Auf die Freitreppe aber traten zwei ältere Männer, von denen der eine ein Verwalter, der zweite der Besitzer sein konnte. Der Leutnant Stahl ritt an die beiden heran und teilte ihnen in kurzer dienstlicher Form mit, dass er laut Befehl den Schlosshof besessen müsse, dass jeder Widerstand zwecklos wäre und die Besitzer sich in die Lage zu finden hätten, widrigenfalls —. Während Stahl diese wohlgesetzte Rede hielt, tänzelte sein Pferd unter ihm herum, und ob er wollte oder nicht, er musste einen Blick auf die Toreinfahrt werfen.
Vor Erstaunen wäre er beinahe vom Gaul gefallen. Denn rechts und links der Schlosseinfahrt standen zwei Schilderhäuser, und vor diesen präsentierten sage und schreibe in der Tracht friderizianischer Grenadiere zwei entsprechend bemalte lebensgroße Holzfiguren das Gewehr. Als er mit einem Ruck seinen Gaul wieder rumgeworfen hatte, sah Stahl in das lächelnde Gesicht des älteren Herrn, der mit freundlicher, ruhiger Stimme sagte: „Herr Leutnant, Sie hätten sich nicht so anstrengen brauchen, ich habe gar nichts gegen Deutschland, mein Schwiegersohn ist selber preußischer Major.“
Einen Augenblick sah Stahl den Redner verblüfft an, dann sprang er vom Gaul herunter, warf seinem Reitburschen Mariechen die Zügel zu, ging die Freitreppe zu dem alten Herrn hinauf, stellte sich vor und sagte: „Nun dann geben Sie uns wenigstens für die schöne Fantasia, die wir Ihnen vorgeritten, einen guten Bügeltrunk.“ Der Besitzer nickte lächelnd Gewähr und führte den Leutnant in ein kühles Jagdzimmer.
Als kurz darauf der Leutnant Redern mit dem Hauptteil der Patrouille erschien, fand er zu seiner Verblüffung einen guten Römer Rheinwein als Friedenstrunk für sich schon bereitstehen. Nachdem noch einer zweiten Flasche der Garaus gemacht war, die Husaren ihre Pferde getränkt und etwas abgefüttert hatten, ritt der Trupp weiter, um nunmehr auch durch Belgisch-Moresnet durchzustoßen und die Straßenkreuzungen zu besetzen und zu sichern.
An einer der Nebenchausseen fanden sie beim Rekognoszieren eine reizende kleine Villa, in der ein deutscher Ingenieur mit Frau und Kindern wohnte. Hier wurden sie zum Kaffee eingeladen und zum Abendbrot. Der gastfreundliche Ingenieur wusste zu berichten, dass die Belgier über einzelne versprengte deutsche Patrouillen unweit Aachen hergefallen seien und sie ermordet hätten.
„Ich weiß nicht, meine Herren, ob Sie Belgien kennen mit seinen zwei Bevölkerungsschichten, den Flamen und den Wallonen. Besonders bei den letzteren handelt es sich um eine einfache, unwissende Industriebevölkerung, fanatisiert und in der Hand des niederen Klerus, der gegen die Deutschen hetzt. In Belgien, dem Land der Kleinwaffenindustrie, hat schon jeder Lausejunge den Browning in der Tasche. Von der Größe des deutschen Heeres haben diese kindlichen Fanatiker keine Ahnung und sie denken mit ihren Revolvern den Vormarsch aufhalten zu können.“
Der Hausherr ließ es sich nicht nehmen, die Abendtafel festlich zu bestellen und fuhr die Offiziere sogar mit dem Auto zum unweit gelegenen Biwakplatz der Kompanie zurück.
Bei Belgisch-Moresnet biwakierte die Truppe zum ersten Mal im Freien. Die Zelte waren aufgeschlagen, die Wachtfeuer lohten und den Maschinengewehroffizieren bot sich das wundervolle Bild eines nächtlichen Heerlagers. Das kleine Offizierszelt hatten die Burschen schon gerichtet, die Schlafsäcke lagen bereit, die Oberkleider wurden abgeworfen, und der Hauptmann gebot Ruhe.
Stahl konnte lange nicht zum Schlaf kommen. Das Schlafen auf knisterndem Stroh war doch noch ungewohnt. Die Geräusche der Nacht, die Tritte der Posten, das Stampfen der an langen Leinen angepflockten Pferde, das Durchscheinen der Lagerfeuer durch die Zeltleinwand und die Eindrücke des ereignisvollen Marsches hielten ihn noch wach. Und dann meldete sich, nachdem die Entspannung einsetzte, doch wieder der alte Herr corpus, und ob er sich auf die rechte oder linke Polarhälfte legte, die Erinnerung des Aachener Steinpflasters sandte ihre zarten Grüße nach.
Die Wachtfeuer sanken herunter, die Pferde wurden ruhiger, und der gute, alte Bordeaux des Ingenieurs gab das seine dazu. Auch Stahl schlief ein. Als um 3 Uhr geweckt wurde, musste er sich besinnen, wo er war, und auf die Frage des Hauptmanns: Was die Herren in dieser ersten Biwakfeldnacht geträumt hätten — da dieses in Erfüllung ginge — zu seiner Schande gestehen, dass er nicht die geringste Spur eines Traumes gehabt habe.
Vielleicht, aber auch nur sehr vielleicht, hatte er etwas freie Magensäure von den guten Weinen des Tages vorher und sicher, aber ganz sicher fühlte er die südliche Verlängerung seines Rückens beim Aufstehen erheblich. Das ging aber schnell vorbei. Der Bursche meldete, dass die Gummibadewanne bereitstände, und Stahl verschwand aus dem Zelt, um mit Unterstützung seines Burschen und zum höchsten Erstaunen des ersten Zuges der Maschinengewehrkompanie sich in Adams Kostüm aus einem Stalleimer mit kaltem Wasser zu bearbeiten und dann der etwas sprachlosen Kompanie einen exakten Müller-Kursus vorzuführen.
Erregte schon der Müller-Kursus die Belustigung der Schützen, so fanden sie für die schwarzbraun gebrannten Knie ihres Zugführers keine Erklärung. Die kurze Wichs, die Samslederne vom Tegernsee, war den Altmärkern unbekannt. Plausibler erschien es ihnen schon, als der kritische Gefreite Meier die Vermutung aussprach, dass Stahls Großmutter vermutlich eine Mulattin gewesen wäre.
Als Leutnant Stahl frisch gebadet und innerlich und äußerlich erneut zum Frühstück im Offizierszelt erscheinen wollte, war dieses längst in seine Bestandteile, sprich Zeltbahnen und Zeltpflöcke, aufgelöst. Die beiden Zugführer, Leutnant Redern und Rose, waren verschwunden, und der Hauptmann fragte mit etwas kühlem Tone, ob der Zug Stahl schon marschbereit stände. Das Frühstück war also eine etwas theoretische Angelegenheit, und Stahl verschwand schleunigst zu seinem Zuge, den zu seiner beruhigenden Freude der Vizefeldwebel Jäckel schon nachgesehen hatte.
Die Züge der Maschinengewehrkompanie formierten sich auf dem Biwakplatz. Die Zugführer standen vor ihren Zügen. Der Dienstälteste, also Redern, meldete dem Hauptmann, der Feldwebel machte Rapport, und 4.15 Uhr erfolgte der Abmarsch in Richtung auf die Maas.
Südlich des Städtchens Visé bei Argenteau war die Maasbrücke von den Belgiern gesprengt worden, aber eine deutsche Pionierkompanie hatte schon eine neue Brücke auf das westliche Ufer geschlagen. Der Marsch ging bei glühender Hitze den Tag hindurch parallel der holländischen Grenze nach Richelle und Argenteau. Hier wurde Ortsbiwak bezogen. Die Bevölkerung aller dieser Orte zeigte sich sehr unruhig. Dumpfer Geschützdonner war den ganzen Tag hörbar und die Kolonnengerüchte wollten wissen, dass bei Lüttich noch um verschiedene Forts gekämpft würde.
In allen Ortschaften sah man abgebrannte Häuser von den Franktireurkämpfen her. Tote Pferde, die in der Hitze schnell auftrieben, mischten ihren bestialischen Geruch mit dem widerlichen Brandgeschmack, der in den Dorfstraßen eingeklemmt saß.
Endlich, schweißtriefend und staubbedeckt, erreichten die Truppen die angewiesenen Quartiere um 2 Uhr mittags. Nur eine Kompanie des dritten Bataillons musste über Argenteau noch weiter marschieren bis auf das westliche Maasufer, um die Brücke gegen Franktireurüberfälle zu sichern. Die Maschinengewehrkompanie erhielt eine schöne Koppel links der Hauptstraße des Dorfes Richelle angewiesen. Essen wurde ausgegeben und man traf alle Anstalten, um nach Möglichkeit Mann und Ross Ruhe zu geben. Aber trotz des herrlichen Sommernachmittages wollte eine rechte Ruhe nicht eintreten. Die Mannschaften wurden scharf angewiesen, nicht allein in den weitverzweigten Gehöften umherzugehen und unbedingt in der Nähe des Biwakplatzes zu bleiben.
Als die glühendste Hitze vorbei war, gingen die Offiziere der Kompanie gemeinsam durch den wohlhabenden Ort. Während sie die Hauptstraße hinunterschritten, hörten sie auf einem Gehöft wilde deutsche Fluche und angstvolles Kreischen von Frauenstimmen. Sie liefen hinzu und fanden deutsche Soldaten einen Misthaufen umschaufelnd, daneben ein paar schreiende belgische Bäuerinnen und vor diesen einige blutgetränkte deutsche Ulanenwaffenröcke.
Einer der Leute meldete, sie hätten das ganze Gehöft durchsucht und unter dem verdächtig frischen feuchten Mist die deutschen Uniformen gefunden. Die Frauen wurden festgenommen und verhört. Es war aber nichts Genaues herauszubringen und man ließ sie wieder frei.
Der deutschen Soldaten hatte sich eine starke Erregung bemächtigt, und auch in der Maschinengewehrkompanie schwirrten die wildesten Gerüchte. Deshalb wurde im Offiziersrate der MGK. beschlossen, zur Ruhe und Sicherheit der Truppe für die Nacht und während des Ortsbiwaks einen Einwohner als Geisel zu nehmen.
Einer der Gewehrführer war ein Unteroffizier der Reserve Böhmen Er erhielt als Neusprachler den Auftrag, eine kurze französische Proklamation zu entwerfen, dass als Garantie für die Sicherheit der Truppe ein angesehener Bürger des Ortes bei der Maschinengewehrkompanie die Nacht zuzubringen hätte. Bliebe die Nacht ruhig, so würde der als Geisel Festgenommene beim Abmarsch ohne weiteres entlassen. Geschähen Überfälle auf deutsche Soldaten, so würde der Mann sofort standrechtlich erschossen.
Ein Offizier, der Leutnant Rose, mit 6 Maschinengewehrschützen und einem Hornisten von der kleinen Kapelle, die sich die Mannschaft der Maschinengewehrkompanie selbst als Marschmusik zusammengestellt hatte, gingen einmal die Dorfstraße hinauf und hinunter. Als die Einwohner aufmerksam geworden waren, blies der Hornist ein Signal, und der Oberlehrer in Feldgrau verlas jetzt nicht mehr seinen Tertianern, sondern einer verbissenen Wallonenbevölkerung einen stilreinen französischen Aufsatz. Darauf wurde der angesehenste Einwohner der Straße, ein Schuhmachermeister, festgenommen. Seine Familie brach in ein Wehgeschrei aus und war nur schwer davon zu überzeugen, dass die Drohung der Proklamation nicht sofort vollstreckt würde. Erst als er den Befehl erhielt, sich warme Oberkleidung und Essen für die Nacht mitzunehmen, begriffen sie, dass man keine sofortige Erschießung beabsichtigte.
Langsam kam die Dämmerung. Der Gewehr- und Waffenappell war vorüber, die Befehle für den nächsten Tag, soweit eingetroffen, wurden ausgegeben, und der Hauptmann erklärte als Abschluss der ganzen Kompanie die allgemeine Lage. Dann flammten wieder die Biwakfeuer auf. Die Mannschaften saßen vor ihren Zelten oder gingen vor diesen im Gespräche auf und ab. Ein Frieden lag über dem Dorfe, als ob es nirgends Krieg gäbe.
Am großen Feuer der Unteroffiziere zwischen der Lagerwache, die die Posten zu stellen und die Ablösung zu regeln hatte, saß der belgische Schuhmachermeister. Es ging ihm nicht schlecht. Die gutmütigen Deutschen gaben ihm zu essen und zu trinken. Nur in einem war seine Bewegungsfreiheit etwas eingeschränkt. Eine solide Pferdeleine war um seine Ferse geknüpft und das andere Ende um einen soliden Baumstamm, und falls er seine diesbezüglichen kleinen oder großen menschlichen Wünsche zu erledigen beabsichtigte, so musste er dieses im 3-m-Radius des deutschen Hanfseiles tun.
Gemütsbewegungen pflegen sich bei vielen Leuten auf die Darmtätigkeit zu legen, und so ging, etwas nervös angeregt, auch unser Schuster ab und zu seine 3-m-Partie und bot, wenn gerade die Wachtfeuer auflohten, manch merkwürdige Silhouette.
Vor dem ersten Hahnenkrähn wurde geweckt. Stahl hatte aus den bisherigen Erlebnissen gelernt. Er ließ sich früher als die anderen Herren durch seinen Burschen wecken und beeilte auch seinen Müller-Kursus. Dann ging er zur Feldküche, mit deren Führer er schon um Tage vorher „einige ernsthafte Worte“ gesprochen hatte, und nun gab es Kaffee und Frühstück nicht nur reichlich und früh genug für die Mannschaften, sondern auch für die Offiziere.





























