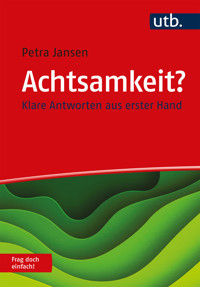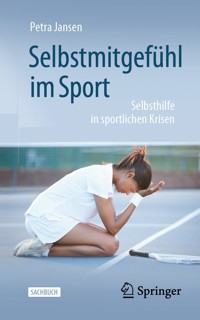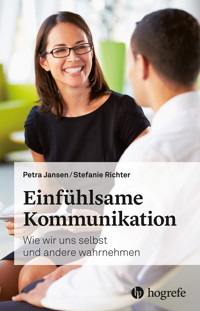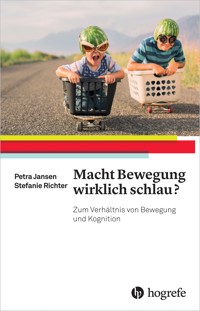
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Medienberichte preisen Bewegung oft als Allheilmittel. Aber abgesehen von den unbestrittenen positiven Effekten auf die Gesundheit: Macht Bewegung wirklich auch noch schlauer? Halten wir uns beispielsweise eine Fussballnationalmannschaft vor Augen - sind diese exzessiv Sport treibenden Spieler automatisch die Schlauesten im Lande? Sollten wir den Schulunterricht schlicht durch den Sportunterricht ersetzen? Die Autorinnen bieten einen differenzierten Überblick über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Einfluss der Bewegung auf die kognitiven Fähigkeiten. Sie zeigen den Effekt von Bewegung und beleuchten dafür unterschiedliche Bereiche: •Bewegung und Alter •Bewegung und Embodiment •Bewegung und Emotion •Bewegung und Schule •andere Faktoren, die die Kognition beeinflussen. «Ich denke, dass das Thema sehr interessant ist und viele Lehrer sich gerade mit der Frage rumschlagen, ob Bewegung und Sport auch für die kognitive Entwicklung der Kinder -förderlich ist. Im deutschsprachigen Raum gibt es meines -Erachtens keine kompetenteren Kolleginnen als die beiden.» Lutz Jäncke
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Macht Bewegung wirklich schlau?
Macht Bewegung wirklich schlau?
Petra Jansen, Stefanie Richter
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Psychologie:
Prof. Dr. Guy Bodenmann, Zürich; Prof. Dr. Lutz Jäncke, Zürich; Prof. Dr. Franz Petermann, Bremen; Prof. Dr. Astrid Schütz, Bamberg; Prof. Dr. Markus Wirtz, Freiburg i. Br.
Petra Jansen
Stefanie Richter
Macht Bewegung wirklich schlau?
Zum Verhältnis von Bewegung und Kognition
Petra Jansen, Prof. Dr.
Institut für Sportwissenschaft
Universität Regensburg
Stefanie Richter, Dr.
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Kopien und Vervielfältigungen zu Lehr- und Unterrichtszwecken, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Psychologie
Länggass-Strasse 76
3000 Bern 9
Schweiz
Tel: +41 31 300 45 00
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.hogrefe.ch
Lektorat: Dr. Susanne Lauri
Bearbeitung: Elke Renz, Stutensee-Spöck
Herstellung: Daniel Berger
Druckvorstufe: punktgenau GmbH, Bühl
Umschlagabbildung: © Andrew Rich by iStockphoto
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Finidr s.r.o., Cˇeský Teˇšín
Printed in Czech Republic
1. Auflage 2016
© 2016 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-95561-2)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-75561-8)
ISBN 978-3-456-85561-5
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus Fabian Grolimund – Mit Kindern lernen (ISBN 9783456756608) © 2012 Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern; © 2016 Hogrefe Verlag, Bern
Inhalt
Einleitung
1 Ausgangslage
1.1 Bewegung in der Mediengesellschaft
1.2 Was bedeutet schlau überhaupt?
1.3 Was bedeutet Bewegung?
1.4 Der Boom der Neurowissenschaften
1.5 Die populärwissenschaftliche Hoffnung
Zusammenfassung Kapitel 1
2 Grundlagen der Bewegung und Kognition
2.1 Exekutive Funktionen
2.2 Visuell-räumliche Fähigkeiten
2.3 Zentrale motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten
2.4 Motorische Entwicklung
Zusammenfassung Kapitel 2
3 Wie verarbeitet das Gehirn Bewegung?
3.1 Das Gehirn als informationsverarbeitendes Organ
3.2 Das Neuron und die Informationsübertragung
3.3 Der Kortex
3.4 Die Struktur des Gehirns
3.5 Der Muskel und die Spinalmotorik
3.6 Willkürliche Motorik
3.7 Interne motorische Modelle
Zusammenfassung Kapitel 3
4 Wie zeigt sich die Kognition im Gehirn?
4.1 Neuronale Korrelate visuell-räumlicher Fähigkeiten
4.2 Neuronale Korrelate Exekutiver Funktionen – Rolle des präfrontalen Kortex
Zusammenfassung Kapitel 4
5 Bewegung und kognitive Fähigkeiten
5.1 Korrelative Studien
5.2 Quasi-experimentelle Designs (z.B. Experten-/Novizen-Vergleich)
5.3 Experimentelle Designs
Zusammenfassung Kapitel 5
6 Andere Einflüsse auf kognitive Fähigkeiten – Bewegung ist nicht alles!
6.1 Geschlecht
6.2 Motivation
6.3 Emotion
6.4 Bindung, Entwicklung und Lernen
Zusammenfassung Kapitel 6
7 Bewegung und Alter
7.1 Veränderungen im Alter
7.2 Der Einfluss der Bewegung auf die Kognition im Alter
7.3 Studien zum Einfluss körperlicher Aktivität auf die neuronale Verarbeitung bei älteren Menschen
7.4. Einfluss der Bewegung bei Menschen mit einer Demenz
7.5. Andere Faktoren, die das Altern positiv beeinflussen können
Zusammenfassung Kapitel 7
8 Bewegung und Embodiment
8.1 Embodiment und Kognition
8.2Die Rolle des Körpers in verschiedenen Bewegungsformen und ihr Einfluss auf die Kognition
8.3 Embodiment bei Kindern
Zusammenfassung Kapitel 8
9 Bewegung und Emotion
9.1 Emotionale Entwicklung
9.2 Einfluss von Bewegung auf den Selbstwert
9.3 Einfluss von Bewegung auf Emotionen und Stimmung
9.4 Einfluss von Bewegung auf emotionale Störungen
9.5 Warum beeinflusst Sport die Emotion?
Zusammenfassung Kapitel 9
10 Bewegung und Schule
10.1 Bewegung und schulische Leistung
10.2 Die Politik, der Sportunterricht und die Vereine
Zusammenfassung Kapitel 10
11 Resümee
Dank
Literaturverzeichnis
Die Autorinnen
Personenregister
Sachregister
Einleitung
Das Hauptanliegen dieses Buches ist es, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Einfluss der Bewegung auf die Kognition differenziert darzustellen. Der Leser bzw. die Leserin soll nach dem Lesen den Eindruck gewonnen haben, dass Bewegung zwar auch für den Geist einiges verbessern kann, aber kein «Allheilmittel» ist, sondern gezielt eingesetzt viel Positives bewirken kann.
Kapitel 1 zeigt auf, wie es um Bewegung bei unserer medienorientierten Lebensweise bestellt ist, welches Verständnis von «Bewegung» und «Schlauheit» in diesem Werk zum Tragen kommt und inwieweit die Neurowissenschaften die Wechselwirkung dieser beiden Bereiche bislang verstehen helfen.
Kapitel 2 verschafft einen Überblick über bestimmte Teilgebiete der Bewegung und Kognition. Hier geht es darum, insbesondere die Teilgebiete ausführlich darzustellen, bei denen positive Effekte gefunden wurden: die sogenannten Exekutiven Funktionen und die visuell-räumlichen Fähigkeiten. Wie wir noch sehen werden, entwickeln sie sich grundlegend im Kindesalter, so dass in dieser «kritischen» Phase die Frage nach dem Einfluss der Bewegung von besonderer Bedeutung ist. Dazu kommt, dass gerade im Kindesalter die Grundlage für ein bewegungsfreudiges Leben gelegt wird, so dass uns in besonderem Maß der Einfluss der Bewegung auf die Kognition bei Kindern interessiert. Anschließend werden die zentralen motorischen Fähigkeiten, konditioneller und koordinativer Art, detailliert beschrieben sowie die motorische Entwicklung skizziert. Wir gehen hier gesondert auf die Entwicklung der Arm- bzw. Zeigebewegungen ein.
In Kapitel 3 werden der Aufbau und einige grundlegende Funktionsweisen des Gehirns erklärt. Auf dieser Grundlage geht es um das Thema, wie das Gehirn Bewegung verarbeitet. Zentrale Begriffe wie Muskeln, Propriozeption und Reflex werden genauso dargestellt wie supraspinale Strukturen, die für die Bewegungsplanung und -durchführung von zentraler Bedeutung sind: das Kleinhirn, die Basalganglien und verschiedene Kortexregionen. Anschließend wird eine Modellvorstellung für die motorische Kontrolle erläutert, die internen motorischen Modelle.
Kapitel 4 zeigt, wie Kognition im Gehirn verarbeitet wird. Es werden diejenigen Prozesse und Gehirnstrukturen besser dargestellt, die bei der Verarbeitung der Exekutiven Funktionen und der visuell-räumlichen Fähigkeiten von Bedeutung sind.
Aufbauend auf Kapitel 3 und 4 werden im Kapitel 5 die Studien dargestellt, die den Zusammenhang zwischen Bewegung und Kognition beleuchten. Dabei ist das Kapitel nach der Art der verwendeten wissenschaftlichen Methode gegliedert. Es beginnt mit Studien, in denen Zusammenhänge untersucht werden (Korrelationsstudien), gefolgt von sogenannten quasi-experimentellen Designs (Untersuchung bestimmter Extremgruppen, die sich durch eine hohe Sportlichkeit oder durch eine eingeschränkte Motorik auszeichnen) sowie experimentellen Designs. Dabei beschränken wir uns auf die Betrachtung der Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bzw. Erwachsenen mittleren Alters. (Die Bedeutung der Bewegung für ältere Erwachsene wird in Kapitel 7 behandelt.)
In Kapitel 6 beschreiben wir einige wichtige Faktoren, die außerdem die Kognition beeinflussen können. Hierzu gehören das Geschlecht, die Motivation bzw. Fähigkeit zur Selbststeuerung, die emotionale Befindlichkeit sowie Entwicklung und Bindung. Natürlich gibt es weitere Faktoren wie die persönliche Veranlagung oder Genetik. Auf die Bedeutung der Genetik für die Kognition werden wir jedoch aufgrund der Komplexität des Themas – die ein eigenes Buch wert wäre – nicht weiter eingehen. Ebenso vernachlässigen wir an dieser Stelle den Einfluss der Ernährung auf die Kognition.
Kapitel 7 widmet sich eingehend dem Thema Sport und Alter. Ausgehend von der veränderten Gesellschaftsstruktur mit einer hohen Anzahl von älteren Menschen ist es gesellschaftlich sehr bedeutsam, wie die Leistungsfähigkeit älterer Menschen bis ins hohe Alter aufrechterhalten werden kann. Hier wird zunächst auf die kognitiven und physiologischen Veränderungen im Alter eingegangen, um dann sowohl unter einer experimentellen als auch unter einer neurowissenschaftlichen Sichtweise die Studien zum Einfluss der Bewegung auf die Kognition im Alter zu betrachten. Schützt Sport tatsächlich vor einer Demenz? Auch dieser Frage soll nachgegangen werden.
Kapitel 8 beschäftigt sich mit der zunehmend beachteten Thematik des Embodiment. Es geht dabei um die Frage nach der Verkörperung (dem körperlichen «Abdruck») aller kognitiven (und natürlich auch emotionalen) Phänomene. Ausgehend von einer langen philosophischen Tradition der Leib-Seele-Trennung beschäftigt sich die empirische Wissenschaft mit dem Phänomen, dass unser Denken und Fühlen im Körper sichtbar wird und umgekehrt.
In Kapitel 9 schließt sich eine detaillierte Betrachtung des Einflusses der Bewegung auf die Emotionen an. Zunächst einmal wird dargestellt, was Emotionen in Abgrenzung zu Stimmungen und Gefühlen sind, wie sie sich entwickeln und wie sie neurowissenschaftlich lokalisiert werden können. Wichtig ist hier auch die Darlegung des Einflusses von Bewegung auf emotionale Störungen: Kann man einer Depression «davonlaufen»?
In Kapitel 10 wird der Einfluss der Bewegung im schulischen Kontext näher untersucht. Der Bewegungsnotstand ist dabei bekannt: Wir sitzen zu viel, in unserer Freizeit, aber auch in unserem Schul- und Berufsleben. Die Politik hat das Problem ihrerseits erkannt. Das Thema der «Bewegten Schule» wurde vielerorts aufgegriffen. Aber was wird hier tatsächlich getan und gibt es schon Ansätze, mehr Bewegung in die Schule zu bringen?
Jedes Kapitel endet mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse. Am Ende des Buches lautet unser Resümee auf die Frage Macht Bewegung schlau?: Ja, teilweise, unter bestimmten Bedingungen kann Bewegung helfen, die Kognition zu verbessern. Diese etwas vage scheinende Antwort bedeutet nicht, dass wir uns nicht gerne positionieren würden, sondern dass nach Durchsicht der relevanten Studien eine eindeutigere Aussage unseres Erachtens nicht möglich ist.
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen die für die Thematik relevanten Studien zusammengefasst haben. Dafür haben wir in den wissenschaftlichen Datenbanken pubmed und medline Datenbankrecherchen durchgeführt. Wir haben den Wissensstand so genau wie uns möglich dargestellt und hoffen, die wichtigen Arbeiten gewürdigt und zitiert zu haben. Aber Wissenschaftlerinnen sind auch nur Menschen und wir bitten, jeden Fehler zu entschuldigen. Das Thema ist brandaktuell, und auch während der Drucklegung dieses Buches wurden sicherlich Arbeiten zu dem Thema publiziert, die vielleicht nicht mehr berücksichtigt werden konnten. So ist Wissenschaft und – das ist das Schöne – alles verändert sich, man bleibt nie stehen und die Dinge entwickeln sich weiter. Man kann schlecht sagen: «Es ist so», sondern immer nur: «Es ist so unter den jeweiligen Bedingungen zu einem gewissen Zeitpunkt» – schauen wir einmal, was kommt, und bleiben wir offen, für das, was uns noch alles erwartet.
Zum Abschluss noch kurz ein Hinweis: Der besseren Lesbarkeit wegen nutzen wir bei Angaben wie Schüler, Lehrer etc. in diesem Buch nur die männliche Form auch dann, wenn beide Geschlechter gemeint sind. (Wo explizit Frauen oder Männer gemeint sind, machen wir dies deutlich.)
1 Ausgangslage
1.1 Bewegung in der Mediengesellschaft
In unserer Gesellschaft ist Bewegung ein Problem. Während Kinder sich in den 1970er Jahren noch 3–4 Stunden pro Tag bewegt haben, ist die Bewegungszeit in den 1990er Jahren auf eine Stunde pro Tag zurückgegangen (Bös et al., 2001). Zusammen mit einem erhöhten Fernseh- und Medienkonsum (s.u.) wundert es nicht, dass man immer öfter Menschen mit einer charakteristischen Körperhaltung sieht (s. Abb. 1).
Abbildung1:Die Veränderung derKörperhaltungin derheutigen Gesellschaft.Durch die häufige Nutzung von Computern undSmartphones sieht man den «modernen Menschen» oft mit einem gebeugtenRücken.
Abbildung 1 macht sehr anschaulich deutlich, welchen Einfluss die veränderte Arbeitswelt und Gesellschaft auf die Physis hat, insbesondere auf die Haltung. Wir sind eine sitzende Gesellschaft. Dies bleibt natürlich nicht ohne Folgen: Gemäß der Gesundheitsberichtserstattung des Bundes (Raspe, 2012) zeigt sich eine hohe Prävalenz der Rückenschmerzen in der Bevölkerung. Ergebnisse der Deutschen Rückenschmerzstudie zeigen, dass nur ca. 20% der Teilnehmer angaben, noch nie unter Rückenschmerzen gelitten zu haben. Sogar Kinder sind heutzutage schon von Rückenschmerzen betroffen (Faingold et al., 2004). Bei den 11–17-Jährigen rangieren wiederkehrende Bauch- und Rückenschmerzen nach den Kopf- und Bauchschmerzen auf dem dritten Platz aller bei Kindern bekannten Schmerzen, wie im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys bekannt wird (KiGGs-Studie; Ellert et al., 2007). Mittlerweile ist man sich jedoch auch vielerorts der gesundheitlichen Risiken bewusst, welche die sitzende Haltung mit sich bringt. So findet man nicht nur in der Süddeutschen Zeitung Schlagzeilen wie die vom 21.1.2015: «Ist Sitzen das neue Rauchen?» Selbst das Harvard Business Manager Magazin veröffentlichte am 20.2.2013 einen Artikel mit der Überschrift: «Sitzen ist das neue Rauchen!» Dies ist jedoch nicht nur ein medialer Eyecatcher, sondern es scheint auch wissenschaftliche Evidenz hierfür zu geben. Bereits 2010 fanden Dunstan et al. einen positiven Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Zeit, welche man vor dem Fernseher sitzend verbringt, und der Sterblichkeit. Darüber hinaus ist bekannt, dass die Zeit, die sitzend vor dem Fernseher verbracht wird, mit einem größeren Essenskonsum und einer höheren Energieaufnahme, einem geringeren Energieverbrauch und einer größeren Gewichtszunahme einhergeht. Schmid et al. (2015) wiesen in ihrer Analyse darauf hin, dass die lange Zeit, die wir im Sitzen verbringen, einhergehend mit einem geringen Level an moderater Aktivität, starke und unabhängige Variablen sind, die einen frühen Tod vorhersagen können. Dabei ist bislang noch ungeklärt, ob ein hohes Maß an sportlicher Aktivität dem erhöhten Risiko häufigen Sitzens entgegenwirken kann. Die Autoren fordern auf jeden Fall, dass der Appell, sportlich aktiver zu sein, durch die Empfehlung einer Reduktion der Zeit im Sitzen ergänzt werden muss. Weiterhin sollen die genauen Mechanismen des schädigenden Einflusses des Sitzens näher untersucht werden. In epidemiologischen Studien konnte z.B. eine positive Verbindung zwischen der sitzenden Zeit und dem Level an Zucker und Fetten im Blut aufgezeigt werden (z.B. Gennuso et al., 2013).
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!