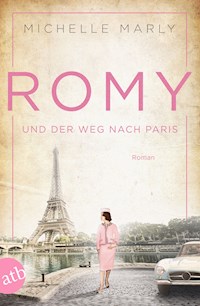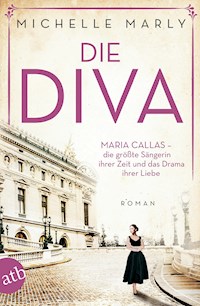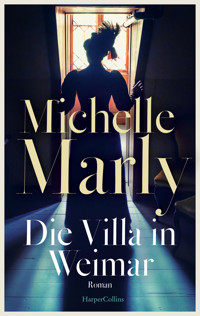10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe
- Sprache: Deutsch
„Das Glück muss man mit Tränen bezahlen.“ Édith Piaf.
Paris, 1944: Nach dem Ende der deutschen Besatzung wird die Sängerin Édith Piaf der Kollaboration angeklagt – und fürchtet ein Auftrittsverbot. Während sie ihre Unschuld zu beweisen versucht, lernt sie Yves Montand kennen, einen ungelenken, aber talentierten jungen Sänger. Édith beginnt mit ihm zu arbeiten, und schon bald werden aus den beiden Chansonniers Liebende. Das Glück an Yves‘ Seite inspiriert Édith zu einem Lied, das sie zu einer Legende machen könnte – La vie en rose ...
Édith Piaf – sie verkörperte den Mut zu lieben wie keine andere und ging in ihrer Kunst wie im Leben bis zum Äußersten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Michelle Marly
Hinter Michelle Marly verbirgt sich die deutsche Bestsellerautorin Micaela Jary, die in der Welt des Kinos und der Musik aufwuchs. Lange Jahre lebte sie in Paris, heute wohnt sie mit Mann und Hund in Berlin und München. Durch ihren Vater, den Komponisten Michael Jary, bekam sie früh Zugang zur Musik, wobei ihre Leidenschaft schon immer den französischen Chansons galt.
Ihr letzter Roman bei atb, »Mademoiselle Coco und der Duft der Liebe«, ist ein internationaler Bestseller.
Informationen zum Buch
»Das Glück muss man mit Tränen bezahlen.« Édith Piaf.
Paris, 1944: Nach dem Ende der deutschen Besatzung wird die Sängerin Édith Piaf der Kollaboration angeklagt – und fürchtet ein Auftrittsverbot. Während sie ihre Unschuld zu beweisen versucht, lernt sie Yves Montand kennen, einen ungelenken, aber talentierten jungen Sänger. Édith beginnt mit ihm zu arbeiten, und schon bald werden aus den beiden Chansonniers Liebende. Das Glück an Yves’ Seite inspiriert Édith zu einem Lied, das sie zu einer Legende machen könnte – La vie en rose.
Édith Piaf – sie verkörperte den Mut zu lieben wie keine andere und ging in ihrer Kunst wie im Leben bis zum Äußersten.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Übersicht
Cover
Titelinformationen
Über Michelle Marly
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog – 1937
Erster Teil – 1944
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Zweiter Teil – 1945
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Dritter Teil – 1945/46
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Epilog – 1947
Nachwort
Impressum
Michelle Marly
Madame Piaf und das Lied der Liebe
Roman
Inhaltsübersicht
Über Michelle Marly
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog – 1937
Erster Teil – 1944
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Zweiter Teil – 1945
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Dritter Teil – 1945/46
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Epilog – 1947
Nachwort
Impressum
C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie
Er für mich, ich für ihn, ein Leben lang
AUS »LA VIE EN ROSE«
Prolog 1937
»Mon légionnaire«
Moral ist, wenn man so lebt,
dass es gar keinen Spaß macht,
so zu leben.
Édith Piaf
Paris
Der größte Trubel hatte sich gelegt. In dem kleinen Bistro an der Place Pigalle saßen nur noch ein paar übrig gebliebene Nachtschwärmer bei dämmriger Beleuchtung. Merkwürdig deplatziert wirkten die beiden Herren im eleganten Frack, die nach einem wohl langen Bummel durch die Vergnügungslokale ihren kleinen, starken Kaffee nippten und frische Croissants eintunkten. In der Ecke neben der Kellertür hatte sich eine Gruppe junger Leute um einen Tisch versammelt, junge Männer mit Schiebermütze aus dem Milieu und schäbig gekleidete Künstler, die so ausgelassen feierten, als gebe es niemals ein Morgen, an dem sie in ihren sorgenvollen Alltag zurückkehren mussten. Diese jungen Menschen gehörten ganz offensichtlich hierher, sie bewegten sich in dem Lokal wie in ihrem eigenen Salon. Dabei umringten sie eine junge Frau, deren Stimme lauter war als alle anderen, sie redete ununterbrochen – und leerte schneller als jeder andere die Gläser. Zu ihr flogen die Blicke der vornehmen Herren ebenso wie die des leichten Mädchens, das mit verschmierter Schminke ihre Nachtarbeit mit einem Pastis beendete und dabei die Scheine auf die Theke zählte, die sie ihren Freiern abgenommen hatte und nun an ihren Zuhälter weiterreichte. Man kannte sich, wenn auch nur vom Sehen.
Édith Gassion, die junge Frau im Zentrum, war ein winziges Persönchen, gerade einundzwanzig Jahre alt, nicht einmal eineinhalb Meter groß und alles andere als eine auffallend attraktive Frau. Ihre Stirn war zu hoch, die Nase zu schmal und zu lang, ihr dunkles Haar widerspenstig und nur halbwegs gepflegt. In ihren braunen Augen lagen jedoch Schalk, Trotz und Traurigkeit dicht beieinander und zogen jeden, der hineinschaute, in ihren Bann. Neben ihrer Stimme war es die Magie dieser Augen, die sie als Schönheit erstrahlen ließ. Es war, als funkelten sie in der Nacht besonders hell, gleich Sternen, die aufgingen, wenn die Bourgeoisie schläfrig wurde. Die Stunden zwischen elf Uhr abends und sechs Uhr morgens waren Édiths liebste Zeit. Da feierte sie endlose Freudenfeste, deren einziger Anlass darin bestand, den Tag zuvor überlebt zu haben. Und obwohl sie nicht viel Geld besaß, bezahlte sie fast immer für all ihre Freunde.
Als die Tür aufgestoßen wurde, wehte ein kalter Luftzug herein. Im ersten Moment achtete niemand darauf, denn in den Morgenstunden mischten sich für gewöhnlich die ersten Frühaufsteher mit den Nachtschwärmern, Männer in Arbeitskleidung begannen hier ihren Tag mit einem Kaffee und einem Cognac. Doch der große, hagere Mittdreißiger, der in den Gastraum trat, gehörte zu einer anderen Klientel. Er war gut gekleidet, auf den Schultern seines eleganten Mantels schmolzen die Flocken des Schneetreibens draußen. Offenbar wollte er weder einen Absacker noch einen Wachmacher: Er sah sich kurz um und schritt dann mit zusammengepressten Lippen und finsterem Blick auf den Ecktisch zu. Hinter Édiths Stuhl blieb er stehen.
»Du musst dich ändern«, stieß er hervor. »Sofort! Hörst du?«
Sie hörte ihn wohl, verstand ihn jedoch nicht. Was weder an dem Trubel um sie herum lag noch an dem Wein oder dem Cognac, die sie abwechselnd trank. Beschäftigt mit der Frage, warum er sich zu dieser Uhrzeit nicht im Bett bei seiner Frau befand, drehte sie sich zu ihm um. »Lass mich in Frieden, Raymond. Ändere du doch erst einmal was in deinem Leben!«
Einer ihrer Freunde blickte über den Rand seines Weinglases zu dem Fremden. »Wer is’n das?«
»Darf ich vorstellen?« In Imitation einer vornehmen Geste ruderte Édith übertrieben mit den Armen. »Das ist Raymond Asso, Textdichter und Liebhaber, Fremdenlegionär und …« Sie zögerte und fügte dann leise mit gesenkten Lidern hinzu: »Freund und Lehrmeister.« Fast hätte sie auch große Liebe gesagt, aber auf gewisse Weise war jeder neue Mann in ihrem Leben eine große Liebe. So einen wie diesen hatte sie allerdings noch nie gehabt, der war etwas Besonderes. Dennoch ließ sie den Zusatz weg. In diesem Augenblick versuchte sie, Raymond ein bisschen weniger zu lieben – sein Auftritt ärgerte sie.
Mehrstimmiges Gejohle war die Antwort auf ihre Vorstellung.
Nun ging ein Ruck durch ihren kleinen, mageren Körper, sie richtete sich auf und legte sich fast auf den Tisch, um die Flasche in dem schäbigen, vergilbten Weinkühler, der einst versilbert gewesen sein mochte, zu erreichen. Durch die Bewegung rutschte ihr bunter Rüschenrock hoch und entblößte ihre Schenkel. »Willst du mit uns trinken?«, rief sie über die Schulter.
»Du benimmst dich wie eine putain«, schimpfte Raymond und drückte sie energisch auf ihren Stuhl zurück.
Achselzuckend ließ Édith ihn gewähren. Seine Worte trafen sie nicht. Generell interessierte sie nicht, was andere Menschen über sie sagten. Putain – Hure – war nicht einmal die übelste Beleidigung. Da, wo sie herkam, gab es ganz andere Bezeichnungen für eine Frau, da wurde niemand mit Samthandschuhen angefasst. Ihre Mutter hatte sie auf einem Treppenaufgang im Arbeiterviertel Belleville zur Welt gebracht. Als Säugling hatte Édith bei der Großmutter mütterlicherseits gelebt, die sie fast verhungern ließ, dann war sie im Bordell der Großmutter väterlicherseits bei Rouen aufgewachsen. Und ausgerechnet in diesem Etablissement hatte Édith erstmals so etwas wie Liebe erlebt. Doch in dem Alter, in dem andere Mädchen in die Schule kamen, hatte der Vater sie der Fürsorge der Prostituierten entrissen. Mit ihm hatte sie im Wanderzirkus gelebt, später auf der Straße. Dagegen war das Zimmer im Piccadilly, einer schäbigen Pension an der Place Blanche mit immerhin relativ anständigen Bewohnern, eine deutliche Verbesserung. Raymond hatte sie dort seit kurzem untergebracht. Raymond, der sie zu einem besseren Menschen zu formen versuchte – und von dem sie wusste, dass er es nicht so meinte, wenn er mit ihr schimpfte.
Die verwirrten und bedrohlichen Blicke der jungen Männer in ihrem Kreis ignorierte er ebenso wie Édiths Gleichmut. Er sprach zu ihr, als wären sie allein: »Diese nächtlichen Gelage müssen aufhören, wenn du etwas aus dir machen willst. Diese Schmarotzer sollen verschwinden, und mit dem vielen Trinken ist es ab sofort auch vorbei.«
»Soll ich ihn rauswerfen?«, rief einer ihrer Freunde, der sich ebenso gut mit den Regeln der Straße auskannte wie Édith. Seine jugendlich helle Männerstimme überschlug sich fast vor Vorfreude auf eine Prügelei mit dem feinen Monsieur.
»Lass ihn«, mischte sich Simone Berteaut ein, Édiths Freundin und Schwester im Geiste. Sie stammte wie Édith von der Straße, und die beiden jungen Frauen teilten ihr Leben seit etwa fünf Jahren, gaben einander Sicherheit, Halt und Geborgenheit. Und Simone kannte jeden Mann, mit dem Édith ins Bett ging. »Gegen den hast du keine Chance. Er war nicht nur Fremdenlegionär, sondern auch bei den Spahis, du weißt schon, diesem algerischen Kavallerieregiment.«
»Aber er trägt keine Uniform …«
»Nicht mehr, Dummkopf. Jetzt ist er Zivilist und schreibt Chansons für Marie Dubas. Er ist ihr Privatsekretär.« Simone sprach ziemlich laut – und der Name der berühmten Sängerin ließ auch den letzten von Édiths Zechbrüdern verstummen. Wer nicht schon von Raymond Assos heroischer Vergangenheit in Nordafrika beeindruckt war, empfand nun tiefe Bewunderung angesichts seiner Bekanntschaft mit Marie Dubas.
Inzwischen waren auch die anderen Gäste auf das Spektakel aufmerksam geworden. Neugierig starrten und lauschten sie. Allein der Wirt hinter der Theke trocknete die zuvor gespülten Mokkatassen ab, als gehe ihn das Geschehen in seinem Lokal nichts an. Scheppernd räumte er die Tassen in das Regal.
»Wenn du dich nicht änderst, wirst du niemals im ABC auftreten können«, verkündete Raymond.
Es wurde so still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören. Sogar der Wirt hielt kurz in der Bewegung inne.
Das ABC war eine andere Welt. Ein Ehrfurcht einflößender Ort, den jeder zumindest dem Namen nach kannte. Nicht nur, dass sich das Musiktheater in einem besseren Bezirk an einem der Grands Boulevards befand. Mehr noch als das legendäre Moulin Rouge war es der Ort für die Großen der Musikbranche. Für fast alle Sänger war es ein Traum, auf dieser Bühne die Weihen des Erfolgs zu empfangen. Wer im ABC auftreten durfte, war längst ein Star oder auf dem besten Wege dorthin. Jeder Pariser wusste das. Und natürlich kannte auch Édith das ABC. Vom Vorbeigehen, von sehnsüchtigen Blicken zu den Plakaten und Ankündigungen der Konzerte. Doch nicht einmal als Zuschauerin war sie bisher dort gewesen, der Preis für die Eintrittskarte lag außerhalb ihrer Möglichkeiten. So blieb das ABC ebenso ein Traum wie die Hoffnung auf ein sorgloseres Leben.
Édith sang vor Publikum, seit sie zehn Jahre alt war. Damals hatte der Vater ihr erklärt, sie müsse sich ihr Essen fortan selbst verdienen. Also hatte sie auf der Straße zu singen begonnen, während er als Akrobat seine Kunststücke zeigte. Sie tingelten durch die Provinz, meist verdiente die Tochter mit ihrer klaren Stimme mehr als der Vater mit seinen Muskeln und seiner Geschicklichkeit. Sie sang, was ihr in den Sinn kam, hauptsächlich die Chansons, die ihre liederliche Mutter in ebensolchen Kaffeehäusern zum Besten gab, und dann noch die »Marseillaise«. Denn für die französische Nationalhymne warfen die Leute immer ein paar Münzen extra in ihren Hut. Ihre Einnahmen wären ausreichend für sie gewesen, hätte der Vater ihr nicht alles abgenommen. Und sie geschlagen, wenn es nicht genug war für ihn. In dieser Zeit lernte Édith jedoch nicht nur die Brutalität des Lebens auf der Straße kennen, sie begriff auch, dass sie singen musste. Denn die Tonfolgen taten so viel mehr, als nur für ihr materielles Überleben zu sorgen – sie schenkten ihr Geborgenheit. Die Musik vermittelte ihr eine Wärme, die sie vergessen ließ, dass sie keine zärtlichen Umarmungen von Mutter oder Vater kannte. Und dann war da der Applaus, die Anerkennung, die sie schon als kleines Mädchen in eine Ekstase versetzte, die nicht annähernd vergleichbar war mit dem Rausch, den sie später erlebte, wenn sie sich betrank. Der Beifall war das Großartigste, was sie je erlebt hatte, ihr vollendetes Glück. Deshalb konnte sie nicht anders: Sie musste singen, um Liebe zu erfahren.
Mit fünfzehn lief sie ihrem Vater davon, ließ den Kontakt zu ihren Eltern aber nie ganz abreißen. Gemeinsam mit einem anderen Straßenkind – ihrer Freundin Simone – machte sie sich auf den Weg in ein neues Leben. Édith sang an der Place Pigalle, und Simone sammelte das Geld ein, das ihr Vortrag den Passanten wert war. Schon bald stellten sich die beiden Mädchen unter den Schutz der jungen Männer, die in diesem Milieu das Sagen hatten. So begannen die Freundschaften, die Édith an den Ecktisch in dieses kleine Bistro führten und die nun seit nahezu drei oder vier Jahren hielten. Als Édith und Simone sich irgendwann in ein besseres Arrondissement vorgewagt hatten, hatten sie prompt Ärger mit der Polizei bekommen und waren dabei einem freundlichen Herrn mittleren Alters begegnet. Dieser war Louis Leplée, der Besitzer des Cabarets Gerny’s. Beeindruckt vom Gesang der jungen Frau, brachte er Édith bei, ihre Stimme zu formen, dazu ein wenig Atemtechnik, gab ihr ordentlich zu essen und ihr und Simone ein warmes Bett, vor dem sie jedoch gelegentlich in die vermeintliche Freiheit der Straße flüchteten. An ihrem privaten Umfeld änderte sich wenig, obwohl Papa Leplée, wie Édith ihn liebevoll nannte, sie von der Straße auf seine Bühne brachte, für einen ersten Schallplattenvertrag sorgte und ihr sogar einen Auftritt im Radio verschaffte. Auch einen Künstlernamen erdachte er für sie: La Môme Piaf, der kleine Spatz, was eine Anspielung auf ihre Körpergröße von nur hundertsiebenundvierzig Zentimetern und auf ihr unabhängiges, freches Wesen war.
Der gewaltsame Tod ihres Mentors und die Verdächtigungen, die Édith mit seiner Ermordung in Verbindung brachten, zwangen sie, Paris für eine Weile zu verlassen. Ihre Freundin Simone wie immer im Schlepptau. Inzwischen brauchte Édith nicht mehr auf der Straße zu singen, dank Leplée konnte sie ein Repertoire vorweisen, das sich für die kleinen Bühnen eignete: In der Provinz zwischen Brest und Nizza, wo sie niemand kannte, fand Édith Engagements in zweit- und drittklassigen Nachtclubs. Die Gagen waren nicht üppig, aber irgendwie schaffte sie es, sich und Simone über Wasser zu halten und stets ausgelassen die Nächte durchzufeiern. Nach ein paar Monaten hatten die beiden jungen Frauen jedoch genug von der Wanderschaft und kehrten nach Paris zurück. Zufällig begegnete Édith an einem ihrer ersten Abende in einer Bar am Montmartre Raymond Asso. Sie kannte ihn flüchtig durch Leplée – und ohne große Worte nahm er sie unter seine Fittiche.
Raymond verschaffte ihr Engagements in kleinen Cabarets, brachte sie im Piccadilly unter und kümmerte sich in jeder freien Minute um sie. Er versuchte, ihr beizubringen, sich wie eine junge Dame auszudrücken und entsprechend zu pflegen. Die Rüschen und Volants an ihren bunten Kleidern hatte er ihr zwar noch nicht ausreden können, aber immerhin schleppte er sie zu einem guten Friseur und riet ihr zu mehr Körperpflege. Letzteres nicht zuletzt aus Eigennutz, da er ihr Geliebter wurde. Édith mochte ihn, sogar viel mehr als das, das Problem war nur, dass er als verheirateter Mann niemals bei ihr übernachtete – und sie hasste es, nachts allein zu sein. Deshalb sorgte sie dafür, dass Simone die andere Seite des Doppelbetts einnahm, was Raymond wiederum verstimmte. Die so entstandene Dissonanz in ihrer Beziehung änderte jedoch nichts an Raymonds Begeisterung für ihr Talent als Sängerin. Wie ein gewisser Pygmalion in der griechischen Mythologie, von dem Édith zum ersten Mal durch ihn hörte, versuchte Raymond, aus ihr eine seiner Ansicht nach perfekte Chansonnette zu machen. Er brachte ihr bei, einen ausdrucksstarken Text zu erkennen und ihn richtig zu betonen; er regte an, dass sie Bücher las, und empfahl ihr bedeutende Schriftsteller. Édith ließ die Werke unberührt, irgendwann musste sie zugeben, dass sie kaum lesen und schreiben konnte, weil sie nie eine Schule besucht hatte und nur im Wanderzirkus hin und wieder unterrichtet worden war. Also bemühte sich Raymond, ihr auch die verlorene Schulzeit zu ersetzen. Und alles immer mit dem Hinweis, eine große »Persönlichkeit« aus ihr zu machen. Er tat fraglos ihrer Karriere gut, doch für den Himmel auf Erden würde selbst er nicht sorgen können. Ein Engagement im ABC war für jemanden wie sie undenkbar.
Brüsk schüttelte sie seine Hand ab. »Bist du verrückt geworden? Ich soll im ABC auftreten? Machst du dich über mich lustig?«
»Ich habe mit dem Direktor Mitty Goldin vereinbart, dass du als Anheizerin von Gilles et Julien auftrittst. Es war nicht einfach, ihn zu überzeugen, die ganze Nacht habe ich auf ihn einreden müssen, dann hat er zugesagt. Du hast dreißig Minuten. Die Premiere ist am sechsundzwanzigsten März.«
Édith klappte das Kinn herab. Fassungslos sah sie Raymond an. Bisher hatte sie sich immer auf ihn verlassen können. Er trennte sich zwar nicht von seiner Frau, aber er war ihr bester Freund. Dafür liebte sie ihn. Außerdem war er ziemlich humorlos, wofür sie ihn etwas weniger liebte. Wenn er jedoch sagte, dass sie im ABC singen würde, dann machte er womöglich keine Witze.
Durch die alkoholisierten Nebelschwaden, die durch ihr Hirn waberten, begriff sie, dass sie tatsächlich vor einem großen Debüt stand. Unwillkürlich schnappte sie nach Luft. Doch statt Raymond um den Hals zu fallen, was ihr erster Impuls war, blieb sie auf ihrem Stuhl wie festgeklebt sitzen und rief mit sich überschlagender Stimme: »Champagner! Champagner für alle!«
In ihre Freunde kam Leben. Die Männer stießen sich gegenseitig mit den Ellenbogen in die Seiten und grinsten.
»Nein, keinen Champagner!«, brüllte Raymond. Er schnippte mit dem Finger, um dem Wirt ein Zeichen zu geben. »Kaffee. Bringen Sie Kaffee. Mademoiselle braucht keinen Champagner, sondern Kaffee. Am besten einen Liter.«
»Du bist ein Spielverderber«, maulte Édith.
»So ist er«, murmelte Simone.
Ihre anderen Freunde grummelten. »Soll ich ihn nicht doch rausschmeißen?«, fragte der, der zuvor schon dieses Ansinnen vertreten hatte.
»Wenn ich jetzt Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen!«, protestierte Édith.
»Sehr gut«, kommentierte Raymond. »Du wirst auch nicht schlafen, sondern arbeiten. Sobald du ein bisschen nüchterner geworden bist, fahren wir zu Marguerite Monnot.«
Édith gähnte demonstrativ und sperrte absichtlich den Mund auf, ohne die Hand davorzuhalten. »Warum willst du mich deiner neuen Geliebten vorstellen?«
Allgemeines Gelächter antwortete ihr.
»Du irrst. Das ist sie nicht.« In Raymonds eisblauen Augen funkelten Blitze. »Marguerite Monnot ist eine der besten Musikerinnen, die ich kenne. Sie ist Komponistin, und wir arbeiten zusammen. Sie hat die Musik zu meinem neuen Chanson ›Mon légionnaire‹ geschrieben, das Marie Dubas auf Schallplatte aufgenommen hat.«
»Oh«, murmelte Édith. Marie Dubas war ihr Vorbild. Die war mehr als eine Sängerin, die Dubas erzählte Geschichten mit ihren Liedern – wie eine Schauspielerin, die in einem Theaterstück Figuren lebendig werden ließ. Dabei verlor sie nie die kleinen Leute aus den Augen, jene Menschen, die schon immer zu Édiths Umfeld gehörten. Édith wünschte sich, diese Klasse zu haben, und versuchte, die bewunderte Sängerin gelegentlich vor dem Spiegel zu kopieren, doch fehlte ihr deren komödiantischer Einschlag – ihr lag mehr die Dramatik. Dass die Komponistin der Dubas mit ihr, La Môme Piaf, zusammenarbeiten wollte, war beinah ebenso unvorstellbar wie ein Engagement im ABC. Andererseits stand der Sekretär und Textdichter der Dubas gerade dicht hinter ihr, sie spürte seine Hand schwer auf ihrer Schulter liegen, und er war ihr Liebhaber und Freund …
Raymond indes redete mit voller Überzeugung weiter: »Du brauchst für das ABC eigene Lieder. Genau genommen darfst du fünf neue Chansons singen. Dafür brauchst du besondere Gesangsstunden, im ABC kommt es auf dein Stimmvolumen an, es gibt dort keine Mikrophone. Außerdem brauchst du neue Garderobe und ein besseres Benehmen, von deinem Auftreten in der Öffentlichkeit wird viel abhängen.«
Die Liste der Notwendigkeiten, die er vor ihr aufrollte wie ein mittelalterlicher Bote eine Rolle Pergament, schien kein Ende zu nehmen. Bald nahm sie gar nicht mehr wahr, was er sagte. Vor ihrem geistigen Auge sah sie drei Buchstaben aufflackern – ABC – und dann den Künstlernamen, den Papa Leplée ihr gegeben hatte, aus strahlenden Glühbirnen geformt, mit denen die Stars auf der Leuchttafel über dem Eingangsportal am Boulevard Poissonnière angekündigt wurden. Sie sah sich auf der großen Bühne, die sie hinter dem zweiflügeligen Eingang vermutete, und hörte sich »Mon légionnaire« singen. Anders als Marie Dubas, ja vielleicht sogar besser … Was für ein wundervoller Traum!
Aber eben nur ein Traum. Sie war zu betrunken, um zu beurteilen, ob Raymond die Wahrheit sprach. Ein Engagement im ABC …? Für mich? Der spinnt doch, fuhr es ihr durch den Kopf.
Dennoch nahm sie gehorsam den Kaffee entgegen, den der Wirt ihr brachte. Sicher war es sinnvoll, ein wenig klarer denken zu können. Dann würde sie womöglich verstehen, was Raymond morgens um halb sechs in diese Bar getrieben hatte. Sein Auftritt kam ihr vor wie die Darbietung eines Magiers im Zirkus: Raymond zauberte ein weißes Kaninchen aus dem Hut und ließ es wieder verschwinden, nachdem der Applaus eingesetzt hatte. Doch keiner ihrer Freunde klatschte. Vielleicht blieb das Kaninchen ja da, und das Engagement im ABC war keine Illusion. Und der Beifall würde am Ende ihrem Debüt im prestigeträchtigsten Musiktheater von Paris gelten. Die Frage war nur, ob dieser Gedanke mehr als eine Illusion sein konnte.
»Du brauchst einen neuen Namen«, hörte sie Raymond sagen, aber auch das nahm sie kaum wahr. Das Koffein schien nicht anders zu wirken als die Unmengen an Alkohol. Oder ein Zuviel von Wein und Cognac vertrug sich nicht mit dem Mokka. Édith wusste es nicht. Bevor ihre Lider plötzlich zufielen und ihr Kopf nach vorn sackte, bohrte sich Raymonds Stimme wie ein Pfeil in ihr Hirn: »Niemand will einen kleinen Spatz im ABC singen hören.«
Sie hatte es ja von Anfang gewusst!
Erster Teil 1944
»Padam, Padam«
Das Leben ist wundervoll.
Es gibt Augenblicke, da möchte man sterben.
Aber dann geschieht etwas Neues,
und man glaubt, man sei im Himmel.
Édith Piaf
Kapitel 1
Paris
Die Stadt erstrahlte zwar noch nicht wieder im hellen Glanz der Vorkriegszeit, doch die Verdunkelungsvorschriften waren weitgehend aufgehoben worden. Gelbes Licht fiel auf die Straßen der Hauptstadt, über die nun keine Armeestiefel mehr zum Angriff oder zur Verteidigung marschierten, die Schüsse der letzten deutschen Heckenschützen waren verhallt, der Geruch von Blut und Tod vom Sommerwind getilgt. Die einzigen Soldaten, die nun zwischen Montmartre und Montparnasse feierten, waren Franzosen oder Alliierte, vor allem GIs der 4.Infanteriedivision, die Paris befreit hatten. Für diese neue Klientel öffneten nach und nach wieder die Vergnügungslokale. Aus den meisten Musiktheatern, Varietés und Cabarets hallten die Töne von Big Bands mit dem Sound von Glenn Miller, die jungen Pariser trällerten neuerdings amerikanische Hits statt Chansons und steckten sich dabei anstelle der typisch französischen schwarzen Gauloises-Zigaretten aus hellem Tabak in die Mundwinkel. Im Schatten des Eiffelturms begann eine neue Zeitrechnung.
Und nun hob sich der Vorhang des ABC für einen jungen Mann Anfang zwanzig. Er stand am Rand der Bühne im Scheinwerferlicht und wirkte wie die schlechte Kopie eines Cowboys. Auf seinem dunklen Haar saß ein Panamahut, der zu groß für sein schmales Gesicht war, und Hemd und Hose waren zu weit für seinen schlaksigen, dünnen Körper. Der Interpret stand während seines Vortrags nicht gerade, wie es sich für einen Chansonnier der Spitzenklasse gehörte, sondern schob die Schulter vor wie ein drittklassiger Nachtclubsänger und zwinkerte seinem Publikum zu. Sein breites Grinsen schien dabei ebenso deplatziert wie die »Yippie, yippie, yeah«-Rufe, mit denen er das Lied »Dans les plaines du Far West« ausschmückte.
»Mon dieu!«
Édith richtete sich in ihrem Theaterstuhl auf, sah sich um – und wunderte sich, dass keine Pfiffe oder Buh-Rufe aus dem Publikum zum Podium flogen. War es möglich, dass die rund eintausendzweihundert Zuschauer des vollbesetzten Musiktheaters von der hanebüchenen Vorstellung angetan waren? Die Leute harrten ruhig auf ihren Plätzen aus, im Halbdunkel erkannte sie auf dem einen oder anderen Gesicht sogar ein wohlwollendes Lächeln. War sie womöglich die Einzige weit und breit, die etwas – eigentlich alles – an dieser Darbietung auszusetzen hatte? So weit konnten die Dankbarkeit der Pariser und die damit verbundene Anbetung alles Amerikanischen doch nicht gehen! Einem Franzosen, der auf der Bühne des prestigeträchtigsten Musiktheaters der Stadt einen Hillbilly-Musikclown aus sich machte, konnte sie beim besten Willen und trotz ihres Sinns für Humor keinen Beifall zollen.
»Er ist Italiener.«
»Was?« Sie fuhr zusammen.
Hatte sie ihre Kritik etwa laut ausgesprochen? Wer außer ihren Begleitern hatte sie gehört? Nicht, dass sie jemals ein Blatt vor den Mund genommen oder etwas darauf gegeben hätte, was andere Leute über sie sagten. Aber gerade jetzt war offenbar geworden, dass sie Feinde besaß, die ihr das Leben schwermachten. Es fehlte ihr noch, morgen in der Zeitung zu lesen, was Édith Piaf von einem sogenannten Talent wie diesem Schnulzensänger hielt. Was sie im Moment gar nicht gebrauchen konnte, war Presse, in der ihre Meinung als anti-amerikanisch und damit womöglich als anti-französisch ausgelegt werden würde. Unwillkürlich sank sie in sich zusammen, machte sich absichtlich kleiner, als sie es ohnehin schon war.
»Er ist Italiener«, wisperte nun Louis Barrier noch einmal. Ihr neuer Impresario saß zu ihrer Rechten an einem der Tische in der Mitte des vorderen Bereichs des Zuschauersaals, wo sie nicht in eine Stuhlreihe gezwängt und die Akustik und Sicht besonders gut waren.
»Das ist doch egal«, gab sie unwillig zurück.
Als habe er sie nicht gehört, führte nun Henri Contet, der Journalist und Textdichter, zu ihrer Linken leise aus: »Yves Montand ist ein Pseudonym. Sein Vater floh vor den Faschisten nach Marseille. Unser Freund heißt mit bürgerlichem Namen Ivo Livi.«
»Freund?« Édith zog ihre Brauen hoch. Ihre Augen flogen zwischen dem Interpreten und Henri hin und her. Sie verstand beim besten Willen nicht, was er an diesem Yves Montand – Ivo Livi oder wie immer er hieß – fand.
Obwohl sie sich ausgerechnet an diesem Abend lieber in einer Bar am Montmartre betrunken hätte, war sie wider besseres Wissen Henris Einladung gefolgt, die er, wie sich herausstellte, mit Louis abgesprochen hatte. Sie tat fast immer, worum ihre Freunde sie baten, es war eine Schwäche von ihr. Sie haderte manchmal damit, weil es zuweilen keine preiswerten Dienste waren, die von ihr gewünscht wurden, aber in der Regel gab sie trotzdem nach. In diesem Fall ging es nicht um Finanzielles, sondern um ihren bevorstehenden Auftritt zur Wiedereröffnung des legendären Moulin Rouge. Ihre erste Wahl für einen Partner in ihrem Vorprogramm war Roger Dann gewesen, doch der konnte nicht nach Paris kommen. Deshalb wollten die beiden Getreuen ihr heute Abend einen Sänger präsentieren, der nicht nur ein Ersatz, sondern viel besser war. Das jedenfalls hatten sie behauptet. Doch die Idee, mit diesem talentlosen jungen Mann auf einer Bühne zu stehen, erschien Édith grotesk. Eine Knallcharge wie dieser Kerl gehörte eindeutig nicht in ihr Programm und genau genommen auch nicht in das ABC. Je länger sie der Darbietung zusah, desto entschlossener wurde Édith in ihrer Ablehnung.
Auch ein Kostümwechsel brachte keine Besserung: Der Sänger zog sich ein Sakko mit albernen Karos über das weiße Hemd, und er wirkte nun nicht mehr nur wie ein Clown, er sah tatsächlich auch so aus, versuchte jedoch weiterhin, die Rolle des Verführers zu spielen. Dazu imitierte er den großartigen Charles Trenet und sang dessen Titel »Swing troubadour«. Als wäre sein Habitus nicht schon peinlich genug, versuchte dieser Einfaltspinsel nun auch noch zu steppen wie Fred Astaire. Aber tanzen konnte er ebenso wenig wie singen. Der Vortrag ärgerte Édith nicht nur, sie betrachtete ihn regelrecht als persönlichen Affront.
Das ABC war noch immer das renommierteste Musiktheater in Paris. Sein Renommee hatte den Wechsel der Direktion, Besatzung und Krieg überstanden, alle großen Stars hatten hier im Laufe der Jahre weiterhin Triumphe gefeiert. Vor allem aber war es die Bühne, auf der sie ihr Debüt als Chansonnette gegeben hatte, genauso wie dieser Yves Montand es gerade versuchte. Dreißig Minuten hatte sie gehabt, weniger als er jetzt. Sie war als Anheizerin vor den Vorhang getreten und als neuer Star abgegangen. Eine kleine Person mit großer Stimme, damals gerade einmal einundzwanzig Jahre alt und in einem schlichten schwarzen Kleid mit einem weißen Spitzenkragen, so unprätentiös wie nur möglich. Das Publikum forderte nach ihrem ersten großen Auftritt eine Zugabe nach der anderen, die Musikkritiker überschlugen sich am nächsten Tag mit Lobeshymnen. Dafür hatte sie hart gearbeitet, wochenlang fast nicht geschlafen und gelernt, was es hieß, eine Persönlichkeit zu werden.
Es hatte sich gelohnt, denn nach diesem denkwürdigen 26.März 1937 kannte jeder in Paris den Namen Édith Piaf. Sie war nicht mehr La Môme Piaf, die kuriose kleine Göre, sondern eine erwachsene Frau, die sich zu benehmen und auszudrücken wusste. Was hatte sich seitdem nicht alles verändert in ihrem Leben? Nicht nur, dass sie Messer und Gabel richtig hielt und sich nicht länger wie eine Zirkusprinzessin anzog – sie war heute tatsächlich eine gebildete junge Frau, eine echte Leseratte, die die intellektuelle Auseinandersetzung schätzte und deren Rede nicht länger von der Sprache der Straße zeugte. Eine Person, von Raymond Asso erfunden. Und ebenso wie Professor Higgins in dem von George Bernard Shaw nach der antiken Geschichte von Ovid geschriebenen Stück machte ihr Pygmalion alles richtig – und verlor sie im Gegensatz zu dem literarischen Helden am Ende trotzdem.
Mit Erleichterung registrierte sie, dass sich der Applaus für das Debüt des heutigen Abends in Grenzen hielt. Es lag zwar ein gewisses Wohlwollen in der Luft, vielleicht sogar Begeisterung bei der einen oder anderen Frau, aber die Anhängerinnen des Schnulzensängers waren nicht in der Überzahl, und der vereinzelte Wunsch nach einem da capo verhallte fast ungehört.
Ich habe meinen Instinkt also doch nicht verloren, fuhr es Édith durch den Kopf, als die Lichter im Zuschauerraum langsam aufblitzten und die übliche Unruhe vor einer Pause einsetzte.
»Yves Montand eignet sich sehr gut für das Vorprogramm Ihres Auftritts«, sagte Louis Barrier, den sie vertraulich Loulou nannte, obwohl er andersherum strikt beim Sie blieb.
»Sind Sie verrückt geworden?« Wenn Édith sich aufregte, klang ihre Stimme im ersten Moment schrill, dann wurde sie mit jedem Wort eine Oktave tiefer und schließlich so heiser wie die eines Whisky trinkenden Kettenrauchers. »Dieser Mann singt schlecht, er tanzt schlecht, und er hat kein Gefühl für Rhythmus.«
»Er war im Alcatraz in Marseille recht erfolgreich. In Nizza, Toulon und Aix-en-Provence ist Yves Montand auch schon aufgetreten.« Louis griff nach dem Weinglas auf dem Tisch, in dem sich noch ein letzter Schluck befand.
»Yves Montand!«, wiederholte sie abfällig. »Wie kann sich jemand diesen Namen ausdenken? Montant steht in der Musik für aufsteigende Töne. Hält der Kerl sich für einen Aufsteiger? Er ist eine Null!«
Louis wechselte einen hilflosen Blick mit Henri, doch der schwieg und stürzte nur den Rest Wein mit einem Schluck hinunter, wobei er ungewöhnlich verzweifelt wirkte.
»Ich möchte mit Roger Dann auftreten.«
»Das weiß ich.« Henri knallte sein Glas auf den Tisch. »Aber Roger Dann hält sich auf dem Land auf und kann nicht nach Paris reisen. Nichts ist einfach in dieser Zeit.«
Nein, das war es tatsächlich nicht. Wer wüsste das an diesem Abend besser als sie? Édith stieß ein trauriges Lachen aus.
Selbst wenn sich Ivo Livi ein anderes, weniger überhebliches Pseudonym zulegen und eine weniger lächerliche Figur abgeben würde, wollte sie diesen Sänger nicht unter ihre Fittiche nehmen. Von seinem Habitus mal ganz abgesehen, glaubte sie nicht an das Repertoire des jungen Mannes. Heute mochten die Pariser in ihrer Begeisterung für alles Amerikanische Songs dieser Art bejubeln, mochten sogar Kaugummi kauen, doch all das hatte nichts mit der französischen Identität zu tun. Wie lange würden ihre Landsleute die noch verleugnen? War nicht zu erwarten, dass sich der Geschmack des Publikums in absehbarer Zeit wieder wandelte? Die Befreiung von Paris lag nur wenige Wochen zurück, noch tobte der Krieg im Norden und Osten der Grande Nation, und durch ständig neue, einander oft widersprechende Nachrichten, die vor allem über Mundpropaganda verbreitet wurden, änderte sich andauernd etwas im Alltag der Franzosen. Niemand kam zur Ruhe. Dieser Frieden war fragil, unzuverlässig. Und um sich vom Grauen abzulenken, wurde gefeiert, als gebe es kein Morgen.
Nichts ist sicher, fuhr es ihr durch den Kopf. Nicht einmal mein Engagement im Moulin Rouge. Aber davon wussten weder Loulou noch Henri, ihr Geliebter. Die Katastrophe hatte sich ja erst heute angekündigt …
»Liebste Môme«, schmeichelte Henri, »hör dir Yves Montand bitte noch einmal an. Vielleicht bei einer Probe.«
»Was sollte dann anders sein?«
»Seine Kleidung. Außerdem werde ich ihm sagen, er soll ein altes Chanson singen.«
»Kennt er keine neuen?«, schnappte Édith.
Henri stieß einen Seufzer aus und spielte mit seinem leeren Glas, schob es unablässig hin und her. Vielleicht musste er seine Hände beschäftigen, um Édith nicht an Ort und Stelle bei den Armen zu packen, hochzuziehen und hinter die Bühne zur Garderobe dieses Südfranzosen zu schleppen.
»Heute war kein besonders guter Tag für mich«, gestand sie und schenkte ihm ein zerknirschtes Lächeln. Henri war nicht nur ein Liebhaber, von dem sie sich genauso oft getrennt wie sie ihn wieder erhört hatte, sondern vor allem ein Freund, der es immer gut mit ihr gemeint hatte und der sich im Gegenzug auf sie verlassen durfte. Mit Louis Barrier war es nicht anders. Mit dem ging sie zwar nicht ins Bett, aber sie schätzte seine Loyalität und brachte ihm dieselbe entgegen. Deshalb räumte sie schließlich gnädig ein: »Weil ihr so an ihm hängt, werde ich mir Monsieur Montand noch einmal anhören.« Und ich werde jeden einzelnen Takt bedauern, den ich mir das antue, fügte sie in Gedanken hinzu.
Henri strahlte. »Du wirst es nicht bereuen. Er hat wirklich Potenzial.«
Und Loulou fügte eifrig hinzu: »Gleich morgen sollten wir …«
»Nein«, unterbrach sie ihn. »Nein, nein, nein, nein. Ich möchte keinen festen Termin ausmachen, nicht jetzt. Außerdem habe ich morgen früh schon etwas vor.« Sie sagte es so leicht dahin, als handele es sich um ein unbedeutendes kleines Rendezvous. Dabei hatte die Vorladung ganz sicher nichts mit romantischem Geplänkel zu tun.
Louis öffnete seinen Mund, wollte etwas sagen, blieb jedoch stumm. Er schloss seine Lippen und sah sie verwundert an. Üblicherweise kannte er ihre Termine, und wenn er sie nicht ohnehin vereinbart hatte, informierte sie ihn darüber. Dass er anscheinend übergangen worden war, verunsicherte ihn – das war ihm deutlich anzumerken.
Sicher verwirrte ihn auch die Tatsache, dass sie eigentlich vor dem Mittag keine Verabredungen wahrnahm. Die Morgenstunden waren für gewöhnlich ihre Schlafenszeit, da sie die Nacht zum Tag machte. Wer sie bei guter Laune erleben wollte, sollte möglichst nicht vor zwei Uhr nachmittags bei ihr anrufen oder vorsprechen. Selbstverständlich hielt sich die Polizei nicht daran. Schriftliche Vorladungen wurden in den Morgenstunden zugestellt, und Verhöre fanden zur selben Zeit statt. Die Männer in französischen Uniformen waren da ebenso wenig phantasievoll wie die Fritzen – und wahrscheinlich auch ebenso unbeugsam.
Viele Künstler waren den Säuberungsaktionen der vergangenen Wochen zum Opfer gefallen. Die neuen Herren der Préfecture reagierten schnell auf Vorwürfe zu angeblicher oder bewiesener Kollaboration, die Hintergründe prüfte anscheinend niemand genau, eine bloße Beschuldigung reichte für ein Verfahren vor dem Comité national d’épuration aus. Es hatte sich in Édiths Kreisen herumgesprochen, dass die große Schauspielerin Arletty in einem Polizeiwagen abtransportiert worden war und nun in der Conciergerie einsaß wie einst Marie Antoinette. Die Mistinguett und Maurice Chevalier waren ebenso in Ungnade gefallen wie ihr Freund Jean Cocteau, von dem sie gehört hatte, dass die Modeschöpferin Coco Chanel in die Schweiz geflohen war. Die Repressalien trafen häufig Frauen, aber warum um alles in der Welt ausgerechnet sie?, fragte Édith sich nun zum x-ten Mal seit der Zustellung der Aufforderung, sich vor dem Comité zu erklären, durch einen Boten im Hotel Alsina, in dem sie derzeit mit ihrer Freundin Simone Berteaut logierte. Zugegeben, sie hatte sich keiner der Widerstandsgruppen angeschlossen, aber sie hatte getan, was sie tun konnte – und damit vielen Menschen geholfen. Unglücklicherweise ahnte sie nicht einmal, welches Vergehen sie auf die Schwarze Liste gebracht haben könnte. Diese Ratlosigkeit war fast so zermürbend wie ihre Furcht vor den möglichen Folgen.
»Ma chère, was ist los?« Henris sanfter und dennoch eindringlicher Tonfall riss sie aus ihren Gedanken.
Sie erwog, den beiden wichtigsten Männern in ihrem Leben von ihrem Termin am nächsten Tag zu erzählen, entschied sich jedoch dagegen. Ihr Aberglaube riet ihr, so wenig wie möglich darüber zu reden. Je mehr sie über die möglichen Repressalien spekulierte, desto wahrscheinlicher wurden ihre Befürchtungen, dachte Édith. Sie hatte schon so viele schwierige, sogar noch bedrohlichere Situationen überstanden, am besten, sie hörte sich erst einmal an, was ihr vorgeworfen wurde. Danach konnte sie mit ihren Freunden sprechen und sehen, was sie gegen die Anschuldigungen vorzubringen in der Lage war.
»Es ist nichts«, behauptete sie. »Ich bin nur müde.«
Henris skeptischem Blick entnahm sie, dass er ihr kein Wort glaubte.
Sie hob ihr Glas, in dem sich schon zu lange kein Tropfen mehr befand. »Bestellst du uns bitte noch eine Flasche Wein? Der zweite Teil wird gleich beginnen, und wenn die Interpreten genauso schlecht sind wie Yves Montand eben, brauche ich dringend etwas zu trinken.« Als Henri Einwände erheben wollte, winkte sie lächelnd ab: »Ja, ja, ich weiß. Du magst ihn. Und Loulou hat ihn empfohlen. Warten wir ab, ob auch ich ihm eines Tages etwas Positives abgewinnen kann.«
Während sich Henri nach der Kellnerin umsah, schellte der Pausengong. Gedankenverloren beobachtete Édith, wie sich der Saal wieder füllte. Vor ihrer Fahrt zur Île de la Cité morgen früh sollte sie unbedingt einen Abstecher nach Sacré-Cœur machen, um eine Kerze für die heilige Thérèse von Lisieux zu entzünden. Eine Fürsprecherin im Himmel konnte nicht schaden, und diese Heilige hatte ihr schon geholfen, als sie noch ein kleines Mädchen war.
»Ich wollte mich selbst vergessen, um anderen Freude zu machen. Von da an war ich glücklich.«
Louis schien wie vom Donner gerührt. »Was haben Sie gesagt? Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden.«
Zum zweiten Mal fühlte sich Édith ertappt. Sie hatte wieder nicht bemerkt, dass sie laut aussprach, was ihr durch den Kopf ging. Ihre Hand flog an ihre Stirn, rieb versonnen die Schläfe. »Ich habe eigentlich nichts gesagt. Es war nur ein Gedanke. Nichts von Bedeutung.« Es war ein Zitat der verehrten Heiligen, das sie zu ihrem Lebensmotto gemacht hatte.
Louis Barrier war noch nicht so lange ihr Impresario, dass er alles über sie wusste. Er hatte vor ein paar Monaten einfach vor ihrer Tür gestanden, sich angeboten – und sie hatte ihn in den Kreis ihrer ergebenen Mitarbeiter aufgenommen. Er war ein jungenhafter Typ Mann, jemand, den Édith gern zum Bruder gehabt hätte. Und er war klug und verstand sein Geschäft. Das Engagement im Moulin Rouge hatte sie ihm zu verdanken, und das war ein ziemlich guter Einstieg für den Neubeginn ihrer Karriere nach der Besatzungszeit. Wenn ihr Erfolg nicht zerstört würde von Menschen, die nicht verstanden, dass sie nie etwas anderes gewollt hatte, als ihrem Publikum Freude zu bereiten. Denn wenn ihr das gelang, war Édith glücklich.
Kapitel 2
»Name?«
Der Polizeibeamte war geradezu verzweifelt um Autorität bemüht, versuchte, seiner Stimme einen tiefen Klang zu geben. Er war noch sehr jung und trug die rote Armbinde des PCF, der kommunistischen Partei. Seit der Befreiung besetzten Kommunisten – trotz des öffentlich zur Schau gestellten Unbehagens General de Gaulles – die Schlüsselpositionen in der Verwaltung von Paris, da den Linken zumindest keine Nähe zu den Faschisten der Vichy-Regierung nachgesagt werden konnte und im Moment noch niemand genau wusste, wer mit wem tatsächlich kollaboriert hatte. Die Mitglieder des politischen Arms der Résistance waren natürlich ebenfalls ohne Tadel, dennoch hatten die Linken die Oberhand gewonnen. Allerdings hatten diese meist jungen Männer in der Regel wenig mehr in ihrem Leben kennengelernt als den Freiheitskampf, und auf ein Verhör mit einem Bühnenstar waren sie ebenso wenig vorbereitet wie auf den Alltag im Frieden.
»Édith Giovanna Gassion.«
Mit bitterer Ironie beobachtete sie die Reaktion ihres Gegenübers. Seine Nervosität war fast greifbar. Ihr Geburtsname steigerte seine Verunsicherung so deutlich, dass sie lachen musste. Sie biss sich auf die Zunge.
Kerle wie dieser Ermittler waren wie besessen davon, nicht schwach zu wirken oder gar dumm dazustehen. Ob er sich an den Säuberungsaktionen gegen Frauen beteiligt hatte, denen vorgeworfen wurde, lacollaboration horizontale betrieben zu haben? Männer tun manchmal Schreckliches, um ihr Bild vom harten Kerl aufrechtzuerhalten, sinnierte Édith. In ihrer Jugend an der Pigalle hatte sie derartige Hahnenkämpfe zur Genüge erlebt. Frauen zu demütigen – ihnen die Köpfe zu rasieren, die Kleider vom Leib zu reißen, sie zu bespucken, zu verprügeln und zu vergewaltigen – war offenbar die Kür. In den ersten beiden Tagen nach der Befreiung von Paris hatte der Mob getobt und vor allem an den Frauen Rache genommen, schlimmer fast als die Jakobiner nach der Revolution. Aber so waren Männer, wenn sie in einen Blutrausch gerieten. Édith war dankbar, dass sie sich davor hatte schützen können. Bis jetzt.
Sie suchte den Blick ihres Kontrahenten. »Ich heiße Édith Giovanna Gassion«, wiederholte sie.
Der junge Mann tippte mit einem nikotingelben Finger auf die Vorladung, die sie ihm bei ihrem Eintreten übergeben hatte. Es war das Papier, das ihr im Hotel Alsina zugestellt worden war. Nun lag es auf dem Tisch, der ihre Sitzplätze trennte. »Wieso steht hier Madame Édith Piaf?«
Sie befanden sich in einem kleinen, kaum möblierten und spärlich beleuchteten Raum. Das winzige Fenster war sicher schon seit Jahren nicht mehr geputzt worden, vielleicht hatte es in der ganzen Zeit auch niemand geöffnet, so stickig war die Luft. Édith fragte sich, wieso es so dreckig war, die Deutschen galten als übertrieben ordentlich und sauber. Aber vielleicht hatten die Fritzen die Atmosphäre in diesem Verhörzimmer ja dazu benutzt, Angeklagte unter Druck zu setzen oder zumindest zu verunsichern, vielleicht sogar zu ersticken. Das versuchte man zweifellos auch mit ihr.
»Édith Piaf ist mein Künstlername«, erklärte sie, um Atem ringend. »Der Textdichter Raymond Asso hat ihn mir vor sieben Jahren gegeben. Mein Geburtsname lautet Édith Giovanna Gassion.«
»Geburtstag und Ort?«
»Ich wurde am neunzehnten Dezember fünfzehn in Paris geboren.«
Im kreisrunden Licht, das die Tischlampe auf das Dossier warf, machte sich der Polizeibeamte Notizen. »Eltern?«
»Wie bitte?«
Er sah kurz auf. »Wie heißen Ihre Eltern? Wer sind sie? Was machen sie? Wo wohnen sie?«
Was soll das?, fragte sie sich im Stillen. Ich bin zu alt, um auf meine Eltern angesprochen zu werden, und ich habe es satt, besser für sie zu sorgen, als sie es jemals für mich getan haben.
Trotz ihres Widerwillens gab sie sich kooperativ und beantwortete die Fragen: »Mein Vater hieß Louis Alphonse Gassion, er war Zirkuskünstler und diente darüber hinaus im neunundachtzigsten Infanterieregiment in Sens«, fügte sie hinzu. Es spielte keine Rolle, ob er sich in der Armee sonderlich hervorgetan hatte – was nicht der Fall war –, in ihrer Situation hielt Édith seine militärische Vergangenheit für nützlich. »Er starb im März dieses Jahres an Lungenkrebs.« Sie schluckte, weil ihr der Tod ihres Vaters plötzlich naheging. Trotz allem. Er war nun einmal ihr Vater, und er hatte sich besser um sie gekümmert als ihre Mutter. Eigentlich war er ein ganz lustiger Vogel gewesen – zumindest solange bei ihren Auftritten genug Geld für ihn abfiel. Bis zuletzt. Um seine Beerdigung hatte sich in ihrem Namen Henri Contet gekümmert, die Rechnungen bezahlt hatte sie selbst.
Ihr Gegenüber nickte und notierte. Dann blickte er auf und sah sie erwartungsvoll an.
»Meine Mutter wurde als Annetta Giovanna Maillard vor neunundvierzig Jahren in der italienischen Hafenstadt Livorno geboren. Wenn sie singt, nennt sie sich Line Marsa. Das tut sie meines Wissens aber nicht mehr oft.« Manche Leute behaupteten, ihre Stimme wäre noch schöner als die der Tochter. Aber das erzählte Édith nicht.
»Wohnen Sie zusammen?«
Das bittere Lachen entrang sich nun doch ihrer Kehle. Es galt nicht dem jungen Mann.
»Ich habe keine Ahnung, wo meine Mutter wohnt. Versuchen Sie es in den Obdachlosenasylen oder Besserungsanstalten. Irgendwo werden Sie sie finden. Für gewöhnlich erfahre ich nur durch die Polizei, wo sie steckt. Dann hat sie mal wieder Ärger gemacht, zu viel getrunken oder zu viel Rauschgift genommen. Manchmal taucht sie bei mir auf, wenn sie Geld braucht. Das hat sie aber schon lange nicht mehr getan.«
Er schrieb und schrieb und ließ sich Zeit.
Am liebsten hätte sie ihn mit der drängenden Frage nach dem Grund ihres Hierseins unterbrochen. Doch eine innere Stimme erinnerte sie daran, dass sie vorsichtig sein sollte. Sie hatte schon einmal eine ähnliche Situation erlebt, als die Polizei sie wegen des Mordes an Louis Leplée stundenlang verhört und zwei Tage lang festgehalten hatte. Damals war sie naiv gewesen, hatte geweint und getobt, aber ihre Unschuld hatte sie auf diese Weise natürlich nicht beweisen können. Als man sie aus Mangel an Beweisen gehen ließ, blieb die Sache an ihr haften wie ein Blatt an einer feuchten Schuhsohle. Heute wollte sie klüger sein, ruhiger und gewissenhafter handeln. Das bedeutete jedoch, Geduld mit ihrem Gegenüber zu haben, selbst wenn es verdammt schwerfiel.
»Ehemann?«
Die Antwort war einfach: »Ich bin nicht verheiratet.«
Als habe er sie nicht gehört, bohrte er weiter: »Kinder?«
Mit dieser Frage hatte Édith nicht gerechnet – und sie tat viel mehr weh als die Erinnerung an den Tod ihres Vaters und die Vernachlässigung durch ihre Mutter. Seit jener Zeit vor fast zwölf Jahren gab es diesen einen Menschen in ihrem Leben, über den sie niemals sprach und der dennoch für immer wie eingemeißelt in ihrem Herzen wohnen würde.
Sie sang an der Place Pigalle, und natürlich war der Montmartre ein deutlich besseres Umfeld als das Arbeiter- und Einwandererviertel Belleville, aus dem sie stammte. Und so war auch der Lieferjunge Louis Dupont anständiger als die mehr oder weniger kriminellen Jugendlichen, mit denen sich Édith sonst umgab. Ein bildhübscher, schmaler Kerl. Und so treu.
Sie verliebten sich, zogen zusammen, obwohl seine Mutter, eine Ladenbesitzerin, vom ersten Moment an gegen die Straßengöre war. Als Édith schwanger wurde, verhinderte sie die Hochzeit des jungen Paares. Der Druck wurde so stark, dass Édith irgendwann flüchtete– in erster Linie vor ihrer belle-mère, aber auch fort von ihrem Geliebten und seinem langweiligen, allzu vorhersehbaren Alltag.
Ihr Entschluss bedeutete allerdings auch, dass sie Marcelle, ihre Tochter, bei deren Vater und Großmutter lassen musste. Genauso war sie selbst schließlich aufgewachsen. Irgendwann, wenn es ihr besser ging, schwor Édith, würde sie die Kleine zu sich nehmen. Doch das Kind erlag mit zwei Jahren einer Hirnhautentzündung, und Édith betete damals verzweifelt, ebenfalls zu sterben, um für immer mit ihrer kleinen Tochter vereint zu sein. Ihre Gebete wurden nicht erhört.
»Nein.« Ihre Stimme klang hart. »Nein, ich habe keine Kinder.« In ihr wuchs der Wunsch nach einem Glas Wein. Zur Beruhigung ihrer Nerven wäre jedoch wahrscheinlich eher eine ganze Flasche Cognac nötig.
Der nikotingelbe Finger klopfte auf das Dossier. »Sie sprachen von einem gewissen Raymond Asso. Wer ist das?«
»Ein guter Freund und Textdichter. Ich habe ihn seit Kriegsbeginn nicht mehr gesehen. Genau genommen trennten sich unsere Wege, als er zur französischen Armee eingezogen wurde.« Sie überlegte, ob sie noch anführen sollte, dass Raymond jüdischer Herkunft war. Aber vielleicht mochte ihr Gegenüber Juden ebenso wenig wie Chansonsängerinnen. Obwohl er Franzose war.
Sie holte tief Luft. »Ich würde jetzt gern wissen, was mir vorgeworfen wird. Davon steht nämlich nichts in der Zustellung.« Ihre Ungeduld war ein Fehler. Sie begriff es, bevor die letzten Worte über ihre Lippen waren. Merde, dachte sie, verärgert über die eigene Impulsivität.
Prompt reagierte der Ermittler erwartungsgemäß – langsam. Er schob die Vorladung hin und her, öffnete eine schmale Mappe aus Pappe, die unter den Papieren mit den handschriftlichen Notizen lag, blickte sinnierend auf den Inhalt.
Von ihrem Platz aus konnte Édith nicht erkennen, was das Interesse des jungen Mannes fesselte. Da sie ihm nicht auch noch den Gefallen tun wollte, ihre Neugier zu offenbaren, sackte sie in sich zusammen, statt sich zu recken, um zu spähen. Sie biss die Zähne aufeinander und zwang sich, in Gedanken die Vorteile eines Burgunders gegenüber einer anderen Rebsorte abzuwägen. Vielleicht beruhigte Alkohol ja schon, wenn man nur an ihn dachte.
Nach einer Weile klappte er die Mappe zu, sah zu ihr auf, dann wieder auf die Vorladung und anschließend noch einmal zu ihr. Diesmal musterte er sie eindringlich. »Ich denke, wir belassen es bei Madame Piaf.«
Es kostete Édith Mühe, still zu bleiben. Sie nickte kaum merklich.
Als spüre er, wie die Unruhe in ihrem Innersten brodelte, schlug er die Akte von neuem seelenruhig auf, blätterte darin. Offensichtlich hatte er viel Zeit – und den festen Willen, ihr zu beweisen, dass er stärkere Nerven besaß als sie.
Schließlich murmelte er beiläufig: »Sie sind Sängerin und im Deutschen Reich aufgetreten …« In beredtem Schweigen brach er ab.
Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen, fuhr es Édith durch den Kopf.
Laut sagte sie: »Ich reise gern.«
»Zu den Boches? Madame, Sie sind im Deutschen Reich aufgetreten!«
»Das bestreite ich nicht. Ich habe vor französischen Kriegsgefangenen gesungen.«
»In Deutschland!«
»Meine Zuhörer waren französische Kriegsgefangene«, beharrte sie.
Der Mann, dessen Namen sie nicht kannte, zog etwas zwischen den Papieren hervor. Es war eine Fotografie. Er schob sie über den Tisch zu ihr. Stumm wartete er auf ihre Reaktion. Doch was sollte sie dazu sagen? Sie leugnete ja keinen ihrer Auftritte im feindlichen Nachbarland.