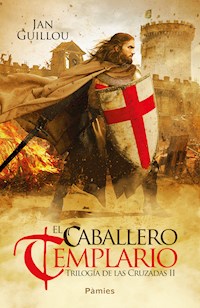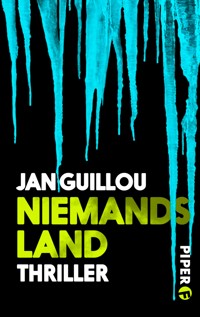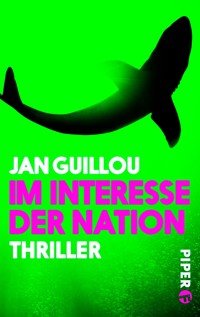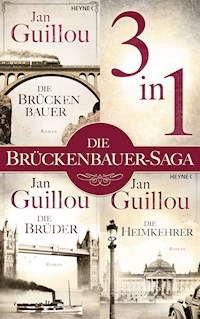4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Terrorangriff gegen Israel soll der größte der Weltgeschichte werden - so viel steht fest für die palästinensische Geheimdienstchefin Mouna al Husseini, genannt Madame Terror. Das technische Know-how holt sie sich bei den Russen: Gemeinsam wird ein gigantisches Atom-U-Boot aus Titan entwickelt, mit dem sich die israelische Flotte ausschalten lässt. Doch auf der U-1 Jerusalem prallen die Mentalitäten der russischen und der arabischen Besatzungsmitglieder aufeinander, und das gesamte Projekt droht zu kippen. Ein Oberbefehlshaber muss her, der fließend Russisch und Englisch spricht, weder Araber noch Russe ist und über umfassendes militärisches Wissen verfügt. Es kommt nur ein Mann infrage, ein alter Freund von Mouna al Husseini: Carl Hamilton, der unter dem Namen Charles Hamlon seit Jahren inkognito in Kalifornien lebt ... In diesem temporeichen Thriller betritt Carl Hamilton, der Held aus der erfolgreichen Krimiserie Bestsellerautors Jan Guillou, erneut die literarische Bühne und hat einen besonders brisanten Fall zu übernehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Übersetzung aus dem Schwedischen von Katrin Frey
ISBN 978-3-492-98100-2 © für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2014 © 2006 Jan Guillou Titel der schwedischen Originalausgabe: »Madame Terror«, Piratförlaget, Stockholm 2006 © des Nachworts: 2006 Piratförlaget Stockholm © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2007 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © Baldas1950 / shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 1. Auflage 2009
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
»Ich bin im Recht, ich übe Gerechtigkeit!«, sprach Kapitän Nemo zu mir. »Ich bin unterdrückt, und hier ist der Unterdrücker! Durch ihn habe ich alles verloren, was ich geliebt und verehrt habe: Vaterland, Weib, Kinder, Vater, Mutter, das alles sah ich zu Grunde gehen! Dort ist alles, was ich hasse! Schweigen Sie!« Ich warf einen letzten Blick auf das Kriegsschiff, welches seine Dampfkraft verstärkte.
Jules Verne,
Prolog
Die erste Version war offensichtlich gelogen. Offensichtlich schon deshalb, weil sie aus sogenannten »westlichen diplomatischen Kreisen« stammte – mit anderen Worten von der CIA in der amerikanischen Botschaft in Moskau. Zum anderen war diese Erklärung für den Tod von einhundertachtzehn russischen Matrosen und Offizieren an Bord des Atom-U-Boots Kursk etwas zu primitiv. Es hieß, ein mit Wasserstoffperoxid betankter Torpedo älteren Typs habe sich selbst entzündet und die fürchterliche Explosion verursacht, die zum Untergang des U-Bootes führte. Die Nato verwendete diese Torpedos wegen ihrer Unzuverlässigkeit seit über fünfzig Jahren nicht mehr.
Vielleicht war die Erklärung nur ein derber Witz eines CIA-Angestellten in irgendeiner Abteilung für politische Analyse und Desinformation. Denn die Kursk stellte gerade deshalb eins der wichtigsten Spionageziele der westlichen Welt dar, weil sie mit modernen Waffen ausgerüstet war, die allen Seestreitkräften der Nato und anderer westlicher Länder erschreckend überlegen waren.
Bereits 1995 hatten russische Wissenschaftler ein Torpedoproblem gelöst, mit dem sich Forscher und Entwickler seit der Erfindung dieser Waffe im 19. Jahrhundert herumgeschlagen hatten.
Ein Torpedo war im Prinzip nie mehr als eine längliche Bombe mit einer Sprengladung vorne und einem Propeller hinten gewesen. Immer wieder hatte man neue Methoden entdeckt, die Sprengkraft zu vervielfachen, die Steuerung zu verbessern und die Antriebskraft zu erhöhen. Doch im Grunde hatte sich zwischen den Neunziger jahren des 19. Jahrhunderts, als sich die Torpedos vierzig Kilometer pro Stunde vorwärtsbewegten, und den Neunzigerjahren des 20.Jahrhunderts, abgesehen von der doppelten Geschwindigkeit, nicht viel verändert.
1995 stellte der russische Wissenschaftler Anatolij Pawkin den von ihm entwickelten Torpedo VA-111Schkwal (Orkan) vor, der trotz seines beachtlichen Gewichts von zwei Tonnen eine Geschwindigkeit von über fünfhundert Kilometern pro Stunde erreichte.
Das Problem, das Anatolij Pawkin endlich gelöst hatte, sein großer Durchbruch, hatte mit dem Reibungswiderstand des Wassers zu tun. Ein Metallrumpf traf, wenn man ihn beschleunigte, auf einen exponentiell wachsenden Wasserwiderstand, woraus die scheinbar unüberwindbare Begrenztheit der Torpedogeschwindigkeit resultierte. Was kein strategisches Problem war, solange für alle das Gleiche galt.
Doch seit 1995 galt nicht mehr das Gleiche für alle. Anatolij Pawkins Erfindung beruhte auf der Idee, etwas anderes als Metall auf den Wasserwiderstand treffen zu lassen. Der neue Torpedo Schkwal bewegte sich in einer Gasblase vorwärts, und Gas war im Wasser schneller als Metall.
Als das Atom-U-Boot Kursk am 12. August 2000 von dem amerikanischen U-Boot USS Memphis versenkt wurde, war es mit der neuen Version VA-232Schkwal bestückt, die unter anderem über ein deutlich besseres Steuerungssystem verfügte. Aus diesem Grund waren die beiden Jagd-U-Boote der Los-Angeles-Klasse, USS Toledo und USS Memphis, zu der größten russischen Flottenübung seit sowjetischen Zeiten kommandiert worden. Sie sollten den Test dieser grauenerregenden neuen Waffe ausspionieren.
Die Anwesenheit der Amerikaner bei der Flottenübung in der Barentssee hatte auch einen politischen Beweggrund. Indem man sich der russischen Großmacht an die Fersen heftete, wollte man seine Verärgerung zum Ausdruck bringen beziehungsweise der Kursk drohen. Damit war die USS Memphis beauftragt. Das andere amerikanische U-Boot, die USS Toledo, sollte sich noch näher anpirschen, von der Seite Tonaufnahmen machen und exakte Messungen vornehmen, sobald die Russen einen Schkwal abfeuerten.
Wäre dieser Torpedo im Kalten Krieg zum Einsatz gekommen, hätte er mit einem Schlag das seemilitärische Kräfteverhältnis aus dem Gleichgewicht gebracht. Er hätte der Sowjetunion die Herrschaft auf den Meeren garantiert, weil kein Flugzeugträgergeschwader mehr vor ihm sicher gewesen wäre. Das Versenken von Flugzeugträgern war die Hauptaufgabe des Schkwal-Torpedos, und unter den Streitkräften innerhalb der Nato war bislang kein Gegenmittel bekannt.
Das war der wahre Grund, warum einhundertachtzehn russische Matrosen und Offiziere zwischen dem 12. und dem 20. August des Jahres 2000 starben. Man wusste, dass dreiundzwanzig Männer eine gewisse Zeit hinter dem neunten wasserdichten Schott im Heck des U-Boots überlebt hatten. Sie klopften an den Rumpf, um SOS-Signale zu schicken, und einige hinterließen Briefe, die nach sorgfältiger russischer Zensur teilweise veröffentlicht wurden. Doch die in der gesunkenen Kursk eingeschlossene Besatzung wartete vergeblich auf die Rettung, obwohl das U-Boot in nur hundert Meter Tiefe und auf flachem Sandboden leicht zugänglich war. Sie starben aus politischen Gründen.
Einer der politischen Gründe für die USA, ihre Verärgerung über die russische Übung in der Barentssee deutlich zu zeigen, war der Verkauf der neuen russischen Torpedowaffe an China. Daher waren an Bord des russischen Stabs- und Flaggschiffes, dem Atomkreuzer Peter der Große, auch einige chinesische Admiräle als Beobachter anwesend.
China drohte immer mal wieder damit, sich Taiwan zurückzuholen, das deshalb permanent von einem amerikanischen Flugzeugträgergeschwader geschützt wurde. Dieser Umstand galt lange Zeit als sichere Garantie dafür, dass China niemals einen Angriff wagen würde, wie sehr es seine Flotte auch modernisierte und verstärkte. Doch der Torpedo Schkwal an Bord von chinesischen U-Booten hätte auch hier die Machtverhältnisse aus dem Gleichgewicht gebracht.
Im schlimmsten Fall würde China den USA enorme Verluste bescheren können, falls sich die amerikanische Flotte in einen Wiedereroberungsversuch Taiwans einmischte. Die Chinesen würden behaupten, die Taiwanfrage sei eine innere chinesische Angelegenheit und man habe selbstverständlich nicht die Absicht, auf amerikanische Flottenkräfte zu schießen – solange man nicht zuerst beschossen werde. Woraufhin man zum Gegenangriff übergehen würde.
Hiervon hatten die einhundertachtzehn Besatzungsmitglieder an Bord der Kursk, dem Stolz der russischen Flotte, vermutlich nicht die geringste Ahnung gehabt. Doch für die Mehrzahl von ihnen war es sicherlich nichts Neues gewesen, während einer Übung von amerikanischen U-Booten bespitzelt zu werden. Amerikanische und sowjetische und später russische U-Boote hatten in den letzten fünfzig Jahren vor allem im Atlantik Katz und Maus gespielt. Mindestens acht russische und zwei amerikanische U-Boot-Wracks waren das Resultat dieser andauernden bitterernsten Spielchen.
In Anbetracht dessen, was vom Sinken der Kursk bekannt wurde, ehe der neu gewählte russische Präsident Wladimir Putin das Durchsickern von Information verhinderte, musste sich das Geschehen in etwa folgendermaßen ereignet haben:
An Bord der Kursk wurde bald bemerkt, dass man von einem amerikanischen U-Boot der Los-Angeles-Klasse, der USS Memphis, verfolgt wurde. Aber das war Teil des Spiels. Die USS Memphis sollte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, um von dem sehr viel aufdringlicheren Spion USS Toledo abzulenken.
Allerdings schien die russische Besatzung ihre beiden Bewacher entdeckt zu haben, denn plötzlich verschwand die Kursk von allen Bildschirmen an Bord der USS Memphis und der USS Toledo.
In den Kommandozentralen der beiden amerikanischen Jagd-U-Boote glaubte man wahrscheinlich, es mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Denn das Aufspüren und – im Falle eines Krieges – Vernichten dieser russischen Riesen war ihre Spezialität. Zudem war die Kursk hundertfünfzig Meter lang und acht Stockwerke hoch, ein riesiges Teil, das man aus so geringer Distanz eigentlich nicht aus den Augen verlieren konnte.
Gewiss war die Kursk ein strategisches U-Boot insofern, als es genau wie seine Vorgänger aus der Taifun-Klasse an jedem Ort der Weltmeere ein enormes Kernwaffenarsenal platzieren konnte. An Bord der Kursk befanden sich vierundzwanzig Interkontinentalraketen mit Mehrfachsprengköpfen, eine Kernwaffenladung, die dem Neunhundertsechzigfachen von Hiroshima entsprach.
Aber im Gegensatz zu ihren Vorgängern konnte sich die Kursk gegen sich anschleichende amerikanische Jagd-U-Boote zur Wehr setzen. Der Torpedo Schkwal eignete sich nicht nur zur Vernichtung von Flugzeugträgern.
Man kann sich also die Panik in den Kommandozentralen der beiden amerikanischen U-Boote ausmalen. Obwohl sie sich in nächster Nähe befanden, war die Kursk genau zwischen ihnen verschwunden, was an sich unmöglich war.
Es mangelte nicht an Erklärungsversuchen. Seichtes Wasser, Magnetismus, Temperaturunterschiede zwischen verschiedenen Wasserschichten und andere natürliche Erklärungen – doch das Schlimmste war, dass diese russischen Giganten trotz lärmender Kernreaktoren offenbar vorsätzlich »verschwinden« konnten. Das Problem mit den lauten Reaktoren galt allerdings für alle drei Boote. Wenn man selbst einen oder zwei Reaktoren an Bord hatte, hörte man zunächst einmal diese, wenn man hinaus in die schwarze Stille lauschte.
Im Nachhinein könnte man vielleicht meinen, die Amerikaner hätten unter diesen Umständen etwas vorsichtiger sein und anhalten sollen, um wenigstens einen Zusammenstoß zu verhindern.
Man wird nie erfahren, was die Amerikaner gedacht haben. Zumindest nicht in den nächsten fünfzig Jahren, solange die Berichte unter Verschluss sind. Aber in Anbetracht der historisch gewachsenen Rivalität zwischen den amerikanischen U-Boot-Besatzungen und der russischen, dem Katz-und-Maus-Spiel unter Feinden, kann man sich leicht vorstellen, dass die amerikanischen Befehlshaber nun einen härteren Ton anschlugen: Diese Schweine brauchen nicht zu glauben, dass sie uns so leicht an der Nase herumführen können, wir müssen diese verdammten Ratten kriegen, asap (»as soon as possible«) und so weiter. Die beiden amerikanischen U-Boote leiteten heftige Manöver ein, um wieder Kontakt zu der auf geheimnisvolle und peinliche Weise verschwundenen Kursk herzustellen.
Der Kommandant auf der USS Toledo wählte eine Variante der russischen Taktik, die in der amerikanischen U-Boot-Sprache Crazy Iwan genannt wurde. Er machte eine 180-Grad-Wende, um die Suche in der entgegengesetzten Richtung fortzusetzen.
Unglücklicherweise ging seine Rechnung auf. Die Kursk hatte ihre beiden Verfolger hinters Licht geführt, indem sie einfach ihre Tiefe verändert hatte und nahezu zum Stillstand gekommen war. Die USS Memphis auf ihren Fersen war daher über die Kursk hinweggeglitten – man muss sich das zufriedene, aber stille russische Lachen vorstellen, als sie merkten, dass ihr Trick funktioniert hatte –, und auch die USS Toledo hatte sich weit von der Kursk entfernt, mit der sie sich eigentlich Seite an Seite glaubte.
Doch nun hatte also die USS Toledo auf eine 180-Grad-Wende gesetzt und fuhr somit direkt auf die Kursk zu.
Als auf beiden U-Booten Alarmsignale die bevorstehende Kollision ankündigten, war es bereits zu spät. Die Katastrophe war unausweichlich.
Der Größenunterschied zwischen den beiden Fahrzeugen war beträchtlich, »so groß wie zwischen einem Schleppkahn und einem Atlantikdampfer«, äußerte sich ein russischer Admiral. Die USS Toledo wurde bei dem Zusammenprall erheblich beschädigt und konnte sich nur unter äußersten Schwierigkeiten und mit Unterstützung der amerikanischen Flotte nach Hause schleppen, nachdem sie wieder die Sicherheit internationaler Gewässer erreicht hatte. Allerdings hatte man eine Notboje hinterlassen; vermutlich war sie bei dem Zusammenstoß automatisch ausgelöst worden.
Durch den wahnsinnigen Lärm, den die Kollision der beiden U-Boote verursachte, konnte die Besatzung der USS Memphis die exakte Position der Kursk ermitteln, welche zudem ihre Geschwindigkeit erhöht hatte und somit nicht mehr zu überhören war.
Wie der Kommandant auf der USS Memphis nun reagierte und agierte, ist möglicherweise vor einem geheimen amerikanischen Kriegsgericht verhandelt worden. Bekannt ist, dass er einen Torpedo vom Typ Mark 48 direkt in den Rumpf der Kursk feuerte. Man möchte annehmen, dass er einen vernünftigen Grund dafür hatte, und die gängigste Theorie hierzu, um nicht zu sagen die einzige, besagt, er habe gehört – oder zu hören geglaubt –, wie die Kursk eine Torpedoluke für den Schkwal geöffnet und sich zum tödlichen Abschuss bereit gemacht habe.
Nur aus diesem Grund soll der amerikanische Kommandant seinen Torpedo abgefeuert haben. Die Logik dahinter war amerikanisch simpel: Er hat zuerst gezogen, aber ich habe schneller geschossen.
Die Wirkung auf die Kursk schien anfänglich bedrückend gering. Sie erhöhte die Geschwindigkeit, als wolle sie das Feld räumen. Doch nach zwei Minuten und fünfzehn Sekunden explodierte ein Großteil der Waffenladung im vorderen Torpedoraum, und das U-Boot sank auf den Grund.
Die USS Memphis entfernte sich langsam und ging auf eine Tiefe, von der aus sie kodierte Signale an die Heimatbasis senden konnte. Welche Befehle zurückkamen, ist nicht bekannt.
Dagegen weiß man, dass die USS Memphis anschließend gemächlich und gut sichtbar Norwegens Küste umrundete und Kurs auf Bergen nahm. Man legte eine Strecke, die normalerweise in zwei Tagen zu schaffen war, in sieben Tagen zurück. Das Manöver erinnerte an bestimmte Vögel, die eine Verletzung vorgaukelten, um von ihren wehrlosen Jungen abzulenken. In diesem Fall von der schwer beschädigten USS Toledo.
Die größte Katastrophe der Seefahrt des neuen Russlands war geschehen. Es war Russlands 11. September. Aber es bestand immer noch die Möglichkeit, die dreiundzwanzig überlebenden russischen Besatzungsmitglieder zu retten. Das U-Boot war in relativ flachem Wasser leicht zugänglich, und das Wetter bereitete keine großen Schwierigkeiten. Keiner Nation der Welt, die über eine mit U-Booten ausgestattete Flotte verfügte, fehlte es an der Ausrüstung für dieses einfache Rettungsmanöver.
Trotzdem mussten die dreiundzwanzig Überlebenden sterben; entweder erstickten sie, oder sie ertranken im allmählich eindringenden Wasser. Es kann zwei bis zehn Tage gedauert haben. Zwei Männer, die sich vollkommen einig waren, hatten den Tod der Seeleute beschlossen; der scheidende amerikanische Präsident Bill Clinton und Russlands frisch gewählter Präsident Putin.
Wladimir W. Putin war von seinem Paten Boris Jelzin mehr oder weniger gekrönt worden. Nach einigen Jahren an der Spitze eines Landes, das mittels Schocktherapie das gesamte staatliche Vermögen in private Hände übergeben hatte, um eine richtige und von der Weltbank anerkannte Demokratie zu werden, war die Familie Jelzin nun die reichste Familie in Russland. In Russland wusste das jedes Kind. Folglich wusste jeder, dass der junge ehemalige KGB-Offizier Putin nur ein Schoßhund seines Paten Jelzin war.
Präsident Putin machte Urlaub in Sotschi am Schwarzen Meer. Und er verweilte dort erstaunlich lange.
Aber schon am zweiten Tag nach der amerikanischen Torpedierung der Kursk bekam er Besuch von seinem Verteidigungsminister, Marschall Igor Sergejew, der ihm einerseits einen vollständigen Bericht dessen überbrachte, was man bislang über das Versenken der Kursk durch die MSS Memphis wusste, und andererseits riet, sich nicht überstürzt nach Moskau zu begeben, weil die Amerikaner das als einen Hinweis auf Krieg hätten deuten können. Sie hatten schließlich zuerst geschossen.
Eine Sache steht fest: Der unerfahrene Staatsmann, der seine gesamte berufliche Laufbahn im abgeschlossenen und äußerst disziplinierten KGB hinter sich gebracht hatte, geriet keineswegs in Panik. Er griff zum Hörer und rief den amerikanischen Präsidenten an.
Keine vierundzwanzig Stunden später landete George Tenet, der damalige Chef der CIA, in Moskau. Mit wem er die Verhandlungen führte, weiß man nicht – Putin hielt sich immer noch in Sotschi auf –, aber das Ergebnis ist bekannt. Russland wurden Schulden in Milliardenhöhe erlassen und ein neuer Kredit über 10,2Milliarden Dollar zu erstaunlich günstigen Bedingungen gewährt.
Dass keine Überlebenden von der Kursk auftauchten und von den Vorfällen berichten konnten, war natürlich die Voraussetzung für dieses Geschäft.
Die zur damaligen Zeit noch halbfreie Presse brodelte vor Gerüchten, die auf den Aussagen verschiedener Admiräle beruhten – deren Version besagte übereinstimmend, das amerikanische U-Boot USS Memphis habe die Kursk versenkt. Und Putin musste grauenhafte Begegnungen mit den Angehörigen der Besatzungsmitglieder über sich ergehen lassen, als er – nachdem alle Übereinkünfte mit den USA getroffen und die Besatzung an Bord der Kursk garantiert tot war – hinauf nach Murmansk fuhr. Er musste sich die Vorwürfe der unbändig trauernden Angehörigen der gefallenen Seeleute anhören.
Nach diesen Erfahrungen zog Putin einige sehr konkrete Konsequenzen. Unter anderem brachte er die Presse ein für alle Mal zum Schweigen und verbannte die neuen Medienmogule ins Ausland. Außerdem kehrte er zur klassischen sowjetischen Strategie zurück, seine Macht einerseits auf die Streitkräfte und andererseits auf den umorganisierten KGB zu gründen.
Er entließ alle Admiräle, die ausgesagt oder auch nur angedeutet hatten, die Kursk sei von den Amerikanern torpediert worden, und seinen Vizepremierminister, der dasselbe behauptet hatte. Anschließend beauftragte er den Generalstaatsanwalt, einige tausend Seiten voller wünschenswerter Folgerungen zu »erarbeiten«. Schlussendlich lautete die offizielle russische Version, ein Torpedo älteren Typs habe sich im Torpedoraum der Kursk selbst entzündet. Eine andere Ursache habe das Unglück nicht.
Dem CIA-Angestellten in der amerikanischen Botschaft, der sich diese beinahe zynische Erklärung ausgedacht hatte, muss etwas mulmig zumute gewesen sein, als sein grober Scherz zur gültigen russischen Version der Ereignisse erhoben wurde.
Doch der neue Präsident Putin zog noch weiter reichende Konsequenzen. Eine bestand darin, die Stärke des neuen Russlands auf militärische Macht zu gründen. Und hierbei wollte man nicht wie früher auf Quantität setzen. Zum Beispiel auf unzählige Panzer, die den Feind in Westeuropa buchstäblich hätten überrollen können. Im Gegenteil: Die überlegene Technologie, über die bereits die Kursk verfügt hatte, sollte weiterentwickelt werden. Die Gehälter in der Flotte wurden um zwanzig Prozent erhöht, alle noch ausstehenden Gehälter wurden ausgezahlt. Und die Angehörigen der Kursk-Besatzung bekamen zwischen fünfundzwanzigund dreißigtausend Dollar als Entschädigung – für russische Verhältnisse unermessliche Summen.
Russland wollte die amerikanische Vormacht auf den Weltmeeren in Frage stellen. Natürlich nicht durch direkte Konfrontation, sondern indem man – gegen gute Bezahlung – russische militärische Technologie an die Feinde der USA verkaufte.
Die Familie Jelzin wurde von Putin schnell kaltgestellt. Allein der Umstand, dass die gesamte alte KGB-Garde im neu gebildeten FSB (eine russische Übersetzung von »FBI«) Putin vergötterte, führte dazu, dass Jelzin sich mit den Dollarmilliarden begnügen musste, die er bereits ergaunert hatte. Im Grunde musste er seinem Schoßhündchen sogar dankbar sein, dass er weder seine Freiheit noch sein Leben oder seine körperliche Unversehrtheit einbüßte.
Nachdem Putin, wie viele Russen es mit Fug und Recht empfanden, die Besatzung der Kursk im Stich gelassen hatte, sackten seine Sympathiewerte zwar in den Keller, doch auch hiergegen fand er schnell ein Mittel. Vor allem dehnte er die staatliche Kontrolle über das Fernsehen aus. Während des Präsidentschaftswahlkampfes 2004 trat er in den Videoclips von bekannten Rockstars auf, führte seine Kunstfertigkeit auf der Judomatte vor und zeigte Bilder von sich beim Telefonieren mit dem neuen, harmlosen und leicht dämlichen amerikanischen Präsidenten, George W. Bush. Er erhielt 72,2Prozent der Stimmen. Seitdem hatte er Russland mit eisernem Griff unter Kontrolle.
Die erfundene Geschichte vom explodierten altertümlichen Torpedo entwickelte sich zur international gültigen Version dessen, was in Wahrheit Russlands 11. September gewesen war. Im Übrigen passte diese Theorie gut zu der Vorstellung, Russland stünde im Allgemeinen und ganz besonders als militärische Macht vor dem Zerfall.
Doch in der internationalen Bruderschaft sub rosae (»Unter der Schweigerose«), das heißt in allen Nachrichtendiensten der Welt, wurde die wahre Geschichte der Kursk bereits einige Monate nach der Katastrophe in der Barentssee im August 2000 bekannt.
Für Geheimdienstler lagen einige Schlussfolgerungen auf der Hand. Russland verfügte über ein enormes militärtechnologisches Potenzial. Und im Hinblick auf U-Boot-Technologie erarbeitete sich Russland gerade einen beachtlichen Vorsprung. Was einige Jahre zuvor als Zufall oder pures Glück betrachtet worden war, nämlich dass es einem russischen U-Boot der gigantischen Anteus-Klasse, möglicherweise der Kursk selbst, gelungen war, sich durch die streng überwachte Straße von Gibraltar ins Mittelmeer zu schleichen, war vielleicht gar kein Glück gewesen. Die Russen waren den Amerikanern in der U-Boot-Technologie vielleicht wirklich überlegen. Das war neu.
Gewiss hatten sich russische Flugzeuge und gewisse Teile der sowjetischen Marine ebenso wie die Raumfahrt oft mit der westlichen Konkurrenz messen, sie hin und wieder sogar übertreffen können. Aber die Sowjetunion hatte sich stets selbst ausgebremst, indem ihre militärische Führung den Zweiten Weltkrieg noch einmal vorbereitet hatte und überzeugt davon gewesen war, dass das Heil in einer schieren wenngleich überwältigenden quantitativen Überlegenheit zu suchen sei. Man hätte hunderttausend Panzer nach Berlin schicken können.
Nachdem jedoch das neue Russland die kostenintensive und außerdem vollkommen aussichtslose Strategie der quantitativen Überlegenheit aufgegeben hatte, um stattdessen auf hoch entwickelte Forschung zu setzen, veränderte sich die Lage. Man hatte die russische U-Boot-Technologie unterschätzt. Sogar einem so gigantischen Fahrzeug wie der Kursk war es zu seinem eigenen Unglück gelungen, zwei amerikanische Jagd-U-Boote in die Irre zu führen. Und zwar so weit, dass der Kapitän der USS Memphis, dessen Namen wir nicht kennen, die Nerven verloren und etwas unternommen hatte, was im gesamten Kalten Krieg nicht passiert war: Er hatte abgedrückt.
Wenn die Russen nun beabsichtigten, den Export dieser Technologie zu steigern, wurde damit, ganz abgesehen vom finanziellen Gewinn, den man damit erzielen konnte, die amerikanische Vorherrschaft über die Weltmeere unterminiert. In der amerikanischen Flotte wurde der VA-232-Schkwal der Einfachheit halber als »Flugzeugträgerkiller« bezeichnet. Das sagte alles.
Das russische Jahresbudget für die gesamte U-Boot-Flotte betrug zum Zeitpunkt der Torpedierung der Kursk weniger als siebzig Millionen Dollar. Diese Zahl stimmte in vieler Hinsicht nachdenklich und wurde von allen bekannten Nachrichtendiensten der Welt, vom MI6 und der CIA im Westen bis zur ISI in Pakistan, auf Tausenden von Seiten analysiert.
Das größte Interesse, und die konkretesten und innovativsten Ideen, weckte sie bei einem Geheimdienst, der eher wenig bekannt war. Und das, obwohl er in vieler Hinsicht genauso effektiv arbeitete wie sein berühmter Hauptfeind, der israelische Geheimdienst Mossad. Seine Effektivität beruhte unter anderem auf den großen Ähnlichkeiten mit eben diesem Mossad.
Es war eine Schwäche: Sie hatte keinen Respekt vor Engländern. Zumindest nicht vor Engländern, die im öffentlichen Dienst arbeiteten und sich selbst als civil servants bezeichneten. Eine eigentlich typisch englische Untertreibung, denn als servants, also Diener, begriffen sich solche Gestalten ganz und gar nicht. Wenn sie in der Ausübung ihres Dienstes überhaupt eine Aufgabe erkannten, dann bestand diese eher darin, die britische Öffentlichkeit hinters Licht zu führen, als ihr zu dienen.
Vielleicht lag es auch daran, dass sie eine Frau war und diese gut gekleideten Snobs mit dem tadellosen Benehmen ständig den Eindruck erweckten, mit ihrer Weiblichkeit nicht umgehen zu können. Wenn sie diesen Männern begegnete, konnte sie sich mitunter nur schwer gegen unpassende Fantasien zur Wehr setzen. Mitten in einem Vortrag eines dieser Männer im gut sitzenden Anzug musste sie plötzlich an Würgehalsbänder mit Nieten denken, wie sie Rocker und Punks von New York bis Beirut trugen. In der Woche ihrer Ankunft in London hatte ein weiterer Minister beziehungsweise ein hohes Parteimitglied seinen Platz räumen müssen, weil News of the World enthüllt hatte, dass der brave Familienvater des Öfteren Gast in einem Schwulenbordell gewesen war, das solche speziellen Spielzeuge bereithielt.
Zu seinem Glück ging das Ende seiner Karriere in einem sehr viel größeren Ereignis unter, das sogar die Londoner Presse vorübergehend ihre Sexfixierung vergessen ließ. London hatte seinen 11. September erlebt. Drei Selbstmordattentäter hatten in der Untergrundbahn und in einem Bus zugeschlagen. Es hatte zweiundfünfzig Tote gegeben.
Der Angriff war nicht überraschend gekommen, und die Verluste in der Londoner Bevölkerung waren verhältnismäßig gering gewesen. Aber dem Entsetzen und der Terrorhetze, die nun in der britischen Öffentlichkeit und den Medien grassierten, lagen auch nicht die Toten, sondern die Tatsache zugrunde, dass die Terroristen Einheimische gewesen waren. Der erste Anschlag auf London war also nicht wie erwartet von irgendwelchen saudiarabischen Fanatikern aus Osama bin Ladens Gangsterbande verübt worden, sondern von britischen und sogar recht wohlgeratenen Jugendlichen. Sie selbst fand das nicht überraschend. Aber es war klar, dass dieses angebliche Mysterium eines der Hauptthemen in den kommenden beiden Sitzungen sein würde.
Sie war lieber zu Fuß gegangen, als sich von ihren britischen Gastgebern ein Taxi bestellen zu lassen. Von ihrem Hotel in St.James’s Place war es nicht weit über die Themse, und für Juli war es in London nur mäßig kalt. Auf der Vauxhall Bridge blieb sie stehen und betrachtete das grüne und gelbweiße Gebäude, das an eine große arabische Hochzeitstorte erinnerte. Genau in der Mitte der Torte befanden sich die großen Sitzungssäle mit den hohen Fenstern, in denen das internationale Treffen stattfinden sollte. Zwei Stockwerke darüber lagen wie in einer Art Hochsitz oder Kanzel die Büros der Bosse. Von ihrem Standort auf der Brücke hätte sie ohne weiteres beide Ziele mit dem RPG, einem Granatgewehr, treffen, nachladen und noch einmal schießen können. Sie hätte die Waffe über das Brückengeländer geworfen und wäre denselben Weg zurückgerannt, den sie gekommen war, und wäre mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr fünfzig Prozent davongekommen.
Die Welt war voller Terrorziele.
Außerdem war die Welt voller Ziele, die bedeutend besser waren als die, die sich Problemjugendliche im Nahen Osten und mittlerweile auch in Westeuropa aussuchten. Aber die westliche Welt und vor allem diese westlichen Experten da oben in den so leicht zu treffenden Sitzungssälen, waren Meister darin, die Gefährlichkeit des Feindes zu übertreiben. Ob das auf mangelhafter Geheimdienstarbeit und Naivität beruhte oder Absicht war, ließ sich nicht genau ausmachen.
Sie öffnete ihre Handtasche und kontrollierte zum letzten Mal Lippenstift und Lidschatten in einem Taschenspiegel mit goldenem Rahmen, dann zog sie den hellen italienischen Mantel enger zusammen und ging rasch das letzte Stück über die Brücke, umrundete das Haus und stand vor dem Diensteingang. Offensichtlich war sie am heutigen Tag die Einzige unter den Gästen, die diesen Weg wählte, denn es hatte sich keine Schlange gebildet. Auf einem Schild stand, man dürfe keine Fahrräder mit hineinnehmen, und hinter dem Panzerglas saß wieder so ein pensionierter Obergefreiter aus Her Majesty’s Reitergarde, der natürlich sofort munter wurde, als er etwas so Verdächtiges wie eine dunkelhaarige und aller Wahrscheinlichkeit nach ausländische Frau entdeckte. Er herrschte sie an, sie möge sich bitte ausweisen.
Wortlos legte sie ihren gut gefälschten britischen Pass und die Einladung vom Chef vor. Der Obergefreite zwirbelte nachdenklich seinen Schnurrbart, während er ihre Papiere betrachtete.
»Brigadegeneral al-Husseini, stimmt das?«, brüllte er.
»Ja, Sir, das stimmt«, antwortete sie übertrieben leise und mit schüchtern gesenkten Lidern, ein Scherz, über den sie sich freute wie ein Kind.
»Einen Augenblick, Madame, Verzeihung, ich meine, Brigadegeneral. Routine, Sie wissen schon«, sagte der Obergefreite und griff zum Telefonhörer.
Drei Minuten später kamen zwei Gestalten in Nadelstreifen atemlos herunter und nahmen sie mit in die Sitzungsetage.
Die langwierigen Sitzungen des ersten Tages enttäuschten sie ganz und gar nicht. Es waren nämlich, genau wie sie erwartet hatte, eher religiöse Zusammenkünfte als Arbeitstreffen. Abgesehen von Kleidung, Sprache und einigen besonderen Ritualen war es ungefähr so wie bei der Hamas oder der Hisbollah. Vielleicht glich das Treffen auch eher einer Parodie auf die UNO – ein internationaler Kongress, der sich versammelt hatte, um über das Thema »Die fürchterliche terroristische Bedrohung, die unsere tägliche und unverbrüchlich loyale Zusammenarbeit erfordert« zu sprechen. Die seltsamsten Delegaten taten ihre Standpunkte kund, zum Beispiel Russen und Weißrussen, deren Verhältnis zum Terrorismus nüchtern betrachtet darin bestand, dass sie ihn energisch betrieben. Oder Schweden, Esten, Finnen, Norweger und Letten, die sich außerordentlich zu freuen schienen, dass sie an einer prestigeträchtigen internationalen Konferenz teilnehmen durften, und offenbar gar kein Interesse hatten, ihre Meinung zu sagen. Dies hier war Diplomatie und keine konkrete Aufklärungsarbeit.
Hier ging es nur um Anwesenheit. Sie saß hinter einem palästinensischen Fähnchen, nur wenige Meter entfernt vom israelischen Mossad. In nichts anderem bestand ihr Auftrag. Das Treffen war lediglich eines der vielen Symptome der globalen Neuordnung, die der 11. September eingeleitet hatte und die durch den neuerlichen Terroranschlag in der vergangenen Woche in London forciert worden war.
Sie saß die langen Sitzungen ab, ohne einzuschlafen und ohne Grimassen zu ziehen oder an den falschen Stellen zu lachen. Beim Mittagessen landete sie neben einem Russen, der sie in einem holprigen Englisch davon zu überzeugen versuchte, dass Osama bin Laden hinter dem ganzen Ärger in Tschetschenien steckte. Sie verzichtete bewusst darauf, ihm zur Hilfe zu kommen, und wechselte nicht ins Russische.
Sir Evan Hunt war ein unzufriedener Chef. Bis vor kurzem war seine Karriere tadellos verlaufen, und gemäß den Plänen seiner lieben Gattin war er sogar geadelt worden. Doch anstatt Chef des gesamten Auslandsnachrichtendienstes MI6 zu werden, in den letzten Jahren durchaus Ziel seines Karriereplans, war er schräg hinaufgekickt worden. Nun war er stellvertretender Chef und Beauftragter für die internationale Zusammenarbeit. Man hatte ihm einzureden versucht, dieser Job sei in Anbetracht der Bedeutung internationaler Zusammenarbeit in einer veränderten Welt nach 9/11 der allerwichtigste Job im MI6. Der Kalte Krieg sei beendet, und somit wäre es auch weitgehend aus mit dem traditionellen Sport, in Osteuropa Agenten zu rekrutieren – aus und vorbei mit der ganzen feinen, alten Geheimniskrämerei. Und es sei ja bekannt, dass es Sir Evan missfiele, dass moderne nachrichtendienstliche Arbeit sich mehr auf die Technik als auf menschliche Quellen stütze. Außerdem agiere der neue Feind global, was einen Ausbau der internationalen Zusammenarbeit erfordere, blablabla, und der heutige Krieg sei asymmetrisch, blablabla – das übliche Geschwafel. Flugzeugträgergeschwader könnten nun mal keine Gruppe von religiösen Fanatikern daran hindern, auf Big Ben zu klettern und sich in die Luft zu sprengen.
Der konservative Sir Evan hielt den Kampf um die Rohstoffreserven auf der Erde, den good old imperialism, für bedeutend wichtiger als diese grassierende Panikkampagne wegen der Terroranschläge. Doch obwohl seine Analyse auf einer dreißigjährigen Laufbahn im britischen Geheimdienst beruhte, war sie kaum dazu angetan, politische Entscheidungsträger zu beeindrucken, die lieber auf die Boulevardpresse hörten.
Es lag Sir Evan jedoch fern, seinem Ärger über diese falsche Gewichtung geheimdienstlicher Arbeit in den westlichen Staaten Luft zu machen, solange der unglückselige oder zumindest mäßig brillante George W. Bush dem Terrorismus den Kampf angesagt hatte. Ebenso wenig wäre ihm eingefallen, sich über das plötzliche Stagnieren seiner Laufbahn zu beklagen. Wenn sich die rechte Gelegenheit bot, würde er die Karriereleiter schon noch um ein paar Dienstgrade hochklettern. Und dafür war es unverzichtbar, nie als Jammerlappen dazustehen.
Folglich empfing er den ihm direkt unterstellten Verbindungsoffizier Lewis MacGregor in bester Laune, um nicht zu sagen enthusiastisch. Aus Erfahrung hielt er es für nötig, den jungen MacGregor auf das Treffen mit seinem palästinensischen Widerpart Mouna al-Husseini vorzubereiten. Ansonsten bestand das nicht unerhebliche Risiko, dass MacGregor zu tief in ihre dunklen Augen blickte und vergaß, wen er vor sich hatte.
»Eine Sache muss Ihnen verdammt klar sein, junger Mann«, begann Sir Evan. »Sie haben es nicht mit einer schönen Frau zu tun, jedenfalls nicht nur. Nebenbei ist sie nicht ganz Ihre Altersklasse. Aber in erster Linie ist sie eine mit allen Wassern gewaschene Mörderin. Ist das klar?«
»Ja, Sir, absolut«, antwortete MacGregor.
»Ich habe ihre Akte hier, die können Sie sich später angucken, obwohl sie wahrscheinlich unvollständig ist. Es dürfte jedoch daraus hervorgehen, dass wir es mit einer außerordentlich gebildeten Frau mit sehr langem Atem zu tun haben. Ihren ersten Israeli tötete sie im Alter von acht Jahren, sie hat in Gaza Handgranaten geworfen …, wurde von Mohammed Odeh, besser bekannt als Abu Daoud, persönlich entdeckt, dem Mann hinter dem Anschlag von München 1972, dem militärischen Vater des palästinensischen Geheimdienstes, wenn man die Sache vorsichtig ausdrücken möchte. Sie hat eng mit Ali Hassan Salameh zusammengearbeitet, der die Force 17 gründete und CIA-Verbindungsoffizier bei den Palästinensern war … ja, und so geht es weiter. Studium an der American University of Beirut … glauben Sie nicht, Sie könnten sich auf Ihre sprachliche Überlegenheit verlassen. Und dann Mord an … das ist vielleicht weniger interessant … dreijährige Ausbildung an einer russischen Spionageschule in Pjöngjang. Das klassische Zeug hat sie also drauf. Aber das Wichtigste ist wahrscheinlich … sie arbeitet schon seit längerem nicht mehr draußen bei Einsätzen, die Zeit der kleinen Morde hat sie sozusagen hinter sich. Sie hat sich im vergangenen Jahrzehnt im politischen Geheimdienst der PLO immer höhere Dienstgrade erworben. Obwohl sie eine Frau ist. Mag sein, dass man dem MI6 hin und wieder vorwirft, Frauen keine Chance zu geben, weil wir so ein … so eine Organisation sind … Aber eine Frau, die stellvertretende Chefin und Beauftragte für alle internationalen Verbindungen in einer arabischen Spionageorganisation wird, kann wahrlich kein Grünschnabel sein. Richtig?«
»Vollkommen richtig, Sir, ich muss Ihrer Analyse wirklich zustimmen, Sir«, antwortete der ziemlich geplättete MacGregor. Einerseits, weil er sich wie ein kleiner Junge behandeln lassen musste, obwohl er beachtliche Mühe darauf verwendet hatte, sich in Mouna al-Husseinis Akte einzulesen, und andererseits, weil man ihm beigebracht hatte, dass Frauen auch konnten, was Männer konnten. Eine Erkenntnis, die bei den älteren Kerlen in der Firma, solchen wie Sir Evan, noch nicht richtig angekommen war.
Aber trotz seiner guten Vorbereitung war MacGregor augenblicklich von ihrer Erscheinung in den Bann geschlagen, als die Tür aufging und sie auf ihn zukam. Natürlich hatte sich in ihrer Akte das eine oder andere körnige Schwarzweißfoto gefunden, Bilder von einer Soldatin mit Kufiya auf dem Kopf und in einer Uniform, die natürlich für einen Mann geschneidert war. Doch die Frau mittleren Alters, die nun in seinem Büro stand, sah wie eine Dame der spanischen oder italienischen Oberschicht aus. Jedenfalls mit Sicherheit nicht wie eine Berufsmörderin und schon gar nicht wie eine Kollegin, die ihm außerdem rangmäßig weit übergeordnet war. MacGregor war Captain der Reserve.
Mouna war auf das Treffen mit dem jungen MacGregor vollkommen unvorbereitet, sie hatte einen der alten Recken erwartet, die sich alle benahmen, aussahen und vor allem klangen wie Kabinettssekretäre im Außenministerium. Sie schlussfolgerte, man habe eine Art Trainee für sie ausgesucht, weil man die neue Zusammenarbeit mit den Palästinensern eher für symbolisch erachtete. Das war ihr ganz recht.
Während er hektisch seine britischen Höflichkeitsfloskeln herunterratterte, sah sie ihn sich genau an; sie wünschte Milch zum Tee und bat darum, wie es sich in der britischen Oberschicht aus irgendwelchen Gründen gehörte, dass man ihr die Milch zuerst servierte. Er machte einen netten und freundlichen Eindruck und wirkte mit seinen roten Haaren und seinem Akzent, wenn man es nicht sogar als Dialekt bezeichnen konnte, fast wie die Karikatur eines Schotten.
»Madame Brigadegeneral«, begann er nervös, als sie in ihren Teetassen rührten, »ich denke, wir haben lediglich zwei Punkte auf der Tagesordnung. Der eine berührt die Frage, wie der Geheimdienst Ihrer Majestät die PLO darin unterstützen kann, geplanten Terroraktionen im Nahen Osten vorzubeugen. Der andere Punkt ist folglich, wie uns die PLO im Gegenzug mit Informationen über terroristische Aktivitäten auf britischem Territorium versorgen kann. Sind wir uns so weit einig, Brigadegeneral?«
»Ja, absolut«, antwortete sie mit aufrichtigem Lächeln. Die Sache würde viel einfacher werden, als sie erwartet hatte.
Sein Problem bestand darin, dass er den Anschein erwecken musste, ihre Zusammenarbeit habe etwas Gegenseitiges an sich; als könnten die Briten im Austausch gegen Informationen über eventuelle weitere Terroranschläge in Großbritannien irgendetwas liefern, was für die Palästinenser von Interesse war.
Mouna widerstand der Versuchung, eine ironische Bemerkung über die Durchschaubarkeit seines Vorschlags zu machen, und erklärte stattdessen ruhig und in sorgsam gewählten Worten – ihrer Erfahrung nach empfanden Männer Frauen, die langsam sprachen, als seriöser –, dass terroristische Aktivitäten in London, die von Palästinensern, Pakistanis, Immigranten der zweiten Generation oder anderen Personen ausgeführt würden, die man als »Muslime« bezeichnen könne, eines der größten Probleme der palästinensischen Freiheitsbewegung darstellten. Der freie palästinensische Staat in Gaza und im Westjordanland, also den Teilen, die nicht von den Israelis besetzt seien, könne sich nicht ohne kräftige internationale Unterstützung erheben. Vor allem von den USA und der EU erwarte man Hilfe. Jeder Terrorakt, egal in welchem Teil der Erde er sich ereigne, sogar unter den australischen Hippies an den Stränden Indonesiens, aber natürlich umso mehr in London, schwäche die diplomatische Rückendeckung für die Palästinenser. Folglich hätten die Palästinenser großes Interesse, weitere Terrorakte in London zu verhindern. Dieser Angelegenheit würde vom palästinensischen Geheimdienst momentan allerhöchste Priorität beigemessen. Beinahe hätte sie bei der dicksten Lüge des Tages die Maske fallen lassen. Doch er kaufte ihr den Sermon ab und machte einen nahezu erleichterten Eindruck. Vermutlich hatte er mit einer der üblichen Kampagnen gerechnet, in denen die Vertreter von Dritte-Welt-Ländern mehr aus Prinzip denn mit ernsten Absichten darauf bestanden, dass man die Verhandlungen auf Augenhöhe führe. Um diese Peinlichkeit war er herumgekommen.
»Well, Captain MacGregor, dann sind wir ein Stück weiter«, seufzte sie erleichtert und in diesem Moment vollkommen aufrichtig. »Haben Sie etwas dagegen, wenn wir einige, sagen wir, bürokratische Probleme hinter uns bringen?«
Sie sah so entspannt aus, dass er nicht erkennen konnte, ob die schnellen Fortschritte, die ihr Gespräch machte, sie überraschten.
»Natürlich nicht, Madam Brigadegeneral«, antwortete er prompt. »Haben Sie an etwas Bestimmtes gedacht?«
»Ja, in der Tat. Wenn ich es richtig verstanden habe, bilden Sie und ich ab heute das Bindeglied zwischen der palästinensischen Befreiungsorganisation, der PLO, und dem Geheimdienst Ihrer Majestät, stimmt das?«
Sie betonte jede Silbe der formellen Bezeichnungen ihrer beider Organisationen und sprach sie mit deutlicher Ironie aus, was ihn ohne Zweifel amüsierte.
»Ganz richtig, Madam«, sagte er. »Sie sind die Frau des Präsidenten und ich der Mann der Königin. Aber worin besteht das Problem?«
Sie gab vor, besorgt zu sein: Schließlich existiere da ein kleines Hindernis. MacGregor arbeite für den MI6, den Teil des Geheimdienstes Ihrer Majestät, der sich nur mit Auslandsfragen beschäftige. Aber die eventuellen Kenntnisse der PLO bezüglich Problemen oder Bewegungen auf britischem Terrain beträfen natürlich eher den Inlandsdienst MI5.
Dies sei aus rein praktischer Perspektive vielleicht kein sehr günstiges Arrangement. Doch auf der anderen Seite gebe es Gesetze und Vorschriften, gegen die wohl nicht viel auszurichten sei.
Tja, in kritischen Situationen könne es zu fatalen Verzögerungen kommen, ehe die Informationen vom MI6 zum MI5 draußen im Feld weitergeleitet würden. Doch mit diesem möglicherweise bürokratischen, ja, zweifellos bürokratischen Nachteil werde man wohl leben müssen. Gesetze und Bestimmungen, so sei es eben.
Sie sah ihn betrübt an. Er tröstete sie damit, dass er am kommenden Tag die Ehre haben werde, ihr beim Höflichkeitsbesuch bei der Terrorabteilung des MI5 zur Seite stehen zu dürfen.
»Sehr gut. Dann lassen Sie uns über das morgige Treffen reden«, sagte sie.
»Selbstverständlich. Haben Sie bestimmte Wünsche?«
»Ja, das habe ich. Dies ist meine erste und vielleicht einzige Begegnung mit dem MI5, und ich wäre außerordentlich dankbar, wenn Sie dort anrufen und ankündigen könnten, dass ich gern eine Analyse unserer gemeinsamen Probleme aus Sicht der PLO in einem zwanzigminütigen Vortrag darstellen würde. Ich meine zwanzig Minuten, nicht einundzwanzig oder neunzehn, ohne unterbrochen zu werden. Die Vorgesetzten sollen selbst entscheiden, welche Angestellten mir zuhören dürfen. Hundert Personen oder zwei, das macht keinen Unterschied. Aber ich will meine zwanzig Minuten. Ich gehe davon aus, dass Sie als mein Verbindungsoffizier mich zu dem Treffen fahren?«
»Es wird mir eine Freude sein«, antwortete MacGregor, bevor ihm klar wurde, dass er auf einen der ältesten Überredungstricks der Welt hereingefallen war. Sie hatte zunächst eine unangemessene Forderung gestellt und dann eine kleine Frage angefügt, auf die er einfach mit Ja antworten musste. Sie stand auf, und er musste ihr als Gentleman in den eleganten Mantel helfen. Schließlich reichte sie ihm die Hand zum Abschied.
»Aber, Madame, ich bin nicht ganz sicher …«, setzte er an.
»Ich gehe davon aus, dass Sie mich um acht Uhr fünfzehn abholen«, fuhr sie unbeschwert fort, während sie an den weiten Ärmeln des Mantels zupfte. »Ich wohne im Duke’s Hotel in St.James’s Place, nicht ganz leicht zu finden, aber Sie werden es schon schaffen. Es war mir ein Vergnügen …«
»Gestatten Sie mir eine letzte Frage!«, startete er einen neuen Versuch, während er gleichzeitig ihren Abgang aus einem der am besten geschützten Gebäude in Großbritannien vorbereiten musste.
»Selbstverständlich«, log sie.
»Wenn es uns möglich wäre, Ihre zwanzigminütige Präsentation zu arrangieren, worüber würden Sie dann sprechen wollen?«
»Oh, nur über das Allerwichtigste«, sagte sie. »Zwei Dinge: Welchen ohnehin ungefährlichen Feinden widmet ihr euch, und welche wirklich gefährlichen Feinde macht ihr euch gerade? Mit euch meine ich Großbritannien. Wir sehen uns morgen!«
Er blieb eine Weile wie gelähmt hinter dem Schreibtisch sitzen. Ihm war, als müsse er erst mal verschnaufen. Es lag auf der Hand, dass diese Frau kein Grünschnabel war. Sir Evan hatte Bescheid gewusst. Und daraus konnte man schließen, dass sie nicht zum ersten Mal dabei war, dachte er und musste über seine eigene, nicht sonderlich scharfsinnige Schlussfolgerung lachen. Nicht zum ersten Mal war vermutlich die Untertreibung des Tages, wenn nicht des Monats.
Was ihm nun bevorstand, hatte er sich selbst eingebrockt. Da musste er durch. Seine wenig beneidenswerte Aufgabe bestand darin, seine mitunter auf groteske Weise feindseligen Kollegen beim MI5 anzurufen und zu versuchen, ihnen eine Tagesordnung für das morgige Treffen vorzuschreiben. Keine leichte Sache.
Im Gegensatz zu ihrem Partner Lewis MacGregor war Mouna al-Husseini außerordentlich gut gelaunt gewesen, als sie das hässliche, tortenähnliche Gebäude verlassen hatte. Labbrige alte Pistazien gemischt mit Humus, einem Püree aus Kichererbsen, dachte sie. Nach diesen Farben hatte sie gesucht. Merkwürdige Torte.
Die Hälfte des Weges hatte sie zurückgelegt. Nun brauchte morgen nur noch der MI5 anzubeißen. Dann wäre die große Operation, die größte aller Zeiten, wahrscheinlich in trockenen Tüchern.
Zuerst fuhr sie mit dem Taxi ins Hotel und zog sich eine Jeans und einen schwarzen Ledermantel aus einem spanischen Modehaus über, dessen Namen sie vergessen hatte. Dann schlenderte sie in die Stadt. Vom Duke’s Hotel war es über die St.James’s Street nur ein Katzensprung zum Piccadilly Circus. Es war fünf Uhr, und die Fußgänger rannten sie nahezu über den Haufen. Eine Unart der Londoner, die offensichtlich Angehörige aller Schichten pflegten. Sie wurde genauso oft von Pakistanis angerempelt wie von Männern mit Hut und Nadelstreifenanzug. So war das Leben in London eben. Es erinnerte sie an Tokio, aber London war früher anders gewesen, zumindest das London ihrer Kindheit.
Eine weitere Veränderung waren all die mehr oder minder sichtbaren Überwachungskameras. Wenn der charmante MacGregor oder, schlimmer noch, einer seiner Widersacher oder Kollegen oder einer seiner gegnerischen Kollegen, oder wie auch immer man diese verworrenen Beziehungen innerhalb des britischen Geheimdienstes bezeichnen sollte, sie nun mit den Kameras verfolgt hätte, seitdem sie das Hotel verlassen hatte, konnte man ihr Bild immer noch in irgendeiner Zentrale sehen. Nicht einmal in der U-Bahn war es mehr möglich, der Überwachung zu entgehen. Auch da unten funktionierte das System.
Wäre sie in London gewesen, um jemanden zu töten, hätte sie Schwierigkeiten gehabt. Aber die Zeiten waren vorbei. Nun hatte sie einen größeren Auftrag.
Sie betrat ein asiatisches Schnellrestaurant und nahm ein undefinierbares Fischgericht zu sich, bevor sie zur U-Bahn am Piccadilly Circus ging und mit der Piccadilly Line zum Finsbury Park fuhr. Die Fahrt dauerte gut zwanzig Minuten.
Sie nahm den falschen Ausgang und musste nach dem Weg zur Moschee fragen. Das Gebäude war relativ neu, wahrscheinlich aus den Siebzigern, ein roter Ziegelbau mit grünen Fensterrahmen, die seltsamerweise an die Farbe des Tortenhauses vom MI6 erinnerten, und einem weißen Minarett, das sich wie ein Schornstein an eine der Ziegelmauern drückte. Es war nicht besonders schön, und außerdem war die ursprünglich weiße Kuppel mit dem Halbmond von der verpesteten Londoner Luft grau geworden. Die Moschee schien geschlossen zu sein, und über dem verriegelten Tor hing deutlich sichtbar eine Überwachungskamera.
Hinter dem Gebäude setzte sie sich auf eine Bank. Schräg gegenüber lag ein Mietshaus aus den gleichen roten Ziegeln mit weißen Sprossenfenstern. Irgendwo da oben hatten sich vermutlich die Typen vom MI5 bei irgendeinem patriotischen Mitbürger eingemietet, um die Moschee rund um die Uhr überwachen zu können. Eine vollkommen idiotische Aktion, besonders wenn man bedachte, was Überstunden in Westeuropa kosteten.
Komischerweise – jedenfalls war es typisch englisch – hatte die Charity Commission die Schließung der Moschee verfügt. Weder die Polizei noch ein anderes Regierungsorgan, geschweige denn der MI5 (wo die Entscheidung vermutlich in Wirklichkeit getroffen worden war) hätten es gewagt, offiziell eine Moschee dicht zu machen. Aber der Wohltätigkeitskommission waren in einem kultivierten Gespräch die Wünsche der staatlichen Stellen dargelegt worden. Anschließend hatte die Wohltätigkeitskommission in guter demokratischer Weise und bestem englischen Geist das Problem genau analysiert und war zu dem Schluss gekommen, dass sich im Kreis der Moschee in Finsbury Park Personen bewegten, die Wohltätigkeit in einem Sinne betrieben, der irgendeiner Regel aus dem viktorianischen England des neunzehnten Jahrhunderts widersprach, in der es um »Anstand« und »gute christliche Absichten« ging.
Diesen ganzen Aufwand, all diese ausgeklügelten bürokratischen Winkelzüge hatten die britischen Behörden auf sich genommen, um eine einzige Moschee zu schließen und einen einzigen lästigen Agitator zum Schweigen zu bringen.
Nein, natürlich war er mehr als nur lästig. Als selbst ernannter Imam (bevor die Stimme Gottes an sein Ohr drang, hatte er als Rausschmeißer in einer Kneipe gearbeitet) stand Abu Hamza für fast alles, was den palästinensischen Widerstandskampf untergrub. Wäre sie zwanzig Jahre jünger gewesen, hätte sie ernsthaft erwogen, ein Team zu ihm zu schicken, um ihm ein für alle Mal das Maul zu stopfen. In Zeiten der weltweiten Kampagne, die sich Krieg gegen den Terror nannte, wurde ein einzelner Mann wie Abu Hamza in Finsbury Park zu einer ebenso großen Belastung wie eine fehlgeleitete Terroraktion. Außerdem repräsentierte er alles, was Mouna ihr Leben lang gehasst hatte: religiösen Eifer und die Vorstellung, Gott habe manchen Menschen das Recht gegeben, andere zu töten oder ihnen ihr Land zu stehlen, und würde sie dafür auch noch im Paradies belohnen.
Bezeichnenderweise hatte sich Abu Hamza zu Beginn seiner Karriere durch krude Ansichten zum Thema Diebstahl hervorgetan. Er hatte gepredigt, der Rechtgläubige dürfe englische Banken bestehlen. Mit dem Zitat »Take, shoot and loot« (»Bedient euch, schießt und plündert«) wurde er bekannt. Da die britische Boulevardpresse solche Moslems liebte und Abu Hamza jegliche Art von Aufmerksamkeit schätzte, entstand zwischen den Medien und dem mittelmäßigen Hassprediger eine natürliche Symbiose. Außerdem war er fotogen, weil er halbblind war und, seitdem er beide Hände bei einer Explosion verloren hatte, Eisenhaken an den Armstümpfen trug. Laut seiner eigenen Aussage rührte diese Verletzung von seinem heldenhaften Einsatz als Freiwilliger in Afghanistan her, wo er angeblich Landminen von Kinderspielplätzen entfernt hatte. Wahrscheinlich hatte sich das Unglück aber bei dem Versuch ereignet, eine Bombe zu basteln. Jedenfalls hatte Abu Hamza eine durchschlagende mediale Wirkung. Er war das nahezu perfekte Feindbild.
Und Idioten dieses Schlages zogen Gleichgesinnte an. Ein Mann, der von den amerikanischen Behörden trotz seiner offensichtlichen Geisteskrankheit »Der zwanzigste Flugzeugentführer« genannt wurde, ein gewisser Zacarias Moussaoui, hatte Abu Hamza in Finsbury Park besucht.
Bei diesem Zusammentreffen habe Moussaoui angeblich den göttlichen Auftrag erhalten, hieß es. Allerdings hatten ihm die so ungeheuer gut informierte internationale Presse und die amerikanischen Behörden, die ihn später gefasst und vor Gericht gestellt hatten, die rein praktischen Konsequenzen seiner Bekehrung gar nicht nachweisen können.
Gleich zu Beginn des Gerichtsverfahrens in den USA verlangte er für sich selbst die Todesstrafe. Mit der Begründung, er sei unschuldig. Als sein Anwalt einwandte, man habe es offensichtlich mit einem Verrückten zu tun, entließ er den
Anwalt – mit Zustimmung des Gerichts. Anschließend beschrieb er sich als treuesten Mann von Osama bin Laden und erhielt eine lebenslängliche Gefängnisstrafe in strenger Isolationshaft.
Eine ähnliche göttliche Erweckung wurde dem sogenannten Schuhbomber, dem Briten Richard Reid, zuteil, der mit ausreichend Sprengstoff an Bord eines Flugzeugs gegangen war, um mindestens eine Brandblase am Fuß zu riskieren. Aufgrund seiner Zeugenaussage zu Abu Hamzas göttlichen Vermittlungstätigkeiten kam er mit zwanzig Jahren Gefängnis davon.
Und als Abu Hamza zu seinem Entzücken endlich selbst vom MI5 geschnappt wurde, behauptete er, der Anführer einer Organisation zu sein, die sich »Anhänger der Scharia« nannte. Selbst die hitzigsten Kriegsreporter der britischen Presse mussten zugeben, dass weniger als zweihundert von den zwei Millionen Londoner Muslimen Mitglieder dieser Horde von Fanatikern waren.
Für irgendetwas würde er mit Sicherheit verurteilt werden. Im Moment saß er im Belmarsh-Gefängnis und hatte eine Anklageschrift mit sechzehn Punkten am Hals. Zum Beispiel »Aufwiegeln von Versammlungsteilnehmern zum Mord an Nicht-Muslimen, besonders Juden« oder »einschüchterndes, verunglimpfendes oder verletzendes Auftreten in der Absicht, zum Rassenhass aufzustacheln«.
Wessen Feind also war Abu Hamza? In erster Linie ihr Feind.
Und es gab keinen Zweifel daran, wie ihre alten russischen Spionagedozenten in Pjöngjang die Situation beurteilt hätten.
Zuerst hätten sie, im Sinne der alten Römer, gefragt: Cui bono – wem nützt es?
Die russischen Dozenten hätten dann dargelegt, dass Abu Hamza im eigenen Interesse handle, vorausgesetzt, er sei tatsächlich so verrückt, wie er sich gab.
Außerdem musste er im Interesse des MI5 handeln. Ein Sicherheitsdienst benötigte einige prominente Feinde und ganz besonders solche, die man vor den Augen der Öffentlichkeit unschädlich machen konnte. Wenn Abu Hamza kein Wahnsinniger war, der sich selbst erfunden hatte, musste der MI5 zumindest das Bedürfnis gehabt haben, ihn zu erfinden.
Aber so eine schematische Analyse erschien Mouna viel zu russisch und konservativ. Die Russen waren nie gezwungen gewesen, mit einer freien Presse und unterschiedlichen politischen Parteien zu operieren. Im Westen gab es Journalisten, die ihre Zeitungen verkaufen wollten, indem sie ihren Lesern mit Tod und Zerstörung drohten, und Politiker, die Stärke zeigen mussten, indem sie Gesetze gegen falsche Gottesbegriffe erließen oder sich für den großen Lauschangriff aussprachen. Da brauchte man viele Abu Hamzas.
All das war sehr unerfreulich und praktisch nicht zu beeinflussen. Auch wenn Abu Hamza und seinesgleichen ihre Hauptfeinde waren, konnte sie ihn nicht erschießen lassen. Nicht nur politische Probleme – wie den Verwicklungen im Falle einer Festnahme –, sondern auch ethische Erwägungen spielten eine Rolle.
Manchmal empfand sie sich schmerzhaft machtlos gegen all diesen Wahnwitz des religiösen Fanatismus, der in der gesamten westlichen Welt den Widerstandskampf in Verruf brachte. Ein einziger Hassprediger in London hatte mehr Gewicht als die israelische Besetzung von Palästina oder die Okkupation des Iraks durch die USA oder ein Angriff auf den Iran, den man in Washington bereits vorbereitete und zu dessen Rechtfertigung man lapidar auf die mögliche atomare Bedrohung durch die Mullahs verwies.
Es war sinnlos, sich bei ihren westlichen Kollegen zu beklagen. Bevor sie dazu käme, etwas zu erklären, würde man demonstrativ entnervte Gesichter aufsetzen und beginnen, sich über Politik und den ganzen hochtrabenden Quatsch zu mokieren.
Dennoch würde sie, auch um zu provozieren, diesen Gedankengang morgen beim MI5 vortragen. Abu Hamza war ihr Feind und ein Freund des britischen Sicherheitsdienstes. Eins war klar: Egal, wie gut sie eine solche Analyse verpackte, sie würden wütend reagieren. Doch das war in gewisser Weise Absicht, es war ein Teil des Köders.
Ihr war aber klar, dass sie manche Formulierungen mildern und einige Sarkasmen weglassen musste. Ihr Notebook wartete schon im Hotelzimmer auf sie. Einige Änderungen am Vortrag würden noch nötig sein. Es wurde gerade erst dunkel, und sie freute sich auf eine Beschäftigung, die weniger deprimierend war als das westliche Nachrichtenprogramm.
Im Hinblick auf den Teil ihres Vortrags, der sich mit den Brüdern Husseini beschäftigen würde, dem wichtigsten Grund für ihre Reise nach London und das Treffen mit ihren feindlichen Alliierten, fühlte sie sich sicherer. Er war gut vorbereitet. Hier musste sie keine Änderungen in letzter Sekunde vornehmen.
Der beige und rote Teppichboden hatte ein geometrisches Muster und eingewebte Gebetsteppiche, die nach Mekka ausgerichtet waren. Der zwanzig mal zwanzig Meter große Raum war momentan leer. Die Kuppel war blau und golden mit Fensterbögen im umayyadischen Stil, wenn er sich nicht irrte. Im unteren Teil der Kuppel befand sich ein Ring aus kleinen Fenstern mit blau gefärbtem Glas – einfach und stilvoll.
Die Moschee hier im Regent’s Park trug den fantasielosen Namen Zentralmoschee, war aber immerhin tatsächlich die größte in London. Grün eingebettet in eine Ecke des Parks lag sie außerdem ganz hübsch.
Als er hereinkam, verspürte er augenblicklich Frieden, es war geradezu rätselhaft. An seinem Arbeitsplatz dröhnte ständig laute Musik, und sein Inneres war immer in Aufruhr. Er musste bald etwas tun, nicht nur reden. Er musste hart zurückschlagen. Und er suchte nach Ratschlägen, die er in der Gesellschaft, in der er aufgewachsen war, niemals bekommen hätte.
Er war kein großer Moslem, das musste er zugeben. Sein älterer Bruder hatte ihn gedrängt, den neuen jungen Imam Abu Ghassan aufzusuchen. Auch sein Arabisch war schlecht. Seit seiner Jugend, als seine Eltern sich hatten scheiden lassen und sein Vater eine Engländerin geheiratet hatte, von der man Dinge berichten konnte, die in einem Gotteshaus unpassend waren, war ihm die Sprache nicht mehr über die Lippen gekommen.
Er wusste – rein praktisch – nicht, wie man betete, wann man aufstehen und wann man vornübergebeugt in der demütigen Haltung knien sollte, die die Engländer so gern in abscheulichen Karikaturen ins Lächerliche zogen.
Und dennoch: Das hier war der einzige Ort in London, wo er augenblicklich Frieden fand, wenn er mit wirren Haaren und wild klopfendem Herzen angestürmt kam, in der festen Überzeugung sofort zurückschlagen zu müssen.
In keinem anderen Zusammenhang hatte das Wort Frieden für ihn eine Bedeutung. Draußen benutzte er es höchstens ironisch.
Hier drinnen waren seine Gedanken klar und rein, und das konnte nur an Gottes Anwesenheit liegen. Eine Erkenntnis die vollkommen neu für ihn war. In der Kapelle seines alten Internats hatte er mit Sicherheit Tausende von Gottesdiensten an all den christlichen Feiertagen abgesessen, ohne sich unter Gott jemals etwas anderes als einen Teil dessen vorstellen zu können, was man gute Erziehung nannte. In Cambridge war es genauso gewesen. Gott war, wenn man so wollte, eine noch frische Bekanntschaft.
Er war absichtlich eine halbe Stunde vor dem Treffen gekommen, um ein wenig dasitzen und seine Gedanken ordnen zu können. Die neue Bekanntschaft verwirrte ihn, auch das musste er zugeben. Aber wenn er daran zurückdachte, wie er vor 9/11 gewesen war, konnte er seinen damaligen Zustand ebenfalls nur als wirr bezeichnen.
Wut und Hass hatten ihn in das Gotteshaus getrieben, und das war, wenn man es so aufrichtig und ohne Beschönigung ausdrückte, vollkommen unangemessen.
Er hoffte, dass auch Ibra vor dem vereinbarten Zeitpunkt eintreffen würde, denn für ihn war es das erste Mal.
Es sei nicht schwer, zur Moschee zu gehen. Man könne einfach hineingehen, hatte er seinem etwas misstrauischen Freund erklärt, der offenbar Wächter, Ausweiskontrollen, Metalldetektoren, Überwachungskameras und all die anderen Dinge vermutete, die mittlerweile das tägliche Leben prägten. Man müsse nur über den weiß gepflasterten Hof spazieren, seine Schuhe in den Regalen abstellen, hineingehen und sich setzen. Niemand würde Fragen stellen, niemand würde sich wundern.
Wie erwartet sah Ibra misstrauisch und eingeschüchtert aus, als er sich durch den Haupteingang zwängte – so, als hätte er ein schlechtes Gewissen, weil er überhaupt hier eindrang, oder noch schlimmer, weil er daran zweifelte, dass er das Recht dazu hatte. Er schien erleichtert, als er seinen Freund entdeckte.
»Hey, Marw, was ist los?«, begrüßte ihn Ibra mit flatternden Lidern und ließ seinen Blick über ein paar kleine Gruppen von Männern wandern, die sich an den Wänden flüsternd unterhielten. Einige hatten auf Buchstützen aus Holz einen aufgeschlagenen Koran vor sich.
»Man könnte fast sagen, Frieden, Bruder«, antwortete Marw. »Gut, dass du nicht zu spät gekommen bist. Dieser Imam, von dem ich dir erzählt habe, Abu Ghassan, kommt immer pünktlich auf die Minute.«
Sie saßen eine Weile bemüht schweigend da. Auch Ibra schien von Frieden erfüllt, seitdem er die Moschee betreten hatte. All ihre heißen Diskussionen bei der Arbeit und all ihre Gedanken über die Notwendigkeit, etwas Großes zu machen, wurden von der Stille hier drinnen gedämpft.
Der Imam kam wirklich auf die Sekunde genau. Er war in ihrem Alter, ziemlich groß und hatte einen durchtrainierten Körper, als ginge er wie jeder andere ins Fitnessstudio. Allerdings hatte er Narben im Gesicht, die erschreckend ausgesehen hätten, wenn seine Augen nicht gewesen wären. Mehr noch als seine religiöse Tracht ließ sein milder und humorvoller Blick ihn als denjenigen erscheinen, der er war.
Marw konnte seine englischen Reflexe, all das, was der Feind ihm ins Gehirn gepflanzt hatte, nicht unterdrücken und stellte die beiden Männer einander in der richtigen Reihenfolge vor.
Sie setzten sich an die Wand, und der Imam stellte den Koran, den er unter dem Arm getragen hatte, auf eine Buchstütze. Dann forderte er sie auf, still dafür zu beten, dass Gott ihr Gespräch leiten möge. Ohne besonderen Aufwand oder bestimmte Gebärden, sollten sie einfach ihre Handflächen mit ausgestreckten Armen nach oben halten.
Beide gaben sich aufrichtig Mühe.
Dann kam er direkt zur Sache und stellte ihnen einige Fragen, die wenig Raum für Ausflüchte ließen. Suchten sie Gott, weil man ihnen Unrecht getan hatte? Wollten sie Gott dienen, indem sie ihre Feinde bekämpften? Oder, etwas edler, indem sie die Feinde des Islam bekämpften? Und ob sie etwa glaubten, dass Gott an einer solchen Einstellung Gefallen fände?
Nüchtern betrachtet blieb ihnen nichts anderes übrig, als zuzugeben, dass es so war. Sie hatten sich gemeinsam einige Gedanken zum Dschihad gemacht, und wenn ihnen jemand anders als dieser ernste und gleichaltrige Imam die Fragen gestellt hätte, hätten sie sich vermutlich auf das dünne Eis begeben und sogar ihren Glauben beschrieben, der die meisten Engländer in Angst und Schrecken versetzte.
Doch hier taugte ihr religiöser Eifer nicht, nun mussten sie politisch und psychologisch argumentieren. Wenn man 9/11 mit der Explosion einer Atombombe vergleichen wolle, begann Ibra, dann habe man zunächst nur eine für alle wahrnehmbare Druckwelle gespürt. Inzwischen könne man die Langzeiteffekte beobachten: die verheerende Wirkung der freigesetzten Strahlung, die über große Entfernungen und einen langen Zeitraum alles und jeden töte.
Vor nicht allzu langer Zeit hätten die Gegensätze innerhalb der britischen Gesellschaft auf der Hautfarbe beruht. Nun komme es auf die Religion an. Jetzt hätten sich sogar die Sikhs, die Typen mit dem Turban, mit den Faschisten aus der Nationalen Front zusammengetan, um den bösen Islam zu bekämpfen. Und die einstigen Rassisten aus der Nationalen Front fänden das in Ordnung.
Man merke die Veränderungen, die Strahlung, auch im Kleinen, meinte Marw. Er und Ibra hätten in den letzten Jahren immer häufiger versteckte Andeutungen zu hören bekommen. Anfänglich seien es Witzeleien gewesen, später immer häufiger offen rassistische Kommentare hinzugekommen.
Und man müsse bedenken, dass es sich in ihrem Fall um hoch qualifizierte Arbeitsplätze handele. Sie seien extrem gut ausgebildet. Das Durchschnittsgehalt in der Firma läge, wenn man von den Sekretärinnen absah, bei dreihunderttausend Pfund.
Seit Londons 9/11, dem Anschlag vor zwei Wochen, sei es nahezu unerträglich geworden. Am liebsten hätten sie ihren Kollegen ins Gesicht geschrien, dass diese Schüler aus Leeds ihr Leben immerhin für eine Sache geopfert hatten, an die sie glaubten. Nicht aus kalkulierten politischen Gründen, nicht um sich zu bereichern, sondern einfach, weil sie die Schnauze voll hatten und verzweifelt waren. Sie hätten sich zur Wehr setzen und in diesem sogenannten Krieg gegen den Terror eine Gegenattacke starten wollen, und das würde, verdammt noch mal, Respekt verdienen. Allerdings wäre es äußerst unklug gewesen, diese Meinung laut zu äußern. Und nicht laut sagen zu können, was man denke, sei unerträglich.
So ging es eine Weile, anfangs eifrig und mit vielen, auch drastischen Worten, da sie beide es gewohnt waren, sich gewandt auszudrücken.
Der Imam hatte ihnen nur schweigend und ohne Anzeichen von Ungeduld gelauscht. Er hatte überhaupt keine Reaktion gezeigt, und das verunsicherte sie zunehmend und ließ sie schließlich ganz verstummen.
»Wollt ihr für das Seelenheil dieser Jugendlichen beten?«, fragte der Imam, als Marw und Ibra nichts mehr zu sagen hatten. Sie nickten zögerlich.
»Das könnt ihr natürlich tun. Gott ist barmherzig, er vergibt, und diese Gymnasiasten sind mehr aus Dummheit als für ihre hohen Prinzipien gestorben. Ihre Dummheit, die uns allen geschadet und die giftige Strahlung verstärkt hat, von der ihr gesprochen habt, diese Dummheit ist ihre einzige Entschuldigung. Aber ihr beide könnt euch nicht auf Dummheit berufen, von euch muss sich Gott viel mehr erwarten. Du, Bruder Marw, wie du dich nennst, ich nehme an, du heißt Marwan, schlag die sechzigste Sure auf, al-Mumtahina, ›Die Geprüfte‹, und lies mir bitte den achten Vers vor.«
Langsam schob er den aufgestellten Koran zu Marwan hinüber, der eine ganze Weile nervös suchte, bis er die richtige Stelle gefunden hatte. Dann las er, etwas holprig zwar, aber dennoch verständlich – so hoffte er zumindest:
Nicht verbietet euch Allah gegen die, die nicht in Sachen des Glaubens gegen euch gestritten oder euch aus euern Häusern getrieben haben, gütig und gerecht zu sein. Siehe, Allah liebt die gerecht Handelnden.
»Nun, ziemlich gut gelesen, Marwan«, sagte der Imam und nickte bedächtig, als wolle er ihnen Zeit geben, die Worte auf sich wirken zu lassen. »Darf ich fragen, ob einer von euch zufällig Palästinenser ist?«
Beide streckten die Hand hoch.
»Das habe ich mir gedacht«, fuhr der Imam fort. »Ihr sollt die lieben, die euch nicht aus Palästina vertrieben haben. Das steht da. Und ihr sollt diejenigen lieben, die uns nicht aufgrund unseres Glaubens bekämpfen. Die Jugendlichen aus Leeds haben eine schwere Sünde begangen. Wie viele von den zweiundfünfzig Londonern, die sterben mussten, haben uns denn aus unserer Heimat vertrieben und unseren Glauben bekämpft? Drei? Möglicherweise zehn? Und die anderen?«
»Sind Sie auch Palästinenser, Abu Ghassan?« Ibra versuchte Zeit zu gewinnen.
»Ja, ich bin Palästinenser. Ich habe zehn Jahre in einem israelischen Gefängnis gesessen, übrigens mit keiner anderen Lektüre als dem Koran. Daher meine Kleidung und die Narben. Aber ihr sollt meiner Frage nicht ausweichen«, antwortete der Imam schnell. »Wie viele von diesen Londonern haben laut Gottes Wort den Tod verdient?«
»So, wie Sie die Frage stellen, rein theoretisch, niemand? Aber gegen wen soll sich der Ohnmächtige wehren?«, fragte Ibra.
»Man nennt dich Ibra, aber du heißt doch Ibrahim, oder? Bedenke, dass du nach einem großen Propheten und geistigen Führer benannt wurdest.«
»Sollen wir uns denn nicht wehren?«
»Doch, das sollen wir manchmal. Wenn es gerechtfertigt ist. Aber nicht so wie am 7. Juli. Schlagt jetzt die neunundzwanzigste Sure, Vers neunundsechzig auf!«