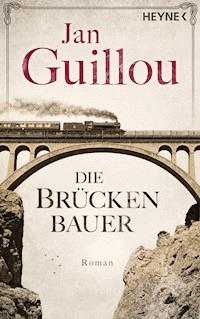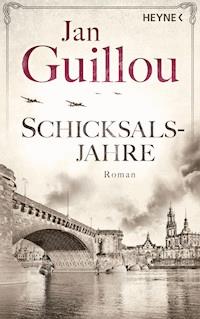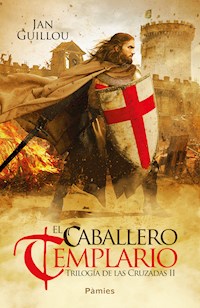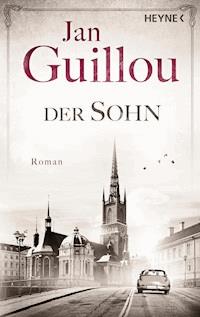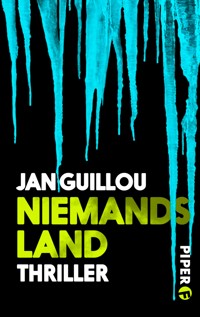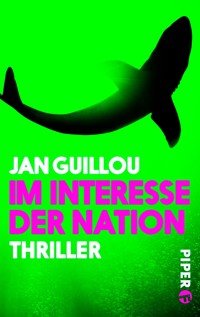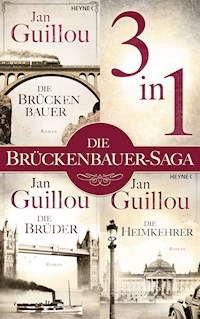
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine packende Familiengeschichte vor der Kulisse eines großen Jahrhunderts
Band 1:
Norwegen am Ende des 19. Jahrhunderts. Als ihr Vater vom Fischfang nicht zurückkehrt, werden Lauritz, Oscar und Sverre zu Halbwaisen. Sie sind noch Kinder, trotzdem schickt ihre Mutter sie zu einer Lehre fort in die Stadt. Die drei Jungen nehmen ihr Schicksal klaglos an. Mehr noch. Begierig und gelehrig saugen sie das Wissen in sich auf. Zwanzig Jahre später beenden sie ihr Studium mit Auszeichnung. Aus den drei Fischerjungen sind die besten Brückenbauer des Landes geworden.
Band 2:
Nach Abschluss ihres Studiums wartet eines der größten Bauprojekte des Landes auf die drei Brüder - der spektakuläre Bau einer Eisenbahnverbindung zwischen Bergen und Oslo. Doch in der Nacht vor der Abreise verschwindet Sverre, der jüngste der drei Brüder. Er hat sich unsterblich verliebt und folgt seiner Liebe nach London. Doch die weltpolitischen Ereignisse werfen ihren Schatten auf das junge Glück, und plötzlich steht Sverre allein da.
Band 3:
Lauritz, der älteste der drei Brüder, hat es als Bauunternehmer in Stockholm zu einigem Wohlstand gebracht. Seine Brüder Oscar und Sverre wohnen unterdessen in Berlin, wo Oscar über den größten Immobilienbesitz der Stadt verfügt. Doch in Deutschland wächst der Faschismus. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die mit Modernität und Avantgarde begann, mit Filmen von Chaplin, Gemälden von Grosz und Romanen von Döblin, entwickelt sich mehr und mehr zu einem Albtraum, in dem Verfolgung und Schikane den Alltag beherrschen. Oscar und Sverre beschließen, Berlin zu verlassen, was sich jedoch als riskantes Unterfangen herausstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1941
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jan Guillou
DIE
BRÜCKENBAUER-
SAGA
Drei Romane in einem Band
Die Brückenbauer
Die Brüder
Die Heimkehrer
Aus dem Schwedischen von Lotta Rüegger
und Holger Wolandt
Zum Buch:
Eine packende Familiengeschichte vor der Kulisse eines großen Jahrhunderts
Band 1: Die Brückenbauer
Norwegen am Ende des 19. Jahrhunderts. Als ihr Vater vom Fischfang nicht zurückkehrt, werden Lauritz, Oscar und Sverre zu Halbwaisen. Sie sind noch Kinder, trotzdem schickt ihre Mutter sie zu einer Lehre fort in die Stadt. Die drei Jungen nehmen ihr Schicksal klaglos an. Mehr noch. Begierig und gelehrig saugen sie das Wissen in sich auf. Zwanzig Jahre später beenden sie ihr Studium mit Auszeichnung. Aus den drei Fischerjungen sind die besten Brückenbauer des Landes geworden.
Band 2: Die Brüder
Nach Abschluss ihres Studiums wartet eines der größten Bauprojekte des Landes auf die drei Brüder – der spektakuläre Bau einer Eisenbahnverbindung zwischen Bergen und Oslo. Doch in der Nacht vor der Abreise verschwindet Sverre, der jüngste der drei Brüder. Er hat sich unsterblich verliebt und folgt seiner Liebe nach London. Doch die weltpolitischen Ereignisse werfen ihren Schatten auf das junge Glück, und plötzlich steht Sverre allein da.
Band 3: Die Heimkehrer
Lauritz, der älteste der drei Brüder, hat es als Bauunternehmer in Stockholm zu einigem Wohlstand gebracht. Seine Brüder Oscar und Sverre wohnen unterdessen in Berlin, wo Oscar über den größten Immobilienbesitz der Stadt verfügt. Doch in Deutschland wächst der Faschismus. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die mit Modernität und Avantgarde begann, mit Filmen von Chaplin, Gemälden von Grosz und Romanen von Döblin, entwickelt sich mehr und mehr zu einem Albtraum, in dem Verfolgung und Schikane den Alltag beherrschen. Oscar und Sverre beschließen, Berlin zu verlassen, was sich jedoch als riskantes Unterfangen herausstellt.
Zum Autor:
Jan Guillou wurde 1944 im schwedischen Södertälje geboren und ist einer der prominentesten Autoren seines Landes. Seine preisgekrönten Kriminalromane um den Helden Coq Rouge erreichten Millionenauflagen. Auch mit seiner historischen Romansaga um den Kreuzritter Arn gelang ihm ein Millionenseller, die Verfilmungen zählen in Schweden zu den erfolgreichsten aller Zeiten. Heute lebt Jan Guillou in Stockholm.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgaben erschienen unter den Titeln
Brobyggarna, Dandy und Mellan Rött Och Svart
bei Piratförlaget, Stockholm
Copyright © 2011, 2012, 2013 by Jan Guillou
Copyright © 2012, 2013, 2014 der deutschen Ausgaben
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by agreement with Salomonsson Agency
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel unter Verwendung von: U1 o. li.: © shutterstock (Peter R. Foster IDMA; Artography) U1 u. li.: © shutterstock (Claudio Divizia; Pierre-Jean Durieu) U1 u. re.: © akg-images und shutterstock (sunfun; Lagui)
ISBN: 978-3-641-21099-1V002
www.heyne.de
Jan Guillou
DIE BRÜCKENBAUER
Roman
Aus dem Schwedischen von Lotta Rüegger
und Holger Wolandt
I
DAS WIKINGERSCHIFF
Die Männer blieben auf dem Meer. So war das Leben. Das war früher geschehen, und es würde wieder geschehen, denn dies war das Los der Küstenbewohner, auf Osterøya und anderen Inseln und an anderen Fjorden.
Somit waren die Jungen Lauritz, Oscar und Sverre vaterlos geworden und auch die kleinen Mädchen Turid, Kathrine und Solveig.
Was dort draußen passiert war, wusste keiner, und für gewöhnlich erfuhr man es auch nie. Der Sturm war zwar schwer gewesen, wie das bei späten Februarstürmen manchmal der Fall war, aber Lauritz und Sverre waren fähige Segler, größer und stärker als die meisten und auf See groß geworden. Von ihnen sagte man halb im Scherz, dass sie zweifellos von den Wikingern abstammten. Ihr Vater war ebenso gewesen.
Man konnte es nur vermuten. Das Eis dürfte zu dieser Jahreszeit nicht die Ursache gewesen sein. Auch nicht, dass sie auf Grund gelaufen oder vom Kurs abgekommen und an einer Felswand zerschellt waren, dafür waren sie zu routinierte Seeleute, die die Fjorde und die Seewege aufs offene Meer wie ihre eigenen schwieligen Handflächen kannten. Vielleicht hatten sie Mastbruch erlitten, oder sie hatten unerwartetes Glück beim Fischfang gehabt, und die Ladung war zu schwer geworden und hatte sich verschoben, als sie dem Sturm zu entkommen versuchten. Aber Vermutungen brachten einen auch nicht weiter.
Der Pastor kam nach einer Woche aus Hosanger herüber, als er sicher sein konnte, dass keine Hoffnung mehr bestand und dass die Verantwortung für die beiden Witwen von den Ehemännern an die Kirche übergegangen war. Er traf mit dem Dampfschiff in Tyssebotn ein und fragte sich von dort aus durch.
Frøynes Gård lag im Windschatten eines steinigen Hügels unweit des Dampfschiffanlegers. Auf dem Hof gab es zwei Wohnhäuser, was sehr ungewöhnlich war, einen Stall, zwei Scheunen und alte Vorratsspeicher, die zum Schutz vor Raubtieren auf hohen Pfosten standen. Alles war gut in Schuss und zeugte eher von bescheidenem Wohlstand als von der Armut, die sonst auf den Inseln verbreitet war. Die Brüder Eriksen waren fleißige, gottesfürchtige Männer gewesen und hatten gut für ihre Familien gesorgt. Sie hatten sogar ihr eigenes Fischerboot gebaut mit einem Laderaum, der doppelt so viel Platz für den Fang bot wie üblich.
Der Geistliche suchte die beiden Witwen, die bereits Trauerkleider trugen, in dem etwas größeren der beiden Wohnhäuser auf, in dem Lauritz’ Ehefrau Maren Kristine mit ihren drei Jungen wohnte. Die Jungen in ihren Sonntagskleidern saßen mit rot geränderten Augen auf einer der Wandbänke in der Stube und neben ihnen die drei kleinen Mädchen, Sverre Eriksens und Aagots Töchter, in schwarzen Kleidchen. Der Pfarrer vermutete, dass es schwarz eingefärbte Sommerkleider waren. Die sechs Kinder boten einen herzerweichenden Anblick.
Die beiden Witwen saßen aufrecht und starr da, als sie dem Geistlichen zuhörten. Sie waren beherrscht, vergossen keine Tränen. Es war deutlich, dass ihnen ihre Würde wichtig war.
Worte des Trostes fand der Pastor keine, was hätte er auch sagen sollen? Er hielt sich ans Praktische. In Fällen, in denen keine Toten zu begraben waren, fand ein Gedenkgottesdienst statt, in dem am Schluss die Seelen der Verstorbenen gesegnet wurden. Man einigte sich auf den Tag.
Anschließend kam die schwierigere Frage, wie die Familien ohne das Einkommen aus dem Fischfang zurechtkommen würden. Die beiden Witwen waren jung, Anfang dreißig, wenn überhaupt so alt, und insbesondere Maren Kristine war eine auffällige Schönheit, rothaarig, sommersprossig und mit großen blauen Augen. Außerdem besaß sie einen nicht unbescheidenen Hof. Es würde ihr sicher nicht schwerfallen, einen neuen Mann zu finden. Das Gleiche galt für ihre Schwägerin.
Dieses anzusprechen wäre in diesem Moment äußerst unpassend gewesen, weshalb der Geistliche sich nach den in allernächster Zeit zu bewältigenden Aufgaben erkundigte. Zu essen gab es genug auf dem Hof: Schafe, Schweine und Hühner, außerdem vier Milchkühe. Da jetzt weniger Münder satt werden mussten, würden die Witwen Käse zum Verkauf herstellen können. Sie gaben an, auch Stoffe weben und färben zu können.
Wären die drei vaterlosen Mädchen älter gewesen, hätte man sie als Mägde in herrschaftliche Familien in Bergen geschickt. Aber das kam nicht infrage, da die Älteste gerade erst neun Jahre alt war.
Bei den Knaben verhielt es sich anders, obwohl auch sie erst zwölf, elf und zehn Jahre alt waren. Sie konnten sich als Lehrlinge in Bergen verdingen, wo alles, was mit Seefahrt und Fischfang zu tun hatte, produziert, gebaut und repariert wurde.
Diese Möglichkeit hatten die Witwen bereits in Erwägung gezogen. Maren Kristines Bruder Hans Tufte arbeitete als Seiler bei Cambell Andersen in Nordnes. Sie hatte ihm bereits geschrieben. Er war zweiter Werkmeister in der Seilerei, besaß also einen gewissen Einfluss, und so Gott wollte, würden sie bald drei Münder weniger zu stopfen haben. Vielleicht würden die Jungen mit der Zeit sogar etwas dazuverdienen.
Der Geistliche betrachtete die drei Jungen, die mit gesenkten Köpfen auf der Wandbank saßen, ohne ein Wort zu sagen oder zu erkennen zu geben, was sie darüber dachten, als Arbeiter in die Stadt ziehen zu müssen. Mit Sicherheit nicht das, was sich die drei Fischersöhne für ihre Zukunft gewünscht hatten. Aber die Not kannte nun mal kein Gebot.
Sehr viel mehr gab es für den Geistlichen nicht zu sagen. Er deutete an, dass er mit einer wohltätigen Gesellschaft in Bergen Kontakt aufnehmen wolle, aber versprechen könne er natürlich nichts. Mit Trauer im Herzen aß er von ihrem frisch gebackenen Brot, wissend, dass es schlimmer war, abzulehnen, als es den sechs Kindern buchstäblich wegzuessen. Die Fischer am Osterfjord nahmen es mit der Moral und der Würde sehr ernst.
Als er sich zum Dampfschiffanleger begab, um jemanden zu dingen, der ihn nach Hosanger segeln konnte, verspürte er sowohl Erleichterung darüber, die schwere Pflicht hinter sich gebracht zu haben, als auch ein schlechtes Gewissen, weil er solch eine Erleichterung empfand. Es hätte viel schlimmer sein können. Doch die schwere Zeit der Trauer und Armut stand den Witwen noch bevor.
Sie mussten, so schrieb es der Brauch vor, mindestens ein Trauerjahr warten, ehe sie überhaupt daran denken konnten, sich einen neuen Mann zu nehmen, aus Not eher als aus Lust.
*
Jon Tygesen war Maschinist des Dampfschiffes Ole Bull, seit es im Frühjahr 1883 in Dienst gestellt worden war. Inzwischen brauchte er nur noch einen kurzen Blick über die Reling zu werfen, um zu wissen, wo auf der Strecke mit den vierzehn Landungsbrücken, die nördlich von Bergen angelaufen wurden, er sich befand. Er war die Aussicht inzwischen leid und fand die Ausländer, die nur zum Vergnügen mit dem Dampfschiff fuhren, ganz und gar unbegreiflich. An der heutigen Fahrt nahmen vier Ausflügler teil, zwei Männer und zwei Frauen, wenn er es richtig mitbekommen hatte, aus England. Draußen auf dem Fjord saßen sie in ihren Ledersesseln im Erste-Klasse-Salon, aber sobald der Dampfer anlegte, kamen sie in dicken Mänteln mit Pelzkragen an Deck, deuteten auf die Gipfel und gestikulierten lebhaft. Die Frauen stießen immer wieder verzückte Rufe aus. Seltsame Leute waren das.
In Tyssebotn war er selbst an Deck gekommen, um frische Luft zu schnappen. Es war sonnig, aber kühl, in der Nacht war oben auf dem Høgefjell viel Schnee gefallen, obwohl es bereits Anfang Mai war.
Unten auf dem Kai fielen ihm drei kleine Jungen auf. Sie trugen handgestrickte Pullover in ungewöhnlich blauen Farbtönen. Aber mehr noch als die Jungen zog ihre schwarz gekleidete Mutter die Blicke auf sich. Sie war eine ansehnliche Frau, selbst in Trauerkleidung. Gefasst verabschiedete sie sich von ihren Söhnen. Sie gab ihnen die Hand, die Jungen machten einen Diener, woraufhin sie sich zum Gehen wandte. Sie ging ein paar Schritte, besann sich dann aber, lief zurück, kniete sich hin und umarmte alle drei kurz und fest. Dann stand sie abrupt auf und ging, ohne sich noch einmal umzusehen.
Jon Tygesen wusste, wer die drei Jungen waren. Er hatte von dem Fischerboot Soløya gehört, das mit Mann und Maus untergegangen war. Die armen Teufel, dachte er. Jetzt müssen sie in die Stadt und sich dort abrackern. Es ist kalt, und sie können sich natürlich nur einen Decksplatz leisten. In diesem Augenblick kam der Kapitän und stellte ihm eine Frage, und er verlor die Jungen aus den Augen.
Sie waren an Eikangervåg vorbei und hatten ein gutes Stück der Strecke hinter sich, als er die drei Jungen die hintere Leiter in den Maschinenraum klettern sah. Er stand weiter vorn und schaufelte Kohle hinter dem großen Dampfkessel, wo sie ihn nicht sehen konnten. Er stützte sich auf die Schaufel und betrachtete sie. Wahrscheinlich wollten sie sich einfach nur aufwärmen. Sie waren die einzigen Deckspassagiere, alle anderen hatten die fünfundzwanzig Öre Zuschlag bezahlt, um unter Deck gehen zu dürfen. An Deck war es ungeheuer kalt.
Das verstieß natürlich gegen die Regeln. Den Passagieren war es strengstens untersagt, sich im Maschinenraum aufzuhalten. Er würde sie rauswerfen müssen. Er beschloss jedoch, als Akt der Nächstenliebe sozusagen, noch etwas damit zu warten, damit sie sich zumindest halbwegs aufwärmen konnten. Als er sie so insgeheim beobachtete, schien es ihm, als seien sie gar nicht wegen der Wärme gekommen, sondern wegen des Dampfkessels und der Maschine. Sie gestikulierten lebhaft und mit eifrigen Gesichtern. Jon Tygesen trieb es Tränen in die Augen.
Entschlossenen Schrittes verließ er sein Versteck und fragte mit strenger Stimme, was die Passagiere im Maschinenraum zu suchen hätten. Die beiden kleineren Jungen sahen aus, als wollten sie Reißaus nehmen, aber der älteste blieb stehen und antwortete in nahezu unverständlichem Dialekt, dass er seinen Brüdern nur zeigen wollte, wie eine Dampfmaschine funktioniert. Jon Tygesen geriet ein wenig aus dem Konzept und musste sich ein Lächeln verkneifen.
»Du bist mir ja ein aufgeweckter Bursche, du weißt also, wie eine Dampfmaschine funktioniert?«, fragte er amüsiert nachsichtig. »Ist es dann überhaupt nötig, dass ich sie euch erkläre?«
Die drei Jungen nickten eifrig, und Jon Tygesen begann seine gewohnte Führung, die er manchmal für die vornehmen Leute aus der Stadt machte. Er ging systematisch vor, begann mit der eigentlichen Kraftquelle, dem Kohlenfeuer, dann wandte er sich dem großen Dampfkessel aus Kupfer und Messing zu und erläuterte die Kraftübertragung mithilfe von Kurbelwellen und Zahnrädern, samt den mechanischen Grundsätzen und allem Drum und Dran.
Die Jungen lächelten selig, erstaunlicherweise schienen sie alles zu verstehen. Zwischendurch warf einer von ihnen, anfänglich noch schüchtern, eine Frage ein, wenn Jon Tygesen etwas übersprungen hatte, um die Sache nicht unnötig zu komplizieren. Wie in aller Welt konnte es sein, dass drei kleine Fischerjungen von Osterøya sich derart gut in einem modernen Maschinenraum zurechtfanden, den sie nie zuvor gesehen hatten?
Nein, räumten sie ein, sie seien noch nie an Bord eines Dampfschiffes gewesen. Aber sie hätten etwas über Maschinen gelesen, in einer Zeitschrift. Jedenfalls bestand kein Zweifel daran, dass sie alles verstanden, was er sagte, und ungewöhnlich interessiert waren.
Als die Ole Bull an dem neu gebauten Kai an der Murebryggen anlegte, vergewisserte sich Jon Tygesen, dass die drei Jungen auch wirklich von jemandem abgeholt wurden. Er winkte ihnen zu und kehrte dann nachdenklich in seinen Maschinenraum zurück.
*
Sie erkannten ihren Onkel Hans kaum wieder, der schon seit mehreren Jahren in der Stadt wohnte. Er wirkte überraschend schmächtig und hatte, verglichen mit ihrem Vater, kleine Hände. Seine Fragen, wie die Reise verlaufen sei und wie es seiner Schwester Maren Kristine gehe, beantworteten sie schüchtern und einsilbig, während sie durch die Stadt gingen.
Die Jungen waren schon mehrmals in Bergen gewesen, aber nie für eine längere Zeit. Im Sommer, bei gutem Wetter, hatten sie manchmal ihren Vater und ihren Onkel Sverre mit dem Fang begleiten dürfen, der direkt am Kai verkauft wurde, aber bis in die eigentliche Stadt waren sie nie vorgedrungen. Nachdem sie nun ihre erste Unsicherheit und Scheu überwunden hatten, fragten sie ihrem Onkel Löcher in den Bauch.
Onkel Hans lebte in einer sogenannten Etagenwohnung in der Verftsgaten nah am Wasser. Hier wohnte ein Haufen fremder Menschen in ein und demselben drei Stockwerke hohen Haus. Die Wohnung bestand aus Zimmer und Küche mit Dienstmädchenkammer. Dort sollten die drei Brüder wohnen. Onkel Hans hatte ihnen eigenhändig drei kleine Kojen gezimmert.
Onkel Hans stellte sie seiner Frau Solveig vor, und sie machten einen Diener und gaben ihr die Hand, wie es ihnen ihre Mutter aufgetragen hatte. Solveig lobte ihre schönen Wollpullover und sagte etwas über die Gabe ihrer Mutter, was sie nicht verstanden.
Zwei Dinge am Stadtleben waren besonders seltsam. Das Wasser kam aus dem Wasserhahn, obwohl man mehrere Meter über dem Erdboden wohnte. Das andere Gewöhnungsbedürftige war die Art, wie die Stadtbewohner schissen. Neben der Küchentür hing ein Schlüssel, der zu einem der nummerierten Plumpsklos auf dem Hof passte. Dieses Klo wurde mit einem Nachbarn geteilt, sonst durfte es niemand benutzen. Einmal in der Woche kamen die Nachtmänner und holten die Tonnen.
Zu Abend gegessen wurde in der Küche, nach dem Tischgebet. Meist gab es Fisch und einmal in der Woche Kartoffeln mit Speck, genau wie zu Hause auf Osterøya.
*
Lauritz, Oscar und Sverre fanden sich in Cambell Andersens Seilerei, die nur zehn Minuten zu Fuß von der Verftsgaten, in der sie wohnten, entfernt lag, schnell zurecht. Sie besaßen eine rasche Auffassungsgabe und handhabten Seile und Werkzeuge mit solchem Geschick, dass die anderen Arbeiter und der Vorarbeiter Onkel Hans neugierige, anerkennende Fragen stellten. Die Fischerjungen seien seit ihrem fünften Lebensjahr zur See gefahren und hätten gelernt, überall mit anzupacken, erklärte er. So seien sie auch behilflich gewesen, als ihr Vater und ihr Onkel ein ungewöhnlich großes Fischerboot gebaut hatten.
Bereits nach einer Woche beschloss Vormann Andresen, ohne beim Direktor zu fragen, den Lauritzen-Jungs nach einem Monat einen Vorschuss auf ihren Lohn zu geben, der üblicherweise erst nach drei Monaten ausgezahlt wurde. Zweifellos würden diese Knaben einmal geschickte Seiler werden.
Sonntags promenierte man. Onkel Hans erklärte, das hieße so. Nach dem Gottesdienst ging man in seinen besten Kleidern durch die Stadt, ohne ein bestimmtes Ziel, und unterhielt sich hier und da mit den Leuten, denen man begegnete. Der Weg, der den drei Brüdern am besten gefiel, führte zu dem kleinen künstlichen Fjord, der nicht Fjord hieß, sondern Lille Lungegårdsvann. Sonntags ruderten Männer mit aufgekrempelten Ärmeln, das Sakko neben sich auf der Ruderbank, Damen durch die Gegend, die achtern saßen und einen Schirm über den Kopf hielten, selbst wenn es nicht regnete. Warum sie gerudert wurden, war den Jungen anfänglich vollkommen rätselhaft, wollten sie doch nirgendwohin, und Angeln hatten sie auch nicht dabei. Onkel Hans erklärte, dass man in der Stadt zum Vergnügen herumruderte, etwa so, wie man auch promenierte, allerdings mit einem Boot. Das machte die Sache nicht weniger befremdlich.
Am Nordufer des Lille Lungegårdsvann verlief die Kaigaten mit großen drei- und vierstöckigen Häusern, deren Fassaden mit Skulpturen und anderem Firlefanz verziert waren. Da diese Häuser aus Stein waren, musste die Belastung des Bodens fürchterlich groß sein, wie die Jungen bereits beim ersten Besuch in dieser vornehmen Straße anmerkten. Sie fragten Onkel Hans, wie dieses Problem gelöst worden sei. Er erwiderte, Stein sei schwer, und lege man Stein auf Stein aufeinander, bekäme das Ganze allein durch das Eigengewicht Stabilität.
Er merkte wohl, dass ihm die Jungen nicht glaubten, aber eine bessere Erklärung hatte er nicht parat, da er selbst noch nie über diese Sache nachgedacht hatte.
Als die Jungen nach einem Monat einen Vorschuss auf ihren ersten Lohn erhielten, konnten sie ihrem Onkel und seiner Frau Solveig das Kostgeld aushändigen und hatten trotzdem noch etwas Geld übrig. Bei einer Abstimmung, die zwei zu eins ausging, wurde beschlossen, dass sie die überschüssigen fünf Kronen der Mutter schicken wollten. Lauritz hätte für das Geld lieber ein Buch über Lokomotiven gekauft.
Alles war so vielversprechend und endete doch bereits vor dem Herbst in einer Katastrophe. Im Nachhinein machte sich Hans Tufte Vorwürfe, weil er nicht wachsamer gewesen war. Aber er wäre doch nie auf die Idee gekommen, dass sich die Jungen in den hellen Juninächten aus einem anderen Grund ins Freie schlichen, als zum Klosett zu gehen. Verzweifelt versuchte er sich damit zu entschuldigen, dass er das unmöglich hätte ahnen können. Nicht einmal ihr zwangsläufiger Schlafmangel war ihm aufgefallen.
Wovor ihm am meisten graute, war, wie er das klägliche Scheitern des Stadtlebens der Jungen seiner Schwester Maren Kristine erklären sollte.
*
Christian Cambell Andresen war achtundzwanzig Jahre alt, er war der älteste Sohn des Seilermeisters Andresen und würde bald das Unternehmen übernehmen. Er war ein gut aussehender Mann mit einem imposanten Schnurrbart und seltsamerweise noch unverheiratet. Man konnte ihn als jüngeres Mitglied der Bergener Gesellschaft betrachten, jedenfalls war er vollwertiges Mitglied des Eisenbahnkomitees, der Theatergesellschaft, der Wohltätigkeitsloge und des Herrenclubs Die gute Absicht. Er hatte den Kopf voller Ideen und war überall ein gern gesehener Gast.
Vor dem freien Sankt-Hans-Abend, wo bereits nicht mehr voll gearbeitet wurde, wollte er noch etwas im Büro erledigen. Er begegnete einigen Arbeitern, die auf dem Weg über den Hof zu einem Schuppen waren, der seit anderthalb Jahren leer stand. Er hatte als Reservelager für Hanf gedient.
Als er sich erkundigte, was los sei und warum die Männer große Feuerwehrbeile auf den Schultern trugen, erhielt er nur ausweichende Antworten von wegen eines »Schabernacks dieser Bengel«, den man unverzüglich in Ordnung bringen wollte. Das weckte seine Neugier. Er ging mit den anderen zu dem Schuppen und öffnete selbst die verzogenen Torflügel.
Der Anblick, der sich ihm bot, versetzte ihn anfänglich derart in Erstaunen, dass er mit offenem Mund dastand. In dem Schuppen stand ein mehr als halb fertiges Boot. Kein Ruderboot und keine Segeljolle, sondern das Modell eines Wikingerschiffes.
»Meine Güte«, murmelte er leise, als ihm endlich aufging, was er dort sah. »Das muss das Gokstadschiff sein!«
Ungeduldig riss er einem der Arbeiter den Zollstock aus der Tasche und begann, das Boot zu vermessen. Es war, nach der neuen Maßeinheit, die erst vor Kurzem in Norwegen und Schweden eingeführt worden war, 4,6 Meter lang und mittschiffs 1,02 Meter breit. Das konnte hinkommen.
Er wollte die Sache sofort kontrollieren und eilte über den Hofplatz zum Hauptgebäude, dann überlegte er es sich anders und ging noch einmal zurück.
»Was habt ihr eigentlich mit den Äxten vor, Männer?«, fragte er.
»Der Vormann hat uns angewiesen, den Dreck zu zerhacken und aufzuräumen«, antwortete der Älteste von ihnen verunsichert. Der Feuereifer des Eigentümersohnes war schließlich nicht zu übersehen.
»Fasst da drinnen um Gottes willen nichts an!«, befahl er. »Lasst alles, wie es ist, mit Werkzeug und allem. Und was meint ihr eigentlich mit dem ›Schabernack dieser Bengel‹?«
Die Antwort erstaunte ihn außerordentlich, das konnte doch nicht sein. Oder hatten die drei neuen Lehrlinge, die kaum älter als elf Jahre waren, tatsächlich das hier gebaut? Und überhaupt, wo waren die Jungen jetzt?
Die verzagte, gemurmelte Antwort ließ Böses ahnen. Vormann Andresen habe die drei kleinen Diebe verprügelt und ihnen fristlos gekündigt. Der zweite Vormann, ihr Onkel, hatte sie daraufhin zum Dampfschiff gebracht und sie nach Hause geschickt.
Wieso sie Diebe seien, hatte Christian Cambell Andersen wissen wollen.
Sie hätten Holz und Sägen von der benachbarten Holzhandlung gestohlen, zwar nur von dem Haufen Abfallholz, aber Diebstahl sei es trotzdem. Das übrige Werkzeug hätten sie in der Reparaturwerkstatt der Seilerei mitgehen lassen.
Diese Erklärung quittierte er mit einem resignierten Kopfnicken. Es hatte keinen Sinn, sich jetzt auf größere Diskussionen einzulassen. Er wiederholte einfach nur seine Anweisung, dass im Schuppen nur ja nichts angefasst werden dürfe. Das gelte vor allem für das »gestohlene« Werkzeug und das Material. Dann eilte er in sein Büro und begann sein Regal mit den Büchern über die Wikinger zu durchsuchen.
Wie etliche seiner Zeitgenossen begeisterte sich Christian Cambell Andersen für die Wikinger. Die Frithjofssaga konnte er auswendig, und die Ausgrabung des ersten gut erhaltenen Wikingerschiffes bei Gokstad hatte er seit seinem einundzwanzigsten Geburtstag genauestens verfolgt.
Schließlich fand er, was er suchte, das Buch, in dem die genauen Maße des Gokstadschiffes standen: 23,3 Meter lang und größte Breite mittschiffs 5,2 Meter, wenn man von Fuß und Zoll umrechnete. Er schrieb die Zahlen auf ein Blatt Papier und rechnete rasch. Es stimmte bis auf den Zentimeter. Die Jungen hatten ihr Modell genau im Maßstab 1:5 gebaut.
Er ließ sich auf seinen englischen Bürostuhl sinken und versuchte, sich einen Reim auf das Ganze zu machen, aber in seinem Kopf drehten sich die Gedanken im Kreis. Er musste sich die Arbeit der Jungen eingehender ansehen! Energisch erhob er sich und ging zügig zurück zum Schuppen auf der anderen Seite des Innenhofs. Er öffnete beide Torflügel, um Licht in den Schuppen zu lassen.
Die Klinkerbeplankung war perfekt, was in Anbetracht der kräftig geschwungenen Linien, die im Vorder- und Achtersteven zusammenliefen und mittschiffs am breitesten waren, erstaunte. Außerdem ragten Vorder- und Achtersteven steil auf. Dass es ein paar kleinen Jungen ohne richtiges Werkzeug gelungen war, diese kühnen und eleganten Linien aus einem Holz zu erschaffen, das sie aus dem Abfallhaufen der Holzhandlung gefischt hatten, war das reinste Wunder.
Er strich mit der Hand über die Beplankung. Keine Unebenheit, alles war perfekt geschliffen. Der Vordersteven war beidseits mit einem geschnitzten verschlungenen Drachenornament verziert, das weitgehend fertig war. Für diesen Schmuck gab es kein bekanntes Vorbild, jedenfalls nicht das Gokstadschiff, dessen war sich Christian Cambell Andersen vollkommen sicher, das hätte er gewusst. Aber die Ornamentik sah vollkommen authentisch aus, künstlerisch vollendet.
Die Ruderbänke lehnten an der Längswand des Schuppens, auch sie glatt abgeschliffen. Was für eine Schande, dass die Jungen die Arbeit nicht hatten vollenden können, ehe irgend so ein Idiot sie erwischt hatte!
Schabernack? Verprügelt, entlassen und nach Hause geschickt!
Das Empörendste war nicht, dass das grausam und unchristlich war, sondern die Einfältigkeit hinter der Bestrafung. Seiler waren keine Seeleute oder Bootsbauer, aber den Sinn für ein schönes Schiff konnte man ja wohl durchaus von jedem Bergener erwarten. Nun, er würde das schon wieder in Ordnung bringen. Es fragte sich nur, wie. Darüber musste er nachdenken.
Wie die meisten anderen Stadtbewohner begab er sich wenige Stunden später auf die große Stadtwiese, um sich die Mittsommerfeuer anzusehen, aber er war mit seinen Gedanken anderswo und ging recht früh, weil Regen in der Luft lag und er nicht nass in den Herrenclub kommen wollte. Er wollte an diesem Abend eine Partie Whist mit Halfdan Michelsen spielen, der so alt war wie er und bald den angesehensten Schiffbaubetrieb der Stadt übernehmen würde, sowie mit den Reedern Mowinckel und Dünner, die beide bedeutend älter waren als Christian und Halfdan, aber den Gedankenaustausch mit der jüngeren Generation, die bald alles übernehmen würde, als Vergnügen erachteten. Vorausgesetzt, es wurde nicht über Politik gesprochen.
Christian spielte die ersten Partien lausig, und die anderen merkten, dass er unkonzentriert war, waren jedoch taktvoll und stellten keine Fragen. Vermutlich ging es um irgendeine Herzensangelegenheit, und über so etwas sprach man nicht in der Guten Absicht.
Als sie jedoch anschließend beim Cognac mit Soda saßen und der Regen gegen die Bleiglasfenster prasselte, das Feuer im offenen Kamin knisterte und die englischen Ledersessel gemütlich knarrten, rückte er damit heraus, worüber er nachgrübelte.
Er erzählte, dass einige Vorarbeiter der Seilerei drei Lehrlinge gefeuert und sie vorher mit Lederriemen verprügelt hätten, weil sie, man höre und staune, ein exakt maßstabgerechtes und beinahe fertiges Modell des Gokstadschiffes gebaut hatten.
Die anderen sahen ihn an, als sei er übergeschnappt.
»Und wie alt waren die Lehrlinge?«, fragte Schiffsreeder Dünner vorsichtig.
»Etwa elf Jahre alt, schätze ich«, antwortete Christian zögernd, denn er befürchtete, ausgelacht zu werden.
Und ausgelacht wurde er. Die anderen konnten nicht an sich halten, entschuldigten sich aber rasch und fuchtelten abwehrend mit den Händen. Eine verlegene Stille trat ein.
»Ich habe einen Vorschlag«, sagte Christian hartnäckig. »Ich wette, dass Sie, meine Herren, zum einen verblüfft sein und mir recht geben werden, wenn Sie das Meisterwerk sehen. Als Entschädigung für Ihr Misstrauen müssen Sie mir bis zum Jahreswechsel meinen Cognac Soda ausgeben. Sollten Sie nicht beeindruckt sein, geht der Cognac Soda für den Rest des Jahres natürlich auf mich!«
Auf die angespannte Stimmung folgte ein Lachen, und man bestellte flugs eine Droschke von W. M. Bøschen in der Kong Oscars Gate. Bei diesem Wetter war an einen Spaziergang nicht zu denken, obwohl es zur Seilerei in Nordnes nicht allzu weit war.
Eine halbe Stunde später, die Pferdedroschke wartete vor dem Gebäude, öffnete Christian die Torflügel des alten Schuppens. Er hielt zwei Petroleumlampen in der Hand, um Licht in das Mittsommerdunkel zu bringen. Die anderen schnappten erstaunt nach Luft, sie waren Schiffsleute und begriffen sofort, was sie vor sich hatten.
Sie begannen eine eingehende Untersuchung des Schiffsmodells, wobei sie einander auf verschiedene Entdeckungen und Beobachtungen aufmerksam machten, beispielsweise dass die Jungen keine Nägel verwendet, sondern die Planken allein mittels Holzdübeln befestigt hatten. Wie aber hatten sie diese Dübel ohne eine Drehbank hergestellt? Halfdan, der von Kindesbeinen an Bootsbauer war, untersuchte einen der Holzdübel genauer, nahm Hammer und Keil zur Hand, schlug ihn vorsichtig heraus und betrachtete ihn von allen Seiten, erst mit gerunzelter Stirn, dann mit einem breiten Lächeln. Anschließend hielt er einen munteren Vortrag und versicherte, dass man es mit, gelinde gesagt, genialen Lausebengeln zu tun habe. Sie hatten die Dübel mit der Hand geschnitzt, in Keilform. Dann hatten sie den Teil des Holzdübels, der durch das gebohrte Loch in den Planken geschoben wurde, dünn mit Hanf umwickelt und mit Teer präpariert. Anschließend hatten sie den Dübel mit dem Hammer eingeschlagen, sodass Teer und Hanf zusammengedrückt wurden und das Ganze richtig fest saß. Abschließend mussten sie nur noch die Enden absägen und mit Sandpapier glatt schmirgeln.
Aber wie hatten die Jungen das Holz für die Rundungen von Bug und Heck zurechtgebogen?
Die Männer sahen sich im flackernden Schein der Petroleumlampen nach einer Erklärung um und fanden sie auch. An der hinteren Schmalseite des Schuppens stand ein Wassereimer auf ein paar Steinen. Unter dem Eimer waren noch die Spuren eines Feuers zu sehen. Sie hatten sich mit Wasserdampf beholfen.
Das rührendste Fundstück war die Vorlage. Sie hing an der einen Längswand und bestand aus Bildern des Gokstadschiffes in Farbdruck, wie es zu Beginn und nach Fertigstellung der Restaurierung ausgesehen hatte und wie man sich vorstellte, dass es vor tausend Jahren einmal ausgesehen hatte. Daneben gab es ein paar einfache Skizzen und Maßangaben. Die Bilder stammten aus einer billigen Illustrierten für Haus und Heim und waren als Bauzeichnungen recht dürftig.
Christian fiel auf, dass die Zeitschriftenbilder keine Vorschläge zur Verzierung von Vorder- und Achtersteven lieferten.
Bester Laune kehrte die kleine Gesellschaft in den Club zurück, um dafür zu sorgen, dass Christian auf Kosten seiner Kameraden den Club bis Ende des Jahres nicht mehr nüchtern verließe.
Als sie so zum zweiten Mal an diesem Mittsommerabend miteinander anstießen, wurden die Freunde von einer feierlichen Stimmung ergriffen.
Was sie gesehen hatten, war einzigartig, da waren sich alle einig. Drei kleine Jungen, die, wenn es hochkam, vier oder fünf Jahre die Schule besucht hatten, mehr war draußen auf den Inseln nicht üblich, hatten etwas gebaut, das als Meisterstück eines Schiffsingenieurs getaugt hätte. Die Wege des Herrn waren unergründlich. Drei Fischerjungen von Osterøya, warum hatte der Herrgott ausgerechnet sie mit solch technischem Genie ausgestattet? Was brachten ihnen diese Gehirnleistungen ein, wenn sie ihre Netze auswarfen, um Dorsche zu fangen?
Christian, der weder an den Herrgott noch an seine unergründlichen Wege glaubte, wandte trocken ein, dass diese Jungen keine Fischer werden würden. Nein, diese Jungen würden Eisenbahningenieure und Brückenbauer werden.
Die anderen sahen ihn verblüfft an, während sie über seine Worte nachdachten. Dann nickten sie fröhlich. Die Idee war genauso brillant wie selbstverständlich. Wer wollte, konnte es auch für einen Fingerzeig Gottes halten.
Bergens Eisenbahnkomitee war 1872 gegründet worden, und sie waren allesamt aktive Mitglieder. Aber die Planungsphase für eine Eisenbahnstrecke war zäh verlaufen, da die Politiker in Kristiania der Meinung waren, dass die Bergener, die schließlich Seeleute waren, weiterhin gut in die Hauptstadt segeln konnten. Soweit sie dort überhaupt etwas verloren hatten. Widerwillig hatte das Storting zugestimmt, eine Eisenbahn zwischen Bergen und Voss zu bauen, und diese war seit einigen Jahren in Betrieb. Aber der große Sprung stand noch aus, von Voss über die ganze Hardangervidda und hinunter nach Kristiania. Die Politiker jammerten und sagten, es sei unmöglich, eine Eisenbahn in solcher Höhe und bei solcher Kälte zu bauen, in solchen Schneemassen und in dem acht Monate andauernden Winter. Außerdem fehlte es in Norwegen an Ingenieurswissen auf diesem hohen Niveau, nicht einmal in der Schweiz sei ein ähnliches Projekt geglückt. Etwas in Angriff zu nehmen, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, wäre somit, trotz gewisser naiver Optimisten aus Bergen, eine verantwortungslose Verschwendung begrenzter staatlicher Mittel.
Dass die Bergenbahn, wie das Projekt genannt wurde, eine unerhörte technische wie ingenieurwissenschaftliche Herausforderung darstellte, darüber zumindest war man sich einig. Aber unmöglich war sie gewiss nicht.
»Also und folglich«, schloss Schiffsreeder Dünner, nachdem sie hin und her überlegt hatten, »werden wir unsere eigenen Ingenieure ausbilden. Wir bieten ihnen die beste technische Ausbildung der Welt. Für die bezahlen wir. Und sie erstatten uns die Kosten zurück, indem sie unsere Eisenbahn bauen.«
Nachdenkliches Schweigen breitete sich um den Tisch aus. Man bestellte ein letztes Glas Cognac Soda und stieß mit Christian an, der von jetzt an ein halbes Jahr lang auf Kosten der anderen trinken durfte.
»Das ist eine großartige Idee«, meinte Schiffsreeder Mowinckel schließlich. »Ich stimme in der Sache und rein vernunftmäßig Dünner zu, aber Gott allein bestimmt über das Schicksal der Jungen und nicht wir, wie sehr wir ihre Begabung in unser heiß begehrtes Projekt auch einbringen möchten. Lasst es mich so sagen: Die gute Absicht sucht immer nach wohlbegründeten Motiven zur Wohltätigkeit. In diesem Fall haben wir eine junge, mittellose Witwe mit drei außerordentlich begabten Söhnen. Genügt das etwa nicht für einen Anfang?«
Die anderen nickten zustimmend und hoben einträchtig ihre Gläser. Man beschloss, dass Christian die Witwe aufsuchen sollte.
*
Es war ausnahmsweise einmal ein vollkommen wolkenloser Junitag. Es hatte zehn Tage lang unablässig geregnet, als Christian von der Murebryggen auf das Deck der Ole Bull stieg. An Bord befanden sich an diesem Tag ungewöhnlich viele, vor allem deutsche Touristen. Vielleicht hatte das mit dem Wetterumschwung zu tun. Der Erste-Klasse-Salon war so voll, dass man eng und unbequem saß. Christian wollte eben einen Spaziergang an Deck machen, als ihn die Frau, die neben ihm saß, fragte, ob er Deutsch spreche. Als er bejahte, begann sie ihn über Wikinger auszufragen, und da er sich selbst für dieses Thema begeisterte, konnte er fast alle ihre Fragen beantworten. Ihre Reisebegleiter stellten weitere Fragen, und er fühlte sich fast wie ein Reiseleiter.
Die Ausländer hatten einen Narren an den Wikingern gefressen, und im Sommer strömten sie von nah und fern an die Fjorde. Das war gewöhnungsbedürftig, aber natürlich gut für Norwegen, denn diese Ausländer hatten viel Geld.
Als er sich schließlich loseisen und an Deck gehen konnte, betrachtete er die Aussicht mit anderen Augen. Wer in Westnorwegen geboren war und nichts anderes kannte, für den sah diese Welt natürlich aus. Glitzerndes Wasser, schneebedeckte Berggipfel, Steilhänge, die direkt ins Wasser reichten, und hohe Wasserfälle. Aber für Leute aus einer rußigen Großstadt wie London oder Berlin war das sicher ein besonderes Erlebnis!
Vielleicht sollte er auch in den Tourismus investieren. Die Seilerei in allen Ehren, aber würde sie auch in Zukunft so gewinnbringend sein wie die neuen Hotels für die Touristen? Er nahm sich vor, dieses Thema für eine abendliche Unterhaltung im Club vorzuschlagen.
Als er an dem einfachen Steg von Tyssebotn an Land ging, die Gangway schwankte bedenklich, war ihm etwas beklommen zumute. Er konnte sich nicht länger mit der Aussicht ablenken, jetzt musste er sich auf die beschwerliche Verhandlung konzentrieren, die vor ihm lag.
Es hatte nicht den Anschein, als würde ihn jemand am Anleger erwarten, obgleich er seinen Besuch schriftlich angekündigt hatte. Seltsam. Er musste sich durchfragen.
Als er schließlich in die dunkle Wohnstube des Frøynes Gård trat, saßen die drei Knaben mit gesenkten Köpfen nebeneinander auf der Wandbank. Sie wagten es nicht, ihn anzusehen.
Die Witwe Maren Kristine nahm verlegen in einem großen, mit Drachenornamenten verzierten geschnitzten Lehnstuhl Platz. Schweigend deutete sie auf einen gleichartigen Stuhl ihr gegenüber. Er hatte noch kein Wort gesagt und war auch nicht von ihr begrüßt worden. Es war gespenstisch.
Christian kämpfte gegen die aufsteigende Panik an. Er fühlte sich wie in einem Albtraum, in dem er äußerst unwillkommen war. Es roch ganz leicht nach Vieh. Außerdem war die Witwe Maren Kristine – und es war natürlich äußerst unpassend, gerade jetzt daran zu denken – eine der schönsten Frauen, denen er je begegnet war. Sie war kaum älter als er selbst, wenn überhaupt. Sie trug ein schwarzes Kleid und ein schwarzes Kopftuch, aber ihr langes, kupferrotes Haar schaute unter dem schwarzen Stoff hervor. Sie betrachtete ihn ruhig, aber nicht freundlich mit ihren hellblauen Augen. Vor ihm auf dem Tisch stand ein kleiner Teller mit Plätzchen. An der Wand aus Holzbalken hingen kunstvoll gewebte Teppiche, wie er sie noch nie gesehen hatte. Er hätte sie gerne näher betrachtet, aber dafür war jetzt nicht der richtige Augenblick. Er musste so schnell wie möglich sein Anliegen vorbringen, da die Familie zu glauben schien, er sei gekommen, um weitere Strafen zu verhängen.
»Ich bin froh, dass Sie und Ihre Söhne mich empfangen konnten, Frau Eriksen«, begann er, seine Kräfte zusammennehmend. »Ich habe ein paar wichtige Dinge zu sagen und will das der Reihe nach tun.«
Er machte eine Pause und schielte zu den Jungen, die immer noch mit gesenktem Blick dasaßen. Sie schienen auf weiteres Ungemach gefasst zu sein.
»Erst einmal«, fuhr er fort, »möchte ich Ihnen gratulieren, Frau Eriksen, dass Sie mit drei so begabten Söhnen gesegnet sind. Ich war ganz verzückt, ja, dieses Wort muss ich einfach verwenden, als ich ihr Modell des Gokstadschiffes gesehen habe.«
Er verstummte und schielte erneut zu den Jungen hinüber, die erstaunt die Köpfe hoben und sich rasch und schüchtern anlächelten, dann aber unverzüglich wieder ernst wurden, aus Angst, ihre Mutter könnte sie sehen. Wie im Gebet senkten sie wieder die Köpfe.
Ihre Mutter verzog noch immer keine Miene. Er war noch nie einem Menschen mit solcher Selbstbeherrschung begegnet. Er war nicht sicher, ob sie auf Angst oder Feindseligkeit zurückzuführen war.
»Als Nächstes möchte ich Folgendes vorbringen«, fuhr er in der Gewissheit fort, bald die gespenstische Stimmung aufheben zu können, »und zwar die aufrichtige Entschuldigung der Firma Cambell Andersen dafür, dass unsere Angestellten die einzigartige Leistung der Jungen so schlecht belohnt haben. Ich kann Ihnen versichern, Frau Eriksen, dass die Geschichte einen glücklicheren und vor allen Dingen gerechteren Verlauf genommen hätte, hätten ich selbst oder mein Vater, die Besitzer der Firma, den fantastischen Schiffbau als Erste entdeckt. Dann hätte es eine Belohnung statt Prügel und Entlassung gegeben.«
Jetzt erst reagierte die Witwe, allerdings umso deutlicher. Sie holte heftig Luft, und das nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Ihr schöner Busen hob und senkte sich, und Christian schämte sich der unvermeidlichen wie unpassenden Beobachtung.
»Wissen Sie, Herr Cambell Andersen«, sagte sie gefasst, wenn auch immer noch schwer atmend, »dass keine anderen Worte mich hätten glücklicher machen können. Mehr kann ich nicht sagen.«
Die drei Jungen saßen nicht mehr aneinandergedrängt und mit gesenkten Köpfen da. Sie streckten die Hälse und betrachteten den Gast forschend und erwartungsvoll. Christian Cambell Andersen war erleichtert, dass das Eis endlich gebrochen war, weil er jetzt sein eigentliches Anliegen vorbringen konnte.
»Des Weiteren«, fuhr er fort und lächelte versuchsweise, »habe ich den Lohn der Jungen für die Zeitspanne, in der sie fälschlich entlassen waren, bei mir. Dazu kommt ein Angebot, zu dem Sie bitte Stellung nehmen wollen, Frau Eriksen. Es kommt von der Wohltätigkeitsloge in Bergen, der ich ebenfalls angehöre, die aber nichts mit der Firma zu tun hat. Der Vorstand der Guten Absicht, wie wir uns nennen, hat beschlossen, die Ausbildung der Jungen zu finanzieren, zuerst an der Kathedralschule in Bergen, dann an der Polytechnischen Schule für die höhere Ausbildung von Knaben in Kristiania und schließlich zum Ingenieur an der Universität Dresden in Deutschland. Das ist die derzeit beste Universität für Ingenieure.«
Die drei Jungen auf der Wandbank sahen ihn ungefähr so überrascht an, wie er es erwartet hatte. Aber ihre Mutter ließ mit keiner Miene erkennen, was sie dachte. Er verstummte und wartete ihre Antwort ab. Es verging eine ganze Weile, und er fragte sich schon, ob er ihr wohl zu viel auf einmal zumutete. Vielleicht erfasste sie gar nicht, welch großzügigen Vorschlag er ihr unterbreitet hatte?
Die Witwe nickte vor sich hin, als müsse sie sich erst noch ihre Worte zurechtlegen. Schließlich holte sie tief Luft und sprach mit fester Stimme, ohne zu stocken, allerdings in einem breiten Dialekt, den er nur mit Mühe verstand.
»Der Pfarrer hat dasselbe gesagt wie Sie, Herr Andersen, dass die Jungen keine Fischer werden sollten. Deswegen sind sie nach Bergen gezogen, um die große Welt kennenzulernen. Aber ich weiß es jetzt und habe es schon damals gewusst, dass uns diese Schulen die Kinder wegnehmen. Wer solchen Unterricht erhält, kehrt nicht zurück. Nie. Ich habe zum Pastor Nein gesagt. Und jetzt sage ich auch Nein. Weil ich drei kleine Männer brauche anstelle des einen großen Mannes, den ich einmal hier auf dem Hof hatte. Des Mannes, den das Meer uns genommen hat.«
Christian Cambell Andersen war im ersten Moment so verdutzt, dass er nicht wusste, was er antworten sollte. Da kam er mit einer fürstlichen Gabe und legte sie funkelnd der schwarz gekleideten Fischerwitwe in den Schoß. Und sie wies ihn ab, ohne auch nur ein einziges Mal mit der Wimper zu zucken.
Er musste nachdenken. Er schielte erneut zu den Jungen hinüber, die aufrecht auf der Wandbank saßen und ihn und ihre Mutter mit entsetzten Augen ansahen, als hofften sie verzweifelt darauf, dass er jetzt etwas schrecklich Kluges sagen würde. Aber sein Kopf war leer, er war vollkommen überrumpelt.
Schweigen war in diesem Haus offenbar nichts Ungewöhnliches. Sie hatte ihn endlose Minuten warten lassen. Jetzt ließ er sie warten, während er nach einer passenden Antwort suchte.
»Wissen Sie, Frau Eriksen«, begann er langsam, »jetzt ist Sommer, und an den Hängen wird das Heu gemäht. Die Jungs sind bei Ihnen gut aufgehoben. Der Unterricht in der Kathedralschule beginnt erst nach den sogenannten Sommerferien, und die enden mehrere Wochen nach der Heuernte. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir von der Loge Die gute Absicht natürlich Ihre schwere Lage, Frau Eriksen, berücksichtigt haben. Wir haben daher beschlossen, Ihnen eine Witwenpension anzubieten, die gut und gerne die Arbeitskraft der drei aufgeweckten Jungen hier auf dem Hof aufwiegt, wenn wir die Jungen ausbilden dürfen, wie ich es vorgeschlagen habe.«
Letzteres entsprach nicht der Wahrheit, es war ihm soeben spontan eingefallen. Aber die wohlhabenden Männer in Bergen hatten also zusammengesessen und nicht überblickt, was es für eine Fischerwitwe bedeutete, ihrer Söhne beraubt zu werden. Diese Dummheit oder zumindest Fantasielosigkeit ließ sich nur mit dem diskreten Beschluss einer Witwenpension aus der Welt schaffen.
Falls ihm irgendein Paragrafenreiter aus dem Vorstand vorwerfen würde, er habe seine Befugnisse überschritten, was tatsächlich zutraf, würde er diese Witwenpension eben aus eigener Tasche zahlen.
Die schöne Witwe war erneut verstummt und sann über ihre Antwort nach. Ihre drei Söhne saßen kerzengerade da und ließen ihre Mutter keine Sekunde aus den Augen. Es bestand kein Zweifel daran, was sie selbst fanden.
»Mutter«, sagte plötzlich einer von ihnen, »verzeiht, dass ich ohne Mutters Erlaubnis spreche, aber eines muss ich sagen. Meine Brüder und ich wünschen uns nichts mehr im Leben als das. Einen größeren Traum könnte man uns nicht erfüllen. Wir versprechen auch, uns immer um dich zu kümmern.«
Die zwei anderen Jungen nickten eifrig.
Christian Cambell Andersen wurde erneut von einem starken Gefühl der Unwirklichkeit ergriffen. Der kleine Ingenieur oder Schiffbauer oder Brückenbauer oder was auch immer er werden wollte, hatte seine Sache kurz und bündig in wenigen Sätzen dargelegt wie der isländische Skalde Snorri Sturluson.
Doch seine Mutter ließ sich Zeit mit ihrer Antwort. Ihr Gesichtsausdruck gab nicht preis, was sie dachte oder wie ihre Antwort ausfallen würde. Dann strahlte sie plötzlich wie die Sonne, die nach einem grauen Tag mit gleißendem Licht über dem Fjord aufgeht.
»Herr Christian Cambell Andersen«, sagte sie. »Mein Vertrauen in Euren guten Willen ist groß. Auch meine Zuversicht ist groß. Mögen Sie sich gut um meine Söhne kümmern.«
Auch sie spricht wie aus einer Wikingersaga, dachte er.
*
Während eines der schlimmsten Stürme des Herbstes fand sich der Rektor der Bergener Kathedralschule bei der Vorstandssitzung der Loge Die gute Absicht ein, weil er zu Punkt 18 der Tagesordnung etwas sagen sollte. Es ging um die Beurteilung der ersten Unterrichtsmonate der Lauritzen-Jungs.
Es sei anfänglich schwierig gewesen, sie auf die Klassen zu verteilen, begann der Rektor. Ihr Wissen variiere sehr stark. Offenbar hätten sie bei dem Pfarrer auf Osterøya Unterricht erhalten, das Übliche also: Rechnen und Schreiben und dann raus auf die See. In manchen Fächern wie deutscher Sprache, Erdkunde und moderner Geschichte lägen sie damit weit hinter ihren Altersgenossen zurück.
In anderen Fächern sei es genau umgekehrt. Ihre Begabung für Mathematik und Physik müsse als einzigartig bezeichnet werden. Der Jüngste besäße außerdem ein augenfälliges künstlerisches Talent. Summa summarum holten sie rasch den Vorsprung sämtlicher Altersgenossen auf, nicht zuletzt, weil sie mit solchem Eifer und solcher Freude lernten, die den Bürgersöhnen der Stadt leider nur selten zu eigen seien. Daran, dass die drei Lauritzen-Jungs außergewöhnlich begabt seien, bestehe kein Zweifel.
»Aber können aus ihnen in Dresden auch diplomierte Ingenieure werden?«, knurrte der Vorsitzende des Vorstands ungeduldig. Es war offenbar, dass der formelle Beschluss so formuliert werden musste.
Eine gespannte Stille breitete sich in dem mit Eichenholz getäfelten Sitzungssaal aus. Nur der Regen, der gegen die Bleiglasfenster peitschte, war zu hören. Die Sitzungsteilnehmer sahen den Rektor auffordernd an, der angesichts der konkreten Frage den Faden verlor.
»Entschuldigen Sie, falls ich mich undeutlich ausgedrückt haben sollte, das war wirklich nicht meine Absicht«, antwortete er schließlich reserviert und presste die Lippen zusammen.
»Gestatten Sie mir einen neuen Versuch, die Sache noch einmal so zu schildern, dass kein Raum für Missverständnisse bleibt«, fuhr er ungehalten fort. »Wenn es drei Jungen in ganz Westnorwegen gibt, aus denen Sie in Dresden Diplomingenieure machen können, dann sind es diese drei!«
Der Vorsitzende ließ sich von dem zurechtweisenden Ton des Rektors nicht provozieren, schlug den Hammer auf den Tisch, dankte Rektor Helmersen für sein Kommen und ging zum nächsten Punkt der Tagesordnung der Wohltätigkeitsloge Die gute Absicht über.
II
1901
Die letzten Tage in Dresden
»Sehr verehrte Herren Diplomingenieure, wir bilden in Dresden nun schon seit vielen Jahren die besten Ingenieure Deutschlands und somit der Welt aus. So war es bereits am Königlich Sächsischen Polytechnikum, und so ist es auch heute noch an dieser unserer Technischen Hochschule.
Doch sind die Voraussetzungen für die Absolventen heute besser als je zuvor in der Geschichte unserer schon seit vielen Hundert Jahren existierenden Ausbildungsstätte. Meine Herren, Ihnen liegt die Welt zu Füßen, eine ganz neue Welt. Das zwanzigste Jahrhundert wird nämlich größere technische Fortschritte erleben als irgendeine andere Epoche in der Geschichte der Menschheit. Die moderne Technik wird sich in großen Sprüngen weiterentwickeln und die Welt so gründlich verändern, dass unsere Kollegen, die hier in hundert Jahren ihr Examen ablegen werden, auf unsere Zeit zurückblicken werden wie wir heute auf die Steinzeit.
Was gestern noch als wilde Fantasie abgestempelt wurde, teilweise sogar heute noch, wird morgen Wirklichkeit sein. Da stellt es dann keine Herausforderung mehr dar, wie bei Jules Verne in achtzig Tagen um die Welt zu reisen. Wir werden die Lüfte erobern, und die meisten in diesem Saal werden Flugverkehr für Passagiere erleben, und zwar nicht nur zwischen Ländern, sondern auch zwischen Kontinenten. Ebenso werden wir die Tiefen der Weltmeere ergründen. Um noch einmal auf Jules Verne zurückzukommen, es wird bald auch eine unterseeische Weltumsegelung möglich sein.
Wir werden im Dunkeln sehen, uns auf Tausende von Kilometern Distanz unterhalten, mit einer Geschwindigkeit von zweihundert Kilometern in der Stunde mit der Eisenbahn reisen und Gebäude errichten, die Hunderte von Metern hoch sind. Es wird Methoden geben, den menschlichen Körper zu durchleuchten und zu untersuchen, ohne ihn zu verletzen, und in Dresden Musik aus Bayreuth zu hören, als säßen wir persönlich im Konzertsaal. Unsere Rechenmaschinen werden hundert-, ja vielleicht tausendmal besser sein als die, die wir heute benutzen. Ich bin mir sicher, dass zumindest Sie, die jüngere Generation, erleben werden, wie der erste deutsche Wissenschaftler den Mond betritt, obwohl Jules Vernes technische Empfehlungen gerade in diesem Punkte nicht viel wert sind.«
An dieser Stelle wurde zum ersten Mal gelacht. Die frischgebackenen Ingenieure hatten bis dahin regungslos und wie verhext dagesessen, ohne einen Laut von sich zu geben. Der Rektor der Technischen Hochschule war als sehr guter Redner bekannt, aber dieses Mal übertraf er sich selbst und die hochgeschraubten Erwartungen.
»Kurz gesagt«, fuhr er fort, »in einigen Jahrzehnten wird die Welt durch unsere technischen Fortschritte vollkommen verändert sein. Wir werden die armen Erdteile mit unserem Wissen bereichern, womit wir in Afrika bereits begonnen haben. Wir werden damit eine Gleichheit der Völker und Rassen herbeiführen, und deswegen ist das, was vor uns liegt, nicht nur ein Projekt für Männer, die als Seele einen Rechenschieber haben, oder eine Frage der physikalischen Gesetzmäßigkeiten und anderer Naturwissenschaften. Es ist auch in hohem Grade ein humanistisches Projekt, das vor Ihnen liegt.
Die umwälzende technische Veränderung, die unsere Welt nun in diesem zwanzigsten Jahrhundert prägen wird, bedeutet für die Menschheit in einer ganz bestimmten Hinsicht eine größere Segnung als alles andere.
Kriegsführung wird nicht mehr als adäquates Mittel zur Lösung politischer Probleme infrage kommen. In einer Welt, die technisch so avanciert ist wie die, an deren Erschaffung Sie von heute an und für den Rest Ihres Berufslebens mitwirken sollen, wird der Krieg in die Rumpelkammer der Geschichte verbannt. Kriege sind primitiv, daher sind hochtechnologische Kriege eine Contradictio in adiecto, ein Widerspruch in sich.
Sie werden nun ausziehen, um diese neue Welt zu zeichnen, zu bauen und zu konstruieren. Ich wünsche Ihnen von ganzem Ingenieursherzen Glück dabei!«
Es folgte ein stürmischer Applaus, der kein Ende nehmen wollte. Es wurde getrampelt, dann erhob sich ein frackbekleideter Examinierter nach dem anderen, bis die Freudenbekundungen in Stehbeifall übergingen.
Als der Applaus verebbt war, wurden die Urkunden überreicht. Die Studenten mit den besten Examensnoten wurden von zehn bis eins aufgerufen. Es war eine unerhörte Ehre, in Dresden zu den besten zehn zu gehören, das ebnete einem den direkten Weg zu den interessantesten und bestbezahlten Stellungen in ganz Europa. Gehörte man zu diesen zehn, standen einem alle Türen offen.
Ein Engländer belegte den zehnten Platz. Er kam auf die Bühne und nahm zu höflichem Applaus, hauptsächlich von seinen Landsleuten, sein Diplom entgegen. Es hieß, dass reiche Engländer, die in Cambridge nicht angenommen worden waren, in Dresden studierten, was von allen Engländern in der Stadt – die zufälligerweise alle reich waren – mit Nachdruck bestritten wurde.
Nummer neun war ein Berliner, Nummer acht ein Hamburger.
Nummer sieben war ein Norweger, Oscar Lauritzen. Er erhielt einen mäßigen, höflichen Applaus. Die drei Brüder saßen nebeneinander. Sverre war aus dem Rennen, Oscar war erleichtert, und Lauritz wurde immer nervöser, da die Anzahl der ersten zehn Plätze zusehends schrumpfte. Er bemühte sich, ungerührt zu wirken, aber seine Brüder durchschauten ihn natürlich.
»Vergiss nicht, dass es ein Wettkampf ist, Lauritz«, flüsterte sein jüngster Bruder Sverre. »Und wann hast du je einen Wettkampf verloren?«
Damit spielte er auf Lauritz’ Karriere als Radrennfahrer an. Im Jahr zuvor war er im Velodrom in Dresden Universitätseuropameister geworden. Die deutsche und die Dresdner Meisterschaft hatte er bereits mehrere Male gewonnen.
Schließlich waren nur noch zwei Urkunden übrig. Als der zweite Platz an einen Leipziger ging, brach Lauritz der kalte Schweiß aus. Er konnte nicht mehr klar denken. Natürlich hätte er zu den zehn Besten gehören müssen, das wussten alle …
Der redegewandte Rektor zog die Spannung bis ins Unerträgliche in die Länge, ehe er mit der letzten Urkunde vortrat.
»Seltsamerweise«, sagte er, »handelt es sich bei der Nummer eins dieses Jahres um einen Mann, der mit etwas sehr Unmodernem und technisch Primitivem, nämlich mit Fahrrädern, Erfolge erringt!«
Damit war alles klar. Die Brüder klopften ihm auf die Schulter. Er selbst versuchte eine ernste Miene aufzusetzen, als wäre er der Einzige unter den siebenundfünfzig frisch examinierten Diplomingenieuren, der nicht verstanden hatte, wer der Mann mit dem Fahrrad war.
»Darf ich unseren Europameister Lauritz Lauritzen bitten, nach vorne zu kommen!«, rief der Rektor laut, um den bereits aufbrausenden Applaus zu übertönen.
Als die drei Brüder anschließend mit ihren Diplomen unter dem Arm auf der George-Bähr-Straße im Gedränge der frisch Examinierten und ihrer Eltern standen, hatten sie wirklich das Gefühl, dass ihnen die Welt zu Füßen lag. Sie würden sich einige Jahre auf der Hardangervidda abrackern müssen, um ihre Schuld abzubezahlen, aber dann waren sie frei. Sobald die Eisenbahnstrecke fertig war, wollten sie versuchen, eine eigene Ingenieurfirma im Zentrum Bergens aufzubauen, die sie im Scherz Lauritzen & Lauritzen & Lauritzen getauft hatten.
Jetzt würden sie sich aber erst einmal auf den Weg zur Dresdner Bank machen, ihre Diplome vorzeigen und wie vereinbart jeder tausend Mark entgegennehmen. Das war ein Abschiedsgeschenk, eine Art Gratifikation von der Loge Die gute Absicht, die sich ihrer angenommen hatte, nachdem sie als Seilerlehrlinge bei Cambell Andersen in Nordnes entlassen worden waren.
Tausend Mark war ein überaus großzügiges Examensgeschenk, das entsprach etwa achttausend norwegischen Kronen, mehr als der Jahresverdienst eines Eisenbahningenieurs bei der Bergenbahn.
Sobald sie ihr Geld hatten, wollten sie nach Hause gehen und kurz die Fräcke ablegen, um für den Abend ein frisches Hemd anzuziehen. Beim Examensbankett wurde ebenfalls Frack getragen.
Ihr Weg war lang gewesen, aber jetzt waren sie am Ziel. Es hätte also für die drei Brüder der glücklichste Tag ihres Lebens sein sollen, und äußerlich war auch nichts Gegenteiliges zu erkennen.
Aber es gab etwas, das Lauritz seinen Brüdern verschwiegen hatte.
Und etwas anderes, das Oscar nicht ausgesprochen hatte.
Und Sverre hatte ebenfalls ein Geheimnis, das er um nichts in der Welt preisgeben wollte.
*
Oscar saß spätabends, am zweiten Abend nach ihrem Verschwinden, auf der Wache in der Nähe des Hauptbahnhofs in der Südvorstadt, die im Übrigen nicht weit von der Technischen Hochschule entfernt lag.
Er war unrasiert und schwitzte, obwohl es ein milder Maiabend war. Hatte er vor zwei Tagen den glücklichsten Tag seines Lebens erlebt, so war dies sein unglücklichster.
Maria Theresia war definitiv verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Keine Spur, kein Brief, kein Blutfleck, nichts.
Er war zwanzig Minuten vor Abfahrt des Zuges nach Berlin auf dem Bahnhof gewesen. Es hätte der erste Schritt in ihr neues, glückliches Leben sein sollen. Endlich war sie frei, auf dem Weg in ein neues Land mit einer neuen Identität. Er war bis über beide Ohren verliebt und hatte das Glück, das ihn erfüllte, kaum fassen können. Sobald sich der Zug in Bewegung setzte, hätte er die mitgebrachte Flasche Champagner geöffnet.
Drei Minuten vor der Abfahrt hatte er sein Gepäck, zwei volle Reisetaschen, aus dem Abteil geholt. Sie musste aufgehalten worden sein, und da konnte er natürlich auch nicht reisen. Es zerrte an seinen Nerven und war ärgerlich, den Zug zu verpassen und am nächsten Tag erneut den Optimismus für die Flucht in eine neue Welt aufbringen zu müssen, eine vielfältigere neue Welt als jene, die der Festredner am Examenstag vorausgesagt hatte.
Sie war nicht gekommen. Die Lokomotive hatte gepfiffen und sich schwerfällig in Bewegung gesetzt.
Er hatte eine Droschke genommen, um das Gepäck zurück nach Hause zu bringen. Dann hatte er sich zu Madame Freuer begeben, um sie zu fragen, ob sie etwas wisse. Das war peinlich, aber unvermeidlich.
Madame Freuer war wie erwartet unfreundlich. Sie glaubte nicht, dass Maria Theresia durchgebrannt war, eher »verreist«. War sie womöglich auf dem Weg zum Bahnhof entführt, überfallen, beraubt worden? Lag sie verletzt im Krankenhaus?
Er hatte versucht, seine Angst und Unruhe beiseitezuschieben, indem er an all die schönen Stunden mit ihr dachte. Er würde nie mehr eine Frau so lieben, wie er Maria Theresia liebte. Dessen war er sich mit seiner ganzen fünfundzwanzigjährigen Lebenserfahrung gewiss. Es gab keine Frau wie sie, keine war schöner, keine charmanter, geistreicher, fantasievoller … erotischer.
Die Polizei war ihm weder höflich noch professionell begegnet. Zuerst hatte Oscar sich an den Diensthabenden des Dezernats für vermisste Personen gewandt.
Nachdem er dem fetten, uninteressierten und mindestens fünfzig Jahre alten Beamten seine Geschichte erzählt hatte, war er ans Dezernat für Betrugsfälle verwiesen worden. Diese trägen und korrupten Bürokraten wollten einfach nicht den Ernst der Lage erkennen. Und jetzt war er auch noch zum Sittlichkeitsdezernat weitergeschickt worden, als handele es sich um eine ganz normale Bordellangelegenheit!
Ihre Lebensgeschichte war sehr ergreifend. Ihre Mutter war eine spanische Gräfin, von ihr hatte sie die dunklen, fast schwarzen Augen, in denen er sich verlieren konnte, ohne sie vor sich zu haben. Ihr Vater war ein geschiedener Graf aus München, besser gesagt aus der Münchner Umgebung, der ein Schloss auf dem Lande besessen hatte, das seit dem 13. Jahrhundert in Familienbesitz war.
Sie hatten im sonnigen Spanien ganz in der Nähe von Valencia gelebt, inmitten von Orangenhainen, das blaue Mittelmeer am Horizont. Sie hatte mit kleinen weißen Lämmern gespielt, und starke Männer hatten sie in den Sattel gehoben und waren mit ihr über die Besitzungen geritten, auf denen Stiere für Stierkämpfe gezüchtet wurden.
Dann hatte sich das Glück auf einen Schlag in einer gewittrigen Nacht in tiefstes Unglück verwandelt. Ihre Mutter mit den funkelnden schwarzen Augen hatte in rasender Eifersucht (ihr Verdacht erwies sich später als unbegründet) ihren Dolch gezückt. Aus Notwehr hatte ihr Vater seine heiß geliebte Spanierin getötet. Eine Katastrophe!
Im Prozess hatte sich ihr Vater aus Edelmut nicht auf Notwehr berufen. Er brachte es nicht übers Herz, die Eifersucht seiner geliebten Frau bei einer einfachen Gerichtsverhandlung publik zu machen. Folglich hatte man ihn zum Tode verurteilt und garrottiert.
Im Alter von fünf Jahren wurde Maria Theresia zu einer besonders bösartigen Tante auf das Schloss bei München geschickt. Da die Tante ihr Vormund und Maria Theresia die rechtmäßige Erbin des Schlosses war, hatte die Tante sie unter einem Vorwand in ein Kinderheim gesteckt. Anschließend hatte sie die Hexe von Kinderheimvorsteherin dafür bezahlt, das kleine unschuldige Mädchen an ein Bordell in Leipzig zu verkaufen.
Maria Theresia hatte längst die Hoffnung aufgegeben, ihren rechtmäßigen Besitz, das Schloss und die Ländereien, zurückzubekommen, wie sie Oscar unter Tränen erzählt hatte. Aber sie hatte nie die Hoffnung auf ein besseres Leben begraben und jede Gelegenheit genutzt, Geld für die Zukunft beiseitezulegen. Sie verwahrte siebentausend Mark in einer Hutschachtel mit doppeltem Boden.
Er hatte die Hutschachtel mit eigenen Augen gesehen.
Sie hatte gehofft, obwohl diese Hoffnung im Laufe der Jahre immer mehr verblasst war, dass ein junger, schöner, intelligenter und blonder Mann kommen und sie retten würde. Sie würden in sein Land ziehen, und er würde ihr ihre frühere Leidenszeit verzeihen. Sie würden alles hinter sich lassen und glücklich miteinander werden.
Oscar hatte sich die erste Begegnung zwischen Maria Theresia und seiner Mutter Maren Kristine mit reger Fantasie ausgemalt. Seine Mutter würde sich nicht vorstellen können, welche Leiden Maria Theresia durchgemacht hatte, weil sie nicht wusste, was ein Bordell war.
Ein müder Polizeibeamter, ungefähr so unrasiert wie Oscar, erschien und musterte ihn wie einen Schwerverbrecher.
»Sie sind der Mann mit der verschwundenen Hure?«, fragte er wenig einfühlsam. »Kommen Sie rein und erzählen Sie!«
Das Büro war ein kleiner Verschlag mit einem Durcheinander an Ermittlungsakten, einem Schreibtisch und zwei Stühlen, deren Lederpolster aufgeplatzt waren. Die Beleuchtung war schwach, nur eine Glühbirne unter einem grünen Lampenschirm auf dem Schreibtisch.
»Und?«, sagte der Polizeibeamte müde. »Wie heißt sie?«
»Maria Theresia.«
»Aus dem Bordell in der Schmaalstraße oder aus dem eleganteren Etablissement bei der Oper? Wie heißt das noch gleich?«
»Salon Morgenstern.«
»Ich verstehe. Einen Augenblick.«
Der Polizeibeamte verschwand im Nebenzimmer, unterhielt sich halblaut und kehrte mit einer Aktenmappe zwischen zwei Lederdeckeln, die von einem schwarzen Bindfaden zusammengehalten wurde, zurück.
»In Dresden haben wir die Huren ziemlich gut im Griff«, murmelte der Polizeibeamte, während er in den Unterlagen blätterte. »Regelmäßige ärztliche Untersuchungen. Sie gelten deshalb als die medizinisch ungefährlichsten Huren im gesamten Deutschen Reich. Zwangsweise Behandlung, wenn es etwas Einfacheres ist, Ausweisung bei Syphilis. Sagten Sie Maria Theresia?«
»Ja.«
»Ausgezeichnet, hier haben wir sie. Judith Kreissler, geboren achtzehnhundertfünfundsiebzig in Posen, bereits einmal in Hamburg wegen Betrugs verurteilt. Hat eine einjährige Gefängnisstrafe verbüßt. Wurde ein weiteres Mal angezeigt, Verfahren eingestellt, hm. Tja, es sieht so aus, als …«
»Sie heißt Maria Theresia, und ihre Mutter war Spanierin, daher hat sie auch so schwarze Augen!«, fiel ihm Oscar ins Wort.
Der Polizeibeamte holte tief Luft und seufzte, wirkte aber nicht im Geringsten verächtlich.
»Maria Theresia ist natürlich ein sehr schöner Name, der einer Königin gebührt. Entschuldigen Sie, das war nicht ironisch gemeint. Aber das ist nur, wie soll ich sagen, ein Künstlername. Ihre schwarzen Augen haben möglicherweise damit zu tun, dass sie Jüdin ist, denn Spanierin ist sie gewiss nicht. Sie stammt wie gesagt aus Posen.«
Um Oscar herum blieb die Zeit stehen. Er sah alles, was sie ihm erzählt hatte, so deutlich vor sich, als wäre er selbst dabei gewesen. Spanien, die Orangenhaine, das blaue Mittelmeer, die temperamentvolle, schöne Mutter, die das Haar mit einem Kamm hochgesteckt hatte, der edle, distinguierte Vater.
Hatte sie ihn belogen? Das konnte nicht sein! Er hatte doch mit eigenen Augen die Hutschachtel gesehen, in der sie ihr unter großen Aufopferungen verdientes Geld verwahrte.
»Ich muss Sie noch etwas fragen«, meinte der Polizeibeamte beiläufig. »Hat sie möglicherweise unmittelbar vor ihrem geheimnisvollen Verschwinden Geld von Ihnen erhalten?«
»Ja. Und das ist es eben, was mich so beunruhigt. Sie könnte beraubt worden sein. Ich habe ihr tausend Mark gegeben!«
»Darf ich fragen, warum?«