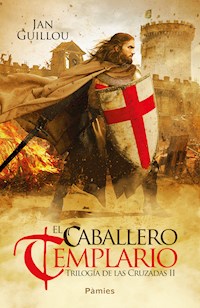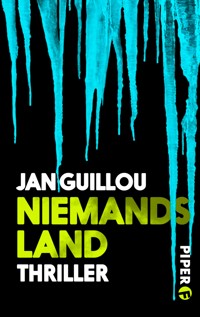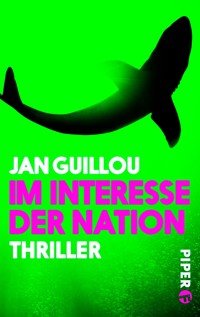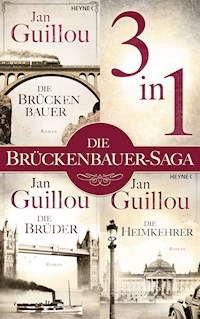2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dem schwedische Superspion Hamilton wird Landesverrat vorgeworfen: Angeblich wurde er während seiner Ausbildung von Russland angeworben und spiele als Agent ein doppeltes Spiel. Dass »Coq Rouge« eine linke Vergangenheit hat, scheint nicht gerade für ihn zu sprechen. Um sich zu entlasten, muss Hamilton einen Mord begehen. Doch dann bekommt er ein unerwartetes Angebot - der russische Geheimdienstchef schlägt ihm eine Zusammenarbeit vor. Hamilton soll herausfinden, welche unbekannte Macht sowohl den Schweden als auch den Russen ins Spionagehandwerk pfuscht. Mit »Coq Rouge« hat Thriller-Autor Jan Guillou einen Agenten geschaffen, der einem James Bond ebenbürtig ist: präzise, schnell und ungeheuer tödlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Übersetzung aus dem Schwedischen von Hans-Joachim Maass
ISBN 978-3-492-98043-2
© für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2013 © Jan Guillou 1989 Published by agreement with Salomonsson Agency Titel der schwedischen Originalausgabe: »Fiendens fiende«, Norstedts Förlag, Stockholm 1989 © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1994 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © ostill / Shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2002
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
DER FEIND
1
Seine Versuche, eine Frau zu erdrosseln, waren alle erfolglos geblieben.
Doch das war sein altes Ich gewesen. Er war krank, verwirrt oder verzweifelt oder ganz einfach nur betrunken gewesen, und außerdem hatte er keine ganz ernst gemeinten mörderischen Absichten gehabt. Jetzt war alles anders.
Sie mißverstand ihn, als er in der Koje das Licht ausmachte, und sie hatte noch Zeit, ein Kichern hören zu lassen, als er sie auf den Bauch drehte und sich rittlings auf sie setzte.
Dann begann er sie fast zärtlich zu erdrosseln, als wäre es ein Liebesakt, als wäre sie tatsächlich seine Ehefrau.
Er verlagerte das Gewicht seiner Knie auf ihre Oberarme und suchte mit dem Daumen behutsam ihren Nacken ab, bis er den Punkt fand, an dem Schädel und Halswirbel aufeinanderteffen, und dann griff er mit den Fingern tiefer um ihren Hals.
Es dauerte ein paar Sekunden, bis sie zu begreifen schien, was mit ihr geschah. Sie zappelte etwas, schlug mit den Beinen um sich, so wie ein Fisch an Land mit der Schwanzflosse schlägt. Doch die weiche Bettwäsche verschluckte den Laut, und nach fünfzehn sehr langen Sekunden, als sie infolge der abgequetschten Blutzufuhr zum Gehirn bewußtlos wurde, blieb sie reglos liegen.
Nur langsam lockerte er den Griff. Dann erhob er sich schwer atmend und blieb eine Weile lautlos in der Dunkelheit stehen, während er sich die steifen Finger massierte.
Er öffnete das Kabinenbullauge, zog einen Hocker zu sich heran und steckte den Kopf hinaus. Kalter Wind und ein harter Regen peitschten ihm ins Gesicht. Er versuchte nach oben und zur Seite zu blicken, doch der Wind und der Eisregen machten es unmöglich, etwas zu erkennen.
Es war zwei Uhr nachts in der dunkelsten Zeit des Jahres, und das Schiff befand sich draußen in der Ostsee auf offenem Meer. Das Risiko, daß irgendein Mitpassagier an Deck stand und die Aussicht aufs Meer bewunderte, war gleich Null. Er zog den Kopf herein, stieg von dem Hocker herunter und trocknete sich mit der Gardine das Gesicht. Dann holte er ein paarmal tief Luft, sammelte sich, ging zur Koje hinüber und zwängte der Frau das Nachthemd über den Kopf. Es war ein weicher, seidenähnlicher Stoff, vermutlich ein allzu luftdichtes Kunstfasergewebe. Unter dem Stoff konnten sich Luftkissen bilden.
Dann nahm er ihr Ringe und Armbanduhr ab und warf sie hinaus. Er bog sich ihren rechten Arm über die Schulter, schleppte sie zu der runden Öffnung des Bullauges und bekam nur mit einiger Mühe ihren Oberkörper und beide Arme ins Freie. Er umfaßte ihre Knie und schob sie nach oben, bis sie über den Rand des Bullauges hinwegglitt. Urplötzlich und lautlos war sie verschwunden.
Er schraubte das Bullauge fest, beugte sich vor und legte die Stirn an das kalte, feuchte Glas.
Ihre Kabine lag etwa mittschiffs. Die Fallhöhe betrug fast zehn Meter. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Turbulenz des Wassers sie in mehr als zehn Meter Tiefe herunterziehen oder in den Sog der Schiffsschraube geraten lassen würde, war recht hoch. Dagegen war es ziemlich unwahrscheinlich, daß sie auf schwedischem Territorium an Land gespült und identifiziert werden würde.
Und außerdem spielte das keine Rolle. In dem Augenblick hätte er schon gewonnen oder verloren, dann wäre alles schon entschieden.
Er ging zur Tür und schaltete das Licht an. Dann nahm er ein Handtuch und wischte das Regenwasser um das Bullauge und auf dem Fußboden auf.
Er stopfte ihre Habseligkeiten in die kleine Reisetasche; die Hygieneartikel legte er geordnet ins Reisenecessaire, darauf das weiße, seidenähnliche Nachthemd. Dann zog er sich an, zog die Bettwäsche in der unteren Koje zurecht und legte sich mit unter dem Kopf gefalteten Händen darauf. Vor drei Tagen war er fünfzig geworden. Aus Anlaß dieses Feiertags hatte er in Übereinstimmung mit irgendwelchen Paragraphen einen Hafturlaub von achtundvierzig Stunden bekommen; bei Ablauf dieses Urlaubs würde er sich schon auf der anderen Seite befinden. Wahrscheinlich würde man erst dann mit der Fahndung nach ihm beginnen. Vermutlich würden die Kollegen, die in einem Wagen vor ihrer Wohnung in einem Vorort saßen … vor der Wohnung, in der sie gewohnt hat, korrigierte er sich … vermutlich würden die Kollegen einander nur ablösen, weiterhin einen leeren Käfig sowie einen Leihwagen bewachen, der nie benutzt werden würde, jedoch auffallend und höchst vorschriftswidrig vor der Haustür geparkt stand.
Falls wider Erwarten eine Fahndung bevorstünde, würde die Polizei am Kai in Nådendal nach einem Paar mittleren Alters in einem Leihwagen Ausschau halten. Alleinreisende schwedische Männer würden sie weitgehend unbeachtet lassen. Er hatte noch acht Stunden Zeit, vier bis Helsinki und dann vier weitere, bis die Fähre nach Tallinn ablegte.
Ohne sie wäre es nie gegangen. Sie hatte die Wagen gemietet, die Tickets gekauft, und sie war der Grund dafür gewesen, daß er unbewacht seinen Urlaub verbringen durfte. Es war eine der zahlreichen humanen Besonderheiten des schwedischen Strafvollzugs, daß Eheleute nach Möglichkeit in Ruhe gelassen wurden, wenn sie zusammenkamen. Vermutlich hatte man nicht mal ihre Wohnung abgehört. Schweden war ein schlappes Land, von Naivität und Dummheit geprägt.
Sie hätte es ohnehin nicht geschafft, den Rest ihres Lebens in Moskau zu verbringen. Er hatte ihr vorgegaukelt, daß sie schon nach wenigen Jahren von Kindern und Enkeln besucht werden könnten, und sie war Schwedin genug gewesen, ihm zu glauben. Er hatte ihr gesagt, daß er als Major des russischen Geheimdienstes GRU ein Recht auf eine Stadtwohnung und ein Sommerhäuschen am Schwarzen Meer habe, und sie hatte auch das geglaubt.
Sie war jetzt bestimmt glücklicher, als sie je hätte werden können. Wenn er nach der Reise erklärt hätte, sie sei nur ein Cover gewesen, um ihm die Flucht zu ermöglichen – etwas anderes hätte er nie gesagt –, hätten sie sie nach Sibirien verbannt oder erschossen.
Unter Umständen hätte er sie auf dieser Reise sogar begleiten müssen. Denn wenn die Russen es sich in den Kopf gesetzt hätten, daß einer ihrer Spione, der in einem feindlich gesinnten Land verurteilt worden war, nicht einfach mit Hafturlaub davonspazieren konnte, wären sie natürlich zu dem Schluß gekommen, daß irgendein westlicher Nachrichtendienst ihn umgedreht hatte und jetzt versuchte, was bislang noch immer mißlungen war: einen Doppelagenten in das Hauptquartier des GRU in Moskauf einzuschleusen. Dies hätte sein Ende bedeutet.
Andererseits würde sich mit seiner Flucht in aller Öffentlichkeit bestätigen, daß es wirklich ein Land auf der Erde gab, in dem ein sowjetischer Spion nach Recht und Gesetz Hafturlaub erhielt, eine Pension, Dienstalterszulagen, einen neuen Namen und einen echten Paß.
Allerdings hatte er sie aus dem Weg geräumt. Das hätten die schwedischen Behörden natürlich nicht mitgemacht, wenn es darum ging, einem Spion ein Cover zu verschaffen. Und falls man seine Version in diesem Punkt anzweifelte, so war die einzige Alternative, daß die Behörden in Schweden sie einfach hätten verschwinden lassen. Ein solches Manöver wäre jedoch unmöglich in einem Land, in dem alle Staatsbürger eine Geburtsnummer haben, in einem Land, in dem alle Telefone abgehört werden können und in dem alles in der Zeitung steht.
Es war also ein Teil seiner Lebensversicherung, daß er sie getötet hatte.
In manchen Augenblicken hatte er sie zudem verabscheut. Sie war ein Weibsbild, das fast zehn Jahre älter war als er und entsprechend aussah. Sie hatte sich allen Ernstes vorgestellte, daß er sie »liebte« und den Rest seines Lebens mit ihr zusammenleben wollte, nur weil sie sich vor einer Ewigkeit in einem Sommer ein paarmal getroffen hatten, als er bei einer Wehrübung gewesen war. Und ein paar Jahre nach dem Urteil hatte sie damit begonnen, ihm zu schreiben, zu einem Zeitpunkt, als er ziemlich am Boden gewesen war.
Jetzt war er zwar schon fünfzig, aber weit besser in Form, als er seit seinem Wehrdienst bei der Küstenwache je gewesen war. Seit sieben Jahren hatte er nüchtern und gesund gelebt und täglich trainiert; das immerhin hatte er dem Gefängnis zu verdanken. Er wog zwanzig Kilo weniger als bei seiner Verurteilung und schaffte jetzt fünfundsiebzig Liegestütze und neunzig Kilo auf der Trainingsbank, und die Zeit der Demütigungen war vorbei.
Er spürte, wie Haß in ihm hochkam, so daß sein Puls plötzlich im ganzen Körper zu pochen begann.
Die Israelis hätten ihn um ein Haar zerbrochen, das ließ sich nicht leugnen. Er war in einem schlechten Zustand gewesen, hatte getrunken und war unvorsichtig gewesen, und sie hatten ihn schon nach einem Tag in Israel geschnappt. Dann hatten sie ihn mit Whisky abgefüllt. Sie drohten ihm mit einer außergerichtlichen Erschießung, falls er nicht mit ihnen zusammenarbeitete. Er hatte trotzdem darauf gesetzt, daß sie nicht alles wußten, was sie zu wissen behaupteten, und erklärt, seine Arbeit habe sich gegen Schweden gerichtet und nicht gegen Israel. Und dann hatte er ihnen einige tatsächliche und einige erfundene Operationen innerhalb Schwedens heruntergebetet, um freigelassen zu werden.
Am Ende füllten sie ihn nochmals ab und setzten ihn in eine El Al-Maschine nach Kopenhagen. In seinem benebelten Zustand glaubte er eine Zeitlang tatsächlich, er sei davongekommen. Doch in Kopenhagen wartete die schwedische Polizei. Sie hatten per Telex schon die Vernehmungsprotokolle und die Berichte erhalten.
Seine schwedischen Kollegen nahmen den Israelis alles ab und machten ihn ausschließlich zu einem Operateur gegen schwedische Interessen, und folglich hätte es nichts anderes geben können als lebenslange Haft. Außerdem stellten sie ihm einen jüdischen Anwalt, der von irgendwelchen Unregelmäßigkeiten in Israel nichts hören wollte, sondern statt dessen im Namen des Inhaftierten alles gestand, was den Kollegen von der Sicherheitspolizei weiterhalf. Und als er sich nach etwa einem halben Jahr so weit aufgerafft hatte, daß er begriff, aus welchen Gründen er das Urteil anfechten konnte, war der Anwalt zur Säpo gerannt und hatte ihm eingeprügelt, daß eine Berufung nur zu einer noch härteren Strafe führen würde. Außerdem drohte man damit, auch seine Frau zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe zu verurteilen, wenn er darauf beharrte, den Prozeß fortzusetzen. Und da hatte er resigniert, sich in die Gefängniszelle verkrochen und sogar versucht, sich das Leben zu nehmen. Der Rechtsstaat, den sie alle zu verteidigen behaupteten, sah ungefähr genauso aus wie das Propagandabild von der Sowjetunion. Für sie und diesen Rechtsstaat war er jedoch nicht verantwortlich.
Er war Offizier des GRU, das war alles. Er war Offizier und Profi, und nur die Arbeit war sein Vaterland. Ohne Nachrichtendienste wäre die Welt im übrigen bedeutend unsicherer, und bei dieser Gleichung spielte es keine große Rolle, auf welcher Seite die Nachrichtenoffiziere oder Spione, wie sie von den Leuten meist genannt wurden, arbeiteten. Das glich sich alles aus.
Er hatte noch mindestens fünfzehn Berufsjahre vor sich und würde von nun an in seinem Beruf sehr gut sein. Keinen Schnaps, keine Frauen, jedenfalls nicht in dem Ausmaß wie früher. Zwei seiner Kollegen waren sogar zur Säpo übergelaufen und hatten ihn als Spion angezeigt. Zum Glück arbeitete die andere Seite damals nach einer Theorie, die darauf hinauslief, daß die Sowjetunion erstens nicht mehr mit herkömmlichen Spionen operierte (so erklärte man die Tatsache, daß sowjetische Spione in Sehweden nie gefaßt wurden), zweitens konnte Stig Sandström auch kein Spion sein, da er vielmehr ganz im Gegenteil Sicherheitsbeamter war, und drittens war es der internationale Terrorismus, unterstützt durch »Linksdemonstranten« und »Chaoten«, der die Hauptgefahr darstellte.
Also. Ein neues Leben mit Ordnung und Disziplin und weniger Schnaps und weniger Frauen. Es war überdies mehr als wahrscheinlich, daß die Russen die weitere Zusammenarbeit von der Erfüllung dieser Bedingungen abhängig machen würden.
Als das Schiff sich Nådendal näherte, stand er auf, rasierte sich und verstaute seine Toilettenartikel in seiner Pilotentasche. Er prüfte, ob er nichts vergessen hatte, und wischte alle Flächen ab, die er oder sie berührt haben konnte. Dann nahm er die beiden Taschen, ging die Treppen zum Autodeck hinunter, stellte ihre Tasche in den Kofferraum und seine auf den Rücksitz. Ihm war erstaunlich ruhig zumute, obwohl die Reise sich jetzt ihrem kritischsten Punkt näherte.
Es war noch immer dunkel draußen, als die Wagen von der Fähre zu rollen begannen. Doch nichts sah danach aus, daß es in der Nähe aufmerksame Polizeibeamte gäbe. Außerdem gab es keine Zollkontrolle. Das Ganze ging fast besorgniserregend leicht.
Er hielt auf dem Weg nach Helsinki alle Geschwindigkeitsbeschränkungen ein und unterbrach die Fahrt nur einmal, um Kaffee zu trinken und Ausschau nach möglichen Verfolgern zu halten.
Als er sich Helsinki näherte, war er überzeugt, es zu schaffen.
In einem Vorort außerhalb der Stadt verließ er die Autobahn, hielt an einer Straßenausbuchtung, nahm seine Tasche vom Rücksitz und wollte gerade den Wagen verlassen, als er an seine Fingerabdrücke im Wagen dachte. Aber in ein oder zwei Wochen würde man ohnehin den Wagen finden, und dann wäre der Zusammenhang klar.
Mit dem rechten Mittelfinger stempelte er einen deutlichen Fingerabdruck auf das Armaturenbrett.
Er lächelte in sich hinein und reckte den Mittelfinger mit einem letzten Abschiedsgruß an die Kollegen in die Höhe. Dann schlug er die Tür zu, schloß ab und ging auf das Vorortzentrum zu, von wo aus er sicherlich einen Bus in die Innenstadt finden würde.
Jetzt blieb nur noch ein Problem. Etwa eine Stunde vor Ablegen der Fähre mußte er den Ersten Steuermann erwischen.
Welcher Mann an diesem Tag auch den Dienst versah, es war der Mann des GRU, mit dem er an Bord ein paar Worte unter vier Augen wechseln mußte. Dann würde er für immer aus dem Blickfeld des schwedischen Sicherheitsdienstes verschwinden. Und dann würden sie endlich für alles bezahlen.
Er stellte sich eine lange Bahnreise von Tallinn über Leningrad nach Moskau vor.
Er irrte sich. Nachdem er vierundzwanzig Stunden in Tallinn eingesperrt worden war, wurde er abgeholt und mit einer Militärmaschine direkt zum alten Flughafen von Moskau gebracht. Als die Maschine auf ein hohes Gebäude am hinteren Ende des Flughafens zuzurollen begann, ging ihm auf, wohin man ihn gebracht hatte. Das Gebäude war nicht nur eins der am besten bewachten Bauwerke der Welt, sondern auch eins der legendenumwobensten. Es war Zentral, wo etwa fünftausend Menschen arbeiteten; das Herz im weltumspannenden Netz des GRU.
Achtundzwanzig Stunden nach der Flucht des sowjetischen Spions Stig Sandström oder, um der offiziellen schwedischen Terminologie zu folgen, »nach dem Mißbrauch seines Hafturlaubs«, wurde in Schweden eine landesweite Fahndung nach ihm ausgelöst. Um diese Zeit war er schon sechs Stunden lang im Hafen von Tallinn in einem unaufgeräumten Zimmer eingeschlossen gewesen.
Aus sowjetischer Sicht oder vielmehr der des GRU stellte sich jetzt die Hauptfrage, was es mit dieser unglaublichen Fluchtgeschichte auf sich hatte. Falls die Flucht von schwedischen oder anderen westlichen Behörden arrangiert worden war, um dem GRU einen Infiltranten als Laus in den Pelz zu setzen, war die Konsequenz einfach und logisch. Dann würde Stig Sandström für immer verschwinden, am besten nach einem Geständnis.
Falls sich jedoch das Unmögliche bestätigen sollte, daß ein zu lebenslänglicher Haft verurteilter Spion ohne jede Bewachung Hafturlaub bekommen kann, würde die Frage auftauchen, ob und auf welche Weise man sich des früheren Informanten bedienen konnte.
Das Risiko, allzu unsichere Schlußfolgerungen zu ziehen, war nicht unbedeutend. Und für Jurij Tschiwartschew, offiziell Militärattaché im Rang eines Obersten in der Botschaft der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, in Wahrheit jedoch Beauftragter des GRU in Skandinavien und Generalmajor, mußte früher oder später seinen Namen unter einen Bericht setzen, der ihn vielleicht seine Karriere kosten konnte, bestenfalls nur sie.
Es war also unerhört wichtig, daß Zentral einen korrekten Bericht mit einer zutreffenden Analyse der Ereignisse erhielt. Doch würden die Kollegen in Moskau vermutlich schwer zu überzeugen sein.
Diese letzte Vermutung beruhte auf Jurij Tschiwartschews spontaner und intuitiver Schlußfolgerung: In keiner mittelamerikanischen Bananenrepublik, selbstverständlich auch nicht in einem der »harten« westlichen Länder, jedoch auch nicht irgendwo in der Dritten Welt, in einem sozialistischen Staat oder auch nur in einem der »weichen« westlichen Staaten wie Österreich oder Finnland würde ein zu lebenslänglicher Haft verurteilter sowjetischer Spion während eines unbewachten Hafturlaubs einfach davonspazieren und mit neuem Paß, neuem Aussehen und Geld in der Tasche, das er von den Behörden in Form von Pension und Krankengeld erhalten hatte, außer Landes reisen können. In keinem einzigen Land der Erde. Mit Ausnahme Schwedens. Es war also theoretisch möglich, daß es sich um eine echte Flucht handelte.
Im übrigen fiel es Jurij Tschiwartschew schwer zu glauben, daß schwedische Sicherheitsorgane den Mut aufbrächten oder auch nur die Logistik hätten, eine Operation nach britischem oder amerikanischem Vorbild aufzuziehen.
Hätte sich das Ganze in Großbritannien ereignet oder in irgendeinem anderen westlichen Land, hätte der Doppelagent nach seiner Ankunft nicht mehr lange zu leben gehabt. Doch hier ging es nun um Schweden, und das stellte jede Logik auf den Kopf.
Jurij Tschiwartschew seufzte, stand auf und unternahm einen seiner gewohnten Spaziergänge in seinem geräumigen Dienstzimmer, um nachzudenken. Er blieb am Fenster stehen und warf einen nachdenklichen Blick auf die blaue Leuchtreklame an der Spitze des Klinkerbaus gegenüber, die ihm nicht zum ersten und wohl auch nicht zum letztenmal verriet, daß in dem Haus ein Presseorgan arbeitete, das sich in seiner strammen antisowjetischen Haltung in Skandinavien von niemandem übertreffen ließ.
Andererseits jedoch war Svenska Dagbladet in seinem ständigen Bemühen, der sozialdemokratischen Regierung mit Hilfe geheimer militärischer Angaben etwas am Zeug zu flicken, zugleich eine der wichtigsten und zuverlässigsten offenen Quellen für die Nachrichtenbeschaffung des GRU: ein sehr hilfreicher Feind also.
Und das galt auch für diesen Fall, dem sich die Zeitung mit einer ausführlichen Hintergrundanalyse widmete.
Er hatte den Bericht noch nicht unterzeichnet, sondern nur einige Anlagen mit seiner Paraphe versehen. Die eigentliche Zusammenfassung lag daneben auf seinem im übrigen völlig leeren Schreibtisch.
Er ging zurück und las die Zusammenfassung noch einmal durch.
Alle logischen Folgerungen mußten von der Chronologie der Ereignisse ausgehen.
Am 26.September hatte die schwedische Regierung Stig Sandströms Gnadengesuch abgelehnt. Die Strafvollzugsbehörden und der zivile Sicherheitsdienst hatten das Gesuch befürwortet, aber die militärische Führung hatte abgelehnt.
Eine Woche vor seinem achtundvierzigstündigen Hafturlaub am 6. und 7.November hatte Sandström erfahren, daß er so gut wie unbewacht sein würde. Dieses wiederum bedeutete, daß ein Beamter der Strafvollzugsbehörde ihn bis zur Wohnung seiner Frau gefahren hatte. Die Sicherheitspolizei hatte zwei Mann dazu abgestellt, das Haus zu überwachen, jedoch nur von der Vorderseite. Da der Häftling folglich durch den Hinterausgang entwichen war, hatte der Chef der schwedischen Reichspolizeiführung erklärt – in vollem Ernst, nämlich im offiziellen Nachrichtenprogramm des staatlichen Fernsehens –, man habe nur die Vorderseite des Hauses bewacht, »da normalerweise kein Besucher durch den Hintereingang kommt«.
Und da die Sicherheitsbeamten ihre Überwachung zudem um vierundzwanzig Uhr abgebrochen hatten, was offenbar etwas mit Überstundenregelungen und Vereinbarungen mit der Gewerkschaft zu tun hat, hatte derselbe Reichspolizeichef auf die gleiche offizielle Weise erklärt, »normalerweise dürften nach Mitternacht keine Besucher mehr zu erwarten sein«.
Die neuen Bewacher des Sicherheitsdienstes hatten am folgenden Morgen um acht Uhr ihren Dienst angetreten, etwa acht Stunden nach dem vermuteten Zeitpunkt der Flucht, und sie hatten sich überdies nicht der Anwesenheit des Beobachtungsobjekts versichert, sondern sich damit begnügt, gut vier Stunden in ihrem Wagen zu sitzen und eine Haustür und einen Leihwagen anzustarren.
Und als der begleitende Beamte der Strafvollzugsbehörde erschienen war, um den Häftling abzuholen, hatten sie ihren Dienst ohne weiteres beendet und waren weggefahren.
Als der Beamte der Strafvollzugsbehörde die Wohnung leer fand, rief er zunächst das Gefängnis in Norrköping an, dann die diensthabenden Kriminalbeamten in Norrköping und schließlich den Sicherheitsdienst.
Beim Sicherheitsdienst fand man es eigentümlich, daß Sandström verschwunden sein sollte, »denn sein Wagen stand doch noch vor der Haustür«, was die wachhabenden Beamten bestätigen konnten.
Der Sicherheitsdienst entschloß sich daher, zusammen mit dem Beamten der Strafvollzugsbehörde zum Stockholmer Hauptbahnhof zu fahren, »um zu sehen, ob Sandström auftauchen würde«.
Er tat es nicht.
Die Polizei in Norrköping ging davon aus, daß die Säpo eine landesweite Fahndung ausgelöst hatte. Die Säpo wiederum war der Meinung, eine landesweite Fahndung sei eine Maßnahme, die nicht vom Sicherheitsdienst veranlaßt werden müsse. Folglich hatte niemand Alarm geschlagen. Um diese Zeit befand sich Sandström schon in Helsinki.
Gut vierundzwanzig Stunden nach der Flucht wurde die landesweite Fahndung ausgelöst. Die Polizei veröffentlichte von Sandström und seiner Frau falsche Fahndungsfotos.
Weitere vierundzwanzig Stunden später wurde entdeckt, daß Frau Annalisa Sandström nicht einen, sondern drei Wagen gemietet hatte. Das wurde von der kurz zuvor eingesetzten Fahndungsleitung der Polizei als »Durchbruch in den Ermittlungen« bezeichnet.
Anschließend hatte man sich rund vierundzwanzig weitere Stunden der Aufgabe gewidmet, einen der drei Leihwagen zu bewachen, der mit deutlichen Diebstahlspuren in einem Stockholmer Vorort aufgefunden worden war.
Danach war die Djursholm-Villa der PLO acht Stunden lang überwacht worden, jedoch ohne Erfolg. Etwa eine Woche nach der Flucht »wurden die Grenzen gesperrt«.
Etwa so war der Verlauf der Ereignisse.
Jurij Tschiwartschew seufzte. Wenn man sich damit begnügte, den vordergründigen Tatsachenverlauf zu analysieren, war nur eine Schlußfolgerung möglich. Kein Sicherheitsdienst der ganzen Welt, nicht einmal der schwedische, konnte derart inkompetent auftreten. Demnach hatten sie ihren Spion umgedreht und mit dem Selbstmordauftrag nach Moskau geschieht, Zentral zu unterwandern.
Es gab jedoch auch eine Version, die das Gesamtbild in einem völlig anderen Licht erscheinen ließ.
Die schwedischen Behörden und die Regierung hatten sich in einem komplizierten Spiel um die Verantwortung verheddert, bei dem jeder einzelne davonzukommen versuchte, ohne als letzter mit dem Schwarzen Peter in der Hand dazusitzen.
Die Strafvollzugsbehörde hatte betont, sie sei nur für die Überwachung des Spions im Haus zuständig gewesen. Außerhalb des Hauses sei er in den Zuständigkeitsbereich der Sicherheitspolizei gefallen.
Dies war von der Säpo entschieden verneint worden. Dort hatte man betont, als einzelne Behörde habe man Entscheidungen einer anderen Behörde nicht überprüfen können, da dies nur der Regierung möglich sei.
Darauf erwiderte die Strafvollzugsbehörde, die Regierung sei über die Umstände des Hafturlaubs unterrichtet gewesen, was vom Justizministerium zunächst entschieden abgestritten wurde.
Später stellte sich jedoch heraus, daß das Justizministerium ein auf dem Amtsweg mit Eingangsstempel bestätigtes Schreiben erhalten hatte, dessen Ausgang bei der Strafvollzugsbehörde ordnungsgemäß registriert worden war und in dem es hieß, Sandström werde zu seinem fünfzigsten Geburtstag einen nur teilweise überwachten Hafturlaub erhalten.
Der Beamte, der das Schreiben entgegengenommen hatte, hatte es in die Schublade gesteckt, ohne es zu lesen, und war anschließend in Urlaub gegangen. Immerhin hatte er seinem Chef eine Aktennotiz hinterlassen, in der es hieß, er habe das Schreiben nicht gelesen.
Sein Chef las es ebenfalls nicht und war folglich außerstande, seinem Chef, dem Justizminister, darüber Meldung zu machen.
Dies führte nach einiger Zeit sowohl zum erzwungenen Rücktritt des Justizministers wie zu der vorzeitigen Pensionierung der beiden Beamten.
Diese letzte Tatsache war für Jurij Tschiwartschew von entscheidender Bedeutung. Denn wenn das Ganze eine Operation des schwedischen Nachrichtendienstes war – die Sicherheitspolizei kam wegen ihrer mangelnden Kompetenz nicht in Frage –, wäre ein Arrangement nicht mehr glaubhaft, das die Köpfe mehrerer politisch verantwortlicher Personen gekostet hätte. Denn um die Geschichte zu decken, hätten rund zehn Bürokraten und Politiker von Anfang an mit allem einverstanden sein müssen, was dann geschehen war.
Eine solche Operation wäre folglich viel zu riskant gewesen. Nicht mal der Alte oder einer seiner jungen Gehilfen in der geheimen Abteilung des Nachrichtendienstes hätte solche Risiken auf sich nehmen können oder wollen.
Ferner hätte das ganze Unternehmen hinter dem Rücken des Sicherheitsdienstes vom Nachrichtendienst durchgeführt werden müssen. Einen solchen Plan hätte der Alte nicht gebilligt. Nicht einmal er durfte von der vollständigen Unfähigkeit des schwedischen Sicherheitsdienstes ausgehen. Wem sollte es gelingen, einen Plan aufzuziehen, bei dem eine der wichtigsten Voraussetzungen darin bestand, daß sich der eigene Sicherheitsdienst bei der Bewachung eines Spions zum Narren machte?
Niemand, nicht mal die schwedische Militärführung, die sich einem harten Läuterungsprozeß hatte unterziehen müssen, würde mit einem derartigen Verhalten rechnen können.
Folglich blieb jetzt nur eine einzige und entscheidende Frage übrig. War der schwedische Sicherheitsdienst mit einer umfassenden Operation einverstanden gewesen, die die eigene Öffentlichkeit, die Staatsführung und den sowjetischen Nachrichtendienst gleichermaßen in die Irre geführt hätte?
Diese Möglichkeit konnte Jurij Tschiwartschew guten Gewissens ausschließen. In keinem westlichen Sicherheitsdienst war das GRU so zahlreich vertreten wie beim schwedischen. Eine komplizierte Aufdeckungsaktion bei der schwedischen Säpo hätte ohne jeden Zweifel dazu geführt, daß das GRU Berichte über die geplante Operation erhalten hätte.
Die Berichte, die man jetzt erhalten hatte, sprachen jedoch eine völlig andere Sprache; sämtliche sowjetischen Agenten bei der schwedischen Sicherheitspolizei berichteten von Panik und Verwirrung.
Jurij Tschiwartschew hob seinen dicken französischen Füllfederhalter und schraubte langsam die Kappe ab. Er betrachtete kurz die Goldfeder, schlug dann entschlossen die letzte Seite des zusammenfassenden Berichts auf und unterschrieb langsam und deutlich. Danach drückte er den Knopf der Gegensprechanlage, mit dem er seinen persönlichen Chiffriertechniker zu sich rief.
Ein blasser und etwas pickliger Fähnrich aus einer der Baltenrepubliken trat ein und erhielt Anweisung, den Haupttext chiffriert an Zentral weiterzuleiten und das Original mit der nächsten Diplomatenpost nach Moskau zu schicken:
»So ja, mein guter Genosse Sandström«, brummte er, als er wieder allein war, »du bist soeben mit dem Leben davongekommen. Möglicherweise hast du einen neuen Job bekommen, wie du ihn dir vielleicht nicht vorgestellt hast. »
Sandström war nur ein einfacher Agent gewesen, einer von vielen bei der schwedischen Sicherheitspolizei. Jurij Tschiwartschew erinnerte sich noch recht genau an die Einzelheiten des Falls Sandström, obwohl die Akte schon vor gut einer Woche nach Moskau geschickt worden war. Sandström unterschied sich von den anderen vor allem dadurch, daß man ihn erst lange nach seiner Ernennung zum Offizier und Sicherheitsbeamten angeworben hatte. Das war sonst nicht üblich. Normalerweise ging man beim GRU von der einfachen Voraussetzung aus, daß die schwedische Sicherheitspolizei ihren Nachwuchs bei der Polizei rekrutiert. So war es dem GRU gelungen, Studenten anzuwerben und sie zu überreden, ihre akademischen Studien aufzugeben und sich statt dessen bei der Polizeischule in Solna zu bewerben. Die Fortsetzung war bis auf einzelne Ausnahmen immer die gleiche. Die jungen Leute brauchten sich nach einigen Jahren Dienst bei der Sicherheitspolizei nicht einmal selbst zu bewerben, sie wurden angeworben. Seit fünfundzwanzig Jahren war dies das ideale Einfallstor gewesen.
Sandström hatte sich jedoch als nachlässig erwiesen, als Weiberheld, Alkoholiker, Abenteurer und zudem als etwas so Einfältiges wie ein überzeugter Antisemit. Man hatte ihn ursprünglich während seiner Dienstzeit für die UNO im Nahen Osten gewinnen und dazu bewegen können, für die »Sache des Friedens und der Gerechtigkeit« zu arbeiten, indem er Nachrichten über die Israelis beschaffte. Allerdings gegen gute Bezahlung.
Die Frage war, ob eine solche Person den Arbeitsaufgaben, die jetzt in Frage kamen, überhaupt gewachsen war. Die Agenten in Schweden arbeiteten mit passiver Nachrichtenbeschaffung, und beim GRU wurde sorgfältig darauf geachtet, daß sie nicht in Situationen gerieten, in denen sie ihre Kollegen gefährden konnten.
Ein Skandinavien-Direktorat von Zentral hatte jedoch eher offensive Aufgaben. Jetzt sollten also die Möglichkeiten geprüft werden, diesen Saufkopf zu einem offensiven Instrument gegen seine Landsleute umzumodeln.
Doch darüber brauchte sich Jurij Tschiwartschew nicht mehr den Kopf zu zerbrechen. Wenn die Umschulung in Moskau oder woanders einigermaßen erfolgreich war, würde Tschiwartschew früher oder später erfahren, welche operativen Ziele diesem Sandström in Schweden gestellt werden würden.
Tschiwartschew wollte die Überlegungen über Sandström gerade beenden, als sein Blick auf ein Porträt in Öl fiel, das seinem Schreibtisch gegenüber an der Wand hing, neben den Karten von Schweden und der Region Stockholm.
Fjodor Matrejewitsch Apraksin stand auf einem kleinen Messingschild unter dem Bild. Außer Jurij Tschiwartschew selbst wußte in der Botschaft kein Mensch, warum dort das Porträt eines Seehelden des zaristischen Rußland hing. Niemand hatte gewagt, auch nur eine Andeutung von Kritik zu äußern oder sich überhaupt nach dem Grund zu erkundigen; ein Resident des GRU kann sich fast alles erlauben.
Apraksin war jedoch der Name einer von drei sowjetischen Unterwasser-Anlagen in den Schären von Stockholm gewesen. Es waren mit Hightech vollgestopfte Anlagen gewesen, die zum Besten gehört hatten, was die Streitkräfte der Sowjetunion entwickelt hatten, und in einem eventuellen, nun ja, höchst eventuellen Krieg hätten diese Spielzeuge eine sehr interessante Rolle übernehmen können.
Leute vom schwedischen Nachrichtendienst hatten jedoch vor dreizehn Monaten alle drei Anlagen gesprengt. Dieses Kommando hatte sogar hinter dem Rücken der eigenen Regierung operiert, um den Erfolg zu sichern.
Als Militär und Kollege mußte Tschiwartschew zugeben, daß die schwedischen Offiziere eine glänzende Opeeration durchgeführt hatten. Bei denen hatte man es nicht gerade mit dem »Irrenhaus auf Kungsholmen« zu tun – so wurde der zivile Sicherheitsdienst genannt. Oder war es das »Affenhaus auf Kungsholmen«?
Das spielte jetzt keine Rolle mehr.
Für den Sowjetbürger Jurij Tschiwartschew war es jedoch ein tragisches Ereignis gewesen. Zweihundertachtundvierzig seiner Landsleute waren gefallen, waren wie Ratten ertränkt worden.
Und Jurij Tschiwartschew hatte eine sehr klare Vorstellung davon, wer für diese schwedische Operation verantwortlich gewesen war und wer sie durchgeführt hatte: ein junger Korvettenkapitän, der inzwischen einer von Schwedens höchstdekorierten Offizieren sein mußte, dem jedoch auch die Aufmerksamkeit, die ihm die Kollegen vom KGB widmeten, auf die Nerven gehen mußte.
Eines stand aber fest: Wenn sich die Frage stellte, wo es mögliche Ziele für taktischen operativen Nachrichtendienst – d.h. Spionage – in Schweden gab, würden die Kollegen beim SSI, insbesondere dieser junge Korvettenkapitän, ganz vorn auf Jurij Tschiwartschews Vorschlagsliste landen.
Kommt Zeit, kommt Rat. Jurij Tschiwartschew rief seine Leute zu der morgendlichen Lagebesprechung zusammen, und seine ehrerbietigen Untergebenen betraten nacheinander den Raum.
2
Ausnahmsweise sieht es nach einem schönen, echten, sonnigen Mittsommer aus, wie früher, dachte er. Auf dem Weg von Berga überschritt er leicht die Geschwindigkeitsbegrenzung. Er hatte beide Seitenscheiben zur Hälfte heruntergekurbelt und Glenn Goulds Version von Bachs Goldberg-Variationen auf höchste Lautstärke gedreht.
Die Tonqualität hätte besser sein können, aber der Wagen gehörte dem Generalstab und nicht ihm. Er vermied es seit einem halben Jahr, seinen eigenen Wagen zu benutzen, da das Außenpersonal des KGB in Stockholm ihm ein ebenso beharrliches wie schwer erklärliches Interesse entgegenzubringen begann. Worauf sie immer aus sein mochten, es war unangenehm und hatte ihn leicht reizbar gemacht.
Wohl deshalb blinkte er jetzt den Volvo, der auf der Überholspur vor ihm fuhr, mit dem Fernlicht an.
Der Volvo blieb auf der Spur und verringerte demonstrativ die Geschwindigkeit. Die Fahrerin war eine junge Frau, neben ihr saß eine Begleiterin. Beide schienen etwa fünfundzwanzig bis dreißig Jahre alt zu sein. Er blinkte erneut, auch diesmal ohne jede Wirkung, blieb mit der Hand auf der Hupe und schaltete gleichzeitig herunter. Als der Volvo widerwillig nach rechts fuhr, beschleunigte er wütend und überholte.
Als er jedoch sah, daß der Volvo die Verfolgung aufnahm, wurde er nachdenklich. Inzwischen kannte er schon die meisten Tschekisten, und diese beiden sahen ganz entschieden wie normale schwedische Mädchen aus. Als sie sich ihm entschlossen näherten, nahm er den Fuß vom Gas. Er beugte sich zum Handschuhfach hinüber, nahm seinen Revolver heraus und legte ihn unter die Lederjacke auf dem Beifahrersitz, worauf er auf die rechte Fahrspur wechselte.
Der Volvo überholte, schnitt ihn und fuhr dann vor ihm her. Ein paar Sekunden später kurbelte das rechts sitzende Mädchen die Seitenscheibe herunter und hielt eine Kelle hinaus, an deren rundem, rot-weißem Ende in deutlich lesbarer Schrift stand: POLIZEI.
Der Volvo wurde langsamer. Beide Wagen fuhren an den Straßenrand und hielten an.
Als er die beiden blonden Mädchen aussteigen und mit entschlossenen Schritten auf sich zukommen sah, mußte er laut auflachen. Er schaltete die Warnblinkanlage ein und kurbelte die Seitenscheibe herunter.
Er lachte immer noch, als sie bei ihm waren; die eine junge Frau, die ihm entgegenkam, hielt ihren Polizeiausweis vor sich, während die zweite Block und Stift in der rechten Hand hatte. Beide trugen Jeans und amerikanische Sportjacken.
»Hör zu, du Macho, das Lachen wird dir schon vergehen. Das wird eine teure Angelegenheit«, sagte die Beamtin, die ihm am nächsten stand, als sie ihren Ausweis einsteckte.
»Das glaube ich nicht«, erwiderte er, während er gleichzeitig Lederjacke und Revolver hinter seinem Sitz auf den Boden legte. Dann machte er die Stereoanlage aus, damit die beiden einsteigen und mit den Formalitäten beginnen konnten.
»Was ist daran nur so komisch?« fragte die andere, als sie sich auf den Beifahrersitz gesetzt und ihren Block aufgeklappt hatte. »Übrigens, hast du einen Führerschein?«
»Ja, bitte sehr«, erwiderte er, da er ihn schon in der Hand hatte. »Ich habe aber eben daran gedacht, daß manche von Gott auf der Stelle bestraft werden. Man denkt, verdammte Weiber, und drückt noch etwas aufs Gaspedal, dann wird man sozusagen mit dem Finger im Marmeladentopf erwischt.«
»Carl Gustaf Gilbert Hamilton«, las die Beamtin auf dem Beifahrersitz laut vor. »Arbeitsplatz?«
»Generalstab.«
»Wo dort?«
»Generalstab reicht.«
»Ein Offizier und Gentleman, der sich heute ein bißchen auf der Straße austoben will«, kicherte die Blondine auf dem Rücksitz.
»Offizier schon, aber Gentleman war ich eben ja nicht unbedingt. Gott muß Feminist geworden sein. Aber welche Geschwindigkeit wollen wir denn aufschreiben?«
»145. Wir sind mehrere hundert Meter mit mindestens 145 hinter dir hergefahren«, erwiderte die Beamtin auf dem Vordersitz.
»Ach nein, schreib lieber 135, dann können wir das gleich hinter uns bringen. Sonst muß ich widersprechen, und dann müßt ihr aussagen, und am Ende werden es doch nur 135. Wir hätten dann viel Zeit vertrödelt, und außerdem kann man nicht viele Sekunden lang 145 fahren, wenn es nur ein paar hundert Meter sein sollen, und da kennt ihr euch bestimmt nicht besser aus als ich«, entgegnete Carl. Er spürte, wie sich seine Laune besserte und überdies auf die beiden jungen Frauen ansteckend wirkte, die bestimmt schon unangenehmere Zeitgenossen beim Schnellfahren erwischt hatten.
»Na schön«, sagte die Frau auf dem Vordersitz. »Deine private Adresse und Beruf?«
»Korvettenkapitän, Drakens Gränd in Gamla stan …«
»Was, zum Teufel, ist Korvettenkapitän?« unterbrach die schreibende Beamtin.
»So was wie Major, nur in der Marine. So heißt das heuzutage«, stellte die Beamtin auf dem Rücksitz fest, während sie sich behaglich zurücklehnte und etwas breitbeiniger hinsetzte. Carl schielte zu ihrem rechten Fuß hinunter, der plötzlich weniger als zehn Zentimeter von seinem versteckten Revolver entfernt war.
»Solltest du jetzt nicht draußen auf See sein und Torpedoboot fahren? Dann könntest du deinen Gelüsten auf gesetzliche Weise Auslauf verschaffen«, murmelte das Mädchen mit den Formularen, während sie eine Visitenkarte abschrieb, die Carl ihr gereicht hatte.
»Torpedoboote gibt es nicht mehr«, seufzte Carl, dessen Miene sich plötzlich verdüsterte. »Ebensowenig Zerstörer und Kreuzer.«
»Du beteiligst dich also nicht an der Jagd nach diesen russischen U-Booten?« fragte die junge Frau auf dem Rücksitz. »Sind es überhaupt russische?«
»Ja, es sind Russen. Nein, ich sitze meist am Schreibtisch und fülle Papiere aus, genau wie ihr, wenn ihr unterwegs seid und unschuldige, normalerweise meist gesetzestreue Verkehrsteilnehmer hereinlegt.«
»So ja, jetzt brauche ich nur noch die Unterschrift da unten, dann bist du einen Tausender los«, stellte die Frau auf dem Vordersitz fest, als sie ihm das ausgefüllte Formular reichte.
Die beiden jungen Frauen scherzten über den zahmsten Verkehrssünder der Woche und wollten gerade aussteigen, als Carl ein ebenso plötzlicher wie unerwarteter Einfall kam.
»Wann habt ihr heute abend Schichtende?« fragte er in dem Moment, in dem eine gerade die Wagentür öffnete.
»Wie bitte? Was hast du gesagt?« fragte das Mädchen vom Rücksitz und beugte sich mit gespieltem Erstaunen vor, während sie die Sonnenbrille hochzog. Sie hatte dunkelblaue Augen. Die Sonnenbrille war von dem Typ, den amerikanische Feministinnen vor ein paar Jahren getragen hatten.
»Ich habe gefragt, wann ihr heute abend Schichtende habt«, wiederholte Carl verlegen. Er bereute seine Frage schon jetzt.
»Um siebzehn Uhr. Wieso?«
»Weil ich mir gedacht habe, wir sollten das feiern. Immerhin hat man mich zum ersten Mal als Verkehrssünder erwischt, dazu noch zwei Frauen. Ich würde euch beide gern zum Essen einladen.«
»Soll das ein Bestechungsversuch sein? Du bist ganz schön dreist«, kicherte sie, ließ die Sonnenbrille auf die Nase gleiten und rief ihre Kollegin, die schon dem Volvo zustrebte, zu sich zurück.
»Hast du gehört? Der Kerl will uns zum Essen einladen!« sagte sie fröhlich. Die Kollegin erstarrte, drehte sich dann demonstrativ langsam um, kam näher und stützte die Ellbogen auf die halb heruntergekurbelte Seitenscheibe auf der rechten Seite.
»Hör mal, du Casanova«, fauchte sie. »Das Bußgeld st ausgeschrieben, und außerdem bin ich mit einem verdammt eifersüchtigen und verdammt großen und starken Polizisten verheiratet.«
»Wunderbar«, gab Carl kalt zurück, »Dann schlage ich vor, daß du ihn mitbringst. Dann können wir beim Kaffee fingerhakeln, Polizei gegen Marine.«
»Du kannst mich mal kreuzweise, du Casanova«, erwiderte sie gedehnt, drehte den Kaugummi im Mund um und ging erneut auf den Volvo zu.
»Was soll man dazu sagen?« seufzte Carl mit gespielter Resignation. »Also um sieben Uhr im Reisen an der Skeppsbron. Findest du hin? Ich bestelle einen Tisch.«
»Hältst du dich etwa für unwiderstehlich? Oder glaubst du, du könntest das Bußgeld wegquatschen«, lächelte die Beamtin mit der Feministinnenbrille.
»Im Augenblick ganz und gar nicht. Das Bußgeld ist ja nur ein Tausender, das Essen dürfte bedeutend teurer werden. Offenbar klappt es weder geschäftlich noch privat mit Bestechungen«, seufzte Carl und streckte die Hand nach dem Zündschlüssel aus.
»Na schön, ich komme«, erwiderte sie schnell. »Um sieben im Reisen, du heißt Hamilton, und ich heiße …«
»Jönsson. Eva-Britt Jönsson, wenn dein Polizeiausweis echt ist.«
»Du hast ja eine Beobachtungsgabe wie ein Polizist. Wenn du aber nicht kommst, erhöhe ich das Bußgeld oder erhöhe die Geschwindigkeit auf 145Sachen. Dann bist du der Dumme und nicht ich, vergiß das nicht.«
Sie lachte und schüttelte den Kopf, als sie zu ihrem Wagen zurückging, den Motor anließ und in einer Wolke blauer Abgase verschwand.
Carl blieb noch sitzen. Er fühlte sich dumm und hereingelegt und glaubte nicht eine Sekunde, daß sie kommen würde. Aber die Einladung war nicht mehr zurückzunehmen.
Auf dem Weg in die Stadt hielt er sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit, und als er in Enskede war, schob er den Kunststoffdeckel über dem Autotelefon zur Seite und bestellte für sieben Uhr im Reisen einen Tisch für zwei Personen.
Fünf Minuten vor sieben saß er an seinem gewohnten Fenstertisch im Reisen und sah auf die immer noch im Sonnenlicht glitzernde Wasserfläche zum Skeppsholmen hin. Er glaubte nicht, daß sie auftauchen würde, beschloß aber, der Form halber mindestens eine Viertelstunde zu warten. Als der Kellner ihn fragte, ob er vor dem Essen einen Drink wünsche, antwortete er zum allerersten Mal mit Ja. Er erinnerte sich vage an etwas, was aus Tequila und etwas Süßem bestand und am oberen Rand des Glases einen Salzring hatte. Er erfuhr, daß es eine Marguerita war, bestellte eine und versank dann wieder im Anblick des glitzernden Wassers.
Operation Big Red lag jetzt mehr als ein Jahr zurück. Das Wasser der Ostsee sah aber aus, wie es vermutlich schon immer ausgesehen hatte, wo immer er es zu sehen bekam. Und die Schweden glaubten immer noch, daß die Streitkräfte bei ihren Versuchen, die fremden U-Boote zu erwischen – falls es die überhaupt gab –, von Mißerfolg zu Mißerfolg eilten.
Seit etwa einem Monat hatte er Schlafstörungen. Er redete sich ein, daß es an den hellen Nächten lag, obwohl ihm die früher nie etwas ausgemacht hatten. Wenn er dann endlich einschlief, manchmal nach mehreren Stunden unter Laken, die wie Taue zusammengerollt waren, bekam er Alpträume. In einem ständig wiederkehrenden Alptraum war er in eine Art U-Boot tief unter der Wasseroberfläche eingesperrt. Plötzlich entstand ein Leck, und ein metallharter Strahl weißen Wassers strömte herein und füllte den Raum immer mehr, bis er oben in einer Ecke in der letzten Luftblase herumschwamm, die immer kleiner und kleiner wurde, bis er endlich aufwachte.
Der Hintergrund dieses Traums war ihm nur zu bewußt. Vor etwas mehr als einem Jahr war eine unbekannte Zahl sowjetischer Seeleute und Offiziere weniger als dreißig Kilometer von seinem Fenstertisch entfernt auf diese Weise ums Leben gekommen.
Er fragte sich, ob Stålhandske und Lundwall Ähnliches erlebt hatten. In weniger als einem halben Jahr würden die beiden aus Kalifornien zurückkehren, um ihren Dienst in der Operationsabteilung aufzunehmen.
Samuel Ulfsson, der Chef des gesamten OP fünf, hatte den Gedanken, das irritierende Interesse des KGB für Carl habe etwas mit dem Unternehmen Big Red zu tun, immer mit einer ärgerlichen Handbewegung abgetan. Sam zufolge war es mehr als zweifelhaft, daß die Stockholmer KGB-Residentur von den sowjetischen Installationen auf schwedischem Territorium überhaupt wußte, und noch unwahrscheinlicher war, daß sie wußten, wer und welche Männer das Unternehmen zum Erfolg geführt hatten.
Die Fahndungseinsätze der Russen hatten jedoch bewirkt, daß Carl nun oben im Generalstab bei Sam Ulfsson beschäftigt wurde, während die Reorganisation von Hamilton Data System ohne ihn weiterlief. Das neue Büro war fertig und als Beraterfirma eines multinationalen Unternehmens im Stadtteil Gärdet mit Geschäftsräumen im obersten Stockwerk eingerichtet worden. Carl war bisher nur ein paarmal dort gewesen, obwohl es sein eigentlicher Arbeitsplatz war.
Sie erschien völlig aus der Puste zehn Minuten zu spät. Sie trug ein geblümtes Sommerkleid und hatte sich eine rosa Wolljacke um die Schultern gelegt. Sie trug keine Strümpfe und hatte kräftige und geschmeidige Beine. Der Schulterpartie merkte man Spuren von Krafttraining an wäre das nicht gewesen, hätte sie als Büromädchen durchgehen können; eine rotblonde schwedische Büroangestellte mit halblangem Haar und einer Pilotenbrille, die eine leichte Kurzsichtigkeit verriet.
Carl stand schnell auf, ging um den Tisch herum und zog ihr den Stuhl heraus. Er bemerkte, daß sie sich Mühe gab, ihre Überraschung über die höfliche Geste zu tarnen.
»Ich hoffe, du kannst meine Verspätung als Offizier und Gentleman entschuldigen«, lächelte sie sichtlich verlegen.
Als sie die Handtasche auf den freien Stuhl neben sich legte, bemerkte Carl ein leises Klappern. Außerdem war die Tasche viel zu schwer. Als er um den Tisch herumging, unterdrückte er einen Impuls, sie zu fragen, ob es zu ihren Gewohnheiten gehöre, mit Dienstwaffe und Handschellen im Gepäck auszugehen, wenn sie sich mit einem Mann treffe.
»Ich kann der Polizeiassistentin Jönsson versichern, daß ich mir die größte Mühe geben werde, mehr Gentleman zu sein als beim letzten Mal«, gab er ihr lächelnd zurück.
»Polizeiinspektor, zumindest Polizeiinspektor auf Anstellung«, korrigierte sie schnell.
»Nicht schlecht für neunundzwanzig Jahre.«
»Woher weißt du, daß ich neunundzwanzig bin?«
»Immer noch von deinem, wie ich annehmen muß, echten Polizeiausweis. Du bist am sechzehnten Mai geboren, im Tierkreiszeichen des Stiers.«
»Du hättest Bulle werden sollen, Kriminaler, bei der Spurensicherung oder so. Warum hast du mich eingeladen?«
»Weil ich plötzlich den Einfall hatte, weil ich dich süß fand, weil ich allein lebe und nur mit Kollegen Umgang habe und ständig nur an den Job denke und darüber spreche. Weshalb bist du gekommen?«
»Weil ich dich für einen interessanten Typ hielt, nicht so aggressiv wie andere Kerle, die sich am Steuer blamieren, weil ich allein lebe und nur mit Kollegen Umgang habe und immerzu nur an den Job denke und darüber quatsche.«
»Was willst du essen und trinken?«
»Keine Ahnung. Das hier ist doch so ein Luxusschuppen, da bin ich sozusagen nicht ganz zu Hause, wenn ich das so sagen darf.«
»Fisch oder Fleisch?«
»Fisch.«
»Du sprichst, als kämst du aus der Arbeiterklasse und dem Süden Stockholms. Hast du Verwandte in Skåne?«
»Ja, wieso?«
»Weil du Jönsson heißt. War nur eine Vermutung. Ich habe auch Verwandte in Skåne.«
»Aber nicht gerade unter den Zuckerrübenpflückern, nicht wahr?«
»Nein, wieso?«
»Weil du Hamilton heißt.«
»Überlaß das Bestellen von Essen und Wein mir. Ich verspreche, daß alles gut sein wird.«
»Diese Sorgen überläßt man am besten der Oberschicht. Willst du mir imponieren?«
»Nein, ich möchte am liebsten jeden Eindruck vermeiden, als hätte ich das vor. Das ist mein Problem. Wenn es aber um Restaurantessen geht, ist die Oberschicht besser als die Arbeiterklasse. Nur das habe ich andeuten wollen.«
Er klappte Speise- und Weinkarte zusammen, winkte den Kellner zu sich heran und bestellte als Vorspeise eine Aal- und Lachspäte mit einem kräftigen elsässischen Gewürztraminer sowie als Hauptgericht gegrillten Steinbutt, dazu einen weißen Burgunder Château Meursault 1984.
Als sie später die Weine kommentierte, fand sie den Elsässer »etwas ungewohnt, aber absolut in Ordnung« und den weißen Burgunder »wirklich verdammt gut«. Soweit er sich erinnern konnte, waren dies die besten Kommentare zu Wein, die er seit mehreren Jahren gehört hatte, zumal in einem immer rücksichtsloser und egoistischer werdenden Land, in dem der Wein-Snobismus zunehmend lächerliche Formen anzunehmen begann.
Nach einer Weile legten sie ihre Reserviertheit ab, und er begann, sie über die Polizeiarbeit auszufragen, teils aus persönlicher Neugier, teils aus beruflichem Interesse.
Sie war abwechselnd mit Fahndungs- und Ermittlungsarbeiten und einigen Kommandoaufgaben betraut, und zwar in der VD eins, der berüchtigtsten Polizeiwache Stockholms. Sie hatte schon immer Polizistin werden wollen, seit der Grundschule. Möglicherweise hatte ihre religiöse Erziehung sie dazu gebracht, die Polizeiarbeit in erster Linie als eine Art sozialen Hilfseinsatz zu sehen. Sie war immer noch Mitglied im Schwedischen Missionsverband. Das soziale Engagement sah sie immer noch als Hauptbestandteil ihrer Arbeit an. In ihrer Wache ließ sich dieser Standpunkt jedoch nicht leicht verteidigen. Dort mußte sie meist Betrunkene über Nacht einsperren, Straßenschlägereien schlichten, kleine Ganoven und Dealer festnehmen, die oft schneller auf freiem Fuß waren, als es gedauert hatte, sie festzunehmen.
Sie wohnte allein in einem Haus draußen in Spånga an einem kleinen See. Bis auf einen Schäferhund namens Roy lebte sie allein. In der Freizeit malte sie Aquarelle, meist Landschaften. Sie sprach in einer kontrastreichen Mischung aus männlichem Polizeijargon und Sozialarbeitersprache. Möglicherweise fanden sich in ihrer Sprache gelegentlich christlich geprägte Redewendungen, die von einem aufrichtigen Mitgefühl für die Unglückskinder der Gesellschaft erfüllt waren.
Er fragte sie, oh es für sie nicht Konflikte mit sich bringe, eine gläubige Christin zu sein und einen Beruf zu haben, der so durch Gewalt geprägt sei. Würde sie es etwa fertigbringen, in einer Situation, in der es die Dienstvorschrift vorschrieb, einen Ganoven zu erschießen?
Sie erwiderte, das sei ihr noch nie passiert, und wenn es ihr passierte, werde sie vermutlich nicht schießen. Die Frage sei jedoch nicht leicht zu beantworten, und von einem Soldaten sei sie übrigens auch sehr merkwürdig. Werde er denn selbst in einer solchen Lage schießen? Er sah ihr erst in die Augen und wandte dann den Blick zur Wasserfläche zwischen Skeppsbron und Skeppsholmen, die immer noch in der Abendsonne glitzerte, und antwortete zögernd, bisher habe er nie eine Wahl und zudem kaum Anlaß gehabt, darüber nachzudenken. Im stillen überschlug er, wie viele Menschen er getötet und wie viele er davon gekannt hatte.
Als sie ihn anschließend nach seinem Job befragte, beschrieb er in unklaren Wendungen, er beschäftige sich mit Datenprogrammen zur Analyse von Sonardaten, die je nach Salzgehalt in verschiedenen Schichten der Ostsee voneinander abwichen, mit akustischen Effekten in unterschiedlichen Abständen und Wassertiefen und derlei. Seine Auskünfte waren nicht direkt unwahr, jedoch so mathematisch gehalten, daß sie uninteressant wurden. So gelang es ihm, bei der zweiten Flasche Wein das Gespräch auf sie zurückzulenken und persönlicher zu werden. Er fragte sie, warum sie nicht verheiratet sei, und ihre Antwort ergab, daß zwei Beziehungen mit Kollegen aufgrund »unterschiedlicher Einstellungen zum Leben« gescheitert seien. Er hatte den Eindruck, daß es etwas mit ihrer Religion zu tun hatte, aber nach einiger Zeit vermutete er, daß eher Gewalt der Grund gewesen war. Sie war mit einem der zehn bis fünfzehn Polizeibeamten verlobt gewesen, die am häufigsten wegen Körperverletzung im Dienst angezeigt worden waren. Sie sagte, er sei eigentlich ein netter Mensch gewesen, doch aus ihrem Mund hörte sich das Wort ›eigentlich‹ an, als wäre er ein Sadist.
Dann war sie wieder an der Reihe. Nun fragte sie, weshalb er mit seinen vierunddreißig Jahren noch nicht verheiratet sei. Er bemühte sich, so wahrheitsgemäß wie möglich zu schildern, daß er allzu lange hoffnungslos verliebt gewesen war, in eine Frau, die er während seiner Studienzeit in Kalifornien kennengelernt hatte. Diese Frau, Tessie O’Connor, fuhr er fort, habe viele Vorzüge, sei aber in einem anderen Land und in einer völlig anderen Kultur zu Hause und zudem mit einer Ausbildung geschlagen, mit der in Schweden nichts anzufangen sei. Und außerdem sei sie in Santa Barbara mit einem reichen Geschäftsmann verheiratet und habe ein Kind mit ihm.
Sie kicherte, als er die letzten Hindernisse nannte, und es wirkte ansteckend, daß sie die Sache von der humorvollen Seite nahm. Er erzählte mit etwas gezwungener Ausgelassenheit, wie er sich vor einem Jahr blamiert hatte, als er in ihr Haus eingedrungen und vom Ehemann vor die Tür gejagt worden sei, der damit gedroht habe, die Hunde auf ihn zu hetzen. Er erwähnte jedoch mit keinem Wort, daß er dann die Hunde getötet hätte. Ebenso verschwieg er, wie er später vor Zorn am ganzen Körper zitternd am Strand gestanden und Steinchen in das grau-grünblaue Wasser geworfen und versucht hatte, seine mörderischen Phantasien zu unterdrücken.
»Wie es scheint, bin ich immer noch in Tessie verliebt«, sagte er. »Es mag zwar hoffnungslos sein, aber es muß wohl so sein, und das hat dazu geführt, daß meine Beziehungen zu Frauen in den letzten Jahren recht seltsam gewesen sind. Ich treffe meist nur Frauen für eine Nacht, aber so ein Gespräch wie dieses habe ich seit Jahren nicht mehr geführt.«
Während er von Tessie berichtete, kam ihm plötzlich der Gedanke, daß dieser Volvo draußen am Nynäsvägen auf ihn gewartet haben könnte. Eine Polizeibeamtin, die in ihrer Freizeit in einem Restaurant eine Dienstwaffe bei sich hatte, war nicht die Norm. Er beschloß jedoch, diese Frage auf sich beruhen zu lassen. Statt dessen fragte er sie, wann sie an den nächsten Tagen arbeite. Er nahm sich vor, sie unter irgendeinem Vorwand während der Dienstzeit anzurufen, um festzustellen, daß sie sich tatsächlich im Dienst befand.
»Und warum bist du Militär geworden?« fragte sie und halbierte den letzten Schluck in ihrem Weinglas.
»Soll ich noch etwas Wein bestellen?« fragte er mit einem Blick auf ihr fast leeres Glas.
»Nein, danke. Ich habe morgen zwar erst Spätschicht, aber trotzdem. Versuch nicht, das Thema zu wechseln. Warum bist du Militär geworden?«
Er sah wieder aufs Wasser hinaus, während er darüber nachdachte, ob er sich diese Frage auch nur selbst beantworten konnte. Eins hatte sich aus dem anderen ergeben. Der Alte hatte ihn während der Grundausbildung aufgefischt und ihm auf Kosten der Streitkräfte eine fünfjährige Ausbildung in den USA angeboten. Fünf Jahre später war ihm alles irgendwie selbstverständlich erschienen.
»Das läßt sich nicht so leicht beantworten«, sagte er und blickte immer noch aufs Wasser. »Aber zunächst war es so, daß ich mit einigen Genossen in Clarté und in der Kommunistischen Partei eine Eliteausbildung haben wollte, als wir unseren Wehrdienst ableisten sollten. Einige wurden natürlich vom Sicherheitsdienst enttarnt und schon früh ausgesondert, aber einige andere wurden Fallschirmjäger oder landeten bei der Küstenwache … nun ja, und später wollte ich in der Reserve bleiben, und so ist es auch gekommen, und dann bin ich irgendwann dabeigeblieben.«
»Bist du Kommunist gewesen?«
»Ja, das muß ich schon zugeben.«
»Und was bist du heute?«
»Offizier.«
»Ich meine politisch.«
»Das weiß ich nicht. Kein Kommunist, kein Sozi, kein Bourgeois, vor allem das nicht. Und wo stehst du selbst?«
»Sozi. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Ich wollte nicht wissen, wie du Offizier geworden bist, sondern warum.«
»Das Verhör geht weiter?
»Ja.«
»Ich glaube, es ist etwa so gewesen. Ich bekam eine teuflisch komplizierte Ausbildung, von der ich glaubte, sie auf ehrliche Weise nutzen zu müssen. Um diese Zeit waren die Sozis aber dabei, Schweden abzurüsten, weil sie sich vorstellten, man könnte die Russen durch schöne Reden in die Knie zwingen, statt sich um eine angemessene militärische Stärke zu bemühen … na ja, der kleine schwedische Igel, du kennst dieses Bild. Ich war damals der Meinung, nur so handeln zu können, das entsprach meiner Überzeugung.«
»Es ist immer der Mühe wert, die Freiheit zu verteidigen, und dieses Zeug?«
»Ja, aber für mich ist das kein Scherz.«
»Für mich auch nicht, Verzeihung. Ich habe es auch nicht so gemeint, auch wenn es sich so angehört hat. Aber wird man als Offizier nicht lausig bezahlt?«
»O ja, wohl ähnlich wie Polizisten.«
»Dann sollten wir uns die Rechnung lieber teilen.«
»Nein, kommt gar nicht in Frage, ich habe dich eingeladen.«
»Ein Offizier der alten Schule sollte einer emanzipierten Polizistin von heute nicht sagen, wie sie sich in Grundsatzfragen zu verhalten hat.«
»Es geht mir nicht um eine Grundsatzfrage«, entgegnete er und reichte einem vorbeieilenden Kellner ein Plastikkärtchen, »es geht um eine praktische Frage, um Gleichstellung und Gerechtigkeit.«
»Ich habe dich doch schon einen Tausender an Bußgeld gekostet.«
Beide lachten laut auf.
Doch als die Rechnung kam und er das Kreditkartenformular unterschrieben und die Hand nach der Rechnung ausgestreckt hatte, um sie zu zerknüllen, war sie schneller. Sie nahm die Rechnung in eine Hand und sah sie aus dem Augenwinkel an, während sie die andere Hand nach der Handtasche ausstreckte. Als sie den Betrag sah, hielt sie mitten in der Bewegung inne.
»Es ist der Wein«, stellte er fest. »Ich habe einen besseren Vorschlag. Beim nächsten Mal lädst du mich ein.«
»Was soll dieses Imponiergehabe? Was soll das?«
»Ich kann es mir leisten, du nicht.«
»Läuft das unter Werbungskosten?«
»Mit einer Polizistin, die mich beim Schnellfahren erwischt hat? Ich möchte den Finanzbeamten sehen, der das anerkennt. Nein, ich bin reich. Du kannst das Ganze als eine privatsozialistische Form des Ausgleichs ansehen. Beim nächsten Mal können wir ja bei dir zu Hause Kohlrouladen essen und Leichtbier trinken.«
Er streckte die Hand nach der Rechnung aus, die sie zwischen den Brüsten an den Körper gepreßt hielt, erwischte sie, zerriß sie und warf die Schnipsel in den Aschenbecher.
»Wie reich bist du genau?«
In ihrer Stimme lag plötzlich eine gewisse Schärfe. Zum ersten Mal an diesem Abend sah sie erkennbar wie eine Polizeibeamtin aus.
»Das weiß ich nicht«, erwiderte er leise.
»Dummes Gewäsch. Bist du Millionär?«
»Ja.«
»Wie viele Millionen?«
»Das weiß ich nicht. Das ist eine Frage der Buchführung oder, wenn man so will, eine philosophische oder politische Frage.«
»Und du bezahlst Steuern?«
»Ja, selbstverständlich. Du meinst auf mein Einkommen?«
»Ja, zum Beispiel.«
»120Prozent, würde ich schätzen. Zufrieden?«
»Du bist also keiner von diesen Scheißkerlen, die ihr Einkommen auf Null herunterrechnen.«
»Nein, aber ich hätte gar nichts dagegen, mehr Steuern zu zahlen. Das ist allerdings komplizierter, als du glaubst.«
»Mehr als 120Prozent?«
»Nun ja, aber entscheidend ist die Vermögenssteuer. Ich bezahle einiges an Vermögenssteuer, und deshalb ergibt das 120Prozent auf mein mageres Gehalt, aber … hör mal, können wir nicht von etwas anderem sprechen?«
»Ist dir das Thema unangenehm?«
»Ja, und es würde mich wirklich traurig machen, wenn Sie mich jetzt nicht irgendwo zum Kaffee einladen, Frau Polizeiinspektor.«
»Bei mir?«
»Nein, nicht am ersten Abend. Laß uns in ein anderes Lokal gehen.«
Sie sah ihn mit einem vollkommen festen, neutralen Blick lange an. Dann lachte sie auf.
»Gar nicht so schlecht für so einen reichen Typen. Na schön, ich lade dich irgendwo auf Djurgården zum Kaffee ein.«
Sie gingen Arm in Arm den Strandvägen entlang. Sie hatte sich bei ihm mit dem linken Arm eingehakt und hielt ihre etwas zu schwere Handtasche in der rechten. Sie winkte ein paar Kollegen in einem vorbeifahrenden Dodge-Bus in Blau und Weiß zu. Da sie mit der Handtasche winken mußte, sah er deutlich, wie schwer sie war.
Sig-Sauer, dachte er. Sie hat die neue Dienstwaffe. Neun Millimeter und fünfzehn Schuß im Magazin, genau wie bei der Beretta.
Auf seinen Vorschlag hin betraten sie hinter der Djurgårdsbron das Gartencafé von Ulla Winblad. Sie sah sich ständig aufmerksam um, aber er fragte nicht weshalb. Vielleicht war das ein automatisches Verhalten, ohne jeden Hintergedanken.
Nur Kaffee zu bestellen war gegen die Bestimmungen, und da sie beide keinen Schnaps trinken wollten, bestellten sie Bier.
Als sie das Bier zur Hälfte ausgetrunken hatten, fragte sie, ob er mal einen Segeltörn mitmachen wolle. Sie teile sich mit einem knappen Dutzend Kollegen und Kolleginnen zwei kleine Hochseejachten, die nach einem komplizierten System allen zur Verfügung stünden. An diesem Wochenende würden fast alle dabei sein, sieben hätten sich angemeldet.«Ich als alleinstehendes Mädchen habe das Recht, einen Mann mitzubringen, vorausgesetzt, er kann einigermaßen segeln und ist nicht von der Säpo.«
»Warum das denn nicht?« fragte er erstaunt.
»Weil die irgendwie keine richtigen Bullen sind. Ziemlich dreiste Typen, und dann gibt es leicht Streit an Bord.«
»Aber Marineoffizier ist in Ordnung?«
»Ja. Kannst du beispielsweise navigieren?«
»Witzige Frage. Die nächste.«
»Übermorgen nachmittag um drei am Anleger von Stavsnäs. Kannst du kommen?«
Er sagte spontan zu, bevor ihm einfiel, daß er seiner Mutter und ihren Verwandten versprochen hatte, sie zum ersten Mal seit mehreren Jahren zu besuchen. Er beschloß jedoch auf der Stelle, diesen Besuch abzusagen und seinem Job die Schuld zu geben.
Später begleitete er sie in einem Taxi zum Haus in Spånga, das an einem See lag. Er stieg aus, hielt ihr die Wagentür auf und lehnte ab, als sie ihn zu einer Tasse Kaffee einladen wollte.
Er blieb noch die halbe Nacht auf, um Musik zu hören.
Seit einem halben Jahr hatte Carl seinen Arbeitsplatz oben im Ostflügel des roten Generalstabsgebäudes am Lidingövägen. Würde man der Arbeitsplatzbeschreibung sein ironisches Urteil zugrunde legen, war er in der Bürokratie des Nachrichtendienstes ein Mittelding zwischen Mädchen für alles und Chefsekretärin. Er war dem Chef des OP fünf unterstellt, was beide als vorübergehend betrachteten, solange die Operationsabteilung noch reorganisiert wurde. Diese war listigerweise in den hinteren Räumen von Hamilton Data System AB untergebracht, einem kleinen Unternehmen der Berater- und Buchhaltungsbranche, das nach außen hin Carl gehörte und sich einer verlustbringenden Tätigkeit widmete, die jedoch den Schein wahren half. Entscheidend war jedoch die Tätigkeit in den hinteren Regionen, zu denen nur Militärpersonal Zutritt hatte und wo die großen IBM-Maschinen herrschten.
Es war vermutlich ein origineller Zug beim schwedischen Nachrichtendienst, eine operative Abteilung mit einer Analyse- und Bearbeitungsabteilung zu kombinieren. Doch dafür gab es praktische Gründe. Sowohl Carl wie seine späteren Nachfolger hatten ihre Ausbildung in Kalifornien zum großen Teil in EDV-Technik und dem erhalten, was normalerweise und mit vorsichtiger Wortwahl als »operative Feldtätigkeit« beschrieben wurde. Am Tage ordentliche Beamte, die sich mit Analysen und EDV-Programmen beschäftigen, und in der Nacht Meuchelmörder, wie Sam zu scherzen pflegte.
Zum Gesamtbild gehörte jedoch auch, daß »operative Feldtätigkeit« eine dem Umfang nach sehr bescheidene Pflanze im schwedischen Garten der Sicherheits- und Nachrichtendienste war. Besonders viele Meuchelmorde hatte es bislang nicht gegeben – auf schwedischem Territorium überhaupt nicht –, und für die gewalttätigen Zwischenfälle, an denen in den letzten Jahren »Personal des schwedischen Nachrichtendienstes beteiligt gewesen war«, wie es in der Aktensprache der Militärs hieß, war Carl so gut wie allein verantwortlich gewesen.
Es fiel Samuel Ulfsson nicht ganz leicht, sich eine persönliche Auffassung von Korvettenkapitän Hamilton zu bilden. Es ließ sich kaum vermeiden, über das Zwiespältige an ihm nachzudenken, über den jungen Mann einerseits, der höflich und wohlerzogen war wie ein Flaggenkadett, der ruhig und systematisch arbeitete und all seine seltsamen EDV-Listen zum rechten Zeitpunkt immer am rechten Ort hatte, und dem außerordentlich speziell ausgebildeten Saboteur und Mörder andererseits, der infolge des Zufalls der Umstände und zweifelsohne auch aus eigenem Antrieb ein professionelles israelisches Mörderkommando erledigt, eine westdeutsche Terroristenorganisation vernichtet, eine Flugzeugentführung verhindert und die Operation Big Red geleitet hatte, was in altmodischen Begriffen den größten militärischen Sieg Schwedens gegen Rußland seit der Schlacht bei Narwa darstellte.
Was macht der Kerl in solchen Situationen? fragte sich Samuel Ulfsson, während er in einigen Sekunden Carl mit seinem Bericht erwartete. Rannte er in eine Telefonzelle, um sich erst als Supermann zu verkleiden? Lag es nur an dieser fünfjährigen teuflischen Ausbildung in den USA? Wie viele Hamiltons hatten dann wohl die Amerikaner? Von den Russen ganz zu schweigen? Auf die Sekunde pünktlich klopfte es an Samuel Ulfssons Tür, was ihn nicht im mindesten erstaunte.
»Komm rein, Carl«, rief er und streckte die Hand nach seiner extraleichten Blend Ultima aus, die er auf Drängen seiner Frau rauchte.
»Guten Morgen, Herr Kapitän«, sagte Carl und nahm Haltung an, ohne dabei allzu demonstrativ oder nachlässig zu wirken.
»Setz dich, Carl, und außerdem genügt Sam, wenn wir unter vier Augen sprechen. Hast du Vorschläge?«
»Danke, Sam. Ja, ich habe eine Liste denkbarer Angaben gemacht, die publiziert werden könnten oder müßten, weil sie schon woanders veröffentlicht worden sind, sowie von Angaben, von denen ich meine, wir sollten sie für geheim erklären. Also, unter wir verstehe ich …«
»Im großen und ganzen also uns beide, abgesehen vom Oberbefehlshaber und dem Marinechef, nicht wahr?«
»Ja, das ist richtig.«
Carl griff nach seiner Aktenmappe, der er drei Berichte mit Kopien entnahm, die er auf sechs Haufen verteilte, um dann mit seinem Vortrag zu beginnen. »Da gibt es mehrere kitzlige Probleme. Der Vierteljahresbericht des Oberbefehlshabers über Unterwasser-Operationen fremder Mächte, der kurzerhand zum Halbjahresbericht erklärt wurde, ist ohnehin schon zu spät erstellt worden. Einander widerstreitende Interessen machen es jedoch schwierig, einen konsensfähigen Text für die Veröffentlichung zusammenzustellen.«