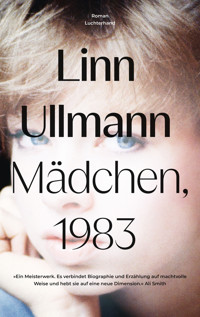
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Indem ich beschreibe, was geschah, indem ich die Geschichte so wahrheitsgemäß erzähle, wie ich nur kann, versuche ich, sie in einem Körper zu vereinen - die Frau von 2021 und das Mädchen von 1983. Ich weiß nicht, ob das möglich ist."
Wie wirkt das, was wir nicht mehr erinnern, in uns weiter? Ist es möglich, ehrlich über etwas zu schreiben, das vor fast vierzig Jahren passiert ist?
Paris, eine Winternacht im Jahr 1983. Sie ist sechzehn Jahre alt und hat sich verirrt im Labyrinth der unbekannten Straßen. Auf einem Zettel hat sie sich die Adresse des dreißig Jahre älteren Modefotografen notiert, der zufällig in New York auf sie aufmerksam wurde und sie bat, nach Paris zu kommen, damit er sie dort fotografieren kann. Gegen den Willen der Mutter, geprägt von dem Wunsch, die Fesseln der Kindheit abzustreifen, macht sie sich auf den Weg. Vier Jahrzehnte später, in einer Zeit der inneren und äußeren Krise, versucht die erwachsene Frau, das junge Mädchen zu verstehen, die sie einmal war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Linn Ullmann
Mädchen, 1983
Roman
Aus dem Norwegischen von Paul Berf
Luchterhand
Die norwegische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Jente, 1983« im Verlag Oktober, Oslo
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Übersetzung wurde von NORLA, Oslo, gefördert.
Der Verlag bedankt sich dafür.
Copyright © der Originalausgabe 2021 Forlaget Oktober AS, Oslo
© der deutschsprachigen Ausgabe 2025 Luchterhand Literatur Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Lektorat: Regina Kammerer
Umschlaggestaltung: buxdesign | München
Umschlagfoto: Getty Images Deutschland GmbH, Bildnummer 6000017468
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-29765-7V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Für Niels
Als sie erwachte, war sie in einem großen Wald, und dann
rannte sie wieder los; aber sie wusste nicht, wohin es ging.
DER EISBÄR KÖNIG VALEMON
I BLAU
Ich bin sechzehn Jahre alt
Ich bin sechzehn Jahre alt und lege meine verschränkten Arme auf den hohen Tisch vor mir, lasse die Wange auf einem Arm ruhen und schaue in die Kamera. Auf dem Foto, das es nicht mehr gibt und an das sich außer mir wohl niemand erinnert, sieht man ein wenig von meinen nackten Schultern. Ich glaube, der Sinn des Fotos ist, Nacktheit anzudeuten, und dass alles, was eine junge Frau tragen muss, wenn sie in die Welt hinauswill, ein Paar lange Ohrringe ist.
Ich glaubte, dich gäbe es nicht mehr
Ich glaubte, dich gäbe es nicht mehr, aber dann tauchtest du vor anderthalb Jahren im September unter einer Ulme auf und verlangtest danach, gehört zu werden.
Du bist durchsichtig. Ganz ohne Gesichtszüge. Wie Wasser.
Dinge, die ich über dich weiß:
Unsere Mutter gebar dich im Schlaf, und dann liefst du davon.
Dich zu beschreiben, ist das Schwierigste, woran ich mich versucht habe. Du bittest mich darum, unmögliche Dinge zu tun, und hörst mir nicht zu, wenn ich sage, dass ich es nicht hinbekomme.
Manchmal glaube ich, unsere Mutter ahnt, dass es noch eine gibt außer mir, dass wir zwei sind, aber dann wischt sie es weg. Nicht jetzt!
Dieses Frühjahr schweben die Flügelnüsse der Ulmen über Oslo, Tag für Tag fallen sie zur Erde, wie ein sanftes Unwetter, still, weiß, wie Laub oder schmutziger Schnee legen sie sich in Haufen auf die Bürgersteige und in Parks, wirbeln über die Häuserdächer. Ich suche im Internet, frage mich, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, was bedeutet das, es sind so viele. Ist es ein Zeichen? Ich glaube, ich messe Zeichen oder dem, was ich als Zeichen wahrnehme, eine zu große Bedeutung bei. Es wehen Flügelnüsse in die Wohnungen der Leute, dünne Samenschuppen, die überhaupt nicht an Nüsse erinnern und in der Luft verschiedene Muster bilden. Sie legen sich auf den Fußboden, in die Badewanne, auf die Laken. Ich suche unter sehr viele Flügelnüsse, finde aber nichts. Ich suche nach Flügelnüsse Zeichen, finde aber auch darunter nichts.
Bleib liegen, sagtest du, fast fürsorglich, ich lege die Arme um dich. Ich wollte aufstehen, es war Morgen, ich hörte Evas Stimme im Wohnzimmer, mein Mann sagte etwas zu ihr und sie lachte, aber du sagtest Nein. Und so blieb ich liegen und hörte stattdessen auf dem Handy einen Podcast mit der amerikanischen Dichterin Sharon Olds. Sie sagte, einer der Gründe dafür, dass sie sich nicht mehr schminke, sei, dass sie die Leute erschrecken wolle; wenn sie nahe genug herankommen, sagte sie, sehen sie, dass etwas anders ist, dass etwas nicht stimmt. Ich bin embryonal, sagte sie (und da dachte ich an dich), ohne Augenbrauen, ohne Augenlider, ohne Mund.
Ich dagegen habe all diese Dinge (Augenbrauen, Augenlider, Mund), und die Fotografie, von der ich erzählen möchte, wurde im Winter 1983 von A in einem Fotostudio in Paris gemacht. Die langen Ohrringe waren aus Strass, sie waren nicht wertvoll, im Gegenteil, daheim, in meinem Zimmer in der Wohnung, die ich mir in New York mit meiner Mutter teilte, hatte ich eine Schatulle voller ähnlicher Ohrringe. Baumelohrringe, Glitzerohrringe, Strass. Flitter. Aber ein Stein, dem Ohrläppchen am nächsten, war blau, daran erinnere ich mich.
~
Der neue Mantel, Anfang Januar 1983 bei Bloomingdale’s gekauft, ist knöchellang und aus einem blauen Wollstoff gefertigt, und hat um die Taille einen Gürtel. Ich bin sechzehn. A lebt in New York, hat aber auch eine Wohnung in Paris. Vielleicht willst du ja mal mitkommen, sagt er.
~
Als ich sechs oder sieben war, und dann wieder, als ich elf war, und ein drittes Mal, als ich dreizehn war, träumte ich von einer großen blauen Feuerqualle mit langen Tentakeln. Alles in dem Traum war blau. Meine Lippen, weil es im Wasser kalt war und ich fror, die Wolken, das Meer. Ich las irgendwo (nachdem ich erwachsen geworden war und nicht mehr von ihnen träumte), dass Quallen im Laufe ihres Lebens durch verschiedene Stadien gehen. Larve, Polyp, Meduse. Ich hatte keine Angst. Nicht im Traum.
~
Ich bin sechzehn Jahre alt. Es ist mitten in der Nacht. Ich bin in As Wohnung in Paris, habe den Mantel aber noch an. Es ist eine kleine Wohnung, ein Zimmer mit Küche und Holzfußboden und hohen Fenstern sowie einem Bad mit blauen Kacheln über dem Waschbecken. Ich stehe mitten in dem großen Zimmer. Ich habe die Arme in einer Art Umarmung um die Taille gelegt, oder wie einen zusätzlichen Gürtel, um den Mantel an seinem Platz zu halten.
Hast du nicht vor, den Mantel auszuziehen?
Doch.
Es ist sehr spät.
Ja.
Warum bist du hergekommen?
Wie meinst du das?
Statt in dein Hotel zu gehen?
~
Du bist das Mädchen, das nicht sterben will, und jetzt, nachdem du viele Jahre fort warst, hast du dich wieder in mich verirrt. Als ich klein war, stellte ich mir vor, dass du abwechselnd in der Tapete und in meinen Kleidern wohnst, und einem großen Insekt ähnelst, einer Libelle, und statt eines Kleids hattest du einen doppelten Satz schimmernder Flügel.
Ich stellte mir vor, wir wären Schwestern. Ich habe vier Halbschwestern, vermisste aber eine ganze Schwester, eine richtige Schwester, eine, die immer da war. Ich hatte meine beste Freundin Heidi, die mein Spiegelbild war, aber Heidi hatte ihre eigene Schwester. Du und ich versprachen uns, dass wir einander niemals verlassen würden. Ich wollte, dass wir einen Bluteid ablegten, aber du hast ja kein Blut, also ließen wir es.
Als ich klein war, hatte ich Angst vor Insekten und im Dunkeln und vor erwachsenen Menschen, die sich betranken –
und dem Atomkrieg und der rasenden Wut meiner Eltern –
und dem Tod, nicht meinem eigenen, sondern dem von Mutter –
und vor Ballsportarten und lauten Geräuschen –
und davor, angefasst und festgehalten zu werden –
~
Das erste Mal begegnete ich A in einem Lift auf dem Weg nach oben im Carnegie Hall-Gebäude zwischen W 56th und 57th Street im Oktober 1982. Wir sprachen nicht miteinander, das Wort begegnete ist deshalb vielleicht falsch. So, wie ich es heute vor mir sehe, fast vierzig Jahre später, waren viele Menschen in dem Aufzug, er hielt mehrmals, Etage auf Etage, und Leute kamen und gingen. Er sagte später, mein Lächeln habe ihn bezaubert. Das glaube ich nicht. Ich lächelte so gut wie nie. Jedenfalls nicht, als ich sechzehn war. Vielleicht bezauberten ihn das weiß-rosa gestreifte Kleid, halb Bonbon, halb Punk, und die große rote Strickmütze aus Norwegen. Mutters Mütze. Ich meine nicht, dass ihn das Kleid als solches bezauberte – ärmellos, mit dünnen Schulterträgern, straff über den Brüsten und der Taille, ehe es sich in einem weichen Rock entfaltete, der bis zur Mitte der Knie reichte –, sondern das Mädchen, das es ganz offensichtlich liebte, sich darin zu zeigen. Die schmale Taille hat sie schon immer, sie war immer dünn, die Brüste sind fast neu und noch nicht vollständig entwickelt. Bis zum Jahreswechsel 1981/1982 war sie flach wie ein Brett. Die geliehene offene Lederjacke über den nackten Schultern ist vier Nummern zu groß und bildet einen massiven Kontrast zu dem weiß-rosa gestreiften Sommerkleid darunter, die einzige Funktion, die der Lederjacke in dieser Szenerie zukommt, besteht darin, dass sie ihr abgenommen werden soll, jemand muss sie einfach von ihr abzupfen.
Einer Untersuchung zufolge, die ich über die Zusammensetzung des Körpers gelesen habe, bestehen Gehirn und Herz aus 73 Prozent Wasser, die Lunge aus 83 Prozent Wasser, die Haut aus 64 Prozent Wasser, Muskeln und Nieren aus 79 Prozent Wasser und das Skelett aus 31 Prozent Wasser. Alles, worüber ich hier schreibe, was sich vor und während und nachdem A in Paris ein Bild von mir machte, abspielte, besteht größtenteils aus Vergessen, so wie der Körper größtenteils aus Wasser besteht. Woran ich mich nicht erinnere, was nur als Träume, Wahrnehmungen oder Schmerzen hochkommt, kann nicht in Worte gefasst werden, wird aber dennoch in Worte gefasst werden.
~
A trat aus dem Aufzug, ging den langen Flur hinunter, schloss das Fotoatelier auf und rief die Frau an, die ich hier Maxine nenne und die ihr Büro im selben Gebäude hatte. Ich habe gerade im Aufzug ein Mädchen gesehen. Ist sie eins von deinen?
Ich versuche, mich an ihre Stimmen zu erinnern, an As Stimme und an die von Maxine. Und was ist mit der Stimme des sechzehnjährigen norwegischen Mädchens, das manchmal Karin genannt wird? Der Name steht in ihrem Pass. Sie spricht jetzt mehr Englisch als Norwegisch, seit sie mit ihrer Schauspielerinnenmutter nach New York gezogen ist. Ich habe keine Erinnerungen an diese Stimme. Englisch ist weder ihre Muttersprache noch ihre Vatersprache, sie ist halb Norwegerin, halb Schwedin, ich stelle mir einen Anflug von Übermut in ihrer Stimme vor, wenn sie spricht, und dass es mit ihrem Englisch zusammenhängt, so als wäre diese dritte Sprache ein Kleid, das sie sich geliehen hat, und als täte sie so, als gehörte es ihr, ich höre auch Unsicherheit – das Mädchen ist sich in allem unsicher –, und diese Unsicherheit verleiht ihrer Stimme unverkennbar einen Klang von dem, was ihr schwedischer Vater, hätte er gehört, wie sie spricht, als verlogen abgetan hätte. Ich habe die Namen von A und Maxine im Internet gesucht, nach Videoclips gefahndet, aber keine mit Ton gefunden, ich dachte, vielleicht wenn ich ihre Stimmen höre, unsere Stimmen höre, würde das Erinnerungen freisetzen, ein Loch in dieses Geschwür stechen, das meine Geschichte von damals ist.
Kannst du sie zu mir hochschicken, ich möchte sie mir mal anschauen.
Maxine war eine gut gekleidete Frau in leger sitzenden, maßgeschneiderten, schwarzen Kleidern, die alles bedeckten, was es an Haut gab, sie trug lange, weiße Perlenketten und große runde Brillen mit schwarzen Gestellen. Schönheit kann so vieles sein, sagte sie. Anfangs war sie eine Agentin aufstrebender Fotografen, mit der Zeit auch einer bunten Auswahl von Fotomodellen, Mädchen und Jungen, schwarz und weiß, straight und gay, jung und nicht mehr ganz so jung. Sie war ihrer Zeit voraus und stellte sich eine Welt vor, in der Mädchen und Jungen, schwarz und weiß, straight und gay, keine festgelegten Kategorien mehr waren. In der Schreibtischschublade habe ich ein kleines Foto von ihr, auf dem sie mit Andy Warhol posiert, der bei dieser Gelegenheit einen dunklen Anzug und Krawatte trägt. Er gleicht einem Schuljungen, drückt den Bauch heraus, auch wenn da nicht viel Bauch ist. Maxine hat sich ein Seidentuch ins Haar gebunden, einen dünnen Gürtel um die Taille, und über der linken Brust eine Silberbrosche angesteckt, sie ist auf dem Foto jünger als zu der Zeit, als ich sie kannte. Sie stehen Arm in Arm steif nebeneinander wie ein altes Ehepaar, sie werfen sich in Pose, machen sich lustig und haben Spaß.
Sie hatte recht, Maxine, dass Schönheit so vieles sein kann, und sie sagte es zu einer Zeit, in der schön gleichbedeutend war mit weiß, dünn, groß, blauäugig. Ich spreche von Mädchen – über die Schönheit von Mädchen –, ich spreche nicht über andere Dinge, die schön sind, wie Vasen, Bäume, Rosen, Steine. Ich verwandte selbst viel Zeit auf schön. War ich schön? Nein. Deine Mutter ist eine der schönsten Frauen der Welt, sagte Maxine, und damit hatte sie natürlich recht.
Vielleicht kann ich etwas aus dir machen, sagte sie.
Ein Jahr später, 1984, veröffentlichte Marguerite Duras den Roman Der Liebhaber, in dem sie schrieb: Wie ich scheinen will, so scheine ich auch, auch schön, wenn es das ist, was gewünscht wird. Und nun hatte A angerufen und gesagt, er wolle sich mich mal anschauen.
Leg die Lederjacke ab, sagte Maxine. Versteck dich nicht.
Ich habe sie mir geliehen, erwiderte ich.
Das interessiert mich nicht, sagte sie. Zieh sie aus. A arbeitet für die französische Vogue. Er ist einer der Besten Er hat dich gesehen, und jetzt will er vielleicht mit dir arbeiten.
Er sah mich im Aufzug.
Er sagte, ich hätte ihn angelächelt, aber das stimmt nicht. Was ich tat, als ich merkte, dass er mich ansah, war, mich aufzurichten, die Schultern zurückzurollen – eine winzige Bewegung –, eine einfache Choreografie für ein sechzehnjähriges Mädchen, das mit der Kindheit abgeschlossen hat, eine kleine, gewollte Bewegung in den Hüften, im Rückgrat, im Hals, in den Wangen, in der Stirn, die Wollust stand mir ins Gesicht geschrieben, und dann rief er Maxine an und sagte, er wolle sich mich mal anschauen.
Ich zog die Lederjacke aus, behielt Mutters rote Mütze jedoch auf. Ich fror an den Armen.
Gänsehaut, sagte er, als er die Tür öffnete und mich hereinließ.
Er zeigte auf meine nackten Arme.
Es ist Oktober, sagte ich, bald November.
Wie alt bist du – vierzehn, fünfzehn?
Sechzehn.
~
Kurz vor Weihnachten lädt A mich im Carnegie Hall-Gebäude zu einem Drink ein. Er wohnt und arbeitet im selben Haus. Es sind andere da, eine kleine Schar von Leuten, kein Essen, nur blaue Drinks und Kokain. Die Wohnung ist groß und luftig mit riesigen, abgerundeten Fenstern, Bücherregalen und Fotos an den Wänden. Ich mag As weiße Wände und dass alle Bilder in schlichten schwarzen Rahmen sind. An diesem Abend vor Weihnachten sitzen er und ich auf dem hellen Holzfußboden, jeder von uns hat ein Glas mit etwas Blauem darin. Jemand hat eine Platte aufgelegt. Jimi Hendrix. A streicht mir einige Haare aus dem Gesicht und sagt, dass ich sie mir ganz kurz schneiden lassen sollte wie Mia Farrow –
In Rosemary’s Baby, unterbreche ich ihn.
Genau, sagt er, wie Mia Farrow in Rosemary’s Baby … und dann flüstert er mir die Worte die Tochter ihres Vaters ins Ohr. Viele Männer in seiner Familie haben beim Film gearbeitet. Das haben wir gemeinsam. Eine große, gertenschlanke Frau geht vorbei und stolpert über unsere Beine. Sie bleibt auf dem Boden liegen, schafft es nicht aufzustehen. Ich sitze da und frage mich, ob das, mir Haare aus dem Gesicht zu streichen, eine Zärtlichkeit ist. Ist er nicht zu alt, um mich auf diese Weise haben zu wollen?
Dieses Mädchen hat so unglaublich viele Filme gesehen, obwohl sie erst fünfzehn ist, sagt A zu der Frau, als sie sich aufrappelt und weiter zum Bad torkelt. Er zeigt auf mich. Die Tochter ihres Vaters, wiederholt er. Die gertenschlanke Frau schüttelt den Kopf.
Das ist mir wirklich völlig egal, murmelt sie.
A sieht mich an und lacht.
Ich bin niemandes Tochter, sage ich.
Er nickt.
Okay.
Ich bin sechzehn und niemandes Kind.
Er zündet sich eine Zigarette an. Bietet mir eine an. Ich nehme sie.
Paris, sagt er. Im Januar. Bist du dabei?
~
Du darfst nicht fahren, sagt Mutter. Ich will nicht, dass du fährst. Das gehört sich nicht. Du musst zur Schule, du kannst nicht einfach wegfahren … du kannst nicht einfach nach Paris fahren!
Mutter weiß nicht, dass ich fast nie in der Schule bin und die Lehrer keinen Unterschied bemerken werden, ob ich nun in Paris oder in New York bin. Meine Lehrer haben Briefe geschrieben, meine Fehlzeiten sind ein Problem, ein Anlass zur Sorge, aber ich habe mir die Briefe jedes Mal geschnappt, bevor Mutter sie lesen konnte, und ihre Unterschrift auf das Formular gesetzt, als Bestätigung dafür, dass der Brief gelesen wurde, und sie zurückgeschickt.
Du bist zu jung, um allein zu reisen, sagt Mutter. Du bist zu jung, um selbst auf dich aufzupassen.
Das bin ich nicht.
Ich weiß nicht, auf wie viele Arten ich nein sagen kann, erklärt sie und betrachtet ihre Hände, als wollte sie die Finger zählen, um haargenau festzuhalten – haargenau –, auf wie viele Arten sie nein sagen kann.
Ich verdrehe die Augen.
Du kapierst nichts, sage ich, er arbeitet für die französische Vogue. Er will mit mir arbeiten. Er will …
Ich dulde es wirklich nicht, dass du die Augen verdrehst, unterbricht Mutter mich, ihre Stimme klingt leicht schrill. Sobald man vierzehn ist, ist es völlig inakzeptabel, die Augen zu verdrehen.
Was?
Ich habe gesagt, sobald man vierzehn ist, ist es völlig inakzeptabel …
Ist das eine Regel?
Das sagen wir in unserer Familie, antwortet sie.
Aber es ist zu hundert Prozent akzeptabel, seiner eigenen Tochter zu verweigern, glücklich zu werden, rufe ich. In unserer Familie? Ist es so?
~
Ich war vierzehn, fünfzehn, sechzehn und trank, bis ich mich übergab oder einschlief. Ich erwachte am Morgen und erinnerte mich nicht, was am Abend zuvor geschehen war. Oft hatte ich auch ohne zu trinken einen Blackout. Als ich neunzehn war, hörte ich auf, so zu trinken, aber das Vergessen – die Blackouts – hat mich mein ganzes Leben begleitet.
Blackout ist das falsche Wort. Die Form von Vergessen, die ich meine, ist nicht schwarz, sondern weiß.
Anne Carson schreibt über Wörter, die sich nicht übersetzen lassen – Wörter, die wir aussprechen, aber nicht definieren, besitzen oder uns zunutze machen können: Fast so, wie wenn dir das Porträt irgendeines Menschen gezeigt wird, von keinem berühmten Menschen, aber einem, den du gleichwohl wiedererkennen würdest, wenn du dich konzentriertest – und während du es sorgsam studierst, siehst du dort, wo das Gesicht sein sollte, einen Klecks weißer Farbe.
Wenn ich dorthin komme, wo sie einen Klecks weißer Farbe schreibt, denke ich an mein eigenes Gesicht, als ich sechzehn war und A kennenlernte.
~
Ich gehe auf eine private High School in der West 61st Street in New York. Ich belege Französisch 2, was suggeriert, dass ich Französisch 1 belegt und bestanden haben sollte, aber als ich im Januar 1983 nach Paris reise, habe ich Probleme, etwas zu verstehen und mich verständlich zu machen. Entweder habe ich alles vergessen, was ich gelernt habe, oder ich habe von Anfang an nichts gelernt.
Ich fehle in jenem Jahr häufig in der Schule, das stimmt. Tage, Wochen. Ich gehe vormittags ins Kino, trinke auf einer Bank im Central Park schwarzen Kaffee, verbringe Stunden im Naturhistorischen Museum, das um die Ecke des Apartmenthauses liegt, in dem ich mit Mutter wohne, das mit dem grünen Baldachin über dem Haupteingang. Im Museum besuche ich die kleinsten Lebewesen, nicht den großen blauen Wal – nein, an dem dreißig Meter langen, zehn Tonnen schweren, blauen Modell aus Schaumstoff und Glasfaser, das von der Decke herabhängt, gehe ich schnurstracks vorbei – und besuche Ausstellungen von Lebewesen, die so klein sind, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann. Bärtierchen, zum Beispiel, sind nicht größer als ein Embryo im Mutterleib. Ich weiß nicht, ob ich damals viel über sie erfuhr und es vergaß, oder ob ich jetzt zum ersten Mal etwas über sie las, nachdem ich am Morgen Sharon Olds gehört hatte, die von ihnen sprach, und daraufhin an die einsamen Tage im Museum vor fast vierzig Jahren erinnert wurde. Bärtierchen gibt es überall – im Meer, auf Gletschern, zwischen Laub und im Moos, von Häuten aus Wasser umgeben, sie leben dort, wo ich im Stadtteil Torshov wohne, in dem Park auf der anderen Straßenseite. Wenn es erforderlich ist – wenn sie müssen –, verwandeln sie sich in Tönnchen. Ein tönnchenförmiger Ruhezustand, lese ich im Internet. Ein Bärtierchen im tönnchenförmigen Ruhezustand kann praktisch alles überleben, extreme Hitze, extreme Kälte, radioaktive Katastrophen, Reisen ins Weltall.
Ich bin sechzehn, ich gehe ins Kino, trinke Kaffee und treibe mich allein im Museum herum.
~
Aber warum fährst du nach Paris? Was wünschst du dir?
Das sechzehnjährige Mädchen sieht mich trotzig an.
Was soll ich darauf antworten?
Ich bin kein Kind mehr, sagt sie.
Ich will das Objekt, der Mittelpunkt, das Ziel der Begierde eines anderen sein.
Ich will nicht allein sein.
~
Es ist nicht viel, was ich aus dieser Zeit aufgehoben habe. Ich schrieb Tagebuch, bis ich fünfzehn war, und erneut, als ich achtzehn war, aber in diesen drei Jahren, zwischen fünfzehn und achtzehn, da schrieb ich nichts. Das Foto, das A von mir machte, mit den Ohrringen, ist fort, aber es gibt ein anderes Foto von 1983. Ich weiß noch, dass die Fotografin – die Frau, die das zweite Bild machte – Französin war, dass sie fließend Englisch sprach, dass sie elegant war. Vielleicht erzählte ich ihr, dass ich gerade zurück aus Paris war.
Es ist noch Winter. Wir gehen die Columbus Avenue hinunter, sie macht das Foto in einem Café. Wir sitzen uns an einem Cafétisch gegenüber und reden (fast wie Freundinnen), während sie ihre Kamera herausholt und anfängt zu fotografieren. Die Geschichte mit A ist noch nicht vorbei, er ruft morgens an, er ruft abends an, er bittet mich zu kommen, aber ich erzähle der Fotografin nichts davon.
Auf dem Foto, das sie von mir macht, trage ich einen blauen Pullover. Ich schaue direkt in die Kamera.
Etwas anderes, das aus jener Zeit an die Oberfläche gespült wird, ist ein Brief meines Französischlehrers. Dass ich ausgerechnet diesen Brief aufbewahrt habe, ist reiner Zufall. Er liegt in einem Karton auf dem Dachboden. Auf den Karton habe ich New York 1981 – 1984 geschrieben, ich finde nur wenige Dinge darin. Der Brief meines Französischlehrers ist nicht besonders lang, eher eine Warnung als ein Brief, davor, was passieren wird, wenn ich weiter die Schule schwänze. Dem Brief lässt sich entnehmen, dass der Französischlehrer Monsieur O hieß. Ich erinnere mich nicht an ihn, wirklich nicht, ich habe keine Erinnerung an ihn, ich kann nicht begreifen, dass er und ich etwas miteinander zu tun hatten. Selbst als ich im Jahrbuch der Schule von 1984, also dem Jahr nach meiner Reise nach Paris, eine Fotografie von ihm finde, erkenne ich ihn nicht wieder oder erinnere mich irgendwie an ihn.
Weil ich 1984 in die Abschlussklasse gehe, gibt es in dem Jahrbuch auch ein Bild von mir. Ich bin stark geschminkt, trage ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose, das Gesicht aus dem Vorjahr, als ich sechzehn war, ist verschwunden, ich habe halblange, rote Haare und sehe aus wie ein ganz anderes Mädchen.
Ich betrachte das Bild von Monsieur O. Ich warte darauf, dass etwas geschieht. Dass etwas in mir an die richtige Stelle gerückt wird. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Wie ist es möglich, dass es zu so einem Augenblick niemals kommt? Ich betrachte das Bild, und statt mich allmählich zu erinnern, fahre ich nur fort zu vergessen.
Geht es A genauso?
Wenn man ihm ein Bild von mir zeigen würde, sogar das Foto, das er selbst gemacht hat, würde er den Kopf schütteln und sagen, nein, ich kann mich wirklich nicht an sie erinnern, tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll.
1984 war Monsieur O ein Mann mit graumelierten Haaren, der von einem anderen Leben träumte. Obwohl, das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht mochte er es, Anfang der achtziger Jahre Französischlehrer an einer privaten High School in New York zu sein? Auf dem Bild lächelt er. Er trägt ein weißes Hemd, ein Tweedjackett und eine breite Seidenkrawatte. Er sitzt über eine große, weiße elektrische Schreibmaschine gebeugt, im Hintergrund erkenne ich ein weißes Bücherregal voller Papierstapel. Sind das Manuskripte? Schreibt Monsieur O an einem großen Roman? Keiner der anderen Lehrer ist mit Schreibmaschine, Bücherregalen und Papierstapeln abgebildet. Mehrere Lehrer sind in einem Klassenzimmer abgebildet, zum Beispiel vor der Tafel, oder im Lehrerzimmer, oder in einem der Flure.
Ich blättere weiter.
An manche Lehrer erinnere ich mich ganz deutlich – den Mathelehrer Mr. C und den Englischlehrer Dr. L und die Physiklehrerin Mrs. T, die im weißen Laborkittel vor dem periodischen System posiert.
Ich blättere zu dem Bild von Monsieur O zurück. Wahrscheinlich haben er und der Fotograf vorher abgesprochen, wie das Bild aussehen soll: Monsieur O wird an der Schreibmaschine sitzen, in einem Raum, der davon erzählt, dass darin große Dinge geschehen (die Papierstapel), und dann, als der Fotograf den Raum betritt, blickt er, gewissermaßen überrascht, auf.
Woran ich mich erinnere, ist –
Woran ich mich erinnere, ist: Ich bin orientierungslos. Ich weiß nichts über Paris. Ich finde den Weg nicht. Das ist es, was geschieht. Ich habe mich nicht vorbereitet, mich einfach mit neuem Mantel und neuen Stiefeln auf den Weg gemacht.
In New York, der Stadt, in der ich mit meiner Mutter lebe, kenne ich mich aus. Begegnest du irgendwann in den achtziger Jahren in New York dem sechzehnjährigen Mädchen, kannst du sie fragen, wie du dahin oder dorthin kommst, sie kann es dir mit Sicherheit zeigen. Aber – und das weiß ich ganz genau: New York ist nicht die Stadt des Mädchens, auch wenn sie dort wohnt. Ich weiß nicht, ob sie eine Stadt hat. Oder einen Ort. Lange – vielleicht, bis sie nach Paris gereist ist, um von A fotografiert zu werden – war es ihre Mutter, die für sie einem Ort am nächsten kam. Sie wollte dort sein, wo die Mutter war. Sie sehnte sich nach ihrem Lachen. Ihrer Stimme. Ihrem Parfüm.
Und was ist mit dir? Du warst meine unsichtbare Schwester, du gingst mit mir durch dick und dünn. Als ich zu alt war, um eine unsichtbare Schwester zu haben, bist du als etwas anderes zurückgekehrt. Gestaltlos, namenlos. Ein Kreis aus Vergessen und Angst und unfertigen Geschichten. Ich werde dich nie wieder verlassen. Waren wir zusammen in Paris? Waren wir eine oder zwei? Du, du, du. Halb Insekt, halb Gespenst, halb verzweifelte Erinnerung. Du kamst im September und wuchst zu etwas so viel Größerem, als ich für möglich gehalten hätte. Du schnürtest dich um mich herum und in mich hinein, bis es unmöglich war zu entscheiden, wo du begannst und ich endete, wer von uns wer war.
~
Es ist Nacht. Ich trage ein Kleid, das ich mir von einem gleichaltrigen Mädchen geliehen habe – ein dünnes, blaues, seidenartiges Kleid, das knapp den Po bedeckt, und den blauen Mantel, den Mutter und ich vor meiner Abreise gekauft haben. Er hält mich warm. Ich spreche kein Französisch, nur ein paar Brocken. Außerdem habe ich Mutters rote Mütze auf. Ein älteres Liebespaar kommt mir auf dem Bürgersteig entgegen, im Licht der Straßenlaternen sehe ich sie deutlich (selbst jetzt, fast vierzig Jahre später). Sie sehen freundlich aus, sie hat lange, dunkle Haare und eine rote Mütze, genau wie ich. Ein riesiger, weißer Hund läuft zwischen ihnen. Die beiden können mir helfen. Ja, das können sie. Ich gehe auf sie zu, ich stelle mich vor sie, stelle mich so hin, dass sie nicht vorbeigehen können, nicht ihren Abendspaziergang mit dem Hund fortsetzen können, ohne vorher mit mir zu sprechen – nicht Abendspaziergang, sondern Nachtspaziergang, es ist jetzt Nacht –, ich halte sie auf dem Bürgersteig an, unter der Straßenlaterne, und bitte um Hilfe. Ich muss mein Hotel finden. Ich erinnere mich nicht an die Adresse. Ich hätte längst auf meinem Zimmer sein sollen. Mutter wollte um zehn Uhr anrufen. Das war die Bedingung dafür, dass ich reisen durfte. All das sage ich auf Englisch. Ich fuchtele und gestikuliere, als reichten Arme und Hände aus, wo die Sprache unzureichend bleibt. Arme und Hände reichen manchmal aus, wo die Sprache unzureichend bleibt, beim Tanzen, Lieben beispielsweise, wenn du dich schlägst, ein Instrument spielst oder wenn du wider Erwarten Kardiologe bist und gerade ein Herz operierst. Hier jedoch nicht. Definitiv nicht. Ich stehe mitten auf dem Bürgersteig, lasse sie nicht vorbei, fuchtele und gestikuliere. Bitte, helfen Sie mir, den Weg zu finden. Ich habe ein Zimmer in einem Hotel. Ich weiß nicht, wo es ist, aber an der Rezeption hängt ein Schlüssel, der meiner ist. Meine Mutter hat viele Male angerufen und ängstigt sich und ist wütend.
Das Liebespaar sieht mich an und stiert. Sie schütteln den Kopf und zucken mit den Schultern. Verzeihung, sagt die Frau mit der roten Mütze, die der meinen ähnelt, Verzeihung, wiederholt sie und zeigt mit einer kleinen, blauen Handschuhhand an, dass ich Platz machen, nicht den Bürgersteig blockieren soll, damit sie und der Hund und der Mann weitergehen können.
Woran ich mich erinnere, ist –
Woran ich mich erinnere, ist der erste Morgen in Paris – vor der langen Nacht, in der ich mich verlaufen habe – und das weiße Licht in dem großen, bunkerartigen Fotoatelier. Die Mädchen sitzen auf einem hohen Hocker in einem Lichtkegel, wenn A sie fotografiert. Die großen Spiegel in der Schminkabteilung werden von Glühbirnen umrahmt. Im Hintergrund wummert Musik, Hall & Oates, she’s a maneater, in dem es nicht um eine gefährliche Frau geht, wie ich damals glaubte, wie wir alle glaubten – es braucht nur ein paar Akkorde, bis wir anfangen, uns zu wiegen, bis wir vorsichtig anfangen, mit den Hüften zu wackeln in dem Studio, so wie wir es hunderte Male allein in unseren Mädchenzimmern getan haben, allein – eine gefährliche, verführerische Frau, die eine Perlenkette aus Männern zurücklässt, Männer, die vor lauter Begierde und Sehnsucht verrückt geworden sind. Eine solche Macht zu haben. Einen solchen Körper. Eine solche Begierde zu wecken. 2014, als ich mich (einmal mehr) daran setze, über das Mädchen von 1983 zu schreiben, nur um kurz darauf aufzugeben, veröffentlicht die Zeitung The Philadelphia Inquirer ein Interview mit dem Musiker John Oates, in dem er erklärt, dass »Maneater« gar nicht von einer Frau handelt, sondern von New York City in den achtziger Jahren, von Gier, Lust und zerstörten Träumen.
Ich erinnere mich, dass ich die langen Strassohrringe anziehe.
Woran ich mich nicht erinnere, ist mein Französischlehrer Monsieur O. Er ist völlig aus meinem Gedächtnis verschwunden. Ich frage mich, ob er mit den Schultern zuckt (genau wie das Liebespaar mit dem Hund), wenn ich ihm bei einer seltenen Gelegenheit ins Auge falle. Da ist sie, dieses Mädchen, die in meinen Stunden niemals anwesend ist. Ich beuge mich über das Bild von ihm. Er sieht aus wie ein Mann, der häufig mit den Schultern zuckt.
In dem besorgten Brief an Mutter – er ist getippt worden, mit Sicherheit auf der großen, weißen Schreibmaschine – hat er sich bemüht, exakt zu sein, er beschreibt seine abwesende, sechzehnjährige Schülerin, so präzise er kann:





























