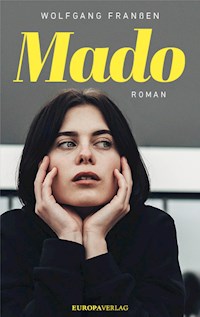
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mado Kaaris ist inmitten von Gewalt aufgewachsen und nach Paris geflohen. Ihr Aufbegehren droht zu scheitern, als sie der ehemalige Boxer, mit dem sie zusammenlebt, aus Eifersucht einsperrt. Eines Abends erschlägt sie ihn und kehrt zu ihrer Familie in die Bretagne zurück, um bei ihrer Großmutter ein paar Tage unterzutauchen. Wieder begegnet sie dem Leben, das sie so sehr hasst: einer Mutter in einer Bauernkneipe, an deren Theke Männer sich besaufen und deren Anzüglichkeiten sie in Kauf nimmt, weil sie mit ihnen ihr Geld verdient. Einer jüngeren Schwester, die sich angepasst hat. Aus Langeweile lässt sie sich auf eine Liebschaft mit Thierry ein, dem seine eigene Familie ebenso fremd ist. Nur ihre Großmutter, die einige Jahre im Gefängnis saß, hat immer auf einem eigenen Leben bestanden. Nun ist sie alt und versucht, Mado zu helfen. Die Bedrohung rückt immer näher und fordert Opfer. Sie kann ihre Enkelin nicht beschützen. Die Gewalt kehrt zurück. Als Mado hinter das Geheimnis ihrer Geburt kommt, bricht eine Welt für sie zusammen und sie fühlt sich von allen betrogen. Sie beschließt, sich zur Wehr zu setzen – in einer Welt, in der Männer vorgeben, wie eine Frau zu sein hat. Angesichts von MeToo und Cancel Culture hat Wolfgang Franßen einen unkorrekten Roman geschrieben. Die Geschichte einer Revolte, des Zorns, die sich zu keiner Seite absichert. Mado verspürt eine Kraft in sich, die selbst die Liebe und das Chaos überlebt. Sie will sich nicht abfinden, sich ihr Leben nicht vorschreiben lassen, um es aus zweiter Hand weiterzuleben. Denn schließlich besitzt sie nur diese eine Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WOLFGANG FRANßEN
Mado
ROMAN
1. eBook-Ausgabe 2021© Wolfgang Franßen, 2020© 2021 Europa Verlag in Europa Verlage GmbHUmschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung eines Fotos von © Romvy/AdobeStockLektorat: Eva Weigl, MünchenLayout und Satz: BuchHaus Robert Gigler, München
Konvertierung: BookwireePub-ISBN: 978-3-95890-366-1
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Für Enna
»Denn das Leben ist ein verlorenes Gut,wenn man es nicht so gelebt hat,wie man hätte leben wollen.«
GEORGE COŞBUC,
rumänischer Dichter (1866–1918)
Inhalt
SHOWTIME
BESUCH
SCHWARZ
WEISS
JAZZ
WOLKEN
HAVANNA
HÖLLE
REGEN
WAS
HOTEL
AFFÄREN
SHIRT
DESSERT
ANGEZÄHLT
AUSHILFE
GELD
SEE
DROGEN
MINUTEN
DIPS
IDIOT
BESETZT
ZEHN
PLAN C
POULET
SUCHE
PARIS
WAHRHEIT
SCHUSSWECHSEL
FERIEN
SURFEN
SEELE
LÖCHER
NACHTS
PFERDE
MILCH
RAUSCHEN
KURZ
POOL
BEGEGNUNG
CLOWNS
WEISS
INSEKTEN
NACHT
TÄTOWIERT
WEISS
WALD
SPUK
SUCHE
WASSER
GERETTET
WEIHER
HAFEN
PLAN D
CLUB
BRECHEN
MEHR
UNRUHE
FERN
DANK
SHOWTIME
Auf einem zerkratzten Holztisch lagen die Reste vom Frühstück. Eine braune Ledergarnitur in den Farben seiner Handschuhe. Blau-weiße Hocker in den Farben seiner Shorts. Schwarze Ringseile schmückten eine Wand. Fotos von Frauen aus Mosambique hingen am Kühlschrank. Aus seiner Zeit als Fahrradverkäufer in Afrika. Eine jener genialen Geschäftsideen, die sein Vermögen aufgefressen hatten. Es gab genug Teller und Tassen und Besteck. Nichts davon gehörte ihr.
Im Fernsehen über dem Kamin aus Styropor sprang das Publikum auf und klatschte frenetisch in die Hände. Der Sänger umarmte den Moderator, der Moderator den Gitarristen, und sie war so zugedröhnt, dass sie sich selbst umarmte.
Sie tanzte. Begleitet vom Klopfen gegen die Zimmerdecke unter ihren Füßen. Was konnte schon passieren? Ihr Boxer hatte sie eingesperrt. Sollten sie ruhig die Gendarmen rufen. Sie würden die Tür aufbrechen müssen, um den Ton leiser zu stellen. Vielleicht beschlagnahmten sie auch den Fernseher. Sie würde weiter tanzen und tanzen und grölen, da für eine eigene Wohnung ihr Geld nicht reichte. Die Freiheit war kostspielig. Mado erschöpft von der Suche danach.
Sie hatte keinen seiner Kämpfe gesehen. Angeblich war er nie zu Boden gegangen. Damit ließ sich offenbar genug Geld verdienen, um sich ein Appartement mit Dachterrasse zu leisten. Zum Abschied hatten sie ihm einen Pokal für vierundfünfzig Kämpfe überreicht, in denen er nichts anderes getan hatte, als sich verprügeln zu lassen.
Fünfzehn gewonnen, sieben gingen ohne Sieger über die Runden. Bei den Niederlagen klammerte er sich an die Seile, bis die Kampfrichter ihn auszählten.
Viel konnte in seinem Kopf nicht mehr funktionieren.
Als der Moderator den nächsten Gast ankündigte, drehte sich der Schlüssel in der Wohnungstür. Wahrscheinlich der Concierge. Eine widerliche Schnecke, die von Wohnung zu Wohnung schleimte, um bloß nicht bei einem der Mieter anzuecken. Sie wurde enttäuscht. Sie hatte sich auf ein kleines Wortgefecht gefreut. Und was bekam sie? Einen mürrischen Enddreißiger mit vernarbten Händen, einer Metallplatte in der Schulter und einem bis zum Bauchnabel offenen Hemd.
Ihr stand eine Nacht voller Selbstmitleid, Prahlerei und hartem Sex bevor, in der es nur darauf ankam, wie lange er durchhielt. Am besten, sie schloss sich gleich im Bad ein.
Sie tanzte weiter, als bemerke sie ihn nicht. Er konnte ihr gar nichts. Sie war die Enkelin von Rosa Kaaris. Er hatte keine Ahnung, mit wem er sich da eingelassen hatte.
Als er sich auf die Couch fallen ließ, wechselte er das Programm. Auf der Suche nach einer seiner geliebten Tiersendungen. Obwohl das eher was fürs Nachmittagsprogramm war. Er zappte durch die Kanäle.
Keine Walrösser, keine Adler, keine Lemminge. Sie war schuld.
Sie tanzte einfach weiter. Niemand klatschte mehr. Also klatschte sie in die Hände. Sie war die einzige Tänzerin im Nachtprogramm des Appartements 4b. Das hatte einen Applaus verdient. Sie drehte sich auf die Terrasse hinaus und hörte in der gelb beleuchteten Straße aus dem Arabercafé einen Streit, riskierte einen Blick über die Brüstung. Nichts. Nicht mal eine Schlägerei. Sonst hätte sie ihn runterschicken können, damit er den Laden aufmischte, was seine Stimmung sicher gehoben hätte.
Wehe, man beachtete ihn nicht. Seine Verzweiflung, sein Leid, seine Besserwisserei. Dabei gehörte ihm alles. Wer war sie schon? In ihrer weißen Jogginghose, dem ärmellosen Shirt, das sie längst hätte ausmustern sollen, weil es ihm nicht gefiel.
Offiziell wohnte sie nicht mal in seinem Appartement. Sie habe sich eingezeckt, klebe an den Wänden, die Bettwäsche rieche nach ihr. Er ertrage sie nicht mehr, hatte er sie beim Frühstück angeschrien. Sie besäße nichts außer einem schönen Körper. Die schöne Mado. Warum sie nicht gleich anschaffen gehe, statt von seinem Geld zu leben? Sie sei ein Parasit. Ohne ihn ein Nichts. Was lag da näher, als sie einzusperren, um in Ruhe feiern zu gehen? Sie war nur ein Tier.
Im Fernseher berichteten sie über eine Schlammlawine, die einen Bus voller Touristen in einem Reservat unter sich begraben hatte. Wenigstens da bekam er ein paar Löwen zu sehen. Vielleicht machten die ihn ja glücklich.
Während sie auf der Terrasse rauchte, erzählte er ihr, wen er alles getroffen habe, zog das Hemd aus, als leide er unter Hitzewallungen, und warf es vor den Kamin. Ein Knopf rollte über den Boden. Seine Unterlippe zuckte. Er klopfte neben sich auf die Couch.
Sie leistete der Einladung nicht Folge, weil sie ahnte, was jetzt kam. Ein schöner Abend zu zweit. Er streifte die Schuhe ab, löste die Socken mit den Zehen von den Füßen, trat auf die Terrasse, packte sie und zerrte sie zur Couch. Sie war nur eine Herumtreiberin. Die er mit Drogen fütterte und die seine Merguez anbrennen ließ. Er riss den Halsansatz ihres Shirts ein. Billiges Zeug. Das hatte sie sich noch gekauft. Er bestand auf Qualität, auf Spitzenware, wenn sie schon sein Geld verschleuderte.
Mit der Hand griff er ihr zwischen die Beine und schob sie hoch. Sie lächelte, sagte ihm, sie habe eine Überraschung für ihn, er solle sich einen Moment gedulden.
Im Schlafzimmer drückte sie die Kleiderbügel auf dem Garderobenständer zur Seite. Sie hörte die Metro oberirdisch über die Gleise donnern. Im Fernsehen sendeten sie ein Journal. Die Bettdecke lag auf dem Boden. Fleckig von der letzten Nacht, als er ihr unbedingt Wein in den Mund hatte kippen müssen, um sich daran zu ergötzen, wie sie sich dauernd verschluckte.
Mit den Fingerspitzen strich sie über den einzigen Pokal, den er nach seinem Abschlusskampf überreicht bekommen hatte. Sie las die Widmung. Wie bei dem berühmten Vorbild streckte ein Boxer die Arme in die Höhe. Massiv und billig. Als Anerkennung für jemanden, der im Ring nicht einmal zu Boden ging.
Mado war fünfundzwanzig und von ihrer Großmutter nicht dazu erzogen worden, einen Herd zu bewachen. Sie hob den Pokal über den Kopf, als habe sie ihn selbst gewonnen. An einer Losbude.
»Bist du schon nackt?«, rief er.
Sie hatte längst den Respekt vor sich verloren. Nur noch Panik war übrig. Sie musste etwas von sich retten. Sie wog den Pokal in den Händen. Wenn eine ihn verdient hatte, dann sie. Sie war auch nicht zu Boden gegangen.
Im Wohnzimmer ließ sie ihm nicht die Zeit, sich umzudrehen. Der erste Schlag streifte seinen Kopf und landete auf der Schulter. Mit dem zweiten traf sie die Stirn. Mit dem dritten die Nase. Hart genug, dass er von der Couch glitt und sie anstarrte. Insgesamt waren es sieben Schläge, vielleicht mehr.
Der Zigarillo klebte in seinem Mundwinkel. Also schlug sie weiter zu, während sie gleichzeitig zählte. Bis zehn. Bis er regungslos dalag.
Einen Augenblick tat er ihr leid. Sie zog den Slip aus, den er ihr gekauft hatte, und wischte sich das Blut von den Füßen.
Es war sicher nicht die beste Lösung. Eine bessere war ihr nicht eingefallen.
BESUCH
Wenn Rosa Kaaris an ihren Mann Matthieu dachte, befiel sie eine gewisse Schwermut. Er war der Sohn eines alteingesessenen Taxiunternehmers in Bordeaux gewesen, bevor er zur Bahn ging und mehr Fahrgäste von einem Ort zum anderen brachte als sein Vater in seinem ganzen Leben. Er war verrückt nach ihr gewesen, hatte alles hinter sich gelassen, um vor ihrer Tür aufzutauchen und stotternd zu gestehen, dass er nicht mehr ohne sie sein wolle. Das hatte so gar nicht zu ihr gepasst. Wie sie ausgerechnet an so einen Kerl gelangt sei, hatten die Schmuggler, mit denen sie Geschäfte machte, sie aufgezogen.
Von Grund auf ehrlich und rechtschaffen.
Matthieu besaß eine hohe Stirn, eine Nickelbrille und verdammt gute Manieren. Ein Sohn, der regelmäßig in die Kirche ging, aber das hatte sie niemandem erzählt, um es ihm in ihren Kreisen nicht noch schwerer zu machen. Er kontrollierte die Fahrkarten auf der Strecke Le Havre–Marseille. Sie sahen sich an seinen freien Tagen. Sie waren verheiratet und auch nicht verheiratet gewesen, je nachdem, wie ihr danach war. Aber sie wurde geliebt. Unendlich.
Matthieu stellte nur zwei Bedingungen für die Hochzeit: Er wollte nichts von ihren Geschäften wissen, und sie würden zusammen in die Rue Lomenech ziehen. Ihre Ehe hielt fünfunddreißig Jahre.
Rosa schüttelte den Kopf. Fünfunddreißig Jahre.
Warum ausgerechnet dieser Mann so elendig an Krebs verreckt war, wollte ihr nicht in den Kopf. Sie ja, Serge auch, aber Matthieu? Dieser stille Mann, der kein Laster kannte, der sonntags Cadre spielte und sich nicht wie andere Männer beschwerte, wenn kein Essen auf dem Tisch stand.
Sie musste ihn alleine sterben lassen, weil sie im Gefängnis saß. Verurteilt für etwas, an dem sie keine Schuld trug. Serge war bei ihm gewesen. Sie hätte den Namen des Verräters, der sie ans Messer geliefert hatte, nur auszusprechen brauchen, doch das hätte bedeutet, dass auch Serge ins Gefängnis gekommen wäre. Einen einzigen Namen, um wenigstens am Begräbnis teilnehmen zu dürfen. Doch Rosa Kaaris hatte geschwiegen.
Egal, wie alt und verschrumpelt sie war, es gab nichts zu bereuen, sie würde alles wieder so machen. Im nächsten Leben, im übernächsten, selbst wenn sie auf der Stelle noch mal jung wäre. Es hatte ihr gefallen, den Staat um seine Steuern zu betrügen. Die neun Jahre im Gefängnis war sie klargekommen. Als sie freikam und alles sich verändert hatte, war sie auch klargekommen. Dass sie die Wohnung nicht mehr verlassen konnte, weil ihre Beine sie nicht mehr weit genug trugen, damit kam sie klar. Dass ihre Tage gezählt waren, sowieso. Nur dass die Sommersprossen aus ihrem Gesicht verschwunden, in Altersflecken übergegangen waren, das ärgerte sie maßlos.
Rosa war groß und schlank und breitschultrig gewesen. Eine herbe Schönheit, der sie nicht nachtrauerte. Die Männer waren ihr mit Respekt begegnet. Sie hatte schon als Kind auf dem Hof ihrer Eltern gearbeitet und bemerkt, dass sie ein Geschick im Verhandeln besaß. Sie war nicht einmal vierzehn gewesen, als ihr Vater sie vorschickte, um ein Schwein zu verkaufen. Von dem Geld, das sie zusätzlich herausschlug, hatte sie allerdings nichts gesehen. Sie begriff früh, dass sie ihr eigenes Geschäft aufziehen musste, wenn für sie etwas übrig bleiben sollte. Mit siebzehn war sie schon nicht mehr auf dem Hof gewesen. Für einen Fischer stand sie auf dem Markt und sorgte dafür, dass sein ganzer Fang an einem Vormittag unter die Leute kam. Mit knapp zwanzig lernte sie einen Flamen kennen, der sein Geld mit bezahlten Leerfahrten verdiente, weil ihn die eigentliche Fracht nicht ernährte. Ein kleiner Betrug, den Rosa sofort einsah. Ihr konnte niemand weismachen, dass alle ihr Geld auf redliche Weise verdienten.
Der alte Leveque nahm sie schließlich unter seine Fittiche und brachte ihr alles bei. Er bezog schottischen und irischen Whisky ohne Steuermarke direkt von den Destillerien, versah sie in einem Schuppen auf einer Landstraße nach Concarneau mit den entsprechenden Siegeln und verschob sie nach Paris. Zu seinem Imperium gehörten Schnaps, Zigarren und Kaffee. In den Siebzigern hatte Rosa sich selbstständig gemacht und auf Medikamente spezialisiert, die auf Frachtern aus Nordirland über Bord gingen. Auch Ärzte wollten schließlich Geld verdienen.
Allein in ihrer Zelle, hatte sie sich oft den Kopf darüber zerbrochen, warum sie so blind gewesen war, warum sie es nicht hatte kommen sehen. Der Kerl, der sie ersetzt hatte, war jünger, gieriger und brutaler gewesen. Nicht daran interessiert, sein eigenes Geschäft aufzuziehen, da sie ja über alle Kontakte verfügte. Mit gepanschten Medikamenten ließ sich mehr Geld verdienen. Ein unschlagbares Argument. Und er war ein Kerl. Als die ersten Patienten Ende der Siebzigerjahre im Koma lagen, war der Skandal vertuscht worden, Rosa war ausgestiegen und hatte das Maison Blanche eröffnet. Sie musste an Matthieu und ihre Kleine denken. Sie war nie ein großes Risiko eingegangen. Nur so weit, dass es für ein gutes Leben reichte, aber halt nicht für eine Villa in Biarritz.
Nach der Jahrtausendwende kam das ganze Ausmaß zutage. Mehrere Patienten waren gestorben. Der Kerl, der sie aus dem Geschäft gedrängt hatte, verfügte inzwischen über so viel Einfluss, dass er dem Gericht eine Schuldige präsentieren konnte: Rosa. Er ließ einen Kronzeugen aussagen, der sie mit Dreck bewarf. Sie stellten es so dar, als trage sie Schuld am Tod Dutzender Patienten. Madame la Mort, wie die Presse sie nannte. Als seien die Toten nicht bereits krank gewesen, sondern hätten alle gerettet werden können. Neun Jahre Schweigen, erst danach hatten sie den wahren Drahtzieher überführt.
Rosa hielt sich vorm Spiegel im Flur eine Hand über den Kopf. Dass sie langsam zu schrumpfen begann, sich nicht mehr richtig aufrecht hielt, auch damit kam sie klar. Die grauen Strähnen hatte sie mit jeder Farbe bekämpft, die ihr Friseur hatte auftreiben können. Nur rothaarig hatte sie nie sein wollen.
Du altes, eitles Biest, dachte sie, als es an der Tür klingelte. Um die Zeit öffnete sie normalerweise niemandem. Egal, wie hartnäckig er auch auf die Klingel drückte.
Sie setzte Wasser auf. Auf jenem Gasherd, den ihre Tochter jedes Jahr zu entsorgen versuchte, weil sie davon überzeugt war, dass ihre Mutter eines Tages vergessen würde, den Hahn abzusperren, und sich in die Luft sprengte.
Das Klingeln nervte sie. Vielleicht ein neuer Postbote, der nicht wusste, dass er ihre Pakete bei der Nachbarin im Erdgeschoss abgeben sollte. Sie hörte ihren Namen. Ein Klopfen. Mit dem vollen Kaffeefilter in der Hand näherte sie sich der Tür und hörte die Stimme ihrer Enkelin.
»Nun mach schon auf. Ich weiß, dass du da bist. Wo sollst du sonst sein?«
Fünf Jahre war es her, seitdem Mado verschwunden war. Fünf Jahre ohne einen Anruf, ohne eine Karte. Was bildete das Kind sich ein? Dass es einfach auftauchte und alles war beim Alten? Rosa kehrte in die Küche zurück, setzte den Filter auf die Kanne, nahm den Kessel vom Herd und goss Wasser hinein.
Das Klopfen ging in ein Hämmern über.
»Was soll das? Mach die Tür auf«, rief Mado.
Es gab drei Phasen bei Rosa Kaaris. In der ersten regte sie sich auf. In der zweiten wurde sie wütend. In der dritten ganz ruhig. Etwas, was niemand wirklich erleben wollte.
Die Hand auf dem dicken Bund liegend, an dem zu viele Schlüssel hingen, von denen sie nicht wusste, zu welchem Schloss sie passten, sagte Rosa: »Nein.«
»Ich bitte dich.« Das klang nicht nach Mado. Ihr kleines Mädchen bat nie um etwas.
Rosa drehte den Schlüssel um. Die Tür sprang einen Spalt weit auf. Als müsse sie all ihren Mut aufbringen, dauerte es einen Moment, bevor Mado ihr in die Küche folgte, wo ihre Großmutter eine Brioche mit Marmelade bestrich.
Mados Hände umklammerten sie von hinten. Sie lehnte den Kopf an ihren Rücken. Sie sollte sich nichts vormachen, dachte Rosa. Sie würde ihre Enkelin nicht wegschicken, obwohl sie das verdient hatte. Sie freute sich, sie zu sehen, aber sie kam auch nicht gegen ihre Natur an. Sie drehte sich um und ohrfeigte Mado, die zurückschrak und auf die Küchenbank fiel, wo sie gesessen hatte, seitdem sie über die Tischkante blicken konnte. Sie war dürr gewesen, mit viel zu langen Fingern. Immer voller Zorn auf ihre Mutter. Auch jetzt sah sie abgemagert aus. Vor allem erschreckte Rosa der leere Blick in ihren Augen.
»Ist das jetzt deine Entschuldigung?«, schnauzte Rosa sie an.
Mados Grinsen explodierte auf ihren Lippen. Sie und sich entschuldigen, was für ein idiotischer Gedanke. Als Kind hatte sie jegliche Bestrafung wortlos hingenommen.
Eine Stunde nachdem Mado ihr alles gestanden hatte, nahm ihre Großmutter sie in den Arm. Am liebsten hätte sie ihr gesagt, dass alles nichts nutzte, egal, was eine Frau anzog, für welche Frisur sie sich auch entschied, Kerle blieben Kerle. Das hatte ihre Enkelin inzwischen selbst herausgefunden.
Sie brauche sich keine Sorgen zu machen, beruhigte sie Mado. Sie würde sich um alles kümmern. Sie würde Serge nach Paris schicken, damit er hinter ihr aufräume. Sie ließ sich die Schlüssel zum Appartement geben und fragte sie, ob sie schon gegessen habe. Irgendwo gab es immer einen Rest Suppe in diesem Haushalt.
Mado sah zu ihr auf. In der Untertasse vor ihr lagen bereits sechs Kippen. Offenbar erinnerte sie sich nicht mehr daran, dass in der Wohnung ihrer Großmutter nicht geraucht werden durfte.
»Haben sie was im Fernsehen gebracht?«, fragte Rosa sie.
»Im Radio jedenfalls nicht«, sagte Mado.
»Das ist gut.«
Das letzte Mal, dass Rosa Kaaris ihre Wohnung verlassen hatte, war bei ihrer Verhaftung gewesen.
Nicht ganz freiwillig. Und das gleich für neun Jahre.
Sie würde niemandem erlauben, ihre Enkelin abzuholen.
SCHWARZ
Das Maison Blanche lag auf einem Hügel, fünfhundert Meter von der Hauptstraße entfernt. Hohes Gestrüpp umgab Parkplatz wie Haus wie Garten. Die Fassade zur Straße hin wurde alle drei Jahre gestrichen. Der Bau einer Terrasse war angedacht und verworfen worden. Wer nachts besoffen ins Freie torkelte, musste höllisch aufpassen, sich nicht wegen der zurückgelassenen Bohlen den Hals zu brechen. Das Maison Blanche war immer da gewesen. Wenn auch erst ab Ende der Siebziger als Bauernkneipe.
Mado zögerte, die Tasche abzustellen. Durch die geöffnete Schiebetür drang Lachen in die Küche. Es roch frischer. Vielleicht war ihre Mutter endlich auf die Idee gekommen, hin und wieder zu lüften. Auch schien sie plötzlich aufzuräumen, statt überall ihre Sachen fallen zu lassen. Es sah so aus, als habe es Mado in diesem Haus nie gegeben. Selbst die Zeichnungen, die ihre Mutter auf Drängen ihrer Großmutter hatte rahmen lassen, hingen nicht mehr am angestammten Platz neben dem Vorratsraum.
Es war erniedrigend, wieder bei der eigenen Mutter einziehen zu müssen. Auch wenn Mado sich schwor, dass es nur für ein paar Tage sein würde.
Laure trat hinter der Theke hervor und ging mit einem Tablett zu einem der Tische. Diesen Hüftschwung, wie hielt sie den bloß durch, dachte Mado. Als Kind hatte sie ihn sich beizubringen versucht. Doch Mado war nicht ihr kleines liebes Mädchen gewesen, das nur den Schwung der Hüfte zu übernehmen brauchte, um so wie sie zu sein.
Den größten Teil ihres Lebens verbrachte Laure Kaaris nachts unter künstlicher Beleuchtung. Bloß kein Tageslicht, bloß keinen Urlaub. Überall war es so wie hier. Die Männer nicht anders, die Frauen nicht. Alles, was Laure brauchte, befand sich zwischen diesen Mauern und wer aus diesem Haus auszog, den gab es nicht mehr.
Als Rosa Kaaris ins Gefängnis einfuhr, hatte ihre Tochter das Maison Blanche übernommen. Sie war jünger, naiver, in den Augen der Nachbarn verruchter gewesen. Nachdem sie eine Zeit lang bei ihrer Tante gewohnt hatte, brachten die Gendarmen sie öfter nach Hause, was ihr nicht wirklich gefiel. Rosa hatte ihr Geld zustecken müssen, weil sie nichts besaß. Eine Frau mit einer kleinen Tochter, die lieber in wilder Ehe mit Kerlen zusammenlebte und nicht wirklich überblickte, worauf es ankam. Mit Rosas Festnahme kehrte sie in den Schoß der Familie zurück. Der Übergang geschah reibungslos, so als wäre Laure darauf vorbereitet gewesen. Hartnäckig hatte sich lange Zeit das Gerücht gehalten, sie steige mit den Bauern der Gegend für ein kleines Entgelt ins Bett. Ein Geschäftszweig, den sie, je älter sie wurde, eingestellt hatte.
Für Mado war dasselbe Leben vorgesehen gewesen.
Sie stellte die Tasche auf einem der Plastikstühle ab, trat ans Fenster und sah in den Garten. Im eingefallenen Gewächshaus wucherte es grün. Die Kiefern grenzten den Garten weiterhin zu den Feldern ab. Die Wäschespinne hatte einen dumpfen Rostton angenommen. Die leeren Weinkartons standen gestapelt neben dem Holzverschlag. Laure füllte den Wein in Flaschen um und beklebte sie mit Etiketten, weil die Touristen, die sich hierher verirrten, keinen Wein aus Kartons tranken.
Als sie durch die Schiebetür trat, fühlte es sich an, als sei sie nie weg gewesen. Ein Junge, mit dem sie zur Schule gegangen war, nickte ihr zu. Mit wässrigen Augen und dem festen Glauben, es eines Tages auch von hier wegzuschaffen. Laure, die Glut der Zigarette knapp vor den Lippen, starrte sie an. Eine Hand ruhte auf dem Zapfhahn. Sie presste die Lippen zusammen, was wohl heißen sollte, habe ich es mir doch gedacht.
Mado musste zugeben, dass ihre Mutter die letzten fünf Jahre und den Sprung über die vierzig schadlos überstanden hatte. Sie war nur etwas runder im Gesicht geworden. Zu der Frisur, am Nacken ausrasiert, hätte sie ihr nicht geraten. Aber sie stand noch immer auf waghalsig hohen Schuhen da, eingekleidet von ihrer besten Freundin, weil sie ihrem eigenen Geschmack misstraute. Den Hals versteckte sie weiterhin mit bunten Schals, von denen sie Dutzende besaß.
Ihre Mutter war sicher nicht die Einzige, die in diesem Moment dachte, dass ihre Tochter endlich zur Vernunft gekommen sei. Der Milchlieferant kniff sich in die Nase. Laurent Binet, der seinen Hof sicher noch nicht an seinen Sohn übergeben hatte, rief seinen Hund zu sich, um ihn darauf aufmerksam zu machen, wer denn da nach Hause gekommen sei.
Mado war zurück und damit Ende und aus.
Ihre Mutter begrüßte sie mit flüchtigen Küssen auf die Wangen und wandte sich einem der Brüder Morin zu, der die Zeche für sich und seinen Bruder bezahlte. Als der mitbekam, dass sein jüngerer Bruder Geld über die Theke schob, kam es zum Streit darüber, dass er sein Bier selber zahlen könne. Sie schubsten einander aus dem Maison Blanche, um sich auf dem Parkplatz abwechselnd in den Schwitzkasten zu nehmen, bis der Jüngere dem Älteren einen Faustschlag versetzte und so die besseren Argumente besaß.
Laure drehte den Ehering an der linken Hand, von dem niemand wusste, wer ihn ihr je übergestreift haben sollte. Es war eher wahrscheinlich, dass sie ihn sich selbst gekauft hatte.
Auf nach Paris, hatte Mado sich gesagt. In ein Leben ohne Schläge, hatte sie sich gesagt. In ein Leben ohne Hausarrest, stattdessen voller Partys, Drogen und guter Musik. Zugegeben, Mado hatte es ihrer Mutter nie leicht gemacht. Vielleicht wäre sie selbst an so einer Tochter verzweifelt. Laure hatte den unverzeihlichen Fehler begangen, sie als Vertraute anzusehen. Dabei war sie nur ein Kind gewesen, wenn ihre Mutter sie in ihrem Bett schlafen ließ, um sich auszuheulen, sich auszukotzen. Irgendwann ging einem das Mitleid aus. Selbst als Kind. Weil sich nie etwas änderte und Mado ständig der Mülleimer für alles war, was im Leben von Laure Kaaris schieflief.
Mit roten Lippen wie eine Leuchtreklame betrachtete ihre Mutter sie mit einem Ausdruck abgrundtiefer Selbstgerechtigkeit. Sie hatte recht behalten. Mit einer Tochter wie Mado landete man auf dem Sozialamt. Mit einer Tochter wie Mado gab es Scherereien. So wie sicher jetzt auch. Sie brauchte nicht zu fragen, was los war. Sie sah es ihr an.
Fünf Jahre.
Bis auf die Touristen, die am Kicker um Schnäpse spielten, kannte Mado jedes Gesicht, und keines davon hatte sie je wiedersehen wollen. Das Hirn der Säufer im Maison Blanche war so auf Mindestgröße zusammengeschmolzen, dass sie nur langsam begriffen, wer da hinter der Theke aufgetaucht war. Sie freuten sich, sie wiederzusehen, und stritten sich darum, wer ihr als Erster einen ausgeben durfte.
Mado wollte nicht gleich den ersten Tag verderben. Sie stieß mit allen an und wünschte sich einen Stromausfall herbei, um die feisten Gesichter nicht ertragen zu müssen. Als Binet sie um die Taille fasste und an sich zog, drehte sie sich geschickt aus der Umklammerung heraus, schob die lange Reise als Entschuldigung vor und schlüpfte durch die mit Aufklebern übersäte Schiebetür zurück in die Küche.
Sie hatte nichts gegessen, und der Schnaps zeigte bereits Wirkung. Sie fühlte sich überdreht. Aufgeputscht. Auf dem Küchentisch schnitt sie sich ein Stück Käse vom Laib ab und fand einen Rest Brot in einer Tüte.
Wenigstens der aufgeplatzte Putz über der Spüle war noch da. Wenigstens knarrte jeder Schritt auf dem Holzboden. Sie zupfte das Shirt runter, das ihren Bauch freilegte, als sie den Pullover auszog, und ließ ihn auf einen Stuhl fallen. Wo war ihre Schwester?
Oben im Gang zu den Schlafzimmern schlug ihr stickige Luft entgegen. Im Dachgeschoss gab es kaum Fenster. Es roch muffig wie auf einem Speicher, was daran lag, dass ihre Mutter selbst Ende April noch heizte, als ständen die ersten Schneestürme vor der Tür.
Zwei mit Wasser gefüllte Eimer versperrten Mado den Weg. Nichts fürchtete Laure Kaaris so sehr wie einen Kabelbrand, der den Dachstuhl in Brand setzte. Für einen Feuerlöscher war nie Geld übrig gewesen. Warum es aus dem Fenster schmeißen, wenn es Wasser aus dem Hahn gab? Die ganze Familie Kaaris war äußerst pragmatisch unterwegs. Mado nahm sich da nicht aus.
Ihre Schwester hatte ihr altes Zimmer in Beschlag genommen. Ein riesiger Fernseher hing an der Schräge über dem Bett. Verelles Strumpfhosen ordentlich aufgehängt an einer Schnur. Zwei bunte Sitzkissen. Leere Plastikflaschen. Mados altes Eisenbett. Sogar ein Kreuz neben dem Waschbecken. Das war neu. Vielleicht war aus Verelle ja eine Nonne geworden. Mado drückte die Tür zum Badezimmer auf.
Die Risse in der Decke waren noch da, als sie Verelles ehemaliges Zimmer betrat, und auch die Farbeimer, mit denen ihre Mutter vor Jahren hier alles hatte streichen wollen. Mado bekam Kopfschmerzen, öffnete das Fenster, das sich nur kippen ließ. Sie suchte in ihrer Tasche nach den Schlaftabletten, von denen sie schon während der Zugfahrt zwei geschluckt hatte.
Ihre Großmutter hatte im Gefängnis gesessen. Ihre Mutter war eine Hure. Ihre Schwester eine Nonne. Sie eine Mörderin.
Eine perfekte Familie.
WEISS
Nach dem Regen vom Vormittag musste Verelle auf dem glitschigen Pfad aufpassen, wohin sie die Füße setzte. Sie schlug ihn ungern ein, weil sie ständig Gefahr lief, dass sich plötzlich kleine Steine in ihren Schuhen befanden. Ein Schuster hatte sich die Sohlen angeschaut. Keinerlei Riss. Wie kamen also die Steine in die Schuhe? Auch jetzt fühlte es sich an, als würde sie unter der Ferse etwas spüren. An der Steigung zum Parkplatz zog sie sich an den Ästen hoch, um das Gleichgewicht zu halten. Die Strumpfhose war mit Dreckspritzern übersät, nur weil sie ein paar Minuten hatte einsparen wollen. Die Strandtasche aus Leinen streifte einen Strauch und blieb hängen. Sie riss daran und schob sie über die Schulter zurück. In einer Mulde rechts von ihr lag die Kühltruhe, die ihre Mutter letztes Jahr entsorgt hatte. Das blanke Metall nahm bereits Grünspan an. Auch ihr erstes Fahrrad war dort gelandet, weil die Senke weder vom Parkplatz noch von der Straße aus einzusehen war.
Verelle schaltete die Taschenlampenfunktion ihres Smartphones an und beleuchtete den Pfad, um nicht noch in letzter Sekunde im Dreck zu landen. Sie war in die Stadt gegangen, um Raymond zu sagen, dass sie ihn nicht so liebe, wie er sie liebe. Er hatte sie einfach gehen lassen, was sie ihm hoch anrechnete. Morgen würde sie ihn allerdings schon wieder treffen müssen, weil sie ihre Jacke in seinem Zimmer vergessen hatte und zu faul gewesen war, auf halber Strecke umzudrehen.
Als sie endlich auf dem Parkplatz stand, blieb sie abrupt stehen und schaute zum Dach hoch. Auf der falschen Seite brannte Licht. Was merkwürdig war, weil ihre Mutter ihr jede Birne, die unnütz brannte, unter die Nase rieb. Wer bezahlte alle Rechnungen? Sie. Wann dürfte ihre Tochter überall das Licht anlassen? Wenn sie eine eigene Wohnung besäße.
Wenn das bedeutete, was Verelle gerade dachte, hatte sie gar keine Lust mehr, nach Hause zu gehen. Sie schnaufte und stampfte mit dem Schuh in den Kies. Immer wenn es gut lief, passierte irgendwas, dass sie sich schlecht fühlte.
Mado.
Ihre Schwester hatte sie vom ersten Moment an gehasst, als sie auf die Welt gekommen war. Sie habe keine Schwester haben wollen, hatte sie jedem unter die Nase gerieben. Nicht einen Moment hatte Mado darüber nachgedacht, was es für Verelle bedeutete, wenn sie einfach nach Paris abhaute. Verelle war fassungslos gewesen, als ihre Mutter nicht nach ihr suchte und der Meinung war, Mado sei weg, dann solle sie auch wegbleiben.
Verelle nahm eine Tube aus der Tasche und cremte sich die Hände ein. Ihre Haut war so weiß. Wenn sie länger als zehn Minuten in der Sonne saß, musste sie gleich in den Schatten. Auch jetzt hatte sie einen leichten Sonnenbrand vom Nachmittag. Daran war natürlich Raymond schuld, weil er den Schirm nicht hatte aufspannen wollen. Raymond war Geschichte, aber eine Schwester wurde man nicht so leicht los, wie sich gerade zeigte.
Mado sollte verschwinden. Alles würde sich wieder nur um sie drehen. Obwohl Verelle putzte, sich ums Essen kümmerte, ein eigenes System entwickelt hatte, wann was zu waschen war, sogar Buch über den Getränkevorrat führte und sich um die Bestellungen kümmerte. Wie ihre Mutter es ihr beigebracht hatte, kassierte sie zweimal bei den Besoffenen ab, sobald deren Kopf auf der Theke lag. Alles egal, sie blieb doch nur die zweite Tochter. Die Nachzüglerin. Der Unfall. Nicht gewollt.
Verelle war wütend. Mado sollte verschwinden. Für sie war hier kein Platz mehr. Sie konnte nicht einfach zurückkommen und so tun, als wäre sie nie weg gewesen. Vielleicht sollte sie auch einmal weglaufen, dachte Verelle. Nur wohin? Wie ihre Schwester nach Paris? Sie wollte nicht weg. Sie wollte hier sein. Das war ihr Zuhause.
Sie kniff sich in den Unterarm, bis der Schmerz so groß war, dass sie die Luft anhalten musste, um ihn auszuhalten. Sie strich ums Haus und konnte sich nicht überwinden hineinzugehen. Unter dem Vordach im Garten, zwischen den Hängematten, in denen sie im Sommer lag und Musik hörte, dachte sie an die drei Hunde und zwei Katzen, die sie zwischen den Sträuchern beerdigt hatten.
An guten Tagen bemühte sie sich, die Erinnerungen an Mado wie bei einem Puzzle zusammenzusetzen, in dem es zu viele Teile gab, die nicht zueinanderpassten. An schlechten tat sie so, als habe sie keine Schwester, als sei das alles nur ein Gerücht.
Mado würde auf ihr altes Zimmer bestehen und ihre Mutter sie sicher nicht davon abhalten. Es lag direkt über der Kneipe. Wenn die Dusche zu lange lief, färbte sich die Wand dunkel und wurde nass. Wehte der Wind aus der falschen Richtung, hörte sie bei offenem Fenster die nahe Autobahn. Sie mochte das Geräusch, weil es sie daran erinnerte, dass da draußen alle irgendwohin fuhren, weil sie alle nicht zu schätzen wussten, wie gut sie es hier hatten. Nur sie, sie wusste das. Vielleicht beabsichtigte Mado ja nur, ihre Mutter um Geld anzuhauen. Egal, welcher Grund auch immer, sie sollte nicht hier sein.
Sie würde alles durcheinanderbringen. Sie verstand sich so gut aufs Lügen. Notlügen, dreiste Lügen, Lügen, die sie erfand, wenn sie in die Ecke getrieben wurde, und Lügen, bei denen es ihr einfach nur Spaß machte, wenn einer auf sie hereinfiel. Niemand, wirklich niemand log so dreist wie ihre Schwester und hielt für sich immer eine Entschuldigung parat.
Verelle zog den rechten Schuh aus und fuhr mit der Hand hinein. Nichts. Kein einziger Stein.
Sie kniff sich in den Arm.
Der Schmerz half, als sie die Tür aufdrückte.
JAZZ
Nach drei Tagen war ihr Boxer immer noch keine Meldung im Radio wert.
Mado besuchte den Ex-Freund ihrer Mutter im Chez Aldo. Ein Enfant terrible wie sie. Koch, Alleinunterhalter auf Hochzeiten und runden Jubiläen, Jazztrompeter. Eine Zeit lang hatte er im Sudan die Großküche bei den Médecins Sans Frontières geführt und war stolz auf sein scharf gewürztes Poulet à la portugaise gewesen. In der Zeit mit Laure war er für sie und ihre Schwester eine Art Ersatzvater gewesen. Bis zu dem Tag, als Laure dahinterkam, dass er zweigleisig fuhr und eine Affäre mit einer Sängerin aus den Niederlanden pflegte, die sich kess Madame nannte und Musette sang.
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, hatte Laure seine Sachen in schwarze Plastiktüten gestopft und vor die Tür gestellt, nachdem sie die Schlösser ausgewechselt hatte. Danach war ihnen jeder Umgang mit ihm verboten worden. Mado hatte ihn vermisst, sich aber nicht gegen ihre Mutter durchsetzen können, die sie angeschnauzt hatte, in ihrer Gegenwart nie wieder seinen Namen zu erwähnen.
Aldo zwinkerte ihr zu und drückte sie so fest, als beabsichtigte er, sie nie mehr loszulassen, während er gleichzeitig einer Familie aus Lyon die Spezialität des Hauses mit den Worten schmackhaft machte, dass es sich dabei um ein Geheimrezept seiner Familie handele. Welche Familie? Hatte er nicht immer behauptet, er besäße keine? Wie er es sechs Jahre mit ihrer Mutter ausgehalten hatte, war ihr ein Rätsel. Wenn die beiden sich zufällig im Supermarché über den Weg liefen, versteckte er sich hinter den Regalen, weil die Kaaris, wie er sie nannte, über den bösen Blick verfüge.
Ein schmächtiger Mann mit buschigen Augenbrauen und viel zu langen Koteletten, die er sich bei Eddy Mitchell abgeschaut hatte. Einem seiner Helden. Viele der Stammgäste kamen nur her, um sich seine Geschichten anzuhören. Sie lieferten ihm ein Stichwort, und egal, ob sie die Geschichte schon kannten oder nicht, er unterhielt sie bestens, und es machte ihm auch nichts aus, wenn sie ihn anschließend damit aufzogen.
Das Chez Aldo war ein besserer Imbisswagen. Mit Holzanbau und einer viel zu großen Außenbeleuchtung zur Schnellstraße hin. Als Musiker hatte er sich zur Ruhe gesetzt, nachdem er Gicht bekam. Was ihn nicht vom Kochen abhielt. Gegessen wird immer, sagte er. Mit ihm war auch die kleine Speisekarte mit den drei Gerichten aus dem Maison Blanche verschwunden.
Die Bands, mit denen er aufgetreten war, hatten gerade mal so viel Geld verdient, um sich eine Übernachtung, ein Frühstück und das Plakat für den nächsten Gig leisten zu können. Er war viel herumgereist. Seine beste Zeit. Frei wie ein Vogel. Und dann hatte er sich in ihre Mutter verliebt, die nichts davon hielt, dass er sich herumtrieb.
Mado hatte Madame nie persönlich kennengelernt und war neugierig, wer es geschafft hatte, ihm so den Kopf zu verdrehen, dass er ihr jeden Wunsch von den Lippen ablas. Sie waren zusammen in Hotels in Deauville aufgetreten. Sobald Madame ein Mikrofon in der Hand hielt, veränderte sich ihre Stimme, wenn Mado ihrem Stiefvater glauben durfte. Sie singe wie nach zwanzig Zigaretten. Fast so verrucht wie die Gréco. Wie die frühen Stunden in einer Bar. Nun litt sie unter chronischer Erschöpfung, nachdem eine Schilddrüsenoperation vollkommen verpfuscht worden war.
Aldo war es gewesen, der Mado genug Geld zugesteckt hatte, damit sie nach Paris verschwinden konnte. Auch ihm hatte sie nie eine Karte geschrieben, aber oft an ihn gedacht. Sie hatte ihm versprochen, es zurückzuzahlen. Irgendwann. Aber wovon?
Mado hatte viele Gerüchte über Madame gehört. Die meisten wunderten sich, dass sie sich mit jemandem wie Aldo abgab und es in der engen Wohnung über dem Imbiss aushielt. Erst gegen Geschäftsschluss traute sie sich nach unten und legte ein Gebaren an den Tag, als habe sie gerade einen umjubelten Auftritt hinter sich. Sie nimmt ihn aus, sagten die Leute. Nun, dachte Mado, wenn er glücklich ist.
Was nach all den Jahren mit ihrer Mutter einem Wunder gleichkam. Es gab in der Umgebung keine Straßenkreuzung, aus der Laure Kaaris nicht schon aus dem Wagen gesprungen war, um ihn wüst zu beschimpfen und zu Fuß nach Hause zu marschieren.
An besonderen Abenden holte er seine Trompete heraus und spielte Chet Baker. Allerdings nur eine Kostprobe, wenn Madame oben ihre Siesta hielt und literweise Wasser in sich hineinschüttete, nachdem ein Quacksalber ihr gesagt hatte, dass sie unter Flüssigkeitsmangel leide.
Mado setzte sich in den zugigen Anbau, behielt die Jacke an und bekam ein Glas von dem guten Wein kredenzt, wie er ihr augenzwinkernd steckte. Aus Kalabrien. Dazu einen Teller Fritten und eine Auswahl selbst hergestellter Saucen.
Mado hatte sich den ganzen Tag unruhig gefühlt, was nichts Gutes bedeutete. Sie spürte, wenn die Dinge in die falsche Richtung liefen. Dann war sie mit sich unzufrieden, egal, was sie auch dagegen unternahm. Sie hatte nicht länger im Zimmer auf dem Bett liegen und die Decke anstieren können.
Zwar hatte ihre Großmutter ihr am Morgen am Telefon mehrmals versichert, dass das Problem in Paris gelöst sei, Serge habe sich um alles gekümmert, aber die Anspannung wich nicht. Was hatte sie sich bloß dabei gedacht, ihm den Schädel einzuschlagen? Sie kratzte sich über den Handrücken, was sie schon als Kind getan hatte, als alle dachten, sie bekäme Neurodermitis.
Aldo schob seine Hand über ihre Finger und sah sie an. »Noch Wein?«, fragte er.
Allein dass er in ihrer Nähe war, tat ihr gut.
Als die letzten Gäste den Imbiss verließen, reichte er ihr den Aschenbecher, und sie gönnte sich die erste Zigarette seit ihrer Ankunft.
»Und?«, fragte er. »Wie war Paris?«
Eine Frage, auf die Mado keine Antwort wusste.
WOLKEN
In dem Maße, wie es im Laufe der Woche wärmer wurde, besserte sich auch Mados Laune. Im Le Point in der Nähe des Bahnhofs trank sie zwei Café serré und aß ein Croissant, das sie in vier Stücke zerriss. Es hatte nur noch bis Ende des Monats geöffnet. Ein Schild in der Tür wies darauf hin, dass eine Kette es übernahm. Mado kannte den Sohn des Besitzers, den sie zu treffen gehofft hatte, der aber laut seinem Vater nun mit seiner Familie in Quimper lebte. Sie lauschte den Gesprächen der Handwerker, die sich über ihre deutschen Auftraggeber beklagten, die sich dauernd beschwerten, wenn sie fünf Minuten zu spät kamen, und beobachtete ein Paar beim Händchenhalten. Sie schien mehr in ihn verliebt zu sein als er in sie.
Bei jedem Klingeln der Schlittenschelle, die über der Eingangstür hing, drehte Mado sich um, als erwarte sie jemanden. Vor ihr an der Wand hing ein alter Weihnachtskalender der Crédit Mutuel voller durchgestrichener Tage, während sie sich den Kopf darüber zerbrach, ob sie womöglich schwanger war. In den letzten Tagen hatte sie sich morgens übergeben müssen. Was vielleicht daran lag, dass sie viel zu viel über den Boxer nachdachte.
Je mehr Tage sich zwischen hier und Paris schoben, desto überzeugter war sie, dass sich das alles rächen würde. Ihre Großmutter hatte ihr verboten, mit jemand anderem als ihr darüber zu reden. Damit müsse sie leben, hatte sie gesagt. So einfach komme sie nicht davon.
Das mit der Schwangerschaft würde sich regeln lassen, beruhigte Mado sich. Sie musste nur eine Apotheke aufsuchen und sich Gewissheit verschaffen. Und dann würde sie einfach noch ein Leben töten. Sein Kind brächte sie jedenfalls nicht zur Welt.
Gewalt war vererbbar.
Der Erste, der in der langen Reihe ihrer Vorfahren mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war, war ihr Ururgroßvater gewesen. Als sturer Anarchist und eingefleischter Bretone war er vor dem Ersten Weltkrieg der Meinung gewesen, dass Banken viel zu viel Profit mit dem Geld anderer Leute machten. Anderthalb Jahre hob er kleinere Beträge ab, indem er Banken stürmte und Kassierern eine Waffe vor die Nase hielt. 1904 hatten sie ihn beim Verlassen eines Kassenraums erschossen. Die Fotos seiner Leiche spielten sie an die Presse weiter, damit alle, die ein Konto besaßen, beruhigt sein konnten. Leo Kaaris. Der Lebemann. Noch schlimmer war sein Bruder gewesen. Ihn hatten sie das Monster genannt, weil er keine Frau gefunden hatte und Nutten in Bordeaux halb totschlug. Das war Philippe Kaaris gewesen. Ein Cousin väterlicherseits paktierte mit den Nazis und versorgte sie mit Informationen. Ihn hatten sie an einer Laterne aufgeknüpft. Dominique Kaaris. Und dann gab es da noch Beatrice und ihre Schwester Jeanne, die sie als Heiratsschwindlerinnen hochgenommen hatten, und nicht zuletzt den guten Octave, den es nach Lille zog, wo sie ihn auf offener Straße niederstachen, nachdem er sich in den Sechzigern auf gestohlene Luxuskarren aus Antwerpen spezialisiert hatte.
Schließlich ihre Großmutter Rosa. Sie fischte Kisten aus dem Meer, die über Bord gefallen waren. Angeblich hatte sie ein Vermögen damit gemacht. Es soll auch einige Mitglieder in ihrem Stammbaum gegeben haben, die einfach ihrer Arbeit nachgingen, Familien gründeten und starben. Nur an deren Namen erinnerte sich keiner.
Die kleine Kaaris nannten sie alle, was mit einem gewissen Respekt verbunden war. Wegen ihrer Großmutter in der Rue Lomenech. Auf siebenundfünfzig Quadratmetern mit Bad auf dem Flur, das sie sich anfangs mit einer Witwe aus Trégunc teilte, bis sie deren Wohnung anmietete und eine Wand durchbrechen ließ.
»Siehst scheiße aus«, sagte François, der Landschaftsbilder an Touristen verkaufte und sich zu ihr an den Tisch setzte. Mit einem der ekligen mit Käse belegten halben Baguettes samt Tomate und welkem Grünzeug, die in der Glasvitrine neben der Theke auf die Halbverhungerten warteten. Auch mit ihm war Mado zusammen zur Schule gegangen. Eine Zeit lang hatten sie sich gut verstanden, sich gegenseitig Daft Punk und Placebo vorgespielt. Dann waren seine Eltern verunglückt und der Vater noch an der Unfallstelle verstorben. Seine Mutter zog seitdem ein Bein hinterher. Von einem Tag auf den anderen war ihre Freundschaft zerbrochen, ohne dass er ihr je einen Grund dafür genannt hatte.
»Ich habe gehört«, missachtete er alle Anzeichen, dass sie in Ruhe gelassen werden wollte, »du bist wieder da.« Er rieb sich das linke Ohrläppchen, war vorzeitig gealtert und sah wie Mitte dreißig aus, was an dem schäbigen Anzug lag, der mindestens zwei Nummern zu groß war und einen Künstler aus ihm machen sollte.
»Ist wohl nicht so gut gelaufen in Paris«, sagte er und holte eine Packung Zigaretten heraus. »Sollen wir draußen eine rauchen?« Ein Feuerzeug steckte in der Packung. Ganz so wie bei ihrem Boxer.
Sie stierte es an, setzte die Tasse ab, legte den Löffel daneben und schaute in den Kaffeesatz. Eine mit ihrer Mutter befreundete Wahrsagerin hatte ihr als Kind beigebracht, daraus die Zukunft vorherzusagen. Nichts von dem, was Mado in den Jahren danach darin gesehen hatte, war jemals eingetreten.
Sie schob den Stuhl zurück, klopfte zweimal auf den Tisch und sagte »Salut«.
HAVANNA
Alle drei Tage achtzehn Minuten auf Bank vier sollten sie in eine Latina verwandeln. Die beste Freundin ihrer Mutter träumte davon, in Havanna zu leben. Sie lernte seit Jahren Spanisch. Für den Fall der Fälle, dass ein Kubaner ihr Sonnenstudio betreten und sie entführen würde. Einmal die Woche bot sie einen Salsa-Kurs an und verbesserte ihre Tanzschritte mittels Anleitungen auf YouTube. Ihr Haar trug sie stets hochgebunden und wickelte ein Tuch darum. Die Wimpern verlängert, die Fußnägel pink lackiert, die Ohren mit bunten, runden Plastikreifen beschwert. Marlène betrachtete sich als Wiedergeburt von Santanas Maria, seitdem sie den Song zum ersten Mal gehört hatte. She’s living the life just like a movie star. Nun ja, nicht ganz, aber fast.
Marlène betrachtete sich in einem Handspiegel, bevor sie sich zu Mado umdrehte. Alles saß perfekt. Auch das weiße Trägerhemd mit der Aufschrift Nicolas pour président mit einem gelben Gesicht darunter, das die Augen verdrehte. Aus einer Schachtel zog sie zwei feuchte Kosmetiktücher, die mit Disneyfiguren bedruckt waren, wischte sich die Hände ab und drückte Mado einen Weingummi aus dem Glas auf dem Empfangstresen in die Hand.
»Vergiss ihn«, sagte sie, rückte den Busen zurecht und erwartete offenbar, dass Mado ihr ein Kompliment machte.
Die offizielle Version, die Mado ihrer Mutter anvertraut hatte, lautete: Ihr Boxer hatte sie wegen einer anderen sitzen lassen. Eine Darstellung, die ihrer Mutter gefiel, ihr Weltbild untermauerte, ohne dass sie allzu viel Mitleid mit ihrer Tochter empfinden musste. Mado war selbst schuld. Was du hier wegwirfst, findest du da wieder, war alles, was Laure Kaaris dazu zu sagen hatte.
Wenn es stimmte, was Marlène über ihre Mutter erzählte, hatte sie immer versucht, ihr einen guten Mann zu suchen. Aber ihre Mutter sei zu wählerisch gewesen. Einmal im Monat fuhren sie gemeinsam nach Bordeaux, um sich neu einzukleiden. Dass die beiden sich nie wegen eines Mannes in die Haare bekommen hatten, sich höchstens mal einen teilten, verdankten sie ihrer Freundschaft von Kindheit an. Wahrscheinlich hätte Marlène auch nie eine Chance gegen den prallen Sex ihrer Mutter besessen, wenn sie es darauf angelegt hätte. Zum Glück stand Laure Kaaris nicht auf Latinos und Marlène nicht auf Zwerge. Sie mussten alle mindestens eins neunzig groß sein. Was die Auswahl sehr einschränkte.
Über einen knarrenden Lautsprecher schmachtete Ricky Martin sie an.
Wieso besaß sie nicht so eine beste Freundin, fragte Mado sich. Vielleicht wäre dann aus ihr keine Mörderin geworden. Sie konnte sich gut vorstellen, dass eine Freundin wie Marlène ihn sicher für sie erschlagen hätte.
Camille, mit der sie sich in den ersten Monaten eine Wohnung an der Bastille geteilt hatte, war ständig eifersüchtig gewesen, wenn sie nach einem Zug um die Häuser erst am nächsten Tag moralisch verkatert wieder auftauchte. Außer ihr gab es da die ehrgeizige Yasmina, die stocksteife Virginie und Marguerite, mit denen sie nicht mal in den Urlaub fuhr.
Mado schlug die Beine auf der Korbbank übereinander, die vor dem Schaufenster stand und über der Marlènes selbst gemalte Werbung Caribbean Hours die Kunden anlocken sollte. Sobald der Ventilator das Schild erfasste, baumelte es hin und her. Marlène tauchte die Füße in eine Schüssel mit lauwarmem Wasser, auf der grauer Schaum schwamm.
»War sowieso nicht der Richtige für dich«, sagte sie. »Viel zu alt. Such dir was Jüngeres. Die Jungen sind froh, wenn du sie rumkommandierst. Und sie halten nicht so lange durch. Das macht es einfacher.«
Eine Frau mit Pferdeschwanz trat aus der Kabine. Mit einigen Pfunden zu viel. Sie wünschte ihnen einen schönen Tag und warf den Kopf in den Nacken, als sie das Studio verließ. Marlène beugte sich zur Seite, um ihr nachzusehen, verkniff sich aber eine gehässige Bemerkung. Sie nahm Mado die Sprühflasche aus der Hand, um die Bank zu säubern. Verschämt drückte sie eine Hand vor den Mund, als sei sie bei etwas Unartigem erwischt worden. Ihre nackten Füße hinterließen Pfützen auf dem Boden.
»Ich könnte Hilfe brauchen«, rief sie aus der Kabine. »Ist eine Menge los. Wollen wir hoffen, dass dieses Scheißwetter da draußen noch eine Zeit lang anhält.«





























