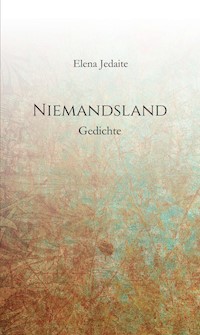2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Leidenschaft für Homöopathie prägt die Welt der angehenden Psychologin Amanda Fox und bestärkt sie in ihrer Entscheidung, nach der Heilpraktikerprüfung in die Praxis ihrer Mutter und des Familienfreundes Dr. Brigg, eines Psychiaters und Psychotherapeuten, einzusteigen. Doch es kommt alles ganz anders. Ihre wohlgeordnete Welt gerät an dem Tag aus den Fugen, als ihr Einstieg in die Heilpraxis durch die Entdeckung einer Leiche vereitelt wird. Die Praxis wird umgehend zum Tatort erklärt. Widerstrebend lässt sich Amanda von ihrem Bruder Mike dazu überreden, bei den verdeckten Ermittlungen mitzuwirken, denn die Spur des Mörders führt auf das rutschige Parkett der Modefirma "Pygmalion", wo Amanda vorübergehend im Büro aushilft. In dubiose Geschehnisse verwickelt, muss sie schließlich um ihr Leben bangen, doch tief im Inneren weiß sie, warum sie sich auf Mikes Vorschlag eingelassen hat: Sie will den Mann schützen, den sie liebt und den sie in Gefahr wähnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Elena Jedaite
Maestro sieht blau
Kriminalroman
Impressum
Neuauflage des Romans „PIGMALION BLUE“
© 2021 Elena Jedaite
Umschlag, Illustration:
https://whatagreathat.com/collections/blue-hats/products/womens-red-white-and-blue-fascinator-hat-with-flowers-and-blue-feathers, eingefärbt, Verlauf oben von A. Tschiedel
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
ISBN
978-3-347-26391-8 (Paperback)
978-3-347-26392-5 (Hardcover)
978-3-347-26393-2 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Im Zeichen von „Natrium muriaticum“
Ein Wiegenlied für eine Leiche
Unliebsame Enthüllungen
Was einem ein Fettnäpfchen beschert
Ungewollte Publicity und zwei Geschenke mit Ohren
Vom Fettnäpfchenhüpfer zur Undercoveragentin 00Pink
„Willkommen bei ‚Pygmalion’ “
Svens Domäne
Mein Plädoyer für die Menschenrechte
Das Geflüster
Ein blauer Schal zu viel
Vom Blaustrumpf zur Lady Blue
Maestro sieht blau
Ein Blick hinter den Spiegel
Ein ereignisvoller Sonntag
Die Rache der gestürzten Primadonna
Wozu eine Bratpfanne beim Babysitting gut sein kann
Sunnyboys Geisterstunde
Die Schachfigur namens Samantha
Joker packt aus
Amandas Traum
Epilog
Danksagung
Prolog
„Wieso hast du so große Augen?“ - „Damit ich euch besser sehen kann“, sagte Mike.
„Wieso hast du so große Ohren?“ - „Damit ich euch besser hören kann“, sagte Joker.
Die beiden gehörten zu den Guten, sie spielten nur den Wolf, weil der echte Wolf damit beschäftigt war, sein Revier zu markieren.
„Wieso trägst du diese blaue Kappe?“ - „Weil das Rotkäppchen in einem Saturnjahr Blau zu tragen hat“, sagte ich und sah in den Spiegel, den wir uns aus einem anderen Märchen ausgeliehen hatten, weil wir in unserem Märchen mehrere Spiegel brauchten, um alle anfallenden Spiegelbilder unterzubringen. All diese Spiegel zerspringen dauernd in tausende von Stücken und setzen streunende Spiegelbilder aus. Das ist ein Problem, weil uns der Hirte fehlt, der diese verlorenen Schäfchen zur Weide treibt. Dafür gibt es einen Schützen. Die schöne Königin aus dem anderen Märchen, die uns freundlicherweise ihren Spiegel zur Verfügung gestellt hat, ist gar nicht so böse wie in ihrem eigenen Märchen, deshalb darf sie bei uns mitmachen. Sie hat rein gar nichts mit dem vergifteten Apfel zu schaffen, sie muss nur dauernd in den Spiegel sehen, schön sein und die anderen an ihre Schönheit erinnern, wenn es mal jemand vergisst oder einfach übersieht. Das kann ab und zu vorkommen, wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Und genau das ist passiert: Ein Baum sah plötzlich ganz anders aus. So etwas endet nie gut, denn es kann einem sehr wehtun, wenn man einen Baum übersieht! Das soll uns aber nicht weiter beunruhigen, weil sich die Bäumchen in einem Märchen manchmal schütteln und rütteln müssen, um kleine und große Wunder zu bewirken. Und ein Adler flog über das Kuckucksnest! Er hatte einen kräftigen Flügelschlag, aber man konnte ihn nicht sehen, weil er sehr hoch flog. Der Kuckuck lässt sich auch nicht blicken, dafür kommt das Kuckucksei groß heraus. Es platzt sogar und wirbelt viel Staub auf. Und selbstverständlich gibt es einen Prinzen, den manche heiß lieben und jemand abgrundtief hasst. Der Prinz weiß aber nichts davon, weil er immer zum Himmel schauen muss, um den Leuten das Blau vom Himmel herunterzuzaubern. Es gibt jemanden, der dafür sorgt, dass der Prinz bei seiner schönen Beschäftigung nicht gestört wird. Dieses Märchen lebt von blauen Akzenten, deshalb muss der Prinz unentwegt dafür sorgen, dass genug Blau vorhanden ist und sich alle darüber freuen, aufregen und wundern können. Alle denken, es ist eine Fahrt ins Blaue, doch das stimmt nicht. Einer weiß ganz genau, wer hinter dem blauen Wunder steckt! Er weiß solche Dinge, weil er hören kann, was hinter den Mauern geflüstert wird. Er muss sich das Geflüster anhören, weil er auf die Guten aufzupassen hat und darum wissen muss, was die Bösen vorhaben. Aber er hört auch die Guten, die nichts zu verbergen haben. Deshalb sage ich: „Pssst! Man hört uns! Außerdem geht gleich der Vorhang hoch!“
Im Zeichen von „Natrium muriaticum“
Als ich an diesem wunderschönen Wintermorgen durch die verschneiten Straßen zu meinem ersten Arbeitsplatz in der Heilpraxis von Dr. Brigg und Fox schritt, fiel mir nichts anderes ein, als über den Wert der Freundlichkeit zu sinnieren. Vielleicht hatte ich tief in meinem Inneren geahnt, dass mein altbewährtes Motto „Lächle die Welt an und sie lächelt zurück“ einer harten Probe ausgesetzt sein würde. Die beiden Altprofis - meine Mutter, die Heilpraktikerin Dolores Fox, und ihr Partner, der Psychiater und Psychotherapeut Dr. Anthony Brigg - waren nicht in der Praxis, um mir an meinem ersten Tag beizustehen. Tony war in den Bergen zum Skifahren, meine Mutter brütete eine Grippe aus und musste wegen Ansteckungsgefahr ihren Patienten fernbleiben. Ich war also auf mich selbst gestellt. Seltsamerweise war ich gar nicht verunsichert. Ich sah dem Tag eher mit freudiger Erregung entgegen und war fest entschlossen, meinen Einsatz mit Bravour zu meistern.
Die Praxis war in einem schmucken, zitronengelb angestrichenen Häuschen untergebracht, das, von schneebedeckten Tannen umringt, ein nettes Bild bot. Es wirkte schon von weitem einladend und sogar fröhlich. Wie ein Küken in einem frischen, neugeborenen Weiß, dachte ich mir in einem Anflug von sentimentalem Stolz, als ich die Praxis durch den Schleier des Schneefalls anpeilte.
Es schneite auf Dächer, Brücken und Bäume, das blendende Weiß dieses herrlichen Morgens verlieh meinem Debüt die gebührende Feierlichkeit.
Meine Heilpraktikerprüfung lag schon exakt fünf Monate zurück, aber meine Passion für Homöopathie zählte zwei stolze Jahrzehnte, denn mit fünf Jahren soll ich mich das erste Mal dazu bekannt haben, indem ich einer schnupfenden Nachbarin meinen Grundsatz ans Herz legte: „Wenn es einem schlecht geht, hilft nur Homöopathie. Mandy Pat bringt dir ihr Natrium muriaticum“, verkündete ich, ohne mich beim Benennen meines Konstitutionsmittels zu verheddern. Ich sprach über mich damals noch in der dritten Person. Mandy Pat ist die Abkürzung von Amanda Patrizia. Zu diesem, zugegeben, geschwollenen Doppelvornamen kam ich wegen der äußerst seltenen Uneinigkeit meiner Eltern. Meine Mutter hatte mich Amanda genannt, noch bevor ich das Licht der Welt erblickt hatte. Sie wollte mich ungern mit einem anderen Rufnamen verwirren, als ich einmal da war. Zusammen mit meinem Zwillingsbruder Mike. Mein Vater wusste damals noch nicht, dass ihm zehn Jahre nach der Geburt der Zwillinge noch eine Tochter ins Haus kommen würde, die den stolzen Namen seiner Lieblingsgroßmutter hätte weiterführen können. So musste ich für die Familientradition väterlicherseits einstehen und bekam den Vornamen meiner Urgroßmutter beigefügt. Selbstverständlich bevorzugte ich, Mandy Pat genannt zu werden. Das klang schon einmal kein bisschen geschwollen, sondern eher ungewollt drollig.
Es gibt bekanntlich Augenblicke, die in die persönliche Geschichte eines Menschen als Trennlinie eingehen. Nachdem ein Augenblick dieser Qualität verstrichen ist, ist nichts mehr wie zuvor, denn dein Leben ist geteilt - in „jetzt“ und in „damals, bevor es geschah“. Man wäre besser dran, wenn sich solch ein fataler Augenblick ankündigen würde - durch einen Paukenschlag etwa -, aber nichts dergleichen geschah.
Es schneite im Zeichen des Segens, wie mir schien, als ich das Tor zur Praxis öffnete. Und da sah ich sie. Im Inneren des Hofes, rechts unter dem Fenster lag eine menschliche Gestalt mit gespreizten Beinen. Keine einzige Sekunde lang nahm ich an, es wäre jemand, der es nicht mehr geschafft hatte, in die Praxis zu gelangen, und an unserer Schwelle zusammengebrochen war. Ich wusste sofort, dass es sich um eine Leiche handelte. Nicht weil ich über eine gewisse Erfahrung diesbezüglich verfügt hätte. Nein, ich wusste es einfach. Sogar unter Schock registriert man unbewusst unzählige Dinge, die sich im Bruchteil eines Augenblicks zu einem Urteil zusammenfügen, das man bewusst gar nicht nachvollziehen kann. Im Nachhinein denke ich, es muss die unnatürliche Körperlage gewesen sein, die mich annehmen ließ, die Frau, die da lag, würde nicht mehr aufstehen. Vielleicht war es auch eine ganz banale Beobachtung, der eine ebenso schlichte Überlegung folgte, wie etwa: Die dicke Schneeschicht auf dem Körper lässt darauf schließen, dass die Person seit ein paar Stunden bewegungslos dagelegen hat; die Körpertemperatur war zu niedrig, um die Schneeflocken zum Schmelzen zu bringen; der Körper lag da und ließ sich von einer weißen Masse einhüllen.
Die allererste Version, die ich mir bei diesem unglaublichen Anblick zusammengereimt hatte, war die kindisch anmutende Annahme, es sei schlicht und einfach ein Trugbild. Ich blinzelte intensiv, um den Spuk zu verscheuchen. Für jemanden, der sich eingehend mit Homöopathie befasst, ist die Überlegung, jemand oder man selbst könnte einer Sinnestäuschung verfallen sein, keinesfalls abwegig. Auf jeden Fall schien mir die Möglichkeit, bei offenen Augen zu träumen, realistischer zu sein als das reale Vorhandensein einer Leiche, dort, wo sie ganz und gar nicht hingehörte. Doch das verzweifelte Blinzeln vermochte die „visuelle Sinnestäuschung“ nicht zu verscheuchen, mir blieb nichts anderes übrig, als das unheimliche Bild als reale Gegebenheit zu akzeptieren.
Was tut man, wenn man in seinem Hof eine verschneite Leiche entdeckt?
Ich schätze, in dieser Situation wäre es angemessen, sich zu vergewissern, ob man es bei der vermeintlichen Leiche nicht mit jemandem zu tun hat, der trotz der bösen Vermutung doch noch unter den Lebenden weilt. Man sollte sich pflichtgemäß dazu überwinden, nach einem Puls zu forschen, oder zumindest den Mut aufbringen, demjenigen einen Spiegel unter die Nase zu halten.
Ich unterließ all diese sehr wohl angebrachten Aktionen und berief mich auf meine vermeintliche Heilpraktikerkompetenz, als ich meinen Fund mit zittriger Stimme als Leiche deklarierte. Der Kommissar, dem ich meine Meldung zukommen ließ und dessen Namen ich in meiner Aufregung nicht mitbekommen hatte, unterließ seinerseits lästige Fragen, die mich in Verlegenheit gebracht hätten, und wies mich an, nichts anzurühren, bis der Tatort gesichert war. Somit wurde das idyllische Bild mit einem zitronengelben Häuschen im ersten Schneefall zum Tatort erklärt. Ich bekam einen Schrecken, als mir einfiel, dass bereits in einer Viertelstunde die erste Patientin eintreffen sollte.
Alle Termine mussten schleunigst abgesagt werden! Dank der vorbildlichen Ordnung, die meine Mutter im beruflichen Umfeld sowie im privaten Leben pflegte, brauchte ich nicht lange nach den Telefonnummern ihrer Patienten zu suchen. Morgen würde sowieso jeder in der Stadt über „unsere Leiche“ Bescheid wissen, die Geschichte würde mit den Morgenblättern auf jedem Frühstückstisch landen, und die Leute würden uns nun „die Praxis mit einer Leiche unter dem Fenster“ nennen.
Ich schalt mich für den unwürdigen Anflug von Selbstmitleid und machte mich an die Arbeit. Es gelang mir zum Glück, die Patientin mit dem Neunuhrtermin auf ihrem Handy zu erreichen. Ich lud sie unter dem Vorwand aus, meine Mutter sei in der Nacht plötzlich an einer Grippe erkrankt und möchte jegliche Ansteckungsgefahr ausschließen, wobei sie mich angewiesen hätte, sie bei all ihren Patienten zu entschuldigen. Während die nette Dame, die schon die Hälfte ihres Weges zurückgelegt hatte, beflissen ihre Enttäuschung unterdrückte und meiner Mutter ihre Genesungswünsche ausrichten ließ, füllte sich der Hof mit betrieblichem Lärm.
Zwei Polizeiwagen und ein Krankenwagen standen vor dem Tor, Männer in Uniform beugten sich mit routiniertem Gesichtsausdruck über die Leiche. Mit Erstaunen registrierte ich die Erleichterung, die fast ruckartig meine Verkrampfung löste: Ich brauchte nicht mehr auf den ungebetenen Eindringling aufzupassen, ich war nicht mehr für die Leiche zuständig, die … fast hätte ich gesagt, mir anvertraut worden war. Sachkundig und mit gebündelter Energie nahmen die Profis die Sache in ihre Hand. Plötzlich war der entweihte Fleck unter meinem Fenster nicht mehr auf die ursprüngliche Weise unheimlich. Ich beobachtete fasziniert den gleichmütigen Gesichtsausdruck der im Hof hantierenden Polizisten, und meine Hände hörten auf zu zittern. Als ich den Hörer auflegte, war ich sogar imstande, den eintretenden Kommissar mit einem Lächeln zu empfangen.
Oberkommissar Kross schüttelte mir energisch die Hand, so wie man jemandem die Hand schüttelt, wenn man ihm etwas zu verdanken hat. Immerhin war ich es, die die Leiche gefunden hatte. Doch ich war eigentlich diejenige, die zu danken hatte, denn er war dabei, mir den unheimlichen Fund abzunehmen.
Es gab über meine Entdeckung nicht viel zu berichten, aber ich gab mich nicht einsilbig, denn ich war immer noch so aufgeregt, dass ich meine Überraschung und mein Grauen unbedingt loswerden musste. Erst als mir sein ungeduldiges Hüsteln aufgefallen war, hielt ich irritiert inne. Ihn interessierten offensichtlich viel mehr meine Personalien als meine aufgewühlten Emotionen.
„Kennen Sie das Opfer?“, fragte er betont kühl, vermutlich, um einem erneuten Redeschwall meinerseits vorzubeugen. Ich beteuerte, das Opfer noch nie gesehen zu haben. Beim Wort „Opfer“ rieselte es mir kalt über den Rücken, obwohl ich zu keinem Zeitpunkt angenommen hatte, es würde sich bei der Leiche um einen Fall mit natürlicher Todesursache handeln.
Als ich mit schlecht unterdrückter Enttäuschung berichtete, dass dieser Tag mein Debüt in der Praxis werden sollte, merkte ich, dass mich etwas an der Miene des Oberkommissars irritierte. Hatte ich da eben ein unterdrücktes Schmunzeln über sein Gesicht huschen sehen? Ich fragte mich, was diesen raschen Mienenwechsel bewirkt haben mochte, und fühlte im Nu, wie ich heftig errötete. Ich ärgerte mich so über meine mangelnde Selbstbeherrschung, dass ich die nächste Frage fast überhört hätte.
„Seit wann steht es fest, dass Sie Ihre Mutter heute in der Praxis vertreten sollen?“
„Seit vorgestern Abend. Ich hatte eigentlich noch keine Gelegenheit, mich eingehend mit den Patientenakten zu befassen. Mein Einsatz war ursprünglich für den nächsten Monat geplant. Es war mehr oder weniger eine Spontanentscheidung, mich sozusagen ins kalte Wasser springen zu lassen. Ich sollte für meine Mutter einspringen, weil …“
Der Inspektor schien ein etwas ungeduldiger Typ zu sein, denn er unterbrach meinen etwas defensiv klingenden Bericht und wollte gar nicht so genau wissen, wieso man mich ohne erforderliche Vorbereitung auf die Patienten losgeschickt hatte. So kam ich nicht dazu, ihm glaubwürdig zu versichern, dass es sonst nicht die Art meiner Mutter war, ihren Patienten Mangel an Kompetenz zuzumuten. Ich rasselte den verschluckten Text in meinem Kopf herunter und merkte erst später, dass der Oberkommissar auf etwas Bestimmtes hinauswollte.
„War es anzunehmen, dass Sie ab etwa sechs Uhr morgens in der Praxis anzutreffen sind?“ Ich schüttelte den Kopf: „Wir vergeben erst ab neun Uhr Termine. Keiner würde uns um sechs Uhr in der Praxis vermuten. Meine Mutter erledigt ihre Büroarbeit gewöhnlich nach der Sprechstunde. Abends. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass jemand von uns zu einer ungewöhnlichen Zeit in der Praxis auftaucht, um etwa eine Patientenakte zu holen, die man in der Praxis vergessen hat, obwohl man vorgehabt hatte, sie zu Hause durchzugehen. Das war zum Beispiel gestern am Spätabend der Fall. Meine Mutter hat es versäumt, die Akte der netten Dame einzustecken, die heute um Viertel nach neun einen Termin hatte. Sie wollte mich aber noch vor meinem Start in ihre Krankengeschichte einweihen.“ Wider Willen schlich sich erneut die wehmütige Note in meine Stimme und ich hüstelte, um sie zu kaschieren, dann fiel mir plötzlich ein, dass ich tatsächlich vorgehabt hatte, gegen sechs in der Praxis zu sein. Bei einem vollen Terminkalender waren zwischen den Patientenbesuchen keine Pausen vorgesehen. Es stand mir ein sehr anstrengender Tag bevor, deshalb hatte ich ursprünglich beabsichtigt, mich an meinem ersten Tag sehr früh an die Arbeit zu machen. Wer hatte meine Pläne durchkreuzt? Kaum zu glauben: Es war meine eigene Mutter. Sie hatte sich auf leisen Sohlen in mein Zimmer geschlichen und den Wecker umgestellt. Als ich zwei Stunden später als geplant in die Küche gehetzt kam, fand ich meine Mutter beim Kaffeekochen vor. Ich griff mir nur verzweifelt an den Kopf und dachte an die Dame, die um Viertel nach neun antreten sollte. Meine nicht realisierte Absicht, den Arbeitstag gegen sechs Uhr morgens zu beginnen, tat nichts zur Sache, deshalb beschloss ich, diese Information für mich zu behalten. Außerdem ging mein übermäßiger Eifer die Polizei kaum etwas an. Dies war eine familiäre Angelegenheit. Oder etwa nicht?
Ich unterließ es selbstverständlich auch, den Kommissar mit überflüssigen Details zu behelligen, doch etwas an seiner Fragestellung beunruhigte mich. Demjenigen, der die Leiche vor unsere Tür gelegt hatte, wäre es sofort aufgefallen, wenn in einem der Praxisräume Licht gebrannt hätte. Dann wäre er brav weitergefahren und hätte sich seiner Last woanders entledigt. Das Häuschen hatte aber in willkommener Dunkelheit geruht, und das Tor in den Hof war nicht abgeschlossen. Eine geeignete Zuflucht für verwaiste Leichen, dachte ich mir bitter. Es war grausam, das schmucke Häuschen, das seine Tür für kranke und genesende Menschen offen hielt, als Leichenablage zu missbrauchen! Wer auch immer das getan haben mochte, verdiente mit Recht meine tiefste Verachtung.
„Wer hat gewusst, dass Sie vorhatten, heute Ihre Mutter zu vertreten?“
Wieder so eine seltsame Frage! Hätte man es etwa unterlassen, die Leiche unter unserem Fenster zu platzieren, wenn meine Mutter hier gewesen wäre? Aus Ehrfurcht vor ihrer Person etwa?
„Ein paar Leute wussten bestimmt davon, weil es für mich ein besonderer Tag werden sollte.“
„Wer genau wusste davon?“ Ich zuckte erneut mit den Schultern. Der Oberkommissar runzelte die Stirn. Er mochte es offensichtlich ganz und gar nicht, wenn man seine Fragen nicht ernst nahm.
„Frau Fox, versuchen Sie sich daran zu erinnern, wem gegenüber Sie gestern erwähnt haben, dass Sie heute in der Praxis anzutreffen sind. Denken Sie einfach darüber nach, mit wem Sie gestern gesprochen haben, nachdem Ihre Mutter Sie um Vertretung gebeten hatte.“ Ich schwieg immer noch, weil mir partout nichts einfallen wollte.
„Ihnen dürfte die Ähnlichkeit Ihrer Person mit dem Opfer nicht entgangen sein …“, meinte er gedehnt und registrierte mit unverhohlener Genugtuung, dass es ihm endlich gelungen war, meine volle Aufmerksamkeit zu erlangen.
„Ich soll der Leiche ähnlich sein?!“, brachte ich entsetzt hervor und musste für einen Augenblick die Augen schließen.
„Frau Fox, die Leiche war vor etwa vier Stunden noch quicklebendig.“
„Ich…“ Ich war sprachlos.
„Tut mir leid, ich wollte Sie nicht dermaßen aufregen.“ Er hüstelte verlegen und meinte, man dürfe zu meinem eigenen Schutz den Verdacht nicht außer Acht lassen. Sollte der Anschlag mir gegolten haben, so sei es nicht ausgeschlossen, dass …
Dass der Mörder immer noch hinter mir her war?
Er nickte und meinte, ich solle mir Zeit lassen und mir in Ruhe überlegen, wer in meinem Bekanntenkreis ein Interesse daran haben könnte, mir ernsthaft zu schaden.
„Mir eine Leiche unterzuschieben?“, fragte ich verwundert.
„Nein, ich meine eher: Sie zu erdrosseln“, antwortete er und betonte dabei jede einzelne Silbe, um seiner Botschaft Nachdruck zu verleihen.
Ich schnappte nach Luft. Der Mann neigte eindeutig zu skurrilen Vorstellungen!
Hiermit war die Unterhaltung so gut wie beendet, der Oberkommissar verlangte nach der Telefonnummer meiner Mutter.
„Ich muss Ihre Mutter leider darum bitten, trotz der Erkältung aufs Revier zu kommen, damit wir ausschließen können, dass es sich bei dem Opfer um eine ihrer Patientinnen handelt“, meinte er.
Arme, ahnungslose Mama! Das konnte ich nicht zulassen! Ich musste ihn dazu überreden, diese Aufgabe mir zu überlassen.
„Lassen Sie mich meiner Mutter die böse Nachricht schonend beibringen. Sie ist Leichen nicht gewohnt, wissen Sie … Und sie ist eigentlich krank, obwohl sie das immer verharmlost. Ein Heilpraktiker hasst es, krank zu sein.“
Der Oberkommissar blickte zuerst, wie mir schien, etwas befremdet, dann erschien an seinen Mundwinkeln dieses kaum wahrnehmbare Zucken, das mich vorher schon gewaltig irritiert hatte. Er nickte, verabschiedete sich und verließ eilig den Raum. Sollte ich nun davon ausgehen, dass er mit meinem Vorschlag einverstanden war? Immerhin hatte er dazu genickt. Nach kurzer Überlegung kam ich zum Schluss, dass ich mich sehr wohl darauf verlassen konnte, dass ein Polizist nicht nur seine Worte, sondern auch seine nonverbalen Botschaften ernst nahm. Und ein Nicken hatte in unserem Kulturkreis eine sehr deutlich umrissene Bedeutung.
Endlich durfte ich den Tatort verlassen. Als ich wegging, hantierten die Leute von der Spurensicherung am Tor. Ich schielte beim Vorbeigehen auf den markierten Fleck unter dem Fenster und eilte davon.
Nicht heulen! Gegen jegliches Leid ist bekanntlich ein Kraut gewachsen. Mein aufgewühltes Gemüt verlangte nach Galgenhumor. Der Scherz schien nach seinem eigenen Gesetz zu leben - je grobstofflicher, desto heilsamer. Galgenhumor war eindeutig eine allopathische Erscheinung: Erst eine gehörige Menge davon entfaltete die notwendige Kraft, um gegen einen hoch dosierten Kummer anzugehen. Im Gegensatz zu dem homöopathischen Heilprinzip: je höher potenziert, desto weitgreifender. Meine Gedanken waren bitter wie ein kräftiger Beifußtee. Bitter und heilsam: „Nicht erschrecken, Mama! Ich komme etwas früher nach Hause, aber kein Grund zur Panik! Deine Patienten haben mich weder abgelehnt, noch verscheucht. Die Polizei hat mich vertrieben. Du weißt, wie die sind. Wenn die ihr Revier erweitern wollen, kennen die keine Scheu. Was passiert ist? Was soll schon passiert sein. Nein, kein Einbrecher hat sich an unserem Häuschen vergriffen. Es ist noch heil und wohlbehalten wie zuvor. Ich musste es abschließen, weil man unseren Hof zum Tatort erklärt hat. Wieso? Ja, weil man unter dem Fenster, hinter dem du gewöhnlich deine Patienten empfängst, eine Leiche gefunden hat. Ja, stell dir das vor! So ein Unding! Jemand hat sie irrtümlicherweise direkt bei uns abgelegt! Da atmet jemand nicht mehr, weil er angeblich erdrosselt wurde, und prompt landet die Leiche vor unserer Tür. Als ob wir alles zu heilen wüssten. Ja, du hast richtig gehört: Die Frau ist erdrosselt worden.“
Als ich unser Haus erreicht hatte, konnte ich wieder tief durchatmen. Ich schloss die Haustür auf, stand ein paar Augenblicke in der Diele und lauschte. Es war still im Haus. Serena war noch gewiss in der Schule, und Mama muss eingeschlafen sein. Nein, das war sie nicht, sie war nirgends zu finden. Nachdem ich das Haus nach ihr abgesucht hatte, setzte ich einen Kaffee auf und ließ mich in den Schaukelstuhl fallen. Und da, auf dem Couchtisch entdeckte ich ihren Zettel: „Schatz, ich weiß über alles Bescheid. Der Oberkommissar hat angerufen und mich gebeten, aufs Revier zu kommen. Es tut mir so leid für dich! Wir reden, wenn ich zurück bin. Mama.“
Ich wartete und mein Groll wuchs. Als ich kurz vor einem Wolkenbruch stand, hörte ich die Tür ins Schloss fallen. Sie atmete schwer, und ihr Gesicht war trotz der winterlichen Kälte verschwitzt. Sie umarmte mich mit einem kläglichen Lächeln und schüttelte den Kopf: „Nein, ich habe die Frau noch nie gesehen.“
Keine Patientin also. Niemand, den wir gekannt hatten. Niemand, mit dem wir etwas zu tun hatten. Mutter war offensichtlich froh, es hinter sich gebracht zu haben. „Erledigt!“, meinte sie, seufzte und goss sich einen Kaffee ein.
„Hat dich das Gesicht der toten Frau an jemanden erinnert, den du kennst?“ Meine Frage sollte beiläufig klingen, doch ich konnte es nicht verhindern, dass meine Stimme dabei verräterisch bebte.
Meine Mutter tätschelte mir beschwichtigend die Hand: „Ich weiß, was du meinst, Amanda. Ich halte das selbstverständlich für ausgeschlossen. Es kann keine Verwechslung gewesen sein. Wer könnte dir nach dem Leben trachten! Wir wissen beide, dass es nichts gibt, was es nicht geben kann. Aber der gute Oberkommissar kann das nicht wissen. Weil er dich nicht kennt.“
Meine Mutter war also ebenso felsenfest davon überzeugt, dass es für niemanden im ganzen Universum einen Grund gab, mich umzubringen. Punkt. „Die Polizei darf aber keine Möglichkeit außer Acht lassen und muss jedem Anhaltspunkt nachgehen.“
Gewiss, Mama.
Viel später, kurz vor Mitternacht kam mir noch ein Gedanke: Wollen wir wetten, dass der Kerl, der seine Leiche bei uns abgelegt hat, die Absicht verfolgte, den Oberkommissar auf die falsche Fährte zu locken? Allein die Kartei der ehemaligen und gegenwärtigen Patienten von Tony Brigg könnte die Polizei ein gutes Jahr beschäftigen. Oder … es war tatsächlich Tonys Patientin, und es war gar kein Zufall, sondern die Absicht des Mörders, dass die Leiche der armen Frau ausgerechnet vor der Tür ihres ehemaligen Psychotherapeuten gefunden wurde. Armer Tony!
Ich hatte das Licht schon abgeschaltet, als ich meine Mutter leise anklopfen hörte. Im blassen Schein meiner Nachtlampe sah ich sie mit einem Tablett vor mir stehen. Ein Glas Wasser und eine Tablette.
„Nein, Mama, bitte! Kein Natrium muriaticum“, bettelte ich. Ich wollte keinen „Airbag“ in meinem Hinterkopf. Ich wollte kein Polster zwischen mir und meinem Elend.
Ich war aber zu müde, um meinen Standpunkt plausibel darzulegen. Zu müde und etwas schläfrig. So sagte ich einfach: „Ich will kein Gnadenpolster. Ich will sie verarbeiten.“
„Was, mein Schatz?“, fragte meine Mutter.
„Die Leiche, Mama.“
Sie schüttelte traurig den Kopf, wünschte mir angenehme Träume und machte das Licht aus. Ich hörte sie leise die Tür zumachen. Stattdessen ging eine andere Tür auf …
Ein Wiegenlied für eine Leiche
Ich behielt Recht: Diese Nacht sollte mir keinen erholsamen Schlaf bescheren. Kaum war ich eingeschlummert, wurde ich an einen finsteren Ort verschleppt. Ich wusste doch, dass der Spuk nur untergetaucht war, um mir irgendwo in einer tristen Landschaft wieder zu begegnen.
Sven, der Mann, den ich heimlich liebte, seitdem ich aus meiner Wiege herausgekrabbelt war, stand mit benebelten Augen da und wiegte ein großes Etwas. Seine Aufmerksamkeit war nicht auf mich gerichtet, sondern auf die Person, der er auch noch hingebungsvoll eine gedehnte, wehmütige Melodie vorsang. Ich näherte mich dem Duo und hoffte, seine zart Umsorgte hässlich und abstoßend zu finden. Es war wieder mal ein weibliches Wesen, das er wie ein krankes Baby umhegte. Langes blondes Haar hing wie bei Rapunzel in feuchten Strähnen bis auf den Boden.
„Warum ist ihr Haar nass?“, fragte ich.
„Es ist gut so. Jetzt wird sie endlich warm, denn ihr Haar taut auf. Es war voller Schnee, sie musste im Schnee liegen. Die Arme.“ Na, bravo, dachte ich mir. Seine Anteilnahme galt wieder mal einer anderen.
„Wieso ließest du sie im Schnee liegen?“, erkundigte ich mich, obwohl es mir eigentlich recht war. Wenn er auf sie gut aufgepasst hätte, müsste er sie jetzt nicht wie einen verschneiten Pudel auftauen.
„Ich doch nicht! Es war jemand anders, der sie bei Wind und Schnee ausgesetzt hat. Deshalb singe ich jetzt für sie. Das wird sie hoffentlich trösten“
„Was singst du denn?“, wollte ich wissen. Ich entspannte mich und war sichtlich erleichtert. Sie gehört also nicht zu ihm. Er wärmt sie aus Nächstenliebe. Und sein Singsang ist nur ein harmloser Freundschaftsdienst.
„Ein Wiegenlied. Ich tu es für dich. Ich singe ein Wiegenlied für deine Leiche.“
Er drehte ihr bleiches Gesicht zu mir herüber, und ich erkannte sie.
„Nein!!!“, schrie ich. „Nein, es ist nicht meine Leiche.“
Ich muss lange und laut geschrien haben, denn als nächstes blinzelte ich in ein viel zu grelles Licht, in dessen Schein ich zu meiner Erleichterung das Gesicht meiner Mutter erblickte.
Meine Mutter hatte anscheinend schon eine Weile auf mich eingeredet, denn ich sah, wie ihre Lippen sich bewegten. Es war wie in einem Stummfilm. Es vergingen ein paar Sekunden, bis ich sie wieder hören konnte.
„Kindchen! Liebes!“, jammerte sie und hatte feuchte Augen. Endlich hatte auch mit mir jemand Mitgefühl! Es tat unendlich gut, ihre tröstende Stimme zu hören. Wenn ich nicht so ein großer Mensch wäre, hätte sie mich glatt hochgehoben, mich gewiegt und mir vorgesungen, so besorgt und aufgelöst wirkte sie.
„Du hast was Schlimmes geträumt. Geht's wieder?“
Ich nickte und versicherte ihr, dass ich vollkommen in Ordnung sei. Ein böser Traum, nichts weiter. Aber wie böse!
„Du hast so laut geschrien, da kam ich hergeeilt“, erklärte sie mir überflüssigerweise.
„Es tut mir so leid. Hoffentlich kannst du wieder einschlafen. Es war auch für dich ein schwerer Tag“, sagte ich entschuldigend.
„Es muss dir nicht leid tun. Du kannst doch nichts dafür. Aber mir tut es umso mehr leid.“ Was meinte sie wohl? Und warum blickte sie so schuldbewusst, so zerknirscht?
„Gestern Nacht, als ich noch in die Praxis zurückmusste, weil ich die Akte von der ‚Pulsatilla‘ vergessen hatte, bin ich gestolpert, gegen den Spiegel gestoßen und … Kurz und gut, der Spiegel fiel runter und ist zerbrochen. Ich ließ aber die Scherben im Bad liegen. Ich hatte vergessen, es zu erwähnen.“
„Das macht doch nichts, Mama. Ich kam nicht einmal dazu, sie zu entdecken. Du weißt ja, wie der Tag verlaufen ist. Wenn ich wieder da bin, kehre ich sie zusammen. Versprochen. Hauptsache, du hast dich nicht verletzt. Ein zerbrochener Spiegel ist jetzt wohl das kleinste Übel, nachdem das passiert ist …“
Ich schaute zur Uhr. Es war zwei Uhr morgens. Und die Mama verzehrte sich wegen ein paar Scherben. Ob sie wohl Fieber hatte? Sie schaute immer noch so mitgenommen aus. Und immer noch schuldbewusst.
„Gott sei Dank habe ich es unterlassen, die Scherben zusammenzukehren. Wenn ich es getan hätte, könnte ich es mir nie verzeihen.“
Oh doch, Mutter war eindeutig krank. Sie phantasierte, aber ihr Blick war klar …
„Du weißt doch, was Doris immer sagt? Wenn ein Spiegel zerbricht, soll man die Scherben sieben Stunden lang liegen lassen. Dann kommt man mit sieben Stunden Pech davon. Räumt man sie gleich weg, so hat man sieben Jahre Pech zu erdulden. Es war elf Uhr abends, als der Spiegel zerbrochen ist. Die Frau soll um sechs Uhr morgens umgebracht worden sein. Wohl doch etwas eher, denn um sechs Uhr morgens war die Pechfrist bereits abgelaufen, man muss sie kurz vor sechs in unserem Hof deponiert haben. Da war es noch dunkel genug, um eine Leiche unbemerkt umher zu schleppen. Wie auch immer, der Spuk ist vorbei. Seine Zeit ist um. Du wirst sehen, es wird sich alles aufklären.“
Mein Gott! Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Meine Mutter war nicht gerade dafür bekannt, eine abergläubische Person zu sein. Im Gegensatz zu Doris. Allys Mutter Doris war die Mystikerin in unserer Runde. Ally war übrigens die beste Freundin meiner Mutter, die beiden waren schon befreundet, bevor ich das Licht der Welt erblickt hatte. Außerdem war Ally Brigg die Ehefrau von Dr. Antony Brigg und die Mutter von Sven, den ich heimlich liebte. So klein und geschlossen war unsere Welt.
Mein Blick muss Bände gesprochen haben, denn sie hielt inne und meinte etwas beschämt: „Amanda, guck nicht so! Ich bin nicht verrückt. Und normalerweise bin ich gar nicht abergläubisch. Nur … ich frage mich: Wieso ist uns so etwas passiert? Vielleicht gibt es für solche Dinge keine Erklärung, und man sollte nicht dauernd nach einem Sinn suchen, wo keiner zu finden ist. Die arme Frau, die man vor unserem Häuschen gefunden hat, kann nichts dafür, dass man sie uns untergeschoben hat. Die hat es ja noch viel härter getroffen. Sie ist ja diejenige, die tot ist. Wir sollten aufhören, uns in dieser eigensüchtigen Weise selbst zu bemitleiden. Wir sind ja schließlich quicklebendig, nur ein wenig schockiert und mitgenommen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Wir müssen für die arme Frau hoffen, dass ihr Mörder gefasst wird und dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Warum sie ausgerechnet bei uns gelandet ist, sollte uns am wenigstens beschäftigen. Selbstverständlich bist du enttäuscht. Und erschreckt. Und du denkst gewiss, ein böses Omen hängt über deinem beruflichen Anfang. Aber so etwas darfst du nicht denken. Wenn jemand ein Pechvogel ist, dann bin ich es. Und ein Tollpatsch zugleich.“
Ich nickte und gab mir Mühe, ein halbwegs überzeugendes Lächeln zustande zu bringen. Sie seufzte und wünschte mir mit etwas zittriger Stimme angenehme Träume. Schlaf gut, Mama!
Ich brauchte dringend meinen Schlaf. Ruhigen, erholsamen Schlaf. Deshalb entschied ich mich doch noch für die verschmähte Tablette und schlief bis zum Morgen durch.
Unliebsame Enthüllungen
„Nein, Schatz, ich bin nicht aufgedreht. Ganz im Gegenteil, ich bin ein wenig schlapp. Du weißt, meine Erkältung. Ja, gewiss werde ich mich schonen. Die Praxis ist geschlossen, bis die Therapeutin wiederhergestellt ist. Die Termine habe ich abgesagt. Erst nächste Woche geht’s wieder weiter. Patrizia? Ja, Amanda geht’s soweit gut. Ich dich auch. Wir sehen uns ja bald. Nein, du brauchst nicht mehr anzurufen, das ist für dich bestimmt ziemlich umständlich. Bis übermorgen. Wir dich auch.“
Papa. Es hat sich nicht danach angehört, als hätte sie ihn in die Geschehnisse des gestrigen Tages eingeweiht. Mutter hasste es grundsätzlich, den Leuten per Telefon unangenehme Nachrichten zukommen zu lassen. Ich dagegen bevorzugte es, mich der direkten Einwirkung destruktiver Energien zu entziehen. Ich zog mich nicht aus purem Egoismus zurück. Es ging mir nicht darum, meine eigene Weste trocken zu halten, sondern ich war davon überzeugt, dass ich von meiner seelischen Struktur her ein „Ignatia-Fall“ war. Und eine Ignatia empfindet die Welt mit äußerster Intensität, deshalb kommt sie gefühlsmäßig kaum aus der emotionalen Achterbahn heraus. In der Emotionsküche von Ignatia ist das Schüren strikt verboten. Was hatte ich mir wohl gestern vor der Ankunft der Polizei hastig auf die Zunge geträufelt? Richtig, Ignatia.
Vater würde also erst übermorgen alles erfahren. „Ich kann ihm doch nicht die letzten Urlaubstage in den Bergen vermiesen. Er hat sich so darauf gefreut. Und er braucht die Entspannung und die Bergluft, nachdem er die letzten Monate so hart gearbeitet hat.“
Mutter war noch ganz aufgeregt. Lügen, sogar Notlügen erfordern einen immensen Kraftaufwand, behauptete sie.
„Tony hätte ich es sogar sagen müssen. Es ist sein gutes Recht, über die letzten Ereignisse informiert zu werden. Schließlich ist es ja auch seine Praxis, die von dem Unglück heimgesucht wurde. Wie sollte ich das aber anstellen? Er stand direkt neben Papa.“
Ich gab ihr Recht. Was sollte es nützen, die beiden unnötig aufzuregen und ihnen den wohlverdienten Urlaub zu verpfuschen. Höchstwahrscheinlich würden sie aus Solidarität mit uns einen Tag früher aufbrechen.
„Er klang so entspannt. So munter. Ich konnte es einfach nicht“, rechtfertigte sie sich kleinlaut.
„Ist ja schon gut, Mama, du hast das Richtige getan.“
„Bist du sicher?“
Ich nickte eifrig.
Am meisten tat es mir aber weh, dass auch mein Bruder Mike zu denjenigen gehörte, die damit verschont werden sollten. „Bitte, Amanda, halte dich zurück! Der Junge bereitet sich auf sein erstes Plädoyer vor. Er wird es früh genug erfahren. Am Montag nach der Verhandlung werden wir ihm alles erzählen. Versprichst du mir, dass du deinen Bruder bis dahin aus der Geschichte heraushältst?“, flehte sie mich an und ließ mich dreimal dazu nicken.
Vater und Tony waren also nicht zu behelligen, Mike war nicht zu stören. Wer blieb da noch vom männlichen Kraftpotenzial übrig? Ich dachte sehnsüchtig an Svens Schulter, an die ich mich am liebsten angelehnt hätte. Ich fragte mich nur, ob diese Schulter am Samstagnachmittag für mein Trost suchendes Haupt noch frei war. Ich galt als Svens „kleine Schwester“ und durfte ihn ohne weiteres fast zu jeder beliebigen Zeit anrufen. Notfalls durfte ich ihn sogar aus den Federn holen.
Da ich mit mir sonst nichts Vernünftiges anfangen konnte, beschloss ich, zur Praxis zu fahren, um die Post abzuholen. Wenn es mir endlich gelingen sollte, Sven an die Strippe zu kriegen, würde er meinen Bericht bestimmt live hören wollen. Schließlich war ich die Person, die höchstpersönlich eine Leiche gefunden und sie der Staatsgewalt ausgeliefert hatte. Wenn Sven je eine Leiche entdeckt hätte, wüsste ich das bestimmt.
Ich wählte seine Festnetznummer und gleich darauf die Nummer seines Handys. Nichts. Ich hasste es, unangemeldet bei jemandem aufzutauchen, aber er ließ mir keine andere Wahl. Es war legitim, ihn ohne Vorwarnung aufzusuchen, lautete unsere Regel. Er war es schließlich, der mich als Baby gewickelt hatte, wenn mal keiner in Sicht war. Soweit ich meine Mutter kannte, dürfte sich eine derartige Situation nicht allzu oft zugetragen haben, was Sven jedoch nicht daran hinderte, diese Tatsache bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu erwähnen. Ich dagegen fand es unfair, wenn nicht gar ungeheuerlich, dass man diese unwürdige Aktion an meinem Körper überhaupt zugelassen hatte. Meine weitsichtige und oberschlaue Mutter hätte schon damals voraussehen müssen, dass die Erinnerung an meine vollen Windeln mich mein Lebensglück kosten würde. Man könnte fast meinen, Sven prahlte mit der für mich peinlichen Erfahrung, um mir durch die Blume eine bestimmte Botschaft zu vermitteln.
Ich hatte mein Leben lang Svens Kunst bewundert und war immer noch davon überzeugt, dass er es weit gebracht hätte, wenn er die Malerei nicht zur Freizeitbeschäftigung reduziert hätte. Obwohl Sven immer noch mit der ursprünglichen Leidenschaft malte, tat er das zu meinem Leidwesen nur noch in der „Auszeit“, in den wenigen Pausen, die er ab und zu einlegen musste, um sich für seine Hauptbeschäftigung aufzubauen: Modedesign. In dieser Branche hatte er es tatsächlich weit gebracht, denn er war der Chefdesigner bei einer renommierten Modefirma namens „Pygmalion“.
Ich hatte noch nie zuvor von dem mir eingeräumten Recht, Sven unangemeldet zu überfallen, Gebrauch gemacht. So beschloss ich, dass es höchste Zeit war, meine Rechte in Anspruch zu nehmen.
Sven hatte vor etwa vier Jahren eine großzügige Vierzimmerwohnung in einem Neubau gemietet, der neben den modernen Vorzügen den betuchten Mietern das Flair hoher Räume bot, was kaum noch in sonstigen neuartigen Bauten anzutreffen war. Mit den riesigen Fenstern, dem eleganten Bad in Königsblau und Gold und der übermäßig raffinierten Kücheneinrichtung stellte die Wohnung alles in den Schatten, was ich bisher schick gefunden hatte. Der weiß getünchte Kamin in dem über vierzig Quadratmeter großen Wohnzimmer vollendete das Bild erlesener Gediegenheit, das Sven mit künstlerischem Geschick entstehen ließ, indem er distinguierte Qualität und puristische Formen durch extravagante Akzente aufgelockert hatte. Das für Gemütlichkeit und Flair zuständige Dekor, wie exotische Pflanzen aus Stahl und Glas, hatte Sven nahtlos in das Kunstwerk hineinwachsen lassen. So war ein Ort von erlesener Schönheit entstanden - Svens Oase. Seltsamerweise fühlte man sich auf Svens Insel nicht fremd. Man konnte sich auf Anhieb mit der Herrlichkeit der Umgebung anfreunden.
Als ich Svens Haus erreichte, ging die Haustür auf und eine elegant gekleidete Dame erschien an der Schwelle. Sie schien mich erkannt zu haben und winkte mich mit einer einladenden Geste ins Haus. De Haustür ging fast geräuschlos hinter mir zu. Nun stand ich da, im Inneren eines nach Wohlstand und Erfolg duftenden Hauses, und starrte auf den grünen Leuchtknopf am Fahrstuhl. Ich entschied mich fürs Treppensteigen, denn mein beträchtlich beschleunigter Puls verlangte nach Ausgleich. Ich kannte diesen Vorgang allzu gut: Jedes Mal, wenn ich mich in Svens unmittelbare Nähe begab, begann mein dummes Herz zu flattern und brachte meinen gesamten Kreislauf durcheinander.
Als ich mich Stufe für Stufe Svens Domizil näherte, fühle ich mit jedem Atemzug, wie sich die Luft um mich herum lichtete, während ich die typischen Symptome einer ganz speziellen Höhenkrankheit entwickelte: Atemnot, Schwindel und Ohrensausen - genau die gleichen Symptome, die so manchem beim Besteigen hoher Berge zu schaffen machen. Die Höhenluft, die diesen Mann umgab, unterlag zwar keinem Naturgesetz, doch weder Schutzgebet noch Yoga kamen dagegen an. Seine Nähe war für mein Nervenkostüm eindeutig pures Gift!
Oben angelangt, atmete ich, soweit es ging, tief durch und klingelte. Es rührte sich nichts hinter der verschlossenen Tür. Ich drückte wiederholt auf den Knopf. Erst als mein ungeduldiges Klingeln jenseits der Tür ertönte, schämte ich mich plötzlich für meinen Überfall. Ich wusste nämlich, dass er zu Hause war, obwohl diese Eingebung durch nichts zu belegen war.
Ich wünschte, die Vernunft hätte gesiegt, und ich wäre umgekehrt. Doch ich blieb stur vor der verschlossenen Tür stehen und wartete, bis ich Svens Schritte vernahm und das Guckloch sich für einen Bruchteil der Sekunde verdunkelte. Als die Tür dann schwungvoll aufging und Sven mich mit gewohnter Liebenswürdigkeit begrüßte, verspürte ich einen kleinen Stich in der Magengrube. Etwas stimmte nicht. Ich sah in Svens strahlendes Gesicht, sein Lächeln war breit und aufrichtig, und seine Freude, mich zu sehen, gab keinen Anlass zum Zweifel. Ich hatte übrigens noch nie seine Zuneigung infrage gestellt oder die Echtheit seiner Freundlichkeit angezweifelt. Svens Sympathie für die kleine Mandy (bei Begrüßung) und Pat (beim Abschied) war solide und rustikal, wie der grün angestrichene Vitrinenschrank im Esszimmer seiner Mutter Ally.
Ich wurde hereingebeten und ins Wohnzimmer geführt. Es vergingen keine drei Sekunden, bis ich den Grund meines Unbehagens ermittelt hatte. In der mit Ylang-Ylang, Nelke und Sandelholzaroma getränkten Luft schwebte eine unbekannte Duftnote mit. Parfüm! Oh! Das konnte nur eins heißen: Die Frau, die dieses Parfüm verströmte, befand sich immer noch in der Wohnung, und ich musste damit rechnen, dass sie demnächst ins Wohnzimmer spazierte, wo auch immer sie sich in diesem Augenblick aufhielt.
„Es tut mir leid, Sven. Ich wollte unbedingt mit dir reden, aber dein Handy war ausgeschaltet, und ich …“ In einer Minute hatte ich mich heiser geredet.
Er drückte mich lachend in den Sessel. „Mandy, wag es ja nicht, dich zu rechtfertigen. Sonst bin ich noch beleidigt. Es tut richtig weh, wenn du mir unterstellst, ich könnte zu irgendwelchem Zeitpunkt meines Lebens nicht darüber erfreut sein, dein niedliches Gesicht zu sehen.“ Genau, niedlich. Die niedliche Mandy zum Hallosagen, die niedliche Pat zum brüderlichen Abschiedskuss, die niedliche Amanda für den feierlichen Anlass und die niedliche Patrizia für die Notwendigkeit gut gemeinter Belehrungen. Ich war die Schwester, die ihm seine Eltern zu schenken versäumt hatten. Der Bedarf an sonstiger weiblicher Zuwendung war sicher anderweitig gedeckt, und es bestand nicht der geringste Mangel an aufregender weiblicher Gesellschaft. Das konnte man ja riechen, dachte ich bitter und schnupperte an der leicht angeheizten Luft, in der außer dem verräterischen Parfum noch ein paar andere, schwer zu deutende Partikel mitschwangen. Auch ohne einschlägige Erfahrung tippte ich auf den Duft bereits ausgekosteter Leidenschaft. Kaum hatte ich den indiskreten Gedanken zu Ende gebracht, schon fühlte ich die verräterische Hitze in meine Wangen schießen, denn er zwinkerte mir verschmitzt zu: „Das, was du aus meiner Duftwolke gerade herausgeschnuppert hast, hört auf den Namen ‚Jadore’. Es braucht dir überhaupt nicht peinlich zu sein. Keine Duftnote kann das Vergnügen, dich zu sehen, überbieten. Sie kommt gleich heraus und wird erfreut sein, deine Bekanntschaft zu machen.“
Ich dagegen verspürte nicht den leisesten Wunsch, ihre Bekanntschaft zu machen, doch ich nickte brav und rang mir ein unverbindliches Lächeln ab. Ich wusste, was sich gehörte: Als kleine Schwester musste man freundliches Interesse an der aktuellen Leidenschaft des großen Bruders bekunden, und das tat ich nun notgedrungen.
Ach, dachte ich mir, euer aller Parfüm wird längst vom Winde verweht sein, während mein von Ylang-Ylang umwehtes schwesterliches Gesicht aus diesem herrlichen Raum nicht wegzudenken war, da es dafür prädestiniert war, eine winzige und trotzdem äußerst wichtige Lücke in Svens Leben auszufüllen. Alles um Sven herum trachtete nach Vollendung. „Meine Welt wäre ohne dein Gesicht um eine Dimension ärmer“, meinte er einst und kniff mich brüderlich in die Wange, um die pathetische Note seiner Aussage zu verniedlichen. Es war nur zu schade, dass er das Ausmaß dieser Dimension nicht einmal erahnte und demzufolge ihre Vorzüge weder einschätzen noch in Anspruch nehmen konnte. Ich seufzte. Er forschte in meinem Gesicht nach dem Grund des Seufzers, kam aber nicht mehr dazu, mich danach zu fragen, denn etwas hinter meinem Rücken lenkte ihn von mir und meinem Seufzer ab. Ich roch die sich nähernde „Jadore-Wolke“, bevor ich, seinem Blick folgend, die schwarzhaarige Frau sah, die im Walzerrhythmus auf uns zuschwebte. Sie trug einen Morgenmantel aus edler rosa Seide und ließ ihn mit jeder Drehung in fließenden Wellen um ihren Körper schwingen. Ihr langes pechschwarzes Haar wirbelte und schimmerte, als würde es mit dem noblen Glanz der Seide wetteifern, sodass der Eindruck entstand, dies hier sei ein Werbespot für ein Shampoo. Erst bei der fünften Drehung begriff ich, was die Frau mit ihrer Vorstellung bezweckte. Ich war in eine exklusive „Modenschau“ hereingeplatzt und musste mir nun ansehen, wie die schillernde Erscheinung nach der siebten Drehung direkt in Svens Schoß landete und ihm einen luftigen Kuss auf die Lippen hauchte. Er hob sie entschieden, aber sanft hoch und stellte sie mir als Samantha vor. „Und das ist Amanda, meine …“ Sie unterbrach ihn strahlend: „Ich weiß, deine kleine Schwester.“ Jetzt würdigte sie mich eines Blickes, der mit Sicherheit für die Familienmitglieder des Verlobten reserviert war und ein gewisses pragmatisch bedingtes Interesse beinhaltete: Schließlich musste man sein künftiges Inventar begutachten, um vorausplanen zu können. Wenn Sven also im Besitz einer „kleinen Schwester“ war, so war es für Samantha vorauszusehen, dass irgendwann die Notwendigkeit bestand, mich in ihrem Haushalt angemessen unterzubringen. Oder irrte ich mich da etwa? Ihr Blick war für ein schlichtes Inventurverfahren etwas zu intensiv. Und zu forschend. Da blinkten doch so winzige Fragezeichen mit. Oder gar Ausrufezeichen? Stimmt das auch so?! Bist du tatsächlich die kleine Mandy oder die harmlose Pat, oder ist es nur eine gekonnte Tarnung, und du bist wie alle anderen auf den unwiderstehlichen Maestro scharf und wartest nur auf die passende Gelegenheit, um deinen Anspruch geltend zu machen?
Ich gab mir einen Ruck und richtete ein paar freundliche Worte an Samantha: „Hi, freut mich. Ein herrlicher Morgenmantel. Ein Geschenk?“ Mein Entgegenkommen bewirkte bei Samantha einen sichtbaren Stimmungswechsel.
„Willst du den Stoff fühlen? Sven hat den besten Geschmack in …“ Sie schien zu überlegen, welches Preisschildchen am besten geeignet war, Svens einzigartigem Geschmack gerecht zu werden. War er nun der beste in der Welt oder gar im ganzen Universum? Sie entschied sich für das schlichte „weit und breit“ und brachte ihren Satz mit einem zufriedenen Seufzer zu Ende. Oje, eigentlich stand es mir gar nicht zu, mich über die Überschwänglichkeit anderer Frauen zu mokieren, wenn es dabei um Sven und seine Talente ging. Wie gesagt, ich selbst hielt ihn schlicht und einfach für ein Genie.
Ich betastete anerkennend den mir hingehaltenen rosa Seidenzipfel. Er fühlte sich an, wie er aussah: eine sanfte Liebkosung, die dazu gedacht war, die Haut der Geliebten zu umschmeicheln, um sie auf die streichelnde Hand des Spenders einzustimmen. Ich konnte mir lebhaft vorstellen, was sich kurz vor meiner Ankunft abgespielt und Sven davon abgehalten hatte, zur Tür zu eilen, als ich an der Schwelle des Paradieses Sturm geklingelt hatte. Ich lächelte tapfer weiter und lobte die Farbe, die Beschaffenheit des Stoffes und die Geschmeidigkeit der Seide insgesamt. Ich hätte noch lange nicht damit aufgehört, wenn Sven meinem Redeschwall kein Ende bereitet hätte. Ihm war meine Verlegenheit keinesfalls entgangen, aber er tippte anscheinend auf allgemeine Scheu vor erotischen Manifestationen oder nur vor einer Andeutung, die auf derartige Dinge hinauslief. Er hielt mich nämlich für etwas prüde und hatte wahrscheinlich Recht damit.
„Ist ja schon gut, Mandy. Jetzt hast du meinem berüchtigten Geschmack genug Lob gespendet und darfst nun meinen Wein würdigen.“ Ich lehnte dankend ab und erklärte, ich müsse einen klaren Kopf bewahren, da ich heute noch einiges aufzuarbeiten hätte.
„Verstehe. Du gehst mit dem dir eigenen Eifer an die Sache ran. Sehr lobenswert, ich bin stolz auf dich! Wie war denn dein erster Tag? War bestimmt aufregend.“
Und ob! Aber mir war mittlerweile die Lust vergangen, ihm zu verraten, wie aufregend es tatsächlich war. Noch weniger Lust verspürte ich dazu, Svens Besuch mit meiner abenteuerlichen Geschichte über eine verschneite Leiche und einen mürrischen Polizisten zu unterhalten, weil ich im Voraus wusste, dass ich kaum die Geduld dazu aufbringen würde, zwischendurch mehrere ausgedehnte Pausen einzulegen, damit die Dame in Rosa ihre „Oh-wieschrecklich-Rufe“ loswerden konnte. Meiner Einschätzung nach gehörte Samantha zu den Frauen, die sich sogar auf Kosten einer Leiche bestens zu profilieren wussten. Je aufregender eine Geschichte war, desto mehr Spielraum bot sie für spitze, affektierte Schreie, die angeblich überwältigende Bestürzung und Entsetzen preisgaben, in Wirklichkeit aber keinem anderen Zweck dienten als den egomanischen Drang der „überwältigten“ Dame zu bedienen. Ich wollte gar nicht so genau wissen, ob ich mit meiner Profildiagnose richtig lag, denn es war nicht auszuschließen, dass ich aus sehr persönlichen Gründen außerstande war, Svens Geliebte gerecht zu beurteilen. Wenn meine Voreingenommenheit tatsächlich mein Urteilsvermögen getrübt haben sollte, so konnte ich vorübergehend nicht auf meinen Instinkt vertrauen und es war müßig, mich zur Objektivität zu ermahnen. Mit diesem Zugeständnis glaubte ich der Fairness im angemessenen Ausmaß gehuldigt zu haben und schob die Suche nach der versteckten Wahrheit auf einen späteren Zeitpunkt auf. Im Moment hatte ich andere Sorgen als mein eigenes Gewissen zu erforschen und Samanthas Charakterfassetten unter die Lupe zu nehmen. Ich suchte nach einem Vorwand, um mich von dem Gastgeber zu verabschieden und rutschte unbehaglich auf dem Stuhl hin und her. Sven betrachtete mich mit einem unergründlichen Gesichtsausdruck und wiederholte seine Frage: „Na, sag schon, wie war dein Tag? Hattest du Erfolg mit deinem Debüt?“
„Es ist, sagen wir mal, nicht ganz nach Plan gelaufen. Ich will euch aber mit Details verschonen. Wir werden noch später Gelegenheit haben, darüber zu plaudern. Ich muss jetzt weiter. Wollte nur sehen, wie es dir geht. Und jetzt habe ich es gesehen: Dir geht es gut.“ Ich hielt ein breites Lächeln aufrecht, doch es drohte jeden Augenblick zu verrutschen. Ich stand eilig und geschäftig auf, wie man halt aufstand, wenn man dem Gastgeber signalisieren wollte, dass man es ernst damit meinte und er sich die Mühe sparen durfte, einen aufzuhalten.
Sven stand ebenfalls auf und schaute etwas irritiert von mir zu Samantha. Der Schatten, der nun sein Gesicht umwölkte, hätte glatt als ein Zeichen aufrichtiger Enttäuschung durchkommen können. War er wirklich darüber enttäuscht, dass ich schon gehen wollte? Ich bildete mir sogar ein, er hätte ein paar Augenblicke gegen die Versuchung angekämpft, Samantha statt meiner hinauszubegleiten: Der Blick, mit dem er seine Geliebte bedacht hatte, war für meine Begriffe eine Spur zu kühl. Das war aber ganz und gar unmöglich, denn es war Samantha, die bei diesem seltsam anmutenden Blickwechsel erleichtert aufatmete. Ihr wollte es offensichtlich nicht gelingen, die Freude über meine Eile zu verbergen. Zum Abschied schenkte sie mir ihr erstes aufrichtiges Lächeln.
Erst draußen konnte ich wieder tief durchatmen. Ich war weg aus seiner Sichtweite, und das war gut so. Svens Fenster gingen auf den Park hinaus. Wenn er jetzt zufällig am Fenster stand, so schaute er in eine andere Richtung, genoss einen schönen Ausblick voller Raum und Licht, und sein Blick wanderte über die Gipfel verschneiter Tannen, dachte ich sehnsüchtig. Je mehr ich mich von seinem Haus entfernte, desto wehmütiger wurde ich, desto einsamer und trostbedürftiger.
Als ich in die Straße einbog, die zur Praxis führte, gelang es mir nur mit Mühe und Not, die aufgestauten Tränen zurückzuhalten.
Wer blieb als Projektionsfläche für meinen Groll übrig? Etwa Sven? Der Mann, der in seinen eigenen Wänden dem legitimen Wunsch nachging, die Frau seiner Wahl in eine rosa Wolke zu wickeln, und nicht einmal ahnte, dass eine andere, wohlgemerkt, erwachsene Frau den Tag herbeisehnte, an dem ihre fatale Wickel-Geschichte ein für allemal im Archiv landete? Wohl kaum. Ich meinte, ich hatte ihm kaum etwas vorzuwerfen, wenn ich Wert darauf legte, ihm gegenüber Gerechtigkeit walten zu lassen. Und das tat ich ganz gewiss. Mir blieb also nichts anderes übrig als traurig zu sein, ohne jemanden dafür verantwortlich zu machen.
Dies war der Stand der Dinge, als ich endlich die Praxis erreicht hatte. Die nächste Wendung meiner Geschichte ließe sich meines Erachtens am besten dadurch erklären, dass ich zu diesem Zeitpunkt immer noch einen starken Wunsch verspürte, mich jemandem mitzuteilen. Es sollte jemand sein, der mir aufrichtiges Interesse entgegenbrachte und mir mit Nachdruck versicherte: Mandy Pat, ich bin ganz Ohr!
Mein Wunsch ging noch am selben Abend in Erfüllung, denn am Tor der Praxis traf ich auf jemanden, der, wie es sich später herausstellen sollte, über ein sehr empfängliches Ohr verfügte und es gerade bei meiner Ankunft aus einer karierten Mütze herausholte. „Ist doch noch wärmer geworden“, sagte der Mann grinsend und steckte die Mütze in seine Aktentasche. Ich griff in den Briefkasten, während er neugierig meine Bewegungen beobachtete. Ein Schaulustiger, dachte ich mir. Jemand, der um den Ort des Geschehens herumschlenderte, weil er wusste, dass sich hier erst gestern ein Drama abgespielt hatte. Ich nickte ihm freundlich zu. Man konnte den Leuten ihre Sensationslust kaum übel nehmen, denn hier in der ruhigen Gegend geschah sonst kaum etwas Aufregendes.
„Sie arbeiten hier“, stellte er fest, als ich ein paar Reklameprospekte und etliche Briefe in meine Tasche schaufelte. Ich nickte wieder stumm und schickte mich an, kehrtzumachen.
„Dann wissen Sie bestimmt, was sich hier gestern abgespielt hat?“
Ich nickte jetzt bereits zum dritten Mal, denn es war mir, trotz allgemeiner Redelust, nicht nach Smalltalk zumute. Ich setzte ein Lächeln auf, doch ich wusste - dicht darunter lag ein matschnasses Jammertal. Ein Wort, und es wäre um meine Selbstbeherrschung geschehen. Der Fremde ließ aber nicht locker: „Einen Augenblick noch. Ich will Sie ja keinesfalls belästigen … Reiner Stauch, mein Name. Sind Sie die Heilpraktikerin? Frau Fox?“
Jetzt musste ich doch einen Laut von mir geben, denn alles andere wäre höchst unhöflich gewesen: „Ja und nein. Sie meinen wohl eher meine Mutter. Ihr und Doktor Brigg gehört die Praxis. Und ja, weil ich ebenso Fox heiße und dabei bin, bei den beiden einzusteigen.“
„Die Praxis ist für eine Woche geschlossen, steht hier. Heißt das, dass das Telefon nicht besetzt ist und keine Termine vergeben werden?“ War das etwa ein potenzieller Patient? Ich schaltete sofort auf zuvorkommend. „Sind Sie etwa an einem Termin interessiert?“, fragte ich freundlich.
Er zögerte einen winzigen Augenblick und nickte. „Ich hatte tatsächlich vor, Ihre Praxis aufzusuchen, weil sie mir von einem Bekannten empfohlen worden ist. Er meinte, mit Magengeschwüren wäre nicht zu spaßen. Sie wollen doch als Heilpraktikerin einsteigen?“
Ich nickte, damit er vor mir sein Magengeschwür ohne Scheu offen legen konnte. Vielleicht sollte man in einem akuten Fall eine Ausnahme machen und einen Notfalltermin vergeben, bevor der Mann sein Geschwür zur Konkurrenz trug? Man konnte schließlich ein Geschwür nicht mit Formalitäten hinhalten, wenn es vielleicht kurz vor dem Ausbruch stand.
„Waren Sie schon beim Arzt? Hat man Sie bereits untersucht und ein Magengeschwür festgestellt?“, forschte ich nach und trat von einem Fuß auf den anderen, denn ich bekam im Matsch, den ich mit meinen dünnen Sohlen stampfte, kalte Füße.
„Ich bitte tausendmal um Vergebung! Es ist hier gewiss nicht der richtige Ort, um mein Geschwür zu ‚sezieren’. Sie holen sich durch meine Unbesonnenheit noch eine Erkältung. Lassen Sie sich von mir zu einem Drink einladen. Gewiss nicht um meines Magengeschwürs willen, sondern zum Aufwärmen. Da gibt es einen Italiener gleich um die Ecke. Aber wem sage ich das? Sie kennen sich in der Gegend hier bestimmt besser aus. Wollen wir? Bitte.“
Sein Lächeln war nett, sein sommersprossiges Gesicht machte einen intelligenten und keineswegs gefährlichen Eindruck. Er hatte offensichtlich Humor, nur seine Art zu reden schien einer anderen Generation anzugehören. Wie er sich wegen seiner „Unbesonnenheit“ eben entschuldigt hatte, klang eher nach Papa. Dabei durfte er kaum zehn Jahre älter sein als ich. Ich hatte keine besondere Lust, mitzugehen, war aber auch nicht abgeneigt, meiner aufgerauten Kehle einen Wein zu gönnen. Ein wenig Ablenkung durfte mir gut tun, nachdem ich den von Sven angebotenen edlen Schluck verschmäht hatte. Sven! An ihn sollte ich im Augenblick am wenigsten denken, denn schon allein der Klang seines Namens beschwor beunruhigende Bilder herauf. Wenn man einen Wind in ein leeres Haus hineinließ … Fenster schließen, Riegel vorschieben, Schleusen hochziehen! Und sich von einem anderen Mann zu einem Drink einladen lassen. Was war schon dabei, sich zu einem Drink einladen zu lassen, vorausgesetzt, man tat es einem Magengeschwür zuliebe, um seinen „Träger“ für die Praxis zu werben? Den Termin würden wir dann gleich beim Italiener ausmachen. Mutter würde sich darum kümmern, denn Magengeschwüre waren für mich noch eine Nummer zu groß.
So kam es, dass ich mich von der Straße weg zu einem Drink verschleppen ließ, was sonst nicht meine Art war. Es gab nämlich auch für die prallsten Geschwüre einen Anrufbeantworter in der leeren Praxis. Notfalls war auch die Privatnummer meiner Mutter zu vergeben, nur galten diese Möglichkeiten bei der angebrochenen Dämmerung nicht mehr, weil es wieder anfing zu schneien. Und weil ich vielleicht doch eine Ablenkung nötig hatte.
Bei dem Italiener um die Ecke war ziemlich viel los. Wir fanden doch noch einen Tisch am Fenster, denn jemand war gerade dabei zu zahlen. Wir warteten nicht, bis der Tisch abgeräumt wurde, sondern ließen uns nieder, bevor uns das Paar, das gleich hinter uns eingetreten war, zuvorkam. Der Sieg im Wettstreit um den Tisch war ein mickriges Erfolgserlebnis, doch es war auch der einzige Erfolg, den ich heute zu verbuchen hatte, deshalb hellte er mir zu meiner eigenen Belustigung etwas die Stimmung auf. Mein Begleiter half mir aus dem Mantel und rückte mir den Stuhl zurecht. Der Mann war ein echter Kavalier. Ich bestellte mir einen halbtrockenen Rotwein. Halt, meinte er, zuerst kommt ein Kognak. Über so viel geschwürunfreundlichen Leichtsinn konnte ich als angehende Heilpraktikerin nicht hinwegsehen. Ich wollte ja kein Spielverderber sein, und das zu schonende Geschwür war auch noch nicht in unserer Behandlung, aber ich brachte es nicht über mich, schweigend zuzusehen, wie jemand vor meinen Augen seinen kranken Magen malträtierte, und hob mahnend den Finger. Mein Gegenüber lachte vergnügt, als fände er meine Mahnung unheimlich erheiternd.
„Das ist ja das Schönste an meinem Geschwür: Es lässt sich nicht aufspüren, um auf Ihre Frage von vorhin zurückzukommen. Ich ließ nach dem Ding fahnden, aber der gute Doktor konnte keine Spur davon entdecken. Obwohl ich genau weiß, dass mein Magen ein düsteres Geheimnis birgt, soll ich mich mit der obskuren Erklärung der Schulmedizin zufrieden geben, der Tumult in meinem Verdauungstrakt sei rein psychosomatisch bedingt. Dieses Etwas, das mich zu Ihrer Praxis getrieben hat, genießt also den Status eines Phantomgeschwürs. Und solange es sich so bedeckt hält und sich nicht identifizieren lässt, strafe ich es meinerseits mit Rücksichtslosigkeit. Ich lass mir doch nicht von einem Phantom den Genuss am Leben versauen. Ich ignoriere es und verleugne es, bis es zur Kooperation bereit ist und sich von Ihnen entdecken lässt.“
Darüber konnte ich nur staunen. Wie konnte man den Verdacht auf ein Geschwür so leichtfertig verdrängen? Und das nur, weil es einem gerade nach einem Kognak zumute war? Das war ganz gewiss ein Fall für meine Mutter, während die Verleugnungsmechanismen, besonders wenn sie so raffiniert verpackt waren wie dieses „Phantomgeschwür“, eindeutig in Tonys Bereich gehörten.
„Ich sehe, Sie sind eine sehr strenge Therapeutin. Da muss man sich noch gehörig austoben, bevor man sich in Ihre Hände begibt. Schauen Sie nicht so vorwurfsvoll! Ich mache zwar ungern Zugeständnisse, aber ich werde meine Gewohnheiten ganz gewiss ändern, wenn man mich von der Notwendigkeit dieses Opfers überzeugt. Ich lasse mich brav untersuchen, überzeugen und beugen. Ohne mich dagegen zu sträuben, weil sich das so schön reimt. Deshalb sollten Sie mich nicht voreilig als einen unzuverlässigen Menschen einstufen oder mich gar im Vorfeld als Patienten ablehnen. Das haben Sie doch nicht vor, oder?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Keine Sorge, wir kriegen den Bösewicht. Ich meine, das Phantomgeschwür. So wie Sie gerade geschaut haben, müssen Sie bestimmt an einen anderen Bösewicht gedacht haben. Es war sicher ein großer Schock für Sie alle, eine Leiche vor der Tür vorzufinden. Wer von Ihnen hat sie denn entdeckt?“
„Ich“, antwortete ich schlicht, ohne jegliche Dramatik. Die Welt, in der raue Winde auf ausgesetzte Leichen matschnassen Schnee fegten, war zweifellos immer noch vorhanden, doch wenn mir jemand glaubhaft versichert hätte, dieses Stück Wirklichkeit habe sich auf Nimmerwiedersehen auf einen anderen Planeten verzogen, hätte mich das kaum in Erstaunen versetzt. Die lustigen Lämpchen, die Bilder mit den sonnigen Landschaften an den altrosafarbenen Wänden, das gedämpfte Gelächter der Gäste und die italienisch angehauchten Stimmen der herumflitzenden Kellner waren dagegen real und gehörten zum Hier und Jetzt. Der Winter war auf eine wundersame Weise ausgesperrt. Draußen, hinter der Fensterscheibe schneite es auf Bäume, Häuser und die lautlos vorbeihuschenden Menschen. Es schneite, wie es in einer Glaskugel schneit, wenn man sie kräftig schüttelt. Es schneite zum Spaß und weil es so schön war zuzusehen, wie die Welt in Zuckerwatte verpackt wurde.
Ich lehnte mich genüsslich zurück, nippte an meinem Wein und packte unter dem Eindruck vorübergehender Gravitationsverschiebung mein ganzes Gedankengut aus: Fakten, Theorien, Vermutungen … Als das Leichen-Thema völlig ausgeschöpft war, verspürte ich den Drang, mein Gegenüber über die verborgenen Ecken und Kanten meiner heiß geliebten Homöopathie aufzuklären: „Es kursieren zwei irrtümliche Theorien in Bezug auf die Homöopathie. Erstens wird behauptet, ein homöopathisches Mittel kann angeblich gar nichts bewirken, weil der Wirkstoff so stark verdünnt wurde, dass das Heilmittel kaum noch ein Molekül davon enthält. Man denkt dabei insbesondere an die Hochpotenzen. Oder es heißt, Homöopathie könne unmöglich Schaden anrichten. Aus dem gleichen Grund. Beide Annahmen sind völlig falsch. Es ist die Schwingung, die in diesem Fall „das Kraut fett macht“. Und was die Ungefährlichkeit einer Fehldiagnose betrifft, da kann unsereiner ein Lied davon singen. Wenn Sie mal Pech haben und bei der Wahl des Mittels danebengreifen, so ist davon auszugehen, dass Ihr ‚falsch gewickelter’ Patient prompt ein paar neu erworbene Symptome zu beklagen hat. Infolge Ihrer Fehldiagnose! Angenommen, Sie haben sich als Laie an eine Selbstbehandlung herangewagt und Ihre Depression fälschlicherweise dem Mittel „Thuja“ zugeordnet, so haben sie bald keine Lust mehr, morgens aus dem Bett zu krabbeln. Das heißt, Sie werden sich in diesem speziellen Fall genau die Symptome einhandeln, die das „Thuja-Bild“ ausmachen. Ich habe mal bei einem sehr achtbaren Homöopathen der alten Schule - im ‚Stauffer’ - über einen Selbstversuch gelesen, der einem das ganze Ausmaß des Übels vor Augen führt. Er hat zur Prüfung des Mittels zweimal am Tag je 5 Tropfen Thuja D 30 eingenommen. Schon am zweiten Abend stellte sich Herzklopfen ein. Am nächsten Morgen