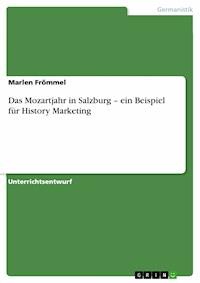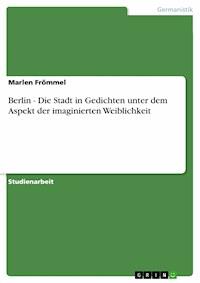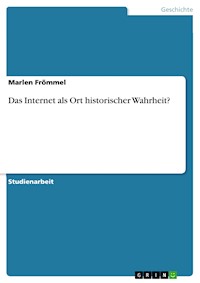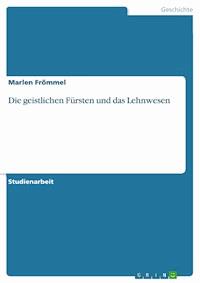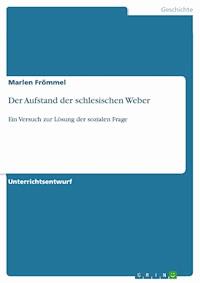29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Geschichte Europas - Mittelalter, Frühe Neuzeit, Note: 1,3, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Sprache: Deutsch, Abstract: Den Ausgangspunkt bildet die Magievorstellung des Mittelalters, welche sich aus antiken Traditionen herausgebildet hatte. Obwohl sie mit der zunehmenden Macht der christlichen Kirche als Konkurrenz angesehen und auch so behandelt wurde, durchzog die Dichotomie Religion – Magie das gesamte Mittelalter. [...] In diesem Zusammenhang soll der Entwicklungslinie Magie-Heidentum-Häresie-Hexenwesen nachgegangen werden. Magie und Hexenwesen durchzogen alle Bereiche der Gesellschaft: Angefangen bei der Alltagswirklichkeit der mittelalterlichen Gesellschaft über die Theologie der Kirche, die Politik des Staates sowie die Rechtsordnungen beider Bereiche bis hin zu Literatur und verschiedenen kulturellen Beziehungen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch das Forschungsinteresse in unterschiedlichsten Disziplinen geweckt wurde. Um dieser [Interpretationsvielfalt] möglichst gerecht zu werden, sollen in einem ersten theoretischen Teil ein kurzer Überblick über Entwicklung der Magie- und Hexenforschung (Kap. I/1) und existierende Forschungskontroversen (Kap. I/2) gegeben sowie das methodische Vorgehen für die Bearbeitung (Kap. I/3) vorgestellt werden. Aufgrund der im Vergleich eher begrenzten Magie-Literatur liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit beim Hexenwesen. Von dieser Prämisse ausgehend müssen zunächst die Begriffe „Magie/Magier“ und „Hexe“ näher bestimmt werden (Kap. I/4). Im zweiten Kapitel soll die Magie des Mittelalters als Voraussetzung für die Entstehung des Hexenwesens dargestellt werden. Hierfür werden die Ursprünge der Magie, besonders in der klassischen Kultur der griechisch-römischen Welt (Kap. II/1), aus der sich die mittelalterlichen Magievorstellungen ergaben (Kap. II/2), sowie die theoretische Einstellung der Kirche (Kap. II/3) näher betrachtet. Das mittelalterliche Hexenwesen und die beginnenden Hexenverfolgungen sind Gegenstand des dritten Teils dieser Arbeit. Ausgehend von der Überformung der magischen Volkskultur durch die kirchliche Hexenlehre (Kap. III/1) wird das Verhältnis von Kirche und Staat zur Magie nachgezeichnet (Kap. III/2) – beides Vorbedingungen, aus denen sich der Hexenstereotyp (Kap. III/3) entwickelte, welches besonders in den „Hexenhammer“ (Kap. III/4) Eingang fand. Die Lage der Frau in Hinblick auf die Gesellschaft sowie die Veränderungen im mittelalterlichen Weltbild (Kap. III/5) werden thematisiert, um die Genese der Hexenverfolgungen (Kap. III/6) zu veranschaulichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Page 1
Page 4
„Magie und Religion sind Gegensätze, die sich nicht vereinbaren lassen.
1Beth, K.: Das Verhältnis von Religion und Magie, in: Petzoldt, L. (Hg.): Magie und Religion (Wege der
Forschung 337). Darmstadt 1978, 27-46. S. 46
2Schmitt, J. C.: Heidenspaß und Höllenangst. Aberglaube im Mittelalter. Frankfurt, New York 1993. S. 11.
4
Page 5
Arbeitsvorhaben und Aufbau der Arbeit
„Die historische Realität der Hexe entfaltet sich in dem, was zunächst im 15. Jahrhundert die Inquisitoren, dann die weltlichen Gerichte und nicht zuletzt die Humanisten der Renaissance in ihr gesehen haben, was sie im Zeichen dieses Begriffes aus- und abgrenzten. Sie entwarfen auf dem Feld der ‚imaginierten Weiblichkeit‘ Muster des Bösen, an dem sich das Gute zu beweisen hatte.“3Entsprechend dem Thema dieser Arbeit „Magie und Hexenwesen im Mittelalter“ greift dieses Zitat als Bearbeitungsgrundlage zeitlich zu weit, aber auch inhaltlich zu kurz. Dennoch beschreibt es eine Entwicklung, der nachgegangen werden soll.
Den Ausgangspunkt bildet die Magievorstellung des Mittelalters, welche sich aus antiken Traditionen herausgebildet hatte. Obwohl sie mit der zunehmenden Macht der christlichen Kirche als Konkurrenz angesehen und auch so behandelt wurde, durchzog die Dichotomie Religion - Magie das gesamte Mittelalter. Als Abgrenzungs- und Abwertungsabsichten sind die in der Folge von Kirche und Staat ergriffenen Maßnahmen zu beurteilen. In diesem Zusammenhang soll der Entwicklungslinie Magie-Heidentum-Häresie-Hexenwesen nachgegangen werden.
Seit jeher war der Volksglaube durch magische Elemente geprägt, doch diese Vorstellungen sind im Laufe der Jahrhunderte einem Wandel unterlegen gewesen, der schließlich auch die „Hexe“ hervorbrachte. Diese inhaltliche Veränderung von der Zauberin zur Hexe, die sie bedingenden Umstände und die zeitliche Verortung der wachsenden Ächtung, die ihren Höhepunkt in den Hexenverfolgungen fand, werden in der Fachliteratur in verschiedene Interpretationszusammenhänge gesetzt. Einerseits lässt sich dabei feststellen, dass der Entstehung des Hexenwesens bzw. den mittelalterlichen Magievorstellungen nicht annähernd soviel Beachtung geschenkt wurde wie den Hexenverfolgungen der Neuzeit, und andererseits präsentiert die Forschung sehr unterschiedliche Vorstellungsbilder in Bezug auf die Auslöser und Motive der Hexenverfolgungen. So reichen die Erklärungen von ländlichen Konfliktbewältigungsstrategien durch Magiebeschuldigungen4, über einen „Feldzug gegen das weibliche Geschlecht“5bis zum Ansatz der geplanten „Vernichtung
3Schade, S.: Kunsthexen - Hexenkünste. Hexen in der bildenden Kunst vom 16. Bis 20. Jahrhundert, in:
Dülmen, R. v. (Hg.): Hexenwelten, Magie, Imagination. Frankfurt am Main 1993, S. 170-218. S. 172.
4Vgl. Levack, B. P.: Hexenjagd. Die Geschichte der Hexenverfolgungen in Europa. München 1995. S. 132.
5Bovenschen, S.: Die aktuelle Hexe, die historische Hexe und der Hexenmythos. Die Hexe: Subjekt der
Naturaneignung und Objekt der Naturbeherrschung, in: Becker, G.; Bovenschen, S.; Brackert, H.; Brauner, S.
& Tümmler, A.: Aus der Zeit der Verzweiflung. Zur Genese und Aktualität des Hexenbildes. Frankfurt am
Main 1977, 259-312. S. 277.
5
Page 6
der weisen Frauen“6zugunsten einer staatlich verfolgten Bevölkerungspolitik. Magie und Hexenwesen durchzogen alle Bereiche der Gesellschaft: Angefangen bei der Alltagswirklichkeit der mittelalterlichen Gesellschaft über die Theologie der Kirche, die Politik des Staates sowie die Rechtsordnungen beider Bereiche bis hin zu Literatur und verschiedenen kulturellen Beziehungen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch das Forschungsinteresse in unterschiedlichsten Disziplinen - z.B. Geschichte und Kunstgeschichte, Soziologie und Psychologie, Anthropologie und Bevölkerungswissenschaftgeweckt wurde, aus dem sich aufgrund der jeweiligen Herangehensweise eine Interpretationsvielfalt ergeben musste, bei der aber nicht immer die Komplexität des Gesamtphänomens Magie und Hexen beachtet wurde.
Um dieser möglichst gerecht zu werden, sollen in einem ersten theoretischen Teil ein kurzer Überblick über Entwicklung der Magie- und Hexenforschung (Kap. I/1) und existierende Forschungskontroversen (Kap. I/2) gegeben sowie das methodische Vorgehen für die Bearbeitung (Kap. I/3) vorgestellt werden. Aufgrund der im Vergleich eher begrenzten Magie-Literatur liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit beim Hexenwesen. Von dieser Prämisse ausgehend müssen zunächst die Begriffe „Magie/Magier“ und „Hexe“ näher bestimmt werden (Kap. I/4).
Im zweiten Kapitel soll die Magie des Mittelalters als Voraussetzung für die Entstehung des Hexenwesens dargestellt werden. Hierfür werden die Ursprünge der Magie, besonders in der klassischen Kultur der griechisch-römischen Welt (Kap. II/1), aus der sich die mittelalterlichen Magievorstellungen ergaben (Kap. II/2), sowie die theoretische Einstellung der Kirche (Kap. II/3) näher betrachtet.
Das mittelalterliche Hexenwesen und die beginnenden Hexenverfolgungen sind Gegen-stand des dritten Teils dieser Arbeit. Ausgehend von der Überformung der magischen Volkskultur durch die kirchliche Hexenlehre (Kap. III/1) wird das Verhältnis von Kirche und Staat zur Magie nachgezeichnet (Kap. III/2) - beides Vorbedingungen, aus denen sich der Hexenstereotyp (Kap. III/3) entwickelte, welches besonders in den „Hexenhammer“ (Kap. III/4) Eingang fand. Die Lage der Frau in Hinblick auf die Gesellschaft sowie die Veränderungen im mittelalterlichen Weltbild (Kap. III/5) werden thematisiert, um die Genese der Hexenverfolgungen (Kap. III/6) zu veranschaulichen. Diese Entwicklungen von Magie- und Hexenvorstellungen, die im Mittelalter besonders durch die Kirche bestimmt waren, lösten sich in der frühen Neuzeit von diesem theologi-
6Heinsohn, G.; Steiger, O.: Die Vernichtung der weisen Frauen. Beiträge zur Theorie und Geschichte von
Bevölkerung und Kindheit. Herbstein 1985.
6
Page 7
schen Kontext und führten, begünstigt durch wirtschaftliche, umweltbedingte, soziologische, aber auch psychologische und religionsgeschichtliche Faktoren, zu einer Ausweitung der Hexenverfolgungen, die sich im 16. und 17. Jahrhundert vielerorts zu einer wahren Massenhysterie steigern konnte. Die legalen Hexenverfolgungen endeten erst im 18. Jahr-hundert.
Teil I: Eine Annäherung von theoretischer Seite
1. Die Entwicklung des Forschungsdiskurses
Da es unmöglich ist, die gesamte Forschungssituation wie auch die Historie von Magie und Hexenwesen in all ihren Facetten darzustellen, wurde nur die Literatur ausgewählt, die entscheidende Entwicklungslinien aufgedeckt und nachgezeichnet hat. Als Grundstein der wissenschaftlichen Erforschung von Magie und Hexenwesen kann W. G. Soldans „Geschichte der Hexenprozesse“ (1843) gelten - 75 Jahre nach der letzten Hexenverfolgung. Zusammen mit J. Hansens „Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozeß im Mittelalter und die Entstehung der großen Hexenverfolgung“ (1900) und H. C. Leas „Materials toward a history of witchcraft“ (1887-1889) sind diese Studien die Meilensteine der älteren Hexenforschung des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Obwohl nicht mehr alle ihrer Ergebnisse Gültigkeit besitzen oder nur Teilaspekte des Gesamtphänomens - die Ideologie der Kirche, ihre Hexenlehre und Inquisition - bei den Interpretationen berücksichtigt wurden, sieht W. Behringer ihren Hauptverdienst in der „präzisen[n] Rekonstruktion der Genese des spezifisch westeuropäischen Hexenbegriffs und seiner Bedeutung für das 15. bis 18. Jahrhundert.“7Und so bildet die ältere Hexenforschung die Grundlage für die heutige Hexenforschung.
Dass sich seit den 70er Jahren immer mehr Wissenschaftler8mit dem Magie- und Hexenthema beschäftigen, lässt einen Paradigmenwechsel in der Forschung deutlich werden, der durch neue Erkenntnisse, aber auch Interessen anderer Disziplinen ausgelöst wurde. So mussten ältere Ergebnisse revidiert werden, da diese neue Hexenforschung die angenommene geographische und zeitliche Uniformität der Hexenverfolgungen nicht mehr bestätigen konnte. Auch die „Epoche des Hexenwahns“ verschob sich. Heute herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass der Höhepunkt der Hexenverfolgungen zwischen 1560
7Behringer, W.: Hexenverfolgung in Bayern. Volksmagie, Glaubenseifer und Staatsräson in der Frühen
Neuzeit. München 1987. S. 5.
8Wenn nicht explizit die weibliche Form genannt wird, umfasst die männliche Form beide Geschlechter.
Einzige Ausnahme bildet „die Hexe“, welchen den Hexer impliziert.
7
Page 8
und 1630 anzusetzen ist. Mancher Erklärungsansatz wird also insofern hinfällig, als dass die Hexenverfolgungen weder im Mittelalter ihren Höhepunkt erreichten, noch durch die Aufklärung beendet wurden.9