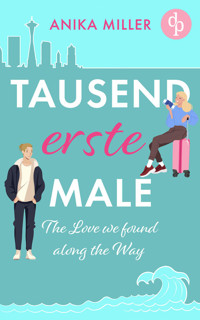8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dark Academia Romantasy mit einzigartiger Magie Ein verbrannter Name. Tanzender Magiestaub. Während sich das Magiewissenschaftsstudium für andere um Bestnoten und Creditpoints dreht, geht es für Amelie Fournier um Leben und Tod. Seit Jahrhunderten ist die Magie verschwunden und auf Amelie lastet die gewaltige Aufgabe, diese zurückzubringen. Scheitert sie, ist sowohl ihre Existenz bedroht als auch das Schicksal ihrer Liebsten und das der gesamten Welt. Für ein Privatleben bleibt daher keine Zeit. Erst recht nicht für ein Rendezvous mit dem Magieziner und Sohn ihres Chefs Raphael Chevalier, der ganz eigene Pläne verfolgt. Mit denen bringt er allerdings nicht nur Amelies Forschung und ihr Herz in Gefahr – sondern auch ihr Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Magiestaub
ANIKA MILLER
Copyright © 2023 by
Drachenmond Verlag GmbH
Auf der Weide 6
50354 Hürth
https://www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Sarah Nierwitzki
Korrektorat: Lillith Korn
Layout Ebook: Stephan Bellem
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
Bildmaterial: Shutterstock
Druck Printausgabe: Booksfactory
ISBN 978-3-95991-558-8
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
1. Amelie
2. Amelie
3. Raphael
4. Amelie
5. Amelie
6. Raphael
7. Amelie
8. Raphael
9. Amelie
10. Raphael
11. Amelie
12. Raphael
13. Amelie
14. Raphael
15. Amelie
16. Amelie
17. Raphael
18. Amelie
19. Raphael
20. Amelie
21. Raphael
22. Amelie
23. Amelie
24. Raphael
25. Amelie
26. Raphael
27. Amelie
28. Raphael
29. Amelie
30. Raphael
31. Amelie
32. Raphael
33. Amelie
34. Amelie
35. Amelie
36. Raphael
37. Raphael
38. Amelie
39. Amelie
40. Raphael
Danksagung
Drachenpost
Für alle
die im Alltag nach Magie suchen.
In diesem Buch werdet ihr sie finden.
Magiefall
(n.) Der Verlust der Magie, der die Welt an den Rand des Abgrunds treibt.
Amelie
Der eisige Atem des Todes streifte meinen Nacken. Ich wirbelte herum, blinzelte in die Finsternis jenseits der unzähligen Kerzen, deren Licht über die steinernen Wände floss. Die Schritte der anderen entfernten sich und ich lauschte der darauffolgenden Stille. Es war eine, die mir in den Ohren dröhnte. Eine, wie sie nur möglich war, wenn man sich so tief unter der Erde befand, dass jedes Geräusch erstarb. Doch sie war trügerisch.
Ein Knistern hing in der Luft. Lautlos zwar, aber ich spürte es. Es war wie ein Prickeln auf der Haut und ein Schauder, der mir über den Körper rieselte. Meine Nackenhaare stellten sich auf und mein Herz geriet ins Stolpern, als ein Flüstern die Stille durchbrach. Daraus formten sich Worte. Alles in mir erstarrte. Ich hielt die Luft an, wagte nicht, mich zu rühren, und versuchte, zu verstehen, was diese körperlose Stimme sagte. Erfolglos. Es klang wie Bruchstücke einer fremden Sprache, eine, auf die mein Körper mit einem Summen reagierte, als verstünde er, was mir verborgen blieb.
Ich war nicht allein. Dieser Gedanke reifte mit überwältigender Gewissheit in mir, obwohl ich niemanden in der Dunkelheit erkannte, die im nächsten Moment allumfassend wurde und alles um mich herum verschluckte, als ein Windhauch fast alle Kerzen löschte.
Das mir vertraute, in den letzten Wochen hartnäckiger gewordene Schwindelgefühl erfasste mich und ließ mich durch die konturlose Umgebung wanken. Ich streckte eine Hand aus und betete, damit keinen der Totenschädel zu berühren, die sich an den Wänden links und rechts neben mir stapelten. Stattdessen fand ich an einer der Säulen Halt, die die niedrigen Decken trugen, und lehnte mich dagegen. Bis sich meine Augen an die Finsternis gewöhnt hatten und ich meinem Gleichgewichtssinn wieder vertrauen konnte, verharrte ich in dieser Position. Woher war der Wind gekommen? Ich sah mich nach meinen Mitstudierenden um und überlegte, ob sich jemand von ihnen einen Scherz mit mir erlaubte. Ein Flüstern streifte mein Ohr und strich sanft durch mein Haar. Ich fuhr herum, hob die Hand und griff ins Leere.
Wieder ein Flüstern, dessen Worte ich nicht verstehen konnte. Wut über diesen albernen Streich verknotete mir den Magen und ich zog mein kleines Notizbuch aus der Gesäßtasche meiner Hose, um eine Seite herauszutrennen und sie in die winzige Flamme der Kerze zu halten. Ein orangefarbenes Licht floss durch den unterirdischen Raum, tanzte über die Schädel, malte Schatten in die Ecken. Da war niemand außer mir.
Der Zettel in meiner Hand schrumpfte unter der Hitze des Feuers zusammen und als dieses den Namen, den ich mir zuvor darauf notiert hatte, verbrannte, überkam mich ein eigenartiges Gefühl, als würde mein schneller schlagendes Herz den Schwindel aus meinem Körper vertreiben wollen. Und als besäße es die Macht dazu.
Seit Tagen plagte mich eine irrationale Mischung aus Müdigkeit und Schlaflosigkeit, doch in diesem Augenblick fühlte ich mich lebendig und unbesiegbar. Der Zettel in meiner Hand zerfiel zu Asche, die Flamme erlosch, aber um mich herum tanzten goldene Partikel, die den Raum erhellten. Sie schwebten in der Luft, gerieten durch meinen Atem in Bewegung und trieben die Schatten vor sich her. Über den erloschenen Kerzen verdichteten sie sich, bis sie wie aus dem Nichts erneut zu brennen begannen.
Ich hielt den Atem an, verfolgte das Schauspiel mit offenem Mund und versuchte, zu verstehen, was ich da sah.
Als Wissenschaftlerin komprimierte sich dieser Moment auf die Wechselwirkung von Beobachtung und Schlussfolgerung, die keinen Spielraum für Interpretationen ließ. Denn was ich sah, war Magie, dessen war ich mir absolut gewiss.
Die Kerzenflammen schossen hoch, der Magiestaub legte sich und das machtvolle Gefühl in mir verklang. Zurück blieb das Flüstern.
»Amelie?«
Kein Flüstern mehr, ein Rufen jetzt. Es riss mich aus der Starre. Juliens Gestalt tauchte vor mir in einem der halbrunden Gänge auf. Er war hochgewachsen, mit breiten Schultern und bewegte sich in geduckter Haltung durch die Katakomben auf mich zu. Das schwarze Haar trug er als Buzz Cut, er hatte dunkelbraune Augen und einen warmen Blick. Als er vor mir stehen blieb, wurde seine positive Ausstrahlung von dem grimmigen Zug um seinen Mund gedämpft.
»Bist du in Ordnung?« Seine Stimme hallte von den Wänden wider.
Der Schreck über das, was gerade geschehen war, saß tief und lähmte mir die Zunge. Zwei Möglichkeiten: Es ging mir sehr viel schlechter, als ich angenommen hatte, und die Halluzinationen setzten bereits ein. Oder ich war meinem Ziel näher als je zuvor. Ich drehte mich von Julien weg, sah durch den Raum, der nicht wirkte, als wäre hier gerade eben etwas Ungewöhnliches geschehen.
Ein Nicken war alles, was ich zustande brachte. Aber es genügte meinem Kommilitonen und er verzog das Gesicht zu einer Grimasse.
»Echt gruselig hier unten«, sagte Julien. »Möglicherweise ist das Professor D’Amboises neuste Strategie, um den Kurs auszudünnen, nachdem dieses Vorhaben bei der letzten Abschlussprüfung gescheitert ist.«
Um einen Platz in einer der legendären Vorlesungen von Professor D’Amboise belegen zu dürfen, musste man schnell sein und sich an dem Tag, wenn der Veranstaltungsplan online gestellt wurde, vor allen anderen einschreiben. Grundvoraussetzung dafür waren ein Wecker und eine zuverlässige Internetverbindung. Julien und ich hatten es in diesem Semester zum zweiten Mal geschafft und nicht zu viel erwartet. Denn die Einführungsveranstaltung der Vorlesung verbrachten wir in den Eingeweiden der Stadt und besichtigten die Pariser Katakomben.
Ich zwang mich zu einem Lächeln, das hoffentlich über meine Unsicherheit hinwegtäuschte. »Verdammt, dann sollten wir uns den anderen wieder anschließen. Ich habe im letzten Semester meine gesamte Freizeit geopfert, um mich für diesen Kurs zu qualifizieren.«
»Nur im letzten Semester?« Der Vorwurf in Juliens Frage war nicht zu überhören.
Seit wir im Wintersemester vor zwei Jahren unser Studium an der Paris-Sorbonne begonnen hatten, pflegten wir eine lose Freundschaft. Oder um es fair auszudrücken: Er pflegte unsere Freundschaft. Es war nicht so, dass ich ihn nicht mochte. Er war ein großartiger Kerl, aufmerksam und humorvoll, der mir das nötige Verständnis für meine exzessiven Forschungen entgegenbrachte. Meistens. Wenn ich den Unterricht nicht so dermaßen ernst genommen hätte, hätte ich ihm womöglich mehr Zeit eingeräumt. Aber ich nahm den Unterricht ernst. Mein Studium und das Ziel, das ich damit verfolgte, hatten für mich oberste Priorität.
Trotzdem wirst du es nie schaffen.
Zweifel übertönten den Optimismus, der mir an anderen Tagen Mut zusprach. Es fühlte sich an, als würde sich eine kalte Hand um mein Herz legen und zudrücken, meinen Puls zum Aufgeben zwingen. Scheitern war keine Option, denn das bedeutete für mich ein Ende, wie ich es nicht akzeptieren konnte.
Wir folgten dem Gang, durch den die anderen Kursteilnehmer verschwunden waren. Die messerscharfe Stimme unseres Professors bewahrte mich davor, Julien mit einer Ausrede zu vertrösten, als wir in eine Kammer traten, an deren Wänden sich unzählige Knochen stapelten. Kerzenlicht tanzte auf den Totenschädeln, die mich aus leeren Höhlen anstarrten. Nie zuvor war ich dem Tod näher gewesen als in diesem Moment. Ich spürte seine Gegenwart. Sie sickerte aus den Wänden, hing schwer in der Luft, dazwischen das Flüstern. Es wurde lauter und fast war ich sicher, dass es Worte waren, die zwischen den Totenschädeln verklangen wie ein Lied, dem niemand außer mir lauschte.
»Mademoiselle Fournier, Monsieur Deschamps! Ich fürchtete schon, Sie in den Tunneln verloren zu haben.«
Das Rauschen des Blutes in meinen Ohren und das Flüstern übertönten Juliens Erwiderung, aber das Kichern meiner Mitstudierenden lenkte meine Aufmerksamkeit zurück auf die Veranstaltung.
Professor D’Amboise blickte mit uns in diesem Semester auf das Leben unseres größten Volkshelden, César E. A. Mézangeau, der bei dem Versuch, die Magie in unserer Welt zu bewahren, gestorben war. D’Amboise war ein stattlicher Mann, der in jungen Jahren sicher attraktiv gewesen war. Er hatte sich das schlohweiße, jedoch noch immer volle Haar als Knoten im Nacken zusammengebunden. Auf seinem Kopf saß eine Hornbrille wie ein Haarreif und hielt ihm die losen Strähnen aus dem Gesicht. Seine Augen waren klein wie die eines Mannes, der sich ein Leben lang im spärlichen Licht einer Bibliothek auf die winzigen Buchstaben alter Bücher konzentriert hatte, passend dazu furchten tiefe Denkfalten seine Stirn. Er kleidete sich stets in karierte Hemden und ungebügelte Bundfaltenhosen, das Markenzeichen für den beliebtesten Dozenten der Magiewissenschaftlichen Fakultät, denn obgleich seinem Fachbereich Theoretische Magiekonzepte der Ruf von Langeweile anhaftete, gestaltete er seine Vorlesungen außergewöhnlich.
»Der Tod war ein unliebsamer Nachbar«, setzte Professor D’Amboise die Führung fort. »Glaubt man den Quellen, starben im Jahr 1779 mehrere Personen im ersten Arrondissements an dem Gestank, der vom nächstgelegenen Friedhof ausging. Daraufhin verfügten die Behörden, den Friedhof zu schließen und die exhumierten Gebeine in die städtische Unterwelt zu überführen. Vom Steinbruch zum Totenbett: die Pariser Katakomben.«
Obwohl seine Stimme durch die niedrigen Wände gepresst klang, tönte die Begeisterung unseres Professors mit jeder Silbe durch. Angesichts der Toten äußerst makaber. Um uns herum hatte man Unmengen an Knochen aufgehäuft. Die Anordnung der übereinandergestapelten Schädel folgte geometrischen Mustern, die wie Kunstwerke des Todes wirkten.
»Jean-Baptiste Beaumont.«
Ich drehte den Kopf auf der Suche nach demjenigen, der das eingeworfen hatte. Die Blicke der anderen hingen jedoch an den Lippen von D’Amboise. Ich zögerte einen Moment, bevor ich mich ihnen anschloss und mich um Konzentration bemühte.
»Isabelle Charpentier.«
Diesmal war die Stimme lauter und knisterte. Das erinnerte mich an den Lautsprecherton eines alten Radios. Auf der Suche nach dem Ursprung sah ich mich erneut um. Warum reagierte niemand darauf? Wenn in einer Veranstaltung ein Handy klingelte, führte das üblicherweise auch zu Gelächter.
»Mademoiselle Fournier.«
Ich zuckte ertappt zusammen und drehte mich zurück zu D’Amboise. Mit erhobener Braue fixierte er mich. »Möchten Sie uns mitteilen, was Sie an diesen Spinnweben derart interessant finden? Steckt möglicherweise nicht nur eine Magiewissenschaftlerin in Ihnen, sondern auch eine Arachnologin?«
Meine Lippen öffneten sich, um eine möglichst eloquente Antwort zu formulieren, aber außer einem Stammeln kam nichts heraus und ich schloss sie wieder. Ich konnte ihm wohl kaum erklären, dass mich eine körperlose Stimme ablenkte, die mir unbekannte Namen zuraunte. Es waren nicht die guten Noten, die mich anspornten, mein Bestes zu geben, sondern die Notwendigkeit von Erfolg, der über den Verlauf meines Lebens entscheiden würde. Ich musste mich auf das fokussieren, was wirklich wichtig war.
»Entschuldigung«, sagte ich schließlich mit Verzögerung, was D’Amboise ein Seufzen entlockte, ehe er sich wieder an sein Publikum wandte.
»Inzwischen fragen Sie sich sicher, warum wir den Auftakt unserer Vorlesung zu Mézangeau in den Eingeweiden der Stadt verbringen. Sollte das nicht der Fall sein, ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Sie über die Spitzfindigkeit eines Teelöffels verfügen und durch die Prüfungen am Ende des Semesters durchfallen werden. Ich bitte Sie, uns derlei Enttäuschungen zu ersparen, und sich für ein anderes Seminar einzuschreiben.«
Vereinzelt erklang Gelächter. Aber Professor D’Amboise war nicht für Humor bekannt. Was er sagte, meinte er. Die geschockten Mienen meiner Mitstudierenden verrieten mir, dass ihnen das bewusst war. Auf die aufgetürmten Gebeine hatten sie nicht halb so stark reagiert wie auf seine Worte.
»Hab ich es nicht gesagt?«, raunte Julien mir zu. Sein warmer Atem streifte mein Ohr, ein Hauch von Leben im Reich der Toten. Dass ich meine verkrampfte Haltung kaum merklich lockerte, quittierte er mit einem Lächeln und deutete in Richtung des Professors. »Er versucht, uns loszuwerden.«
»Nur wenn Sie weiterhin den Unterricht stören!«, rief dieser über die anderen hinweg. »Haben Sie etwas Gehaltvolles beizutragen, Monsieur Deschamps?«
Julien richtete sich auf und stieß dabei gegen die niedrige Decke. Er fluchte, rieb sich den Kopf. »Ob Sie’s glauben oder nicht, das habe ich.« Sein herausfordernder Tonfall brachte die Umstehenden zum Kichern und auch Professor D’Amboises Mundwinkel zuckten.
»Überraschen Sie mich!«
»Wir befinden uns in der Gesellschaft von über sechs Millionen Toten«, sagte Julien mit einer ausladenden Handbewegung. »Aber nur der knochige Arsch eines einzigen Mannes hat die Macht, das Herz unseres Lieblingsprofessors höherschlagen zu lassen.«
»Falls Sie glauben, dass Sie sich gute Noten erschmeicheln können, irren Sie sich. Fahren Sie fort, Monsieur!« D’Amboise machte eine gönnerhafte Geste.
»Zeit seines Lebens hat sich César Mézangeau für die Pariser Unterwelt interessiert. Gerüchten zufolge hat man ihn nach seinem Tod 1857 hier unten bestattet.«
Der Professor klatschte in die Hände. »Es gibt in dieser Stadt keinen besseren Ort für den Auftakt einer Vorlesung über unseren tragischen Helden. Nicht einmal meinen Hörsaal. Leider habe ich keine Sondergenehmigung erhalten, um die gesamte Veranstaltung in die Katakomben zu verlegen. Eine Schande, dass unsereins, die wir heutzutage noch der Magie nachhängen, von jenen belächelt werden, die sich mit der tristen Realität ohne sie abgefunden haben. Wie dem auch sei, wir sehen uns das nächste Mal wieder an der Uni.«
Verhaltener Applaus erklang, dem ich mich zögerlich anschloss, ehe die Ersten auf den Ausgang zustrebten. Professor D’Amboise empörte sich mit einem verächtlichen Grunzen über die Eile, mit der sie der Gesellschaft der Toten zu entkommen suchten. Ich konnte es ihnen nicht verdenken. Fröstelnd schob ich die geballten Fäuste in die Taschen des Wollmantels und bemühte mich um einen gleichgültigen Gesichtsausdruck, während ich das Echo der sonderbaren Stimme in meinen Gedanken zu ignorieren versuchte.
»Manche Menschen sind immun gegen die Energie verstorbener Seelen und andere ertragen sie schlichtweg nicht«, bemerkte der Professor schulterzuckend.
Nacheinander traten wir in den schmalen Gang, der uns durch das Labyrinth des Pariser Untergrundes am schnellsten zurück an die Tagesoberfläche führen würde.
»Ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, oder der Tatsache geschuldet ist, dass dies unsere letzte Veranstaltung für heute war und der verdiente Feierabend ruft«, bemerkte Julien, der wenige Schritte hinter mir lief.
»Es ist mir neu, dass Studierende Feierabend verdient haben«, entgegnete der Professor.
Ich spürte die Energie der Toten eindeutig, aber mein Notendurchschnitt war mir wichtiger als das Bedürfnis, diesem Ort zu entfliehen. Auch wenn ich der Furcht in den letzten Stunden allzu gerne nachgegeben hätte. Um mich herum ragten die Gebeine der Toten auf, dazwischen waren ein paar Schädel in Herzform angeordnet. Ich wandte mich ab und wich den Pfützen aus, die sich auf dem unebenen Boden gebildet hatten.
Die Stille folgte mir wie ein Schatten und ließ die Unterhaltung zwischen Julien und dem Professor verstummen. Das Flüstern strich über mich hinweg und liebkoste mein Bewusstsein, indem es mir weitere Namen nannte. Marie-Claire de Valois. Henri Dupont. Alexandre Duval.
Nicht darauf hören, ermahnte ich mich, obwohl das unmöglich war.
Ich taumelte, streckte die Hand aus, um den Sturz abzufangen. Mit den Fingern streifte ich eine raue, kühle Oberfläche. Knochen. Ich fuhr zurück und beobachtete, wie sich die Dunkelheit um mich herum verdichtete. Schwarzer Rauch, von goldenen Partikeln durchsetzt – ein kurzes Aufflackern von Magie.
Was. Unmöglich. Sein. Sollte.
Denn in meiner Welt gab es keine Magie. Zumindest nicht mehr. Sie war 1857 verschwunden, ein Wendepunkt der Weltgeschichte, über den dieser Tage nur spekuliert werden konnte. In der Magieforschung suchten die brillantesten Köpfe der Welt nach einem Weg, die Magie zurückzuholen, die Magiehistorik sichtete und bewertete Hinweise auf das damalige Leben. Quellen gab es kaum, da die meisten von Magiegegnern, den sogenannten Antimagies, zerstört worden waren.
Heute war unbekannt, wie groß der Anteil der Magie im Alltag war, aber da einige Gebäude mit ihrer Hilfe errichtet worden waren, die inzwischen einstürzten oder zerfielen, war davon auszugehen, dass er zumindest nicht unerheblich war. Ich lebte in einer Welt, die von den Spuren des Verlustes gezeichnet war, und im Wissen, dass sie eines Tages daran zugrunde gehen würde.
Und dennoch war ich mir in diesem Moment sicher, dass es Magie war, die mir in den Katakomben nun schon zum zweiten Mal begegnet war, und nach mir rief.
Das lähmende Gefühl von Angst ließ von mir ab und wich einer fiebrigen Erwartung, die warm durch meinen Körper tröpfelte.
»Professor!« Meine Stimme übertönte das Flüstern, das zu einem leisen Rauschen am Rande zusammenschrumpfte. Ich beschleunigte die Schritte und schloss zu D’Amboise auf, der sich mir mit mildem Lächeln zuwandte.
»Mademoiselle Fournier«, sagte er. »Womit kann ich dienen?«
Ich räusperte mich. »Sie sprachen von der Energie der Toten, Monsieur. Was meinen Sie damit?«
Das Geräusch unserer Schritte war gedämpft, während wir durch die verwinkelten Gänge in Richtung des Ausgangs liefen. Fast glaubte ich, dass mir der Professor keine Antwort mehr geben würde, als er endlich sagte: »Im Moment seines Todes hinterlässt ein Mensch Energie auf der Welt. Ein Stempel seiner Existenz, wenn man so will.«
Der Untergrund schluckte seine Worte. Doch es bedurfte keines Echos. Sie geisterten durch meinen Kopf, brannten sich mir ein und formten eine Idee, die mein Herz immer schneller schlagen ließ.
Es gab nur wenige gesicherte Kenntnisse über die Magie. Aber in einer Sache war sich die neuere Forschung einig: Magie war Energie. Und um sie zu wirken, brauchte es eine Möglichkeit, sie freizusetzen – ähnlich wie in der Chemie. Wenn man verschiedene Elemente mischte, knallte es. Oder man erzeugte im Idealfall Magie.
Bedauerlicherweise hatte es in den letzten Jahren um mich herum häufiger geknallt, als dass ich echte Magie sequenziert hätte. Als ich mich an Kristallmagie ausprobiert hatte, fing mein Notizbuch Feuer. Möglicherweise lag das am Brennglaseffekt und nicht am Umstand, dass ich tatsächlich Magie gewirkt hatte. Weitere Forschungen in diese Richtung verliefen ebenfalls ins Leere. Ich hatte Magie wie eine Gleichung mit einer Unbekannten behandelt, hatte sämtliche Formeln umgestellt, das X jedoch niemals aufgelöst. Ich hatte unzählige Fantasyserien und -filme in der Hoffnung gesehen, dort die Inspiration für weitere Versuche zu finden. Infolgedessen fand ich heraus, dass Zauberstäbe nicht mehr als alberne Spielzeuge waren und keinerlei Nutzen erfüllten. Edelsteine waren nichts weiter als Staubfänger und Zaubersprüche eine herausragende Möglichkeit, an der eigenen Redegewandtheit zu feilen. Magie hatte ich damit allerdings nicht bewirken können.
Aber hier tief unter der Stadt nahm ich die Magie plötzlich wahr.
Die Hoffnung, die in mir keimte, war zerbrechlich. Zu viele Niederlagen pflasterten meinen Weg. Doch eine Mischung aus Ehrgeiz, einen weiteren Versuch zu unternehmen, und Zeitdruck trieb mich an.
Amelie
Als wir aus den Katakomben traten, dämmerte es bereits. Der öffentliche Zugang zum Bauch der Stadt lag an einem der für Paris charakteristischen breiten Boulevards mit gepflasterter Straße, umrahmt von verschiedenen Gebäuden, die sichtliche Spuren des Verfalls aufwiesen. Gesprungene Fenster, Efeu, der unkontrolliert wucherte, teilweise eingestürztes Mauerwerk. Auch wenn mir dieser Anblick vertraut war, schnitt er mir regelmäßig ins Herz, weil die Ruinen stumme Zeugen einer vergangenen Ära waren, die ich so sehr herbeisehnte.
Um mich herum verschwand der Boulevard, die Welt kippte und ich streckte die Arme aus. Nicht wie eine Ballerina, sondern wie eine Betrunkene, die die Macht über die eigenen Füße verloren hatte. Ich bekam Juliens Arm zu fassen und lehnte mich in einem Zustand überwältigender Erschöpfung gegen ihn. Diese verdammte Krankheit. Das erste und zweite Stadium galten als harmlos, fast symptomfrei. Doch immer wieder überraschte mich dieser Schwindel mit einer Heftigkeit, die mich am aktuellen Forschungsstand zweifeln ließ.
»Amelie?« Juliens Besorgnis drang durch den Nebel in meinem Gehirn.
Als mir der Zedernduft seines Deos in die Nase stieg und ich mir seiner Nähe und Wärme bewusst wurde, ließ ich ihn los und schuf mit einem schnellen Schritt nach hinten Abstand zwischen uns.
»Mist, Julien, tut mir leid. Mir war nur kurz … schwindelig.«
»Geht es denn wieder?« Prüfend sah er mich an und ich bemühte mich um einen gleichgültigen Ausdruck.
»Ja, natürlich. Alles gut. Das lag bestimmt daran, dass es in den Katakomben so stickig war.«
»Bestimmt.«
Jetzt strömte kalte Luft in meine Lunge und vertrieb das Unwohlsein, klärte meinen Geist für Gedanken an goldenen Magiestaub, die Energie von Toten und geflüsterte Namen längst Verstorbener, während sich unser Professor verabschiedete und auf einem Motorroller unweit des Eingangs zu den Katakomben aufsaß. Als Julien unschlüssig stehen blieb, bemerkte ich, dass wir die Letzten aus unserem Kurs waren. Zum Glück hatte niemand sonst etwas von meinem kleinen Schwächeanfall mitbekommen.
»Das war die ungewöhnlichste Veranstaltung, die ich je an dieser Uni besucht habe.« Juliens Worte beendeten das Chaos in meinem Kopf. Er scharrte mit der Fußspitze auf dem vom Herbstregen glänzenden Boden. »Wir könnten …«
Das schrille Piepen eines Handys unterbrach ihn.
»Pardon«, murmelte ich zerstreut. »Das war meins.«
Ich öffnete die Seitentasche des Lederrucksackes und zog es hervor. In den Katakomben hatte ich keinen Empfang gehabt. Jetzt, da es sich zurück ins Netz eingewählt hatte, gingen mehrere Nachrichten ein. Sie alle stammten von meiner Freundin und Mitbewohnerin Sandrine.
Sandrine Perreault – 17:28
Das neue Semester ist drei Tage alt. Drei Tage! Und ich ersticke schon jetzt in Hausaufgaben.
Sandrine Perreault – 18:13
Wo steckst du? Hast du Hunger?
Sandrine Perreault – 18:22
Wir könnten etwas kochen. Treffen wir uns zu Hause?
Ich ließ das Handy sinken und sah zu Julien auf. »Entschuldige. Das war Sandrine. Sie hat Hunger.«
Ein Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Dann solltest du dich beeilen.«
»Ja, stimmt. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Was wolltest du sagen?«
Julien winkte ab. »Nicht so wichtig. Nur dass wir das Referat im Theorietutorium zusammen halten könnten.« Er hob die Schultern und schob die Hände in die Hosentaschen. »Ist ja noch Zeit bis dahin. Lass uns ein anderes Mal drüber sprechen. Ich muss los. Bestell Sandrine schöne Grüße.«
»Richte ich aus. Au revoir, Julien, wir sehen uns morgen.«
Kurz winkte ich ihm nach und richtete meine Aufmerksamkeit anschließend zurück auf das Smartphone, um in der Kontaktliste nach Sandrines Nummer zu suchen und sie anzurufen. Dreimal klingelte es, bis meine Mitbewohnerin das Gespräch entgegennahm.
»Hast du Zeit?«, fragte ich sie ohne Umschweife.
»Klar!«, rief sie. »Ich verhungere. Wo treffen wir uns?«
»In der Uni. Kennst du das Labor im magiewissenschaftlichen Trakt?«
Ein Stöhnen drang durch die Leitung. »Da gibt es nichts zu essen. Was stimmt bloß nicht mit dir?«
»Tu es für deine Lieblingsmitbewohnerin!«, schnurrte ich. »Ich brauche deine Hilfe.«
»Mit leerem Magen tauge ich zu nichts.«
»Schön, machen wir es so: Auf dem Weg zur Uni lege ich einen Zwischenstopp ein und bringe Essen mit.«
»Du zahlst?«
»Ich zahle.«
Sandrine seufzte theatralisch. »Wir sehen uns in einer Stunde.«
»Merci, Sandrine!« Ich steckte das Handy zurück in die Tasche und schlug den Weg zur Metro ein, um quer durch die Stadt in Richtung Universität zu fahren. Ich stieg eine Station früher aus und machte bei dem besten Burgerladen der Stadt Halt, ehe ich zu Fuß weiterlief.
Zu dieser Tageszeit übte die Rue Soufflot gruseligen Charme aus. Mehrere der gusseisernen Straßenlaternen waren wie Baumstämme im Sturm umgeknickt, sodass weite Teile im Dunkeln lagen. Die dahinterliegenden Gebäude waren verlassen und beherbergten nichts weiter als Finsternis, die hinter den eingeschlagenen Fenstern lauerte. In der einen Hand die Tüte mit Burgern griff ich mit der anderen nach meinem Smartphone und betätigte die Taschenlampen-App. Das Licht floss in einem breiten Kegel vor mir über den rissigen, moosbedeckten Gehweg und machte ein Hindernis sichtbar, dem ich im letzten Moment auswich. Es sah aus wie das Geländerbruchstück eines verrosteten Balkons, die wie Knochen aus den Fassaden ragten.
Es war leicht, sich vorzustellen, wie Paris ohne den Magiefall – so lautete der offizielle Begriff für die Abwesenheit der Magie und den damit einhergehenden Zerfall – ausgesehen hätte. Majestätisch mit prächtigen Gebäuden und historischen Bauwerken. Aber ein Großteil der Architektur, die mit Magie errichtet worden war, hatte sich in modrige Ruinen verwandelt und Menschen starben an Krankheiten, bedingt durch Magiefall.
Das Hauptgebäude der Sorbonne-Paris, in dem sich die Magiewissenschaftliche Fakultät befand, lag auf dem linken Seineufer in der Rue Remy Cousin, eine Straße, die aufgrund von instabiler Bodenbeschaffenheit und einsturzgefährdeten Häusern teilweise gesperrt war. Als ich dort ankam, war es bereits nach acht und die Korridore waren wie ausgestorben. Ich meldete mich mit meinem Studierendenausweis an der Pforte an und erhielt den Schlüssel zum Labor, das wir bis Mitternacht nutzen durften, ehe der Haupteingang verriegelt wurde. Wer sich bis zu diesem Zeitpunkt im Gebäude aufhielt, würde das auch noch bis zum Morgengrauen tun, wenn sich die Tore der Universität wieder öffneten.
Der Duft von fettigen Pommes und Burgern mischte sich mit dem von altem Papier und Ledereinbänden, als ich die Papiertüte mit dem Essen auf den Arbeitstisch in der Mitte des Labors stellte und mich auf einen der Hocker fallen ließ. Normalerweise herrschte hier rege Betriebsamkeit, an den meisten Abenden war der Raum jedoch leer, weshalb ich ihn gerne für meine Forschungen beanspruchte.
Hinter den Sprossenfenstern lag die von Lichtern gespickte Nacht über Paris. Drinnen erhellte eine Schreibtischlampe den Raum und ließ die golden geprägten Buchrücken im Regal gegenüber schimmern. Auf der anderen Seite standen mehrere Vitrinen, die getrocknete Kräuter, glitzernde Geoden und eine Auswahl an Edelsteinen beherbergten. Darüber spannte sich ein kunstvolles Stuckgewölbe. Das Labor war so majestätisch wie das gesamte Universitätsgebäude auf der Rive Gauche. Selbst wenn mich die äußeren Umstände nicht dazu zwingen würden, hätte ich meine Zeit gerne hier verbracht, auf den Spuren der Magie, die Paris einst verloren hatte.
Die Tür knarrte und kündigte Sandrine an. Mit großen Schritten und wehendem Mantel durchmaß sie den Raum und steuerte direkt auf die vor Fett triefende Tüte mit Fast Food zu. Dabei klackerten die Absätze ihrer Stiefeletten auf dem Parkett und betonten ihre Vorliebe für große Auftritte. Sie war ein kleiner, zierlicher Mensch, der es dennoch schaffte, den gesamten Raum bis zur Decke mit ihrer Präsenz zu füllen. Jede ihrer Bewegungen machte deutlich, wie bewusst sie sich selbst war.
»Ich sterbe, wenn ich nicht gleich etwas zu essen bekomme«, keuchte sie und schob sich die Ärmel ihres Mantels hoch, ehe sie in die Tüte langte und einen der Burger wie einen Schatz barg. »Komm zu Maman!«
Als sie hineinbiss, quollen auf der Rückseite Salat, Tomaten und Fleisch hervor, die sie mit dem Zeigefinger zurück zwischen die Brötchenhälften schob. Der Genuss entlockte ihr ein Stöhnen.
»Diescher Tag war wie verhekscht«, brachte sie mit vollem Mund hervor und schluckte. »Für Magietheorie im 19. Jahrhundert müssen wir bis nächste Woche zweihundert Seiten lesen. Und die Pflichtlektüre für das Aufbaumodul von Magische Literatur umfasst zehn Titel. In einem Semester.«
Sandrine schnaufte und grub die Zähne tief in den Burger, als wäre er die Lösung ihrer Probleme der ersten Vorlesungswoche. Vermutlich war er das auch. Meine Mitbewohnerin baute Stress mit Essen ab. Was für mich den Vorteil hatte, dass ich in Prüfungsphasen hervorragend verköstigt wurde, denn so leidenschaftlich gern und gut sie aß, kochte sie auch.
Eine Weile sah ich Sandrine schweigend beim Essen zu. Nachdem sie den Burger vernichtet hatte, seufzte sie und fischte ein paar Pommes aus der Tüte.
»Das ist das beste Fast Food der ganzen Stadt«, bemerkte sie. »Warum greifst du nicht zu?«
Als ich nicht sofort antwortete, sah sie mich aus zusammengekniffenen Augen an. »Du bist ein bisschen blass um die Nase«, stellte sie fest und ließ den Blick über mein Gesicht wandern. »Und deine Augenringe haben Augenringe. Was ist los?«
Die Schlaflosigkeit, die mich in den letzten Tagen nachts wach gehalten hatte, und die Anspannung, die mich seit den Katakomben begleitete und durch Sandrines Ankunft am Rand meines Bewusstseins gelauert hatte, verdarben mir den Appetit, und selbst der verführerische Duft fettigen Essens motivierte mich nicht, etwas davon zu probieren.
Stattdessen zwang ich mich zur Ruhe und sortierte meine Gedanken. »Heute habe ich an der Einführungsveranstaltung von Mézangauscher Heroismus teilgenommen.«
»Dann würde ich wohl auch so müde aussehen.«
Ich ignorierte Sandrines Bemerkung. »Professor D’Amboise hat mit uns die Katakomben besucht.«
»Warum muss ich mir für das Studium die Augen aus dem Kopf lesen, während du den Pariser Untergrund unsicher machen darfst?« Sandrine zog eine Schnute und säuberte die vor Fett glänzenden Finger an einer Serviette.
»Das liegt in der Natur der Sache. Magiegeschichte und Literatur sind nun mal theoretische Fächer«, erinnerte ich sie.
Schon nach der Einführungsphase hatte sie Zweifel an ihrer Studienrichtung geäußert. Allerdings war Sandrine mit verbissenem Ehrgeiz gesegnet und beendete, was sie begonnen hatte. Inzwischen arbeitete sie nebenbei in der Redaktion der Zeitung Les Nouvelles, ein Ausgleich zum langweiligen Unterricht. Ihre Worte, nicht meine. Im Rahmen eines interdisziplinären Moduls hatte ich in der Vergangenheit Veranstaltungen der Magiegeschichte besucht und teilte ihre Meinung über den Langeweilegrad der Inhalte nicht.
Sandrine schnitt eine Grimasse. »Aufmerksam sein bei der Studienwahl.« Sie seufzte. »Die Katakomben also. Darüber habe ich im letzten Semester eine Hausarbeit geschrieben.«
Sandrine hatte mit der Bestnote abgeschlossen. Allerdings hatte sie an den Tagen vor der Abgabe aus Nervosität mehr gebacken, als wir zu zweit hatten essen können, und so hatte ich kurzzeitig den Lieferdienst gemimt und die Nachbarschaft mit den Leckereien meiner Mitbewohnerin versorgt.
»Deshalb habe ich dich hergebeten.« Auf einmal schien dem Raum sämtlicher Sauerstoff entzogen worden. Das Atmen fiel mir schwer und mein Puls beschleunigte sich in ungesundem Maße. Die Anspannung ließ mich nicht länger still sitzen. Ich sprang vom Hocker und tigerte durch den Raum. Sandrines Verwirrung war ich mir nur allzu bewusst.
»Um mit mir über diese Hausarbeit zu sprechen? Eigentlich wollte ich nie wieder an diese leidige Episode meines Studentinnenlebens denken!«
Mir entfuhr ein fast schon hysterisches Kichern, das Sandrine mit hochgezogenen Brauen quittierte. »Es geht nicht um diese Arbeit, sondern um die Katakomben. Warst du je dort?«
»Natürlich. Ich habe sie zu Recherchezwecken besucht. Ein verdammt unheimlicher Ort.«
»Was du nicht sagst«, murmelte ich und fuhr mir durchs Haar. Einige hellbraune Strähnen lösten sich aus der Klammer an meinem Hinterkopf und fielen mir ins Gesicht. Ich wischte sie beiseite und zerstörte das, was nach einem langen Unitag von der Frisur übrig geblieben war. Dann gab ich Sandrine eine Kurzfassung von dem, was ich in den Eingeweiden der Stadt erlebt hatte. Das Flüstern, die Gegenwart von Magie. Eine Möglichkeit, die ich nie zuvor in Betracht gezogen hatte.
Der Ausdruck, mit dem Sandrine mich bedachte, war mir fremd. Bewunderung lag darin, etwas, das sie mir bislang nicht entgegengebracht hatte. Seit zwei Jahren teilten wir uns schon eine Wohnung in der Rue Ravignan im 18. Arrondissement. Ein so winziger Raum bot keinen Platz für Geheimnisse. Sandrine war mir näher als irgendein anderer Mensch. Doch für meine exzessiven Forschungen und die fast schon exzentrische Faszination für Magie hatte sie wenig übrig.
»D’Amboise erwähnte etwas, das mich auf eine Idee gebracht hat«, beendete ich den Monolog und musste schlucken. Sandrines gespannte Erwartung steigerte meine Nervosität. Sie saß mit überkreuzten Beinen auf einem der Hocker. Den Mantel hatte sie inzwischen abgelegt. Das lange blonde Haar fiel ihr glatt über die Schultern und umspielte den Rüschenrand ihrer dunkelgrünen Bluse. Neugierde und Ungeduld glommen gleichermaßen hinter ihrer Brille in den hellblauen Augen. Ich ahnte, dass ich ihren Blick als Nächstes in Unglaube verwandeln würde.
»Wenn ein Mensch stirbt, hinterlässt er Energie«, sagte ich langsam. »Und Energie ist nichts anderes als Magie in ihrer rohen, unverbrauchten Form. Die Katakomben sind voll davon. Wir müssen sie uns einfach nur zunutze machen.«
»D’accord«, meinte Sandrine und zupfte die mit Perlen verzierte Klammer aus ihrem Haar, um ihre hellblonden Strähnen neu zu arrangieren und festzustecken. »Da gibt es nur ein Problem: Die Magie ist fort, Amelie. Oder hast du das vergessen?«
Wie könnte ich das je, wenn es für mich um so viel mehr ging als um den Wunsch, lediglich Magie wirken zu können? Früher waren es die Geschichten meines Grand-Papas gewesen, die meinen Willen geschürt hatten, mehr über Magie herauszufinden. Heute war es die Dringlichkeit meiner Situation, denn es ging für mich um nicht weniger als Leben und Tod. Das mochte pathetisch klingen, war aber nichts anderes als die Realität. Eine, die mir in schwachen Momenten Angst einjagte, weil sie mir meine eigene Sterblichkeit bewusst machte, mich in anderen Momenten motivierte, durchzuhalten. So wie jetzt.
Meine Welt war dem Untergang geweiht. Die Seine hatte sich schwarz gefärbt und trat regelmäßig über die Ufer, Feuer wüteten in verschiedenen Teilen der Stadt und Gebäude, die mit Magie errichtet worden waren, zerfielen. In anderen Städten sah es ähnlich düster aus.
Das Universitätsgebäude mochte noch so imposant wirken mit seiner schmuckvollen Architektur, aber auch hier verbargen sich hinter den Säulen feine Risse im Gemäuer. Von dem Kuppelfresko an der Decke über uns blätterte die Farbe ab. Sie rieselte in bunten Schuppen wie Blätter im Herbst zu Boden. Das schummrige Licht verschleierte den schleichenden Zerfall, so wie ich ihn unter meiner Kleidung versteckte und hinter einem Lächeln verbarg. Aber er war da und wenn ich keinen Weg fand, um ihn aufzuhalten, würde ich alles verlieren, mich verlieren.
»Was weißt du über Namensmagie?« Nun hämmerte mein Herz im Gleichklang mit meinen hektischen Schritten, während ich durch den Raum lief.
Spannung knisterte zwischen uns in der Luft. Wie ein Funke sprang sie auf Sandrine über. Meine Mitbewohnerin ließ von ihrem Haar ab und rutschte bis zur Kante des Hockers vor. »Nicht viel. Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts gab es Forschende, die sich damit beschäftigt haben. Aber über Denkansätze haben sie es nie hinausgeschafft und die Fachwelt hat sie belächelt. Im Grunde genommen ging es darum, dass das Wissen um Namen Macht verleiht.«
»Der Name einer Person, eines Gegenstandes oder eines Tiers ist unwiderruflich mit dessen innerstem Wesen verbunden«, sagte ich. »Wenn man ihn kennt, erlangt man Macht.«
»Die Rumpelstilzchen-Theorie«, bestätigte Sandrine nickend. »Und du glaubst …« Sie unterbrach sich. »Was glaubst du eigentlich?«
Sekunden der Stille dehnten sich zwischen uns aus. Draußen erklangen die Sirenen eines Krankenwagens. Die Schreibtischlampe flackerte, beschwor Schatten, die in den Ecken des Raumes lauerten.
Ich räusperte mich. Auf einmal war meine Kehle eng. »Dass das Verbrennen des Namens einer verstorbenen Person die verbliebene Energie aktivieren könnte.«
Sandrine griff erneut in ihr Haar, hielt dann jedoch inne, als hätte sie sich selbst dabei ertappt. »Wie kommst du ausgerechnet darauf?«
Es war an der Zeit, die Details, die ich bei der kurzen Zusammenfassung über meinen Aufenthalt in den Katakomben ausgelassen hatte, zu ergänzen. Ich schluckte. »Weil ich es getan habe.« In wenigen Worten schilderte ich, wie die Kerzen erloschen und wieder aufgeflammt waren, und von allem, was dazwischen geschehen war. Ein verbrannter Name. Tanzender Magiestaub.
Die Bewunderung auf Sandrines Gesicht verwandelte sich in tiefe Ehrfurcht, die ihre Augen funkeln ließ. »Wie lautete der Name?«
»Célestine Bonnet.«
Sandrine zog die Nase kraus. »Langsam verstehe ich, welche Rolle ich dabei spiele.« Sie faltete die Tüte, in der sich noch ein paar Pommes und ein vergessener Burger befanden, und stellte sie beiseite. »Es war die Familie Bonnet, die verhindern wollte, dass die Katakomben als Massengrab benutzt wurden, weil sie ihre einzige Tochter in der Nähe wissen wollte. Célestine Bonnet«
»Sie konnten nichts dagegen unternehmen, richtig?«, mutmaßte ich und Sandrine schüttelte den Kopf.
»Célestine wurde wie unzählige andere unter die Erde gebracht, aber nie begraben.«
»Ich brauche mehr Namen von Toten in den Katakomben.« Aufregung ließ meine Stimme brüchig werden und meine Wangen fiebrig erröten.
Zahlreiche Experimente und Nächte, in denen ich mich durch endlose Magiekonzepte gequält hatte, prägten die vergangenen Jahre. Julien hatte recht, wenn er andeutete, dass ich neben dem Studium kein Leben hatte, und die Tatsache, dass sich mein Freundeskreis auf nur zwei Person beschränkte, von denen eine nebenbei meine Mitbewohnerin war, sprach ebenfalls für sich. Aber all die Opfer waren es wert, wenn ich am Ende überlebte.
Das gleichmäßige Kratzen eines Füllers brach die angespannte Stille im Labor. Sandrines Haare fielen ihr wie ein Vorhang über die Schultern und verbargen das Papier, das sie seit ein paar Minuten beschrieb. Ich zog Kreise um den Tisch und zwang mich, ruhig zu atmen, obwohl sich mein Körper anfühlte, als wäre ich einen Marathon gelaufen. Ausgelaugt, aber voller Adrenalin.
Die Friedhöfe waren Ende des 18. Jahrhunderts nach behördlichem Beschluss radikal geräumt worden. Es gab keine Gedenktafeln mit den Namen jener Toten, die die Ewigkeit in den Katakomben fristeten. Doch Sandrine war im Rahmen ihrer Recherche auf einige von ihnen gestoßen.
Als sie den Kopf hob, fing ich ihren Blick auf. Abwartend, ein wenig unbehaglich. »Und du bist dir mit diesen Namen absolut sicher?«
»Das sind alle, an die ich mich erinnere. Es gibt ein Buch, auf das ich mich in der Hausarbeit bezogen habe. Ein Register, in dem Tote, die von den Friedhöfen in die Katakomben überführt wurden, gelistet wurden. Es befindet sich in der Sammlung des Musée de la Magie. Erinnerst du dich?«
Ich nickte, denn ich hatte meinen Chef Gaspard Chevalier darum gebeten, es für Sandrine ausleihen zu dürfen. Neben dem Studium arbeitete ich für ihn als Museumsführerin und hatte Zugang zu sämtlichen Ausstellungsstücken.
Mit einer banalen Endgültigkeit legte Sandrine den Füller beiseite und reichte mir das vollgeschriebene Papier. Ihre Handschrift ergoss sich schwungvoll über das Blatt und wenn ich richtig lag, bildete es die Worte, die die Macht haben könnten, die Magie zurückzuholen. Unsere Welt für immer zu verändern.
Dann deutete Sandrine auf die Rauchmelder, die unter der Decke hingen und gelegentlich blinkten. »Ob es wohl ratsam ist, hier drin etwas abzufackeln?« Ihre Stimme triefte vor Sarkasmus, was ich ignorierte.
»Julien hat hier vor ein paar Monaten geraucht. Wenn wir kein Lagerfeuer anzünden, wird schon nichts passieren.«
»Die Magie ist 1857 verschwunden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Leute damals ständig Feuer gemacht haben, um zu zaubern. Gab es damals schon Streichhölzer?«
»Schwefelhölzer«, antwortete ich. »Die sind noch viel älter.« Ich zückte das Smartphone und überprüfte diese Behauptung. »Ja, hier steht, dass es Schwefelhölzer bereits um 600 gab, das erste Streichholz wurde um 1826 erfunden.«
»Na schön.« Sandrine biss auf ihre Unterlippe und fuhr mit dem Nagel des Zeigefingers die Namensliste nach. »Und du glaubst, dass es funktionieren wird?«
Fiebrige Erwartung ergriff Besitz von mir, als ich ein Feuerzeug aus den Untiefen meiner Tasche beförderte und die Flamme aufschnappen ließ. Sie machte die Dunkelheit um uns herum dichter, warb mit ihrem orangeroten Tänzeln um Aufmerksamkeit. Ich hörte das Echo jener Stimmen aus den Katakomben und wusste, dass eine durchaus realistische Möglichkeit bestand, in dieser Nacht ein Stück Geschichte zu schreiben.
Raphael
Irisierendes Blau. Leuchtende Farben. Wabernde Schatten. Das Mikroskop offenbarte mir eine vollkommen neue Welt. Ich tauchte in das abstrakte Bild, das sich mir bot, beobachtete verschiedene Zellformen und skizzierte die Reaktion von Chloroplasten, Vakuolen und Mitochondrien auf Magiezufuhr. Das Leuchten des Präparates hatte sich nach stundenlanger Arbeit in meine Netzhaut gebrannt, erfolgreich war ich allerdings nicht gewesen.
Vor über drei Jahren hatte ich mich für Magiezin eingeschrieben, um Maligne Magieplasie zu erforschen und nach einem Heilmittel zu suchen. Dabei handelte es sich um eine Erkrankung des blutbildenden Systems, das ich durch Zuführung von Restmagie zu stabilisieren versuchte. Klang in der Theorie einfacher, als es praktisch war, denn nach mehreren Semestern und meinem Job als Laborassistent beim größten Magie-Tech-Unternehmen weltweit war ich noch keinen Schritt weiter und mir saß die Zeit im Nacken. Wenn ich scheiterte, würde ich mehr verlieren als den Sinn meines Studiums. Allein die Vorstellung sorgte dafür, dass es mich kalt überlief und meine Hände zu zittern begannen. Deshalb war Scheitern keine Option.
Ich lehnte mich zurück, blinzelte gegen die blauen Punkte an, die vor mir tanzten. Mein Rücken ermahnte mich, dass es Zeit wurde, Feierabend zu machen, und bestrafte meine verkrampfte Haltung mit einem scharfen Stechen. Der Grund, aus dem ich all das tat, rechtfertigte den Umstand, dass ich mich selbst vernachlässigte.
Nacheinander knackten meine Wirbel, als ich mich streckte. Dann entfernte ich den Objektträger, beschriftete das Präparat und schaltete das Mikroskop aus. Zurück blieb eine Dunkelheit im Raum, die mir deutlich machte, wie lange ich an den Hausaufgaben für Magische Zellreaktionen gearbeitet hatte. Eindeutig zu lange, denn inzwischen waren die anderen Arbeitsplätze verwaist, der Saal war leer. Draußen hatte sich die Nacht der Stadt bemächtigt.
Ich packte die Tasche und trat hinaus auf den Gang. Stille lag über dem Universitätsgebäude und erinnerte mich einmal mehr daran, dass ich es bereits am dritten Tag des neuen Semesters deutlich übertrieben hatte. Vor einem Jahr hatte mich der Hausmeister eingesperrt, nachdem ich bis weit nach Mitternacht über dem Mikroskop verbracht hatte. Damals hatte ich hier übernachten und mich am Morgen, nachdem mich ein Angestellter der Putzfirma gefunden hatte, dem Dekan erklären müssen – und mir danach geschworen, das Lernpensum auf ein normales Level zurückzuschrauben. Was mir heute missglückt war. Ich schrieb es der Euphorie des neuen Semesters und der Dringlichkeit meiner Lage zu. Eine gefährliche Mischung für einen gesunden Biorhythmus.
Das Licht der Stadt fiel durch die hohen Fenster und zeichnete mir einen Weg durch die Dunkelheit. Der Klang meiner Schritte im leeren Gang war mir befremdlich, war das Gebäude tagsüber doch von dem Summen unzähliger Gespräche erfüllt. Als ich um eine Ecke bog, um den Magiezinischen Trakt zu verlassen, stellte ich fest, dass ich nicht der einzige Studierende war, den an diesem Abend der Ehrgeiz gepackt hatte.
Die Tür zum Magiewissenschaftlichen Labor war nur angelehnt. Licht strömte durch den Spalt in den Gang und lockte meine Neugier. Um die Person vor einer unfreiwilligen Übernachtung im Universitätsgebäude zu warnen, trat ich näher.
Zuerst glaubte ich mich zurück hinter meinem Mikroskop, das mir eine Welt eröffnete, die zu betreten der Menschheit unmöglich geworden war. Dann begriff ich, dass das, was ich sah, echt war.
In der Mitte des Raumes stand eine Frau.
Im Nachhinein muss ich mich für diese Beobachtung beglückwünschen, denn der schwarze Rauch, der um sie herumwirbelte, stellte eine ziemlich große Ablenkung dar. Er war durchsetzt von goldenen Partikeln, die sich in den dunklen Fenstern spiegelten und das Labor in ein irisierendes Licht hüllten.
Das war nicht möglich. Es konnte einfach nicht sein. Ich war überarbeitet, mein Gehirn strafte mich ab, indem es mir einen Streich spielte. Das war die einzige Erklärung, denn niemand unserer Zeit war in der Lage, Magie zu wirken. Nicht auf diese Art und nicht in diesem Umfang.
Unmöglich.
Meine Gedanken setzten aus und dass ich den Atem anhielt, merkte ich erst Sekunden später, als ich keuchend nach Luft schnappte. Um den Laut zu ersticken, schlug ich mir beide Hände auf den Mund. Aber die Frau bemerkte mich nicht. Sie schloss die Lider. Die Magie spielte mit ihr, zog an ihrem hellbraunen Haar, bauschte ihre Kleidung auf. Merde! Scheiße, das hier war einfach unmöglich. Asclépios Industrielle, der mächtigste Magie-Tech-Konzern der Welt, suchte seit Jahrzehnten nach einem Weg, die Magie zurückzuholen. Erfolglos. Wie konnte das eine Studentin in einem behelfsmäßigen Labor der Sorbonne-Paris schaffen?
In dem Moment hob die Frau die Lider und drehte beide Handflächen nach oben. Fasziniert beobachtete ich, wie sie zwei Flammen schuf. Der von goldenen Partikeln durchsetzte Rauch wirbelte schneller und löste sich auf, als sie sich in Feuersäulen verwandelten und gen Decke schossen.
»Amelie!« Der Schrei einer zweiten Frau, die mir bisher nicht aufgefallen war, gellte durch den Raum und alles wurde dunkel. Ein dumpfes Geräusch erklang, wie ein Körper, der auf den Boden prallte.
Ich hielt den Atem an, versuchte, die Finsternis zu durchdringen. Es gelang mir erst, als die zweite Frau auf einen Lichtschalter schlug und zwei Röhrenlampen an der Decke flackernd zum Leben erwachten.
Amelie lag reglos am Boden. Das hellbraune Haar war zerzaust und verbarg ihr Gesicht vor mir. Ohne darüber nachzudenken, trat ich vor. Aber sie richtete sich in dem Moment auf, da ich die Hand auf die Klinke der Tür legte. Ich hielt inne, begegnete ihrem Spiegelbild in den dunklen Fensterscheiben. Ihr Blick war direkt auf mich gerichtet.
Ich ließ die Klinke los, als hätte ich mich verbrannt. Rückwärts taumelnd brachte ich Abstand zwischen mich und diese Frau und dem, was ich gerade gesehen hatte.
»Da ist jemand!«, erklang eine Stimme, in der Bestürzung mitschwang, und ich war mir sicher, dass es Amelies war, denn sie klang um eine Nuance tiefer als die der anderen Frau.
Schritte näherten sich, die Tür wurde aufgestoßen. Aber ich hatte den Treppenabsatz bereits erreicht und hastete die Stufen hinab. Stahl das Geheimnis, das mir anzuvertrauen sie zweifelsohne nicht beabsichtigt hatten.
»Amelie Fournier.«
»Wie bitte?«
»Amelie Fournier. Sie ist der Grund, aus dem deine Geräte hier in der letzten Nacht verrückt gespielt haben.« Demonstrativ tippte ich gegen einen der Flatscreens, über den ein Band aus für mich unleserlichen Codes huschte.
Es war ein Leichtes gewesen, ihren vollständigen Namen herauszufinden. Sie selbst war in den sozialen Netzwerken unsichtbar. Ganz im Gegensatz zu ihrer Mitbewohnerin Sandrine Perreault: dreiundzwanzig Jahre alt, erstes Semester im Masterstudiengang Magiegeschichte und Literatur, Kaffee-Junkie und Hobbyköchin. Durch Sandrine hatte ich Amelie Fournier in einem Blogpost der Magiewissenschaftlichen Fakultät entdeckt. Sie hatte im vergangenen Jahr den ersten Platz des César-Mézangeau-Preises für moderne magietheoretische Konzepte gewonnen und war händeschüttelnd mit dem Dekan in dem Labor abgelichtet worden, in dem sie in der letzten Nacht etwas geschafft hatte, wovon andere nur träumen konnten.
Fleißige Frau.
Davide schob sich die dicke Brille zurück auf die Nase. Eine Geste, die mir in den letzten Monaten, seit ich als Laborassistent für Asclépios Industrielle arbeitete, vertraut geworden war. Ebenso wie seine hagere, fast schon zerbrechlich wirkende Statur und das Haar, das er in einem unordentlichen Knoten trug. Die meisten in unserem Alter verwendeten viel Zeit darauf, es so aussehen zu lassen. Bei Davide war es seinen Marotten geschuldet. Ständig brauchten seine Hände Beschäftigung. Wenn sie nicht gerade über die Tastatur flogen, um etwas zu programmieren oder zu hacken, fuhr er sich durch die Haare und löste die gebändigten Strähnen.
»Woher weißt du davon?« Misstrauen färbte die Stimme meines Arbeitskollegen tiefer und er blinzelte zu mir hoch. Hinter den Gläsern der Brille wirkten seine Augen größer und eine Nuance dunkler, als sie es eigentlich waren.
Ich warf einen Blick über die Schulter, ehe ich ihm antwortete. Niemand schenkte uns Beachtung. Die Kollegen der Informatik konzentrierten sich allesamt auf die Bildschirme vor ihnen und hämmerten auf die Tastaturen ein.
»Weil ich Zeuge wurde, wie sie Magie angewandt hat«, flüsterte ich.
»Sie … Moment. Was?« Die schüchterne Art fiel von Davide ab, als er sich schwungvoll erhob. Der Drehstuhl rollte durch die Bewegung zurück und knallte lautstark gegen den Schreibtisch. Die Monitore erzitterten unter dem Aufprall und eine der IT-Mitarbeiterinnen sah mit zusammengekniffenen Augen in unsere Richtung. »Verarschst du mich?«, keuchte mein Kollege und musterte mich.
Ich machte eine entschuldigende Geste in Richtung der Frau und bedeutete Davide, leise zu sein. Seinen Stuhl nahm ich in Beschlag und ließ mich darauf fallen. »Ich wünschte, das täte ich. Letzte Nacht bin ich unfreiwillig Zeuge geworden, wie sie …« Ich wedelte mit der Hand. »Du weißt schon.«
»Der Scanner hat eine ungewöhnlich starke Dichte an Magiepartikeln gemessen.«
Davide beugte sich stehend über seinen Arbeitsplatz, bewegte den Mauszeiger über den Screen und öffnete eine Karte. Sie zeigte Paris zu verschiedenen Uhrzeiten. Gegen zehn Uhr abends bildete sich über dem 5. Arrondissement eine dichte Wolke goldener Punkte.
»Ich dachte, es wäre ein Fehler im Code«, fuhr Davide fort und betrachtete die Aufnahme. »Ich habe den gesamten Morgen damit verbracht, ihn zu finden. Aber das … damit hätte ich nicht gerechnet. Hast du es schon gemeldet?«
Die Frage hatte durchaus ihre Berechtigung. Ich wusste, dass es das Erste war, was ich hätte tun müssen. Aber Skrupel hielten mich zurück, weil ich nicht wusste, wie mein Arbeitgeber mit dieser Entdeckung durch eine Studentin umgehen würde. Auch wenn wir Mitarbeitenden uns einer guten Sache verschrieben hatten, war AI letztendlich auch nur ein Wirtschaftsunternehmen, das am Ende des Jahres genügend Geld machen musste. In der Vergangenheit hatte man bereits die Ansätze anderer Forschender nachverfolgt. Was, wenn sie das auch mit Amelies Arbeit taten und diese an sich rissen? Mir die Möglichkeit nahmen, selbst davon zu profitieren? Nein, was das anging, musste ich bedacht vorgehen.
»Hast du es getan?«, entgegnete ich herausfordernd.
Davide errötete. »Na ja, ich dachte, ich hätte Mist programmiert, also …«
Ich nickte.
»Die Sache ist zu groß, um es nicht zu melden. Du könntest deinen Job verlieren, wenn du es nicht tust. Schlimmer noch. Ich könnte meinen Job verlieren.« Davide stöhnte gequält. »Ich mag meinen Job.«
»Niemand wird seinen Job verlieren«, meinte ich und rieb mir das Kinn. »Wir melden es. Aber, Davide, kannst du mir einen Gefallen tun?«
Er hob die Schultern. »Klar, was gibt’s?«
Ich zögerte. »Kannst du ein Auge auf Amelie haben?« Die Bitte war ungewöhnlich und entsprang dem Wunsch, die Kontrolle über diese Situation zu erlangen, die mir möglicherweise einen Ausweg aus meiner eigenen bot.
Auf die Frage folgte eine kurze Stille, bis Davide sie mit einem Seufzen beendete. »Du bist dir bewusst, dass wir hier die Grenze des Legalen überschreiten? Datenschutz ist in diesem Land ein äußerst sensibles Thema.«
»Und genau darum geht es, oder? Sie zu schützen. Was, wenn jemand erfährt, was sie da tut, und aus den falschen Gründen Interesse an ihr entwickelt? Ihre Erkenntnisse könnten für unsere Forschungen von unfassbarem Wert sein.«
»Ich passe auf sie auf«, versprach Davide. Ich verspürte in einem Maße Erleichterung, die Besorgnis hätte in mir erregen können. Ich sollte mich nicht derart für diese Frau interessieren. Und doch tat ich es. Denn immerhin hatte sie etwas geschafft, das die gesamte Welt für unmöglich gehalten hatte. Das barg eine gewisse Gefahr, die Aufmerksamkeit falscher Personen auf sich zu ziehen. Davon beschäftigte Asclépios Industrielle einige, die Amelies Forschung dem Meistbietenden verhökern würden, mal ganz abgesehen von den Antimagies, die um jeden Preis verhindern wollten, dass die Magie einen Weg zurück in die Welt fand.
Ich schob diese Gedanken beiseite, als ich merkte, dass mein Schweigen zu lange währte. Mit einem Räuspern nahm ich unser Gespräch wieder auf. »Gut, ich spreche mit Lucille.«
Sie war meine direkte Vorgesetzte und der Inbegriff von Diskretion und Professionalität. Wenn jemand wusste, wie wir mit dieser Situation umgehen sollten, dann sie.
Natürlich hatte Lucille keine Ahnung. Aber es gab das Département für die Verwaltung magischer Angelegenheiten, denen wir den Vorfall melden könnten, eine Abteilung, die von Asclépios Industrielle gefördert wurde, die dieser Tage allerdings reichlich wenig zu tun hatte.
»Wie kann eine junge Frau schaffen, was wir seit Jahren versuchen?« Lucille stand mit dem Rücken zu mir und gab vor, das einzige dekorative Bild im Raum zu betrachten. Anspannung zeichnete sich deutlich in der Art und Weise ab, wie sie ihre Schultern hielt. »In diesem Haus arbeiten die besten Forschenden der Welt und beißen sich an der Frage, wie wir die Magie reaktivieren, die Zähne aus. Wer zur Hölle ist diese Frau?«
»Ich kenne sie nicht und online habe ich nicht viele Informationen über sie gefunden. Sie hält sich aus den sozialen Netzwerken raus, lebt für ihr Studium.«
»Natürlich tut sie das. Wie sonst hätte sie das größte Rätsel unserer Geschichte lösen können?« Anerkennung und Neid schwangen gleichermaßen in Lucilles Stimme mit.
Sie hatte sich der Wissenschaft verschrieben und die Universität als jüngste Doktorandin verlassen, bevor sie bei AI angefangen hatte, wo sie inzwischen die Abteilung Zelluläre Magiescopie leitete. Ihr größter Erfolg war die Beobachtung, dass eine kranke Zelle auf den Kontakt mit Restmagie reagierte. Seit Jahren versuchte sie, daran anzuknüpfen. Vergeblich. Amelie hingegen könnte den Schlüssel zur Decodierung magischer Krankheiten in den Händen halten, denn die Maligne Magieplasie wurde durch den Magiefall ausgelöst. Im Umkehrschluss gingen Forschende davon aus, dass die Krankheit geheilt werden würde, wenn man es schaffte, die Magie zurückzuholen. Und das machte Amelie für mich so wertvoll.
»Weißt du, wie sie es gemacht hat?«, fragte Lucille.
»Es war dunkel und ich habe nicht alles mitbekommen.«
Schließlich wandte sie sich mir doch noch zu. Eine Falte zwischen ihren Brauen verunzierte ihr makelloses Gesicht und bezeugte ihre Ratlosigkeit. »Und du bist dir sicher?«
»Du glaubst mir nicht?« Ihre Frage kränkte mich, dennoch konnte ich sie ihr nicht verübeln. Wenn Davide mir nicht den gestiegenen Magiewert bestätigt hätte, hätte ich die Ereignisse der letzten Nacht möglicherweise als Nachwirkung auf mein hohes Arbeitspensum verbucht.
»Es geht nicht darum, ob ich dir glaube, sondern was ich der Chefetage oder alternativ dem DfdVmA erzähle. Wie, denkst du, klingt das, wenn eine unbedeutende junge Frau die größte Entdeckung unserer Zeit macht statt das Team aus den weltbesten Forschenden. Da werden Köpfe rollen. Allerdings will ich vermeiden, dass meiner dazugehört. Also sollten wir herausfinden, was dahintersteckt. Ob es eine einmalige Sache war. Um unseretwillen.« Lucille fasste in ihren akkuraten Pferdeschwanz und befreite mit dieser Bewegung einige Strähnen aus der Frisur. Eine unkontrolliertere Geste hatte ich an dieser sonst so beherrschten Frau nie zuvor beobachtet. »Wir sollten uns gut überlegen, wie wir vorgehen«, sagte sie und betrachtete ihre Hände, als könnte sie nicht glauben, was sie gerade damit angestellt hatte. Die Strähne, die ihr nun ins Gesicht fiel, pustete sie ungehalten zurück. »Sichergehen, dass wirklich passiert ist, was du geglaubt hast zu sehen.«
»Was immer das war, Davides Scanner hat es aufgezeichnet.«
Lucille hob das spitze Kinn. »Ich vertraue deinem Urteilsvermögen. Und Davides Genie. Aber bevor wir die Angelegenheit nach oben weitergeben, sollten wir uns absolut sicher sein.«
Ich nickte. Zweifelsohne war das die unbedenklichste Strategie für uns alle. Außerdem bot sie mir genügend Zeit, meine Optionen abzuwägen. Ich musste herausfinden, ob Amelies Forschung imstande war, meine Probleme zu lösen. Am besten, bevor andere davon erfuhren.
»Na schön.« Lucille seufzte. »Davide soll den Magiewert in der Umgebung der jungen Frau checken und du heftest dich an ihre Fersen.«
Ich riss die Augen auf und begegnete der Entschlossenheit in der Miene meiner Vorgesetzten. »Lucille, ich bin Laborassistent und kein Geheimagent.«
»Aber du bist mein Laborassistent. Wenn du dein Gehalt am Ende des Monats auf deinem Konto begrüßen willst, musst du tun, was ich sage.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert …«
»Raphael, du bist der Einzige, der sich dieser Frau unauffällig nähern kann. Woran arbeitest du gerade?«
»Ich unterstütze Marie in der Auswertung der Präparate nach Injektion magischen Materials in gesundem Gewebe.«
»Gut. Das schafft sie allein.« Lucille massierte sich die Nasenwurzel. »Ich kann dich nicht dazu zwingen, diese Frau im Auge zu behalten. Aber ich bitte dich darum. Du weißt, was das für unsere Forschung bedeuten könnte.«
»Für unsere Forschung? Verdammt, für die ganze Welt.«
Mein Widerstand war dahin, meine Neugier zu groß. Ich wollte herausfinden, wer Amelie Fournier war. Ob sie tatsächlich eine Möglichkeit gefunden hatte, die mich mein kaputtes Leben kitten ließ.
Nach dem Gespräch mit Lucille packte ich meine Tasche, während Marie sich darüber mokierte, dass ich sie im Stich ließ. Ich nutzte ihre Aufregung, griff in den Steckkasten, in dem sie beschriftete Magiepräparate sammelte, und schob mir zwei der Reagenzgläser in die Hosentasche. Am Anfang war es ein Nervenkitzel gewesen, die Proben aus dem Gebäude zu schmuggeln, aber das Sicherheitspersonal kontrollierte allenfalls Rucksäcke, wenn es nicht damit beschäftigt war, sich über das Wetter zu ärgern, das zu heiß, nass oder kalt war, abhängig von der Jahreszeit, in der wir uns gerade befanden.
Davide sah auf, als ich an die Tür zum Büro der Informatiker klopfte. Rote Flecken zeichneten sich deutlich auf seiner blassen Haut ab und bezeugten seine Nervosität.
»Und?«, raunte er mir zu, damit seine Kollegen ihn nicht hören konnten.
»Lucille weiß Bescheid«, erwiderte ich ebenso gedämpft. Mit dem Kinn wies ich auf seinen Computer. »Kannst du herausfinden, wo Amelie gerade steckt?«
»Klar«, sagte Davide, schob die Brille zurecht und klickte sich durch ein paar seiner Programme. Bis er eine Antwort für mich hatte, verging erschreckend wenig Zeit. »Sie ist in der Uni.«
»Und das sagt dir diese Karte da?« Stirnrunzelnd betrachtete ich das, was der Magiescanner auf dem Bildschirm darstellte.
»Nee«, meinte Davide und deutete auf eine andere Anwendung, eine Liste unterschiedlich langer Zahlen. »Der Scanner dokumentiert nur die Magiedichte. Aber hiermit kann ich herausfinden, wann sie mit ihrer Schlüsselkarte die Uni betreten hat.« Er beugte sich vor. »Um 9:43 Uhr. Seitdem hat sie das Gebäude nicht mehr verlassen. Hab das Sicherheitssystem der Uni gehackt.«
»Du … wow.« Ich schüttelte den Kopf. »Das ist gruseliger als die Vorstellung, dass es da eine Frau gibt, die imstande ist, Magie zu wirken.«
Ein verlegenes Lächeln zeigte sich auf Davides Gesicht. »Das ist mein Job.«
Ich klopfte ihm auf die Schulter. »Danke, Kumpel. Behältst du sie im Auge und meldest dich, falls du etwas Ungewöhnliches bemerkst?«
»Was hast du vor?«, wollte er wissen.
»Feldstudien betreiben.«
In den letzten Jahren meines Studiums und in der Zeit bei AI hatte ich mehrere Experimente durchgeführt. Dieses hier war das angenehmste von allen, dessen war ich mir sicher, als ich die Cafeteria betrat und mir der aromatische Duft von Kaffee entgegenschlug. In anderen Fakultäten wurde eine undefinierbare braune Brühe ausgeschenkt, aber seit ein Barista im Hauptgebäude eingezogen war, investierte ich hier mein hart erarbeitetes Geld in Koffein.
Ich reihte mich in die Schlange vor der Theke ein und sah mich unauffällig in dem großen Saal um. Viele Tische waren belegt. Studierende steckten die Köpfe zusammen. Ihre Gespräche summierten sich unter den hohen Decken zu einem monotonen Brummen. Es waren zu viele, um Amelie zwischen ihnen auszumachen.
Als ich an der Reihe war, bestellte ich einen Kaffee und dazu ein Croissant und machte mich mit der Beute auf in Richtung Ausgang. Am Ende eines langen Tisches war ein Platz frei, von dem aus ich die Tür einsehen konnte.
Parallel zu meiner Kaffeetasse leerte sich die Cafeteria, bis eine überschaubare Anzahl Studierender zurückblieb. Amelie war immer noch nicht zu sehen, dafür aber ihre Mitbewohnerin, die meine Aufmerksamkeit auf sich zog, indem sie sich erhob, das hellblonde Haar über die Schulter warf und den Blick auf Amelie freigab. Sie saßen nicht allzu weit von mir entfernt, Amelie schräg gegenüber saß ein Kerl mit breitem Kreuz. Leeres Geschirr stapelte sich auf den Tabletts vor ihnen. Sandrine gab dem Kerl die obligatorischen Küsschen, ehe sie sich zu Amelie beugte und ihr etwas zuraunte, was vor dem Typen verborgen bleiben sollte.
Ich verlagerte das Gewicht, bis ich Amelie direkt ansehen konnte. Sie sah nicht aus wie eine Frau, die letzte Nacht etwas vollbracht hatte, von dem die ganze Welt träumte. Feminine Kleidung, hellbraune Haare und ein herzförmiges Gesicht. Dass sie mir nicht schon zuvor an der Uni aufgefallen war, wunderte mich, denn sie war hübsch und sie hatte etwas an sich, das mich fesselte. Und wenn es nur das Wissen darum war, dass hinter ihrer Erscheinung weitaus mehr steckte, als man auf den ersten Blick erahnte.
Amelie schnitt eine Grimasse und brachte Sandrine damit zum Lachen. Auch mir entlockte das ein Schmunzeln, denn ihre Nase kräuselte sich dabei auf niedliche Art und Weise. Dann schulterte Sandrine ihre Tasche, drehte sich um und lief auf den Ausgang zu. Damit näherte sie sich unweigerlich meinem Beobachtungsposten. Ich nippte an dem Kaffee, als sie auf meiner Höhe war, und drehte die Tasse so, dass sie einen Teil meines Gesichts verbarg. Doch sie beachtete mich nicht, fixierte einen Punkt jenseits der geöffneten Türflügel und rauschte an mir vorbei.
Sobald sie fort war, senkte ich den provisorischen Schutzschild und konzentrierte mich auf Amelie und den Typen. Sie unterhielten sich. Besser gesagt, er hielt einen Monolog, ihr Blick schweifte immer wieder umher. Die Tatsache, dass er sie derart langweilte und es offensichtlich nicht einmal merkte, amüsierte mich. Vermutlich war jemand, der mit einer Intelligenz gesegnet war, die weit über unsereins hinausging, nicht an belanglosen Gesprächen interessiert. Ob der Typ wusste, dass er nicht in ihrer Liga spielte? Vermutlich nicht, denn er sprach unablässig weiter.
Schließlich ertönte der Gong, der den nächsten Unterrichtsblock ankündigte. Als hätte sie nur darauf gewartet, erhob sich Amelie. Sie sagte etwas, nahm ihr Tablett und brachte es zum dafür vorgesehenen Servierwagen. Der Typ trabte ihr nach und gemeinsam wandten sie sich in meine Richtung. Amelie hielt sich aufrecht und das Kinn hoch erhoben. Obwohl sie sehr viel kleiner war als er, wirkte es nicht so, als wäre sie sich dessen bewusst. Ihre Bewegungen waren präzise und souverän wie die einer selbstsicheren Person.
Ich vergaß die Tassen-Tarnung und starrte sie an, sehr viel faszinierter, als ich hätte sein dürfen. Als sie die Tür fast erreicht hatten, traf mich Amelies Blick. Ein leichtes Lächeln, das meinen Puls antrieb, huschte über ihr Gesicht. Doch als sie den Kopf drehte und diesen Typen ansah, und ich begriff, dass dieser Ausdruck nicht mir gegolten hatte, geriet er ins Stocken.