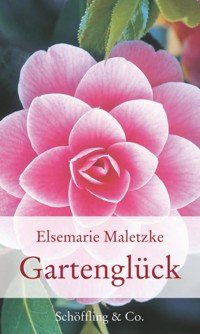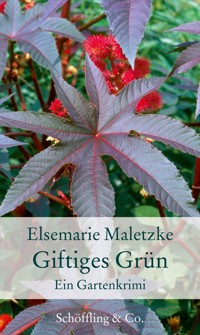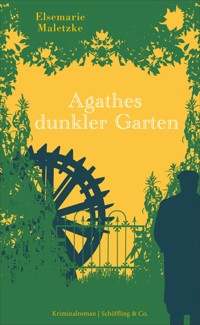11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Simon Jankowskis schwacher Punkt sind seine geliebten Magnolien. Um sie zu retten, lässt er sich auf einen gefährlichen Handel mit einem Erpresser ein. Denn Simon hat mehr als seinen Ruf und seinen Job zu verlieren. Der angesehene Wissenschaftler am Arboretum im polnischen Kórnik schmuggelt seltene und streng geschützte Pflanzen außer Landes.Als ihm ein Kollege auf die Schliche kommt und droht, ihn auffliegen zu lassen und die Magnolien im Arboretum zu vernichten, ist Simon bereit, als Kurier ein geheimnisvolles Päckchen nach Frankfurt mitzunehmen und es dort auf dem alten jüdischen Friedhof zu deponieren. Er nutzt einen Forschungsauftrag, um sich bei Elinor Sander einzumieten, von deren Garten er Zugang zum Friedhof hat. Doch die Übergabe scheitert; das Päckchen geht verloren. Als Elinor es findet, ist Simon dem Tod nah und Elinor wird zur Gejagten.In ihrem zweiten Gartenkrimi schreibt Elsemarie Maletzke spannend und mit gewohnt elegantem Schwung über einen höflichen Magnolienexperten und eine spröde Gärtnerin, die ein fremdes Verbrechen zusammenführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
1. Teil: Der Magnolienexperte
2. Teil: Der neunte Stein
3. Teil: Blausterne
Dank
Autorenporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
Magnolienmord
1. Teil
Der Magnolienexperte
Der Fuchs konnte das Wasser von weitem riechen. Er schlüpfte aus seinem Versteck unter dem Monument der Freifrau Mathilde von Rothschild und lief in der warmen Abenddämmerung seiner Nase nach durch die Platanenallee nach Osten, vorbei an geborstenen Säulen, abgestürzten Marmortafeln und Urnen mit verdorrtem Efeu; schnürte entlang der Mauer, die das strenge offene Gräberfeld der orthodoxen, das er klüglich mied, von den prunkvollen, baumbeschatteten Denkmälern der eher weltlich gesinnten Juden trennte, dem Duft des Wasser entgegen, der vom Ende der Mauer zu ihm heranwehte. Seit drei Monaten hatte es in Frankfurt nicht mehr geregnet und der Fuchs, der aus dem Geviert aus zwei Meter hohen Mauern und grauen Metalltoren nicht entkam, litt Durst. Die großen Platanen hatten begonnen, mitten im Sommer ihre Rinde abzuwerfen, die wie zerbrochene Ritterrüstungen auf den Wegen und um die weißen Stämme lag. Da die Gräber sich selbst überlassen waren, gab es auf dem alten jüdischen Friedhof an der Rat-Beil-Straße keine Brunnen, keine Gießkannen, keine Pfützen. In der Frühe leckte der Fuchs den Tau vom Gras.
Das Wasser kam und ging, klickte leise, winkte über die östliche Mauer und das eiserne Gattertörchen, regnete jenseits über Beete, die nun fast im Dunkeln lagen. Nur die weißen Blumen waren noch sichtbar. Es flog zurück, prasselte kurz auf einen Streifen harter Erde, erhob sich und verschwand wieder. Der leichte Bratengeruch des Phloxes konnte den Fuchs nicht irritieren; er folgte dem Wasser, sobald es über die Mauer kam, und schnappte mit erhobener Schnauze nach den Tropfen.
Elinor, die reglos auf dem Ziegelweg stand und dem Radschlagen des Gartensprengers zuschaute, sah durch die Eisenstäbe den Fuchs wie eine Erscheinung hin und her jagen. Sie füllte eine Blechschüssel mit Wasser, schloss das Tor auf und stellte sie draußen auf den Pfad. Kein Fuchs, aber am nächsten Morgen war die Schüssel leer. Elinor goss sie wieder voll und stellte einen Napf mit Trockenfutter daneben. Das Wasser war genehm, das Katzenfutter unter seiner Würde. So wurden sie miteinander bekannt.
*
Das Haus an der Ecke Rat-Beil-Straße, Friedberger Landstraße hatte Elinors Urgroßvater, der Architekt Conrad Sander gebaut, Mitglied einer alten Frankfurter Familie. Sein Ehrengrab lag jenseits der Mauer des jüdischen auf dem sehr viel größeren städtischen Hauptfriedhof und zeigte einen bärtigen Mann im Halbprofil, gerahmt von seinen Insignien, Lot, Zirkel und Zollstock. Eine von Sanders architektonischen Großtaten war die Bebauung der Friedberger Landstraße mit einer Zeile würdiger Wohnhäuser aus gelbem Klinker mit blauem Fachwerk im steilen Giebel.
Im Grundriss und in der Faltung ihrer schwungvollen Schieferdächer wichen sie ein wenig voneinander ab, aber ihre Türen und Fensterläden leuchteten im selben Blau und ihre Vestibüle waren bis zur halben Höhe mit glänzenden weinroten Kacheln und einer abschließenden feinen blauen Bordüre gefliest. Gedrechselte Geländer führten durch die Treppenhäuser, aber nach der Bel Etage für die am besten betuchten Mieter wurden die runden Holzknäufe auf den Pfosten und der Stuck an den Decken spärlicher und auf die Mansardenzimmer des Dienstpersonals hatte Architekt Sander keine Phantasie mehr verschwendet, geschweige denn an ein Kaminloch für das Ofenrohr gedacht. Hinter jedem Haus lag ein großer Garten mit einem Pavillon in der Mitte, umkränzt von Kieswegen, die jede Woche gerecht, und niedrigen Ligusterhecken, die zweimal im Jahr von einem Gärtner geschoren wurden.
Im Jahr der Erbauung war die Gegend noch fast ländlich; die Straße nach Friedberg eine Lindenchaussee und aus den Fenstern sah man jenseits der Straße auf Wiesen und Apfelbäume. Vorbei. Die Stadt war über alle Häuser bis auf das der Sanders hinweggegangen. Keiner, der sie nicht gekannt hatte und auch nur einen Tag nach ihrer Zerstörung die Straße entlangging, würde sie vermissen, dachte Elinor, keiner den Stolz und die Gediegenheit des Ensembles mehr würdigen. Die Nachbarschaft war an Autohäuser, Reifengroßhändler, einen Sanitärbedarf, eine Klopsbraterei und einen Baumarkt gefallen, die mit der Front zur vierspurigen Friedberger Landstraße und mit dem Rücken zur Friedhofsmauer standen. Nur Sanders Blauhaus hatte die Form gewahrt und seinen Garten behalten. Nun, nach Vaters Tod würde sie es mit Bibi teilen. Ich freue mich, dass meine kleine Schwester nach Hause kommt, sagte sie sich, aber bei dem Gedanken, dass sie Vaters Zimmer für sie ausräumen müsste, fühlte sie die Tränen aufsteigen.
*
Niemand nannte Bibi bei ihrem Namen Fabienne und tatsächlich passte der Zwitscherlaut besser zu ihrer Erscheinung, obwohl aus dem lispelnden blonden Mädchen von der Munterkeit einer Blaumeise eine etwas formlose Frau von Ende vierzig geworden war. Doch ihre hellen Augen, die immer ein wenig verblüfft in die Welt schauten, und die fröhliche Ungeniertheit, mit der Bibi ihre Wünsche durchzusetzen verstand, ließen noch immer an das Kind denken, dem die zehn Jahre ältere Elinor einmal Mutterersatz geworden war. Bibi hatte gerade laufen gelernt, als ihre eigene Mutter die Welt verließ. In den Augen der Hinterbliebenen war sie, die jüngere Tochter und kleine Schwester, nie über den Stand der nicht ganz leicht Erziehbaren hinausgewachsen. Und sie lispelte immer noch.
Bibi war nicht zu Vaters Beerdigung erschienen. Es sei alles viel zu schnell gegangen, beschied sie Elinor am Telefon, und natürlich könne sie das Atelier nicht Knall auf Fall zuschließen, um durch die halbe Republik zu düsen. Viel zu teuer. Sie sagte wirklich Knall auf Fall, obwohl Vater nach seinem Sturz schon lange gebrechlich gewesen war und Elinor, nachdem der Ambulanzwagen ihn ins Bürgerhospital verfrachtet hatte, sie gebeten hatte, nach Hause zu kommen. »Jetzt«, sagte Bibi am Telefon, »hat er sowieso nichts mehr davon«, und Lio wäre als seine Lieblingstochter und die Praktischere von ihnen beiden, bestens geeignet, die Beerdigung und den ganzen Kram in die Wege zu leiten. Der ganze Kram war, soweit Elinor sich erinnern konnte, immer in ihre Zuständigkeit gefallen.
Sie habe allerdings nichts dagegen, zurück nach Frankfurt und ins Blauhaus zu ziehen, sagte Bibi, denn ihr verbrecherischer Hausbesitzer sei gerade dabei, sie in München aus ihrer Wohnung hinaus zu gentrifizieren. Die neue Miete könne sie nie und nimmer aufbringen. Ob Lio sich vielleicht schon einmal in der Nähe nach einer Werkstatt umtun könne, Hinterhof wäre total gut, Erdgeschoss, vierhundert kalt, nicht mehr. Elinor dachte, dass sich ihre Schwester besser selbst mit den Frankfurter Mieten bekannt machen sollte, aber sie versprach, sich umzuhören. Bibi war nun ihre letzte nahe Verwandte und der einzige Mensch, der sie bei ihrem Kindernamen nennen durfte.
*
Elinor, der alte Herr Sander und ihr Kater Heinz hatten sich im Blauhaus das Hochparterre geteilt; für jeden zwei Zimmer, die durch Schiebetüren verbunden waren; dazwischen lagen die Küche und das dunkel getäfelte Wohnzimmer mit dem Esstisch, den sie fast nie auszogen. Conrad Sander kochte gern. Er überraschte seine Tochter, die es nicht gern tat, mit Wildpasteten und interessanten Süßspeisen, aber sie hatten nicht viele Freunde, und seit er tot war, aß Elinor in der Küche, ihr Buch unter den Tellerrand geklemmt. Das Bad hatten sie einvernehmlich zu abgesprochenen Zeiten genutzt; Elinor morgens als Erste, ehe sie entlang der Friedhofsmauer unter den Linden zur Deutschen Nationalbibliothek radelte. Als Vater starb, war sie dabei, in ihrer Abteilung eine Ausstellung über Flucht und Exil deutscher Schriftsteller unter den Nationalsozialisten vorzubereiten. Nun packte sie die Bücher von Stefan Zweig, Klaus Mann und Irmgard Keun, die sie ihm aus den Beständen geliehen hatte, zusammen und brachte sie zurück ins Magazin.
Kater Heinz, weiß und grau getigert, dick und freundlich, hatte überall freien Zutritt, aber meistens legte er sich in Vaters Bett und konnte nur schwer daraus verschoben werden. Elinor hatte ihn mehrmals aufgefordert, sich im Garten um die Wühlmäuse zu kümmern, aber Heinz war kein Jäger, sondern ein Sammler zärtlicher Gesten. Ein wenig Haschen nach Blütenflaum war ihm aufregende Tätigkeit an der frischen Luft genug.
Zur Straße hin war die Wohnung laut, zum Friedhof düster, weil die Ligusterhecken aufgeschossen waren und zu viele zu große Bäume zu nahe standen, aber ihr Vater konnte am Geländer die wenigen Stufen in den Garten bezwingen und bei seinen geliebten Rosen sitzen. Als er noch rüstig war, hatte er seiner Ältesten gezeigt, wie man sie okulierte und zusammen hatten sie eine Ghislaine de Feligonde auf eine Heckenrose gepfropft, die mit langen Ranken, spärlichen Blüten und nach Licht ringend durch den Liguster die Friedhofsmauer hinaufgeklettert war.
»Du musst diese Fichten absägen, Lio«, sagte der alte Herr Sander, »sie sind viel zu groß und verschatten alles. Die Rosen brauchen Sonne und außerdem haben Nadelbäume im Garten nichts zu suchen.« Dann war er gestorben und Elinor war traurig und ratlos zurückgeblieben. Wie sie diese Fichten absägen sollte, ohne dass Haus, Dach und Garten oder die Friedhofsmauer zu Schaden kämen, war ihr unerfindlich. Es würde sie ein Vermögen kosten, das sie nicht hatte. Das Haus trug sich gerade so durch die Mieten.
Deshalb blieb nach dem Tod ihres Vaters alles, wie es war. Elinor radelte morgens zur Bibliothek, Heinz ließ sich im Garten nieder. So wenig wie der Fuchs aus seinem Revier entkommen konnte, so wenig Lust verspürte der Kater, das seine zu verlassen. Vermutlich kannten sie sich, aber sie sprachen nicht miteinander.
Der Garten stand ihm und Elinor nun allein zu. Das Ehepaar Bienfait im ersten Stock durfte einen Blick hinunter werfen; Frau Hensel im zweiten wohnte bereits in den Baumwipfeln. Bienfaits, von hugenottischer Herkunft, gleichwohl ebenso alt eingesessen wie die Sanders, hatten sich daran gewöhnt, dass Generationen von Mitbürgern ihren Namen distinktionslos frankfurterisch statt französisch aussprachen. Herr Bienfait, ein kleiner hagerer Mann, war in seinem aktiven Leben Ingenieur gewesen und revanchierte sich für die erschwingliche Miete mit kleinen Handreichungen wie dem Abdichten eines regendurchlässigen Dachfensters oder der Reparatur von Elinors Fahrradgangschaltung. Er nahm auch Pakete entgegen. Frau Bienfait, einen Kopf größer als ihr Mann, hätte Elinor gern im Garten zur Seite gestanden, aber sie musste sich mit ihrem halb verglasten Balkon begnügen, auf der sie Kamelien in Töpfen und Kübeln pflegte, die wegen des Baumschattens vorzüglich gediehen.
Frau Hensel im Stockwerk über ihr hatte sich weniger gut mit den Fichten arrangiert und bereits zum Werkzeug gegriffen, die Zweige, die an ihr Schlafzimmerfenster pochten, herangezerrt und abgesägt. Wie Elinor war sie eine Freundin der Literatur und beide liebten es, sich auf diesem Gebiet en passant und bei jeder Gelegenheit zu prüfen und einander zu übertreffen; allerdings hatte sich Frau Hensel bei der Lektüre ganz auf englische Romane des 19. Jahrhunderts geworfen, die ihr, wie sie sagte, ein Leben lang Anregung genug boten und das Zeitgenössische vollkommen in den Hintergrund drängten.
Die viktorianische Ära prägte auch alle übrigen Aspekte ihrer Existenz. Sie schlief in einem knarrenden Mahagonibett, frühstückte von englischem Porzellan (Spode Polka Dot) und sammelte gläserne Tintenfässer. Die Regale in ihrer Bibliothek stammten aus einem alten Schreibwarengeschäft im Frankfurter Nordend, das einer »Fromagerie« Platz gemacht hatte, und damit kein Zweifel an Frau Hensels präferiertem Jahrhundert aufkommen konnte, hing an prominenter Stelle über dem Chesterfieldsofa eine Reproduktion des Gemäldes von Winterhalter, das die junge Queen Victoria mit gelöstem Haar zeigte. Weder besaß sie einen Fernsehapparat, noch hatte sie sich mit virtuellen Formen der Kommunikation vertraut gemacht. Ihre Rede würzte sie gern mit englischen Wendungen, und zur Teestunde empfing sie ihre Freundinnen mit Kresseschnittchen und schottischen Mürbteigkeksen. Und obwohl Frau Hensel ihre Grille mit adäquatem Humor pflegte, hielten Männer es meistens nicht lange mit ihr aus; zu sehr glich ihr eigenes nachdrückliches Auftreten dem eines älteren Gentleman, und wenn sie das Haus verließ, kleidete sie sich in Weste und Gehrock und schwang einen Spazierstock mit silberner Krücke.
»Es ist ja bei mir wie auf der Sturmhöhe«, beschwerte sie sich bei ihrer Hausbesitzerin. »Irgendwann wird mir so ein Ast durch die Scheibe entgegenkommen.«
»So lange kein Gespenst mit eindringen will, sind Sie sicher«, gab Elinor zurück, aber jedes Mal wenn sie sich im Haus begegneten, erinnerten sie Frau Hensels strafender Blick und das Klopfen ihres Spazierstocks daran, dass sie noch immer nichts gegen die Bäume unternommen hatte.
Die drei Mansardenzimmer hatten die Sanders früher an Studenten der Fachhochschule untervermietet, die ihnen auf Dauer jedoch zu geräuschvoll waren. Ein angehender Erzieher hatte sich nicht entblödet, auf der Treppe nach Heinz zu treten, als der ihm vertrauensvoll um die Beine strich. Er wurde dabei beobachtet und mit seiner fristlosen Kündigung konfrontiert. Elinor legte die Kammern zu einer möblierten Wohnung zusammen, ließ eine Küche und ein winziges Bad unter der Dachschräge einbauen, bewahrte jedoch die breiten hellen Holzdielen und die Jugendstiltüren mit den Messingklinken und übertrug die Vermittlung einer Agentur, die ihr Männer auf Montage, gastierende Schauspielerinnen am Theater, durchreisende Datenschutzbeauftragte und andere Menschen mit befristeter Aufenthaltsdauer schickte. Gestern hatte ihr die Agentur telefonisch einen neuen Mieter angekündigt, einen Herrn aus Polen, Jankowski der Name, Dr. Simon Jankowski.
»Für wie lange?«, fragte Elinor.
»Nur sechs Wochen«, erwiderte die Agenturdame. »Ist das für Sie okay?«
»Ich berechne zwei volle Monate, wie Sie wissen. Was macht er?«
»Er ist irgendein Spezialist. Das Botanische Institut hat angefragt.«
»Spezialist wofür?« Ein Zögern. Offenbar suchte die andere etwas auf ihrem Bildschirm.
»Dendrologie«.
»Ah, Bäume!«, sagte Elinor erfreut.
*
Auch die Verfügung über das Gattertörchen, hinter dem an einem Sommerabend der Fuchs aufgetaucht war, stand ihr nun allein zu. Jeden Samstag, an jüdischen Feiertagen und nach Einbruch der Dunkelheit wurde der Friedhof abgeschlossen. Elinor erinnerte sich an Herrn Bacharach, der eine Kippa trug, und der früher mit dem Schlüsselbund herumgegangen war und abgesperrt hatte. Er hatte neben dem Hauptportal an der Rat-Beil-Straße in einem Bungalow gewohnt, in dessen Fenstern die Gardinen schon lange in Fetzen hingen.
Wenn Vater früher mit ihr an der einen und dem Stativ in der anderen Hand über den Friedhof spaziert war, um die Grabmale aus jedem Winkel und bei jedem Licht zu fotografieren, hatte er ab und zu bei ihm angeklopft. Herr Bacharach hatte dann Teewasser aufgesetzt und die beiden hatten eine Partie Domino gespielt, während Elinor noch einmal bei den Rothschilds und Schwarzschilds, den Oppenheimers, Landauers und Hallgartens vorbeigeschaut, die Rosen auf den Säulen, die schwarzsteinernen Tuchfalten und Fransen über den Sarkophagen und die weiße Marmorhand einer in der Erde versinkenden Gestalt gestreichelt hatte.
Damit sie einander auch abends Gesellschaft leisten konnten, hatte Herr Bacharach für Vater einen Schlüssel zu dem Eisentörchen in der östlichen Mauer nachfertigen lassen, das man vom Friedhof wie vom Garten her absperren aber nur von Sanders Seite aufklinken konnte. Als Herr Bacharach in Pension ging und kein neuer Pförtner einzog, war der Schlüssel bei Conrad Sander geblieben. Auf den Torpfosten wurden Überwachungskameras installiert und abends kam ein Herr von der jüdischen Gemeinde, parkte seinen roten Opel auf dem Kiesplatz hinter dem Hauptportal, sah kurz nach dem Rechten und schloss hinter sich ab. Inzwischen waren er und Elinor einander bekannte Gestalten, die sich von Ferne mit Handzeichen grüßten.
Sie wusste nicht, ob sie vom Auge der Kamera, die auf ihr Törchen gerichtet war, gesehen wurde und falls ja, von wem und ob ein Beobachter ihr den Zutritt verwehren würde, aber niemand schien sie zu bemerken oder Anstoß zu nehmen, und so öffnete sie, wenn die wenigen Besucher abends gegangen waren, ihr Törchen und wanderte durch die Platanenalleen und die Reihen schiefer Grabsteine, von denen sich einige mit der Stirn gegen ihren Baum gelehnt hatten und langsam mit ihm verwachsen waren. Niemand würde sie je voneinander trennen, denn in dieser Erde wurde nicht nach dreißig Jahren das Unterste wieder zuoberst gekehrt. Wer es bis hierhin geschafft hatte, blieb für immer ungestört. Elinor, die vermeidbare Veränderungen ablehnte, fühlte sich bei jedem Gang vom Geist dieses unerschütterlichen Orts und seinen Geheimnissen umfangen. Sie bildete sich gern ein, der Tod sei zu vielen, denen man so rühmende Monumente gesetzt und so ehrende Inschriften gewidmet hatte, als Freund gekommen, und sie mied das unausgesprochene Grauen, das über den glatten hellen Steinen jener lag, die in den Vernichtungslagern umgebracht worden waren.
Zu einigen Grabmalen kannte sie die Geschichte und es gab solche, die sie immer wieder besuchte um Kiesel auf die Ränder zu legen, damit jene, die unter ihnen ruhten, nicht so ganz vergessen aussahen wie etwa die kleine Milly Cohn, die nur zwei Jahre alt geworden und deren Name fast nicht mehr zu lesen war. Elinor ging zu der mutigen Bertha Pappenheim, die ihr jüdisches Frauenheim gegen die Nationalsozialisten verteidigt hatte, und zu Lisa Rado unter ihrem kariösen Fundament aus verwitterten Ziegeln, einer Soubrette, an die sich niemand mehr erinnerte, obwohl bei ihrer Beerdigung an einem Januartag 1928 der Friedhof die Menge ihrer Verehrer kaum fassen konnte. Die Nazis hatten alle ihre Bilder und Schallplatten vernichtet.
Im Juni wehte der Duft der blühenden Linden an der Rat-Beil-Straße über den Friedhof. Im Herbst raschelten ihre Stiefel durch das dürre Laub, im Frühling standen die Grabmale in wilden Sternhyazinthen wie in blauen Teichen. Sie hoffte, dass die Flut der kleinen Scillablüten einmal in den Garten hineinschwappen würde, und um ihren Strom zu beschleunigen, grub sie Dutzende von Zwiebelchen aus und steckte sie in ihre Beete.
Manchmal erblickte sie in der Dämmerung den Fuchs, der dreißig Schritte von ihrem Törchen entfernt hinter dem Grabmal der Familie Bing saß und auf sein Wasser wartete. Sie stellte die Blechschüssel neben den steinernen Pfosten, ohne ihn anzusehen, und ging ihrer Wege. Am leisen Scheppern merkte sie, dass er hinter ihrem Rücken vorbeigehuscht war. »Zähme mich«, dachte sie, aber dabei handelt es sich nur um ein literarisches Zitat. Er war ein wildes Tier, das sich einen fatalen Ort zum Leben ausgesucht hatte. Doch sie freute sich, ihn in ihrer Nähe zu wissen.
*
Am nächsten Morgen stellte sich der neue Mieter der Mansardenwohnung vor. »Simon Jankowski«, sagte er und verbeugte sich leicht mit altmodischer Höflichkeit, als deute er einen Handkuss an. Er hatte eine angenehme Stimme und sprach mit sanft knarrendem Akzent. Elinor sah einen großen Mann jenseits der fünfzig mit grauen Augen, graugesticheltem Haar und schmalen Wangen. Gärtnerbräune, dachte sie, die am Kragen und über den Ellenbogen aufhört. Weißes Hemd, Khakihose, Lederschuhe. Zu seinen Füßen lag ein Seesack, darüber eine abgetragene Barbourjacke. Er roch nach Zigaretten und seine Augen verrieten ihr, dass er trank. Hoffentlich benimmt er sich da oben, dachte sie.
Er sah eine alte Jungfer, noch schlank, noch ganz appetitlich, mit hohen Wangenknochen, die sie auch im nächsten Jahrzehnt noch gut aussehen lassen würden und einem Haarschopf, so fest, dass ein Pfeil darin stecken bleiben würde. Ihre Hände waren lang und elegant, ihre Augen von einem überraschend dunklen Blau. Sie kam ihm auf sein Klingeln im Vestibül entgegen, als habe sie ihn auf die Minute erwartet, einen Schlüsselbund in der Hand und so kühl wie die roten Kacheln an der Wand.
»Sander«, sagte sie, ohne ihm die Hand zu reichen, nickte und musterte ihn mit dem allersparsamsten Lächeln. Die kann mich nicht leiden, dachte er. Ein barsches Weib. Offenbar auf dem Kriegspfad. Nicht sein Fall.
»Ist das Ihr ganzes Gepäck?«
»Mehr habe ich nicht.«
»Dann hier hinauf, bitte.«
Nach dem zweiten Stock endete das gedrechselte Geländer. Eine einfache Dachbodentreppe führte zu einem kurzen Flur und einer alten Tür mit geriffelten Scheiben zwischen den Sprossen. Sie sperrte auf und er trat hinter ihr ein.
»Es ist eine Nichtraucherwohnung.«
»Gewiss.«
»Wohnzimmer, Schlafzimmer, im dritten Zimmer habe ich ein paar von meinen Büchern stehen. Wenn Sie etwas lesen wollen, können Sie sich gern bedienen. Küche und Bad sind da drüben. WLAN hier am Schreibtisch. Bettbezüge und Handtücher finden Sie im Schrank, Putzsachen in der Abseite.«
Er sah sich um. Bis auf das alte Ledersofa und eine antike Truhe, auf der das Fernsehgerät stand, waren die Zimmer mit schlichten hellen Möbeln eingerichtet, die nicht geeignet waren, das ästhetische Empfinden der wechselnden Mieter zu beleidigen. Im Schlafzimmer fiel sein Blick durchs Dachfenster auf die lebhaft schwankende Krone einer großen Fichte. Das entsprach nicht seinen Vorstellungen. Er hatte damit gerechnet, den Friedhof zu überblicken. Er deutete aus dem Fenster.
»Haben Sie keine Angst, dass er Ihnen mal aufs Dach fällt?« Sie lächelte und er sah Falten, die ihr gut standen.
»Ich weiß, diese Bäume müssten weg, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll.«
»Da könnte ich Ihnen vielleicht raten.« Sie blickte ihn unschlüssig und, wie er meinte, ein wenig abschätzend an, hebelte dann das Fenster auf, schaute hinaus – warme Sommerluft strömte herein – zog es wieder zu. Keine Antwort. Wechsel des Themas.
»Sie kommen aus Polen?«, fragte sie, um nicht mit der dämlichsten aller Bemerkungen – Sie sprechen aber sehr gut Deutsch – ihre Bekanntschaft zu eröffnen.
»Ganz recht, aus Poznań, aber ich bin seit fünfundzwanzig Jahren in Deutschland unterwegs. Es geht immer hin und her.« Er bewegte die Hände und lächelte gewinnend.
»Und Sie sind Dendrologe?«
»In Kórnik am Arboretum.« Er sprach es mit kurzem E und rollendem R aus. »Mein Fachgebiet sind Magnolien. Ich verfolge hier am Botanischen Institut einen kleinen Forschungsauftrag zur Diversität von Magnoliaceae.«
»Oh, Magnolien. Wie schön. Leider nichts für meinen Garten. Zu dunkel.« Und als habe sie schon zu viel über einen geheimen Ort verraten, klappte sie den Mund zu, reichte ihm die Schlüssel, legte den Meldeschein auf den Tisch und wandte sich zur Tür. »Füllen Sie den bitte noch aus und bringen Sie ihn mir zurück. Ich wohne im Parterre. Klingeln Sie einfach«, und abschließend: »Der 32er Bus fährt übrigens bis zum Botanischen Garten. Die Friedberger Landstraße runter und rechts um die Ecke ist die Haltestelle.«
»Oh, danke, ja, sicher«, antwortete er und schloss die Tür hinter ihr. Noch ehe er den Seesack auspackte, streifte er die Schuhe ab, stieg aufs Bett, schob das Dachfenster hoch und lehnte sich hinaus. Es war sinnlos. Das ausladende Schieferdach versperrte ihm den Blick nach unten und statt auf den Friedhof sah er auf eine Kulisse eng stehender Fichten mit herabhängenden spärlich benadelten Ästen, die fast bis in die Spitzen von Efeu beklettert und umbuscht waren. Er stieg wieder ab, öffnete den Schrank, räumte ein paar Kleidungsstücke, ein Fernglas und eine große Taschenlampe hinein. Aus der Tiefe holte er ein mit Paketband umwickeltes Plastiksäckchen und legte es ins Eisfach des Kühlschranks. Als Nächstes kam eine Flasche mit Klarem zum Vorschein. Jankowski goss sich zwei Finger hoch Schnaps ins Zahnputzglas und trank seine Enttäuschung nieder. Das barsche Weib hatte recht. Die Bäume mussten weg.
*
Er nahm jeden Morgen um Viertel nach sieben den 32er und fuhr zum Botanischen Garten, kehrte gegen sechs mit einer Einkaufstüte zurück und ging nicht mehr aus. Er brachte keinen Besuch mit und es kam auch keine Post für ihn, die Elinor auf den Tisch im Vestibül hätte legen können. Dem Meldeschein entnahm sie, dass der polnische Staatsbürger Szymon Jankowski drei Jahre jünger als sie und in Poznań, dem ehemaligen Posen, geboren war. Weitere Auskünfte über seinen Stand oder seine Person gab es nicht. Doch dann meldete sich Frau Hensel aus dem zweiten Stock bei Elinor:
»Der neue Mieter raucht zum Dachfenster raus. Der Qualm zieht bis in meine Küche.«
»Über den Luftraum habe ich leider keine Gewalt, Frau Hensel.«
»Aber vielleicht wäre ein ernstes Wort angebracht.«
»Ich bitte Sie! Wir sind doch erwachsene Menschen.«
»Ich denke oft an Manderley«, warnte Frau Hensel.
»Das war Brandstiftung und fällt außerdem nicht in Ihr Jahrhundert.«
Frau Hensel war beleidigt, aber Elinor verfolgte eigene Pläne mit Simon Jankowski, die ernste Worte vorläufig ausschlossen. Eine Woche nachdem er eingezogen war, sprach sie ihn an, als er morgens die Treppe herunterkam. Sie passt also auf, dachte er, sie hat hinter der Tür auf mich gelauert.
»Wegen des Rats, den Sie mir geben wollten, Herr Dr. Jankowski«, sagte Elinor nach kurzem Gruß, und auf seinen fragenden Blick: »Es geht um die Bäume, die Fichten hinter dem Haus. Sie machen alles so düster und ich würde sie gern absägen.«
»Kein Problem. Das kann ich für Sie erledigen. Ich brauche aber eine helfende Hand.«
»Mich?«
»Wenn Sie ein bisschen Mumm in den Knochen haben?«
»Zweifeln Sie daran?« Diesmal nahm er sich heraus, sie ein wenig abschätzig zu mustern. Mit diesen Händen konnte sie vielleicht blühende Kirschzweige in einer Vase anordnen, aber keine Stämme wegräumen.
»Ich dachte eher an einen Holzfäller. Es ist kein leichter Job.«
»Ich denke, wir schaffen das. Brauchen wir eine Kettensäge? Haben Sie vielleicht eine?« Der Geist eines Lächelns streifte seine Mundwinkel.
»Ich habe eine Kettensäge, aber nicht hier. Außerdem müssen wir warten. Vor Ende September darf man keine Bäume fällen, wegen der Vögel.«
»Nicht mal diese furchtbaren Fichten? Da nistet kein einziger Vogel drin.«
»Das weiß man nicht«, sagte er. »Kann ich sie mir heute Abend einmal ansehen?«
So kam es, dass Simon Jankowski Elinors Garten betrat, als die Sonne tief im Westen stand und die Platanen auf dem Friedhof ihre gefleckten Schatten über die Mauer warfen. Der Fuchs, der hinter dem Grabstein der Familie Bing gewartet hatte, machte sich aus dem Staub, als er ihre Stimmen hörte.
Es war ein alter Garten, dicht bepflanzt, und alles darin strebte in die Höhe. Durch seine Mitte führte ein breiter, im Fischgrätmuster verlegter Ziegelweg, der von einer ganzen Batterie großer Blumentöpfe, die offenbar immer der Sonne hinterher gerückt wurden, gesäumt war.
Auf dem ebenfalls mit Ziegeln gepflasterten Platz, wo früher der Pavillon das Zentrum des Gartens gebildet hatte und es am hellsten war, standen ein runder Eisentisch und einige Korbstühle. In einem hatte Heinz sich niedergelassen. Jankowski kraulte ihn zur Begrüßung hinter den Ohren, was sowohl der Kater als auch seine Herrin gut aufnahmen. Sie hatte, um sich gastlich zu erweisen, ein Tablett mit Eistee und zwei Gläsern auf den Tisch gestellt.
Jankowski ließ sich Zeit und während er mit Blicken zu messen und im Kopf zu rechnen schien – die Höhe der Bäume, den Abstand zum Haus und zur Friedhofsmauer –, nahm er alles andere ebenso gründlich wahr. Zu viel, zu dicht, zu düster. Der Liguster müsste als Erster dran glauben. Und der Efeu, der über die Mauer gekrochen kam. Er konnte Efeu, diesen Würger alter Bäume, nicht ausstehen.