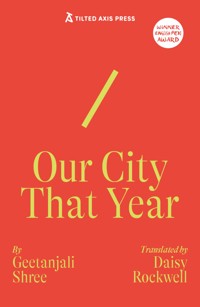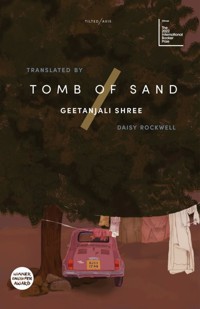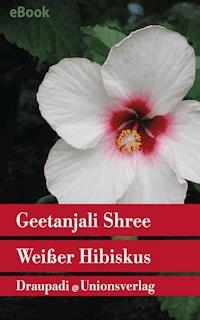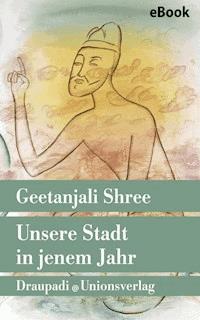9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Während Sunaina mit ihrem Bruder durch den Guavenhain streift und auf Mangobäume klettert, ist ihre Mutter Mai stets zu Hause. Unter den Argusaugen ihrer Schwiegermutter stampft sie Linsen, röstet Papadam, backt Chapati. Still umsorgt sie die ganze Familie, fast unsichtbar hinter den Mauern des großen Anwesens. Als Sunaina und ihr Bruder älter werden, lehnen sie sich gegen die starren Regeln der Familie auf und setzen sich ein gemeinsames Ziel: Mai aus ihrer so eng scheinenden Welt zu befreien. Erst spät bemerken sie allerdings, dass Mais Welt eine ganz andere ist, als sie glauben. Die Booker-Preisträgerin Geetanjali Shree porträtiert drei Generationen einer indischen Familie und erzählt von der gewaltigen Herausforderung, einander wirklich zu verstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Sunaina und ihr Bruder haben ein gemeinsames Ziel: ihre Mutter Mai, die nie das Haus verlässt, aus ihrer so eng scheinenden Welt zu befreien. Doch das ist eine ganz andere, als sie glauben. Die Booker-Preisträgerin porträtiert drei Generationen einer indischen Familie und erzählt von der Herausforderung, einander wirklich zu verstehen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Geetanjali Shree (*1957, eigentlich Geetanjali Pandey) begann zunächst eine akademische Karriere als Historikerin und Sozialwissenschaftlerin, bevor sie sich dem Schreiben widmete. 2022 wurde sie mit dem Booker International Prize ausgezeichnet. Sie lebt in Neu-Delhi.
Zur Webseite von Geetanjali Shree.
Reinhold Schein (*1948) arbeitete viele Jahre als Deutsch-Lektor an indischen Hochschulen und ist als Übersetzer aus dem Englischen und dem Hindi tätig.
Zur Webseite von Reinhold Schein.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Geetanjali Shree
Mai
Roman
Aus dem Hindi von Reinhold Schein
E-Book-Ausgabe
Draupadi @ Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book des Draupadi-Verlags erscheint in Zusammenarbeit mit dem Unionsverlag.
Die Originalausgabe erschien 1993.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2010 im Draupadi Verlag.
Originaltitel: Māī
© der deutschen Ausgabe by Draupadi Verlag, Heidelberg 2010
© der Hindi-Ausgabe by Geetanjali Shree, 1993
Diese Ausgabe erscheint mit freundlicher Genehmigung des Draupadi Verlags, Heidelberg.
© by Draupadi Verlag, Heidelberg 2023
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Caro Helm photography (Alamy Stock Foto)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-30878-7
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 25.05.2023, 12:00h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
MAI
1 – Dass unsere Mutter eine schwache Wirbelsäule hatte …2 – Mai hielt sich ständig gebeugt, und sie sprach …3 – Gedanken machten wir uns auch damals schon …4 – Papa stand in dem Ruf, wie der weise …5 – Glanz und Ansehen unseres Hauses beruhten auf Großvaters …6 – Subodh war zwei Jahre jünger als ich …7 – Wenn Subodh in sein Internat fuhr, blieb ich …8 – In meiner Kindheit spielte das Feuer allerdings keine …9 – Ein Opfer zu bringen, um dafür im Gegenzug …10 – Großvater, der Großgrundbesitzer gewesen war und dem Papa …11 – Seitdem Subodh in der Schule Bestnoten bekam …12 – Großmutter liebte uns zwar abgöttisch, aber unsere immer …13 – Kleidung war bei uns zu Hause ein großes …14 – Subodh wusste einiges von meinen Abenteuern. Da unser …15 – Mai konnten wir nur in Verbindung mit uns …16 – Eines Tages« ist mir spontan herausgerutscht, aber wann …17 – Als wir sie nicht retten konnten, begannen wir …18 – Subodh hatte das Elternhaus freudig verlassen, ohne dass …19 – Wir fuhren zu Holi, zu Diwali, in allen …20 – Wir wären im Traum nicht darauf gekommen …21 – Unser Grundstück grenzte an den alten Basar …22 – Das Heimweh überflutete mich wie eine Welle und …23 – Genau das hatte uns schon von Kindheit an …24 – Da, wo die Augen sein sollten, war einfach …25 – Langsam, fast unmerklich, änderte sich Subodh. Ich weiß …26 – Bua war zu irgendeinem Feiertag gekommen. Sie begleitete …27 – Papa war sehr zufrieden, dass Subodh in England …28 – Wir waren erwachsen geworden und konnten nicht länger …29 – Aber hält sich das Leben an die Bahnen …30 – Mai war meine Wegweiserin: So, wie sie war …31 – Bisweilen bleibt es uns auch erspart, eine Entscheidung …32 – Wir fanden nicht, dass sich im Haus viel …33 – Später ging uns auf, dass wir überhaupt nicht …34 – Mai hatte nichts als diese Asche hinterlassen …35 – Das Gefühl, dass Mai in mir selbst stets …NachwortWorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Geetanjali Shree
Über Reinhold Schein
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Geetanjali Shree
Zum Thema Indien
Zum Thema Asien
Zum Thema Frau
1
Dass unsere Mutter eine schwache Wirbelsäule hatte, wussten wir ja von Anfang an.
Später bestätigte uns der Doktor: Es ist das Schicksal derer, die sich ständig gebeugt halten. Durch die gekrümmte Haltung verschleißen die Bandscheiben, und stellenweise werden die Nerven eingeklemmt. Diese Leute haben schließlich immer Schmerzen, wenn sie sich beugen und auch, wenn sie sich aufrichten.
Mai hielt sich immer gekrümmt. Das wissen wir, wir hatten sie ja von Anfang an so gesehen. Schließlich fing ihr Leben mit unserem zusammen an. Von Anfang an war sie ein schweigender, gebeugter Schatten, überall zur Stelle, immer damit beschäftigt, alle zu versorgen, allen ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
Und damals waren es eine Menge Leute, die irgendwelche Bedürfnisse hatten. Erst viel später wurden die Menschen in unserem feudalen Anwesen rar. Damals florierte das Haus mit seinen Bewohnern und Besuchern, Hausangestellten und Lohnarbeitern. Und mittendrin huschte Mai herum, hielt sämtliche Fäden in der Hand und behielt den Überblick.
Die Rede ist von unserer Kindheit. Unser Haus war sehr groß. Wir waren fest überzeugt, dass damals alle in solchen Häusern lebten, auf deren weiten Dachterrassen Languren herumsprangen und von wo die Kinder durch Oberlichter in die Zimmer hinunterspähten. Wo in aller Frühe die Pfauen riefen, von wo sie später auch in den Hof geflogen kamen und tanzten. Wir sammelten ihre Federn vom Boden und vom Dach auf. Bündelweise Pfauenfedern, für die wir uns immer neue Verwendungsmöglichkeiten ausdachten. Den ganzen Tag gab es im Haus ein ständiges Kommen und Gehen. Manche Besucher begrüßten wir freudig, vor anderen versteckten wir uns. Und in der Nacht der Lichtschein von Petroleumlampen.
Elektrischer Strom kam später. Später wurde auch die Wasserpumpe mit dem langen Schwengel zum Spielgerät für uns. Es gab Eimer aus Eisen und Messing, die Mai oder Hardeyi an der Pumpe füllten: für unsere Großmutter, für unseren Vater oder für uns. Dann war da der Messingzuber, den Bhondu für unseren Großvater täglich mit Wasser aus dem Brunnen füllte.
Großvater hatte eine separate Badestube mit Toilette, etwas abseits vom Haus, in der Nähe seines Wohnzimmers. Sie war überdacht, aber ich erinnere mich nicht, ob sie feste Wände hatte oder nur mit Wandschirmen abgetrennt war. Drinnen stand ein Schemel – nicht nur ein niedriges Bänkchen, um darauf zu hocken. Ein kleiner Messingkrug stand immer daneben, und der Zuber war randvoll mit Wasser. Hätte Großvater mit weniger Wasser für sein Bad auskommen müssen, dann hätte er wohl lieber ganz darauf verzichtet. Neben dem Schemel fürs Bad war das hölzerne Klosett, das der Latrinenreiniger täglich säuberte.
Eines Tages stürmten wir mitten im Spielen aus Versehen in die Badestube. Großvater saß mit gekreuzten Beinen auf dem Schemel und goss sich gerade mit dem Kännchen Wasser über den Kopf. An seiner heiligen Schnur hingen Tropfen. Er regte sich kein bisschen auf, sondern sagte nur streng und kurz angebunden: »Raus!« Und wir machten uns erschrocken davon.
Der Rest der Familie hatte Bad und Toilette im inneren Bereich des Hauses, auf der Seite der überdachten Veranda,wo Großmutter gewöhnlich saß, mit Zugang zum Innenhof.Von diesem Innenhof gelangte man in eine weitere Bade- und Wäschekammer, und auf der anderen Hofseite waren die Küche und eine Kammer für Brennholz und Kohle. Auch die Pumpe stand im Innenhof. Im Winter zündete Hardeyi neben ihr einen Ofen an, auf dem das Badewasser in großen Töpfen erhitzt wurde. Noch jetzt sehe ich Mai, wie sie die Töpfe mit dem Ende ihres Saris vom Feuer nahm und das Wasser in den Eimer goss.
Später ließ Vater eine Wand seines Schlafzimmers durchbrechen und ein neues WC und Bad anbauen, in dem es alles gab: Wasserspülung, Hähne, eine Dusche, einen Elektro-Geyser, auch einen Eimer und Kannen aus buntem Kunststoff.
Aber das war später. Später änderte sich überhaupt vieles. Zwar nahm Großmutter bis zum Schluss nur im Innenhof ihr Bad, an diesem Brauch hielt sie bis an ihr Lebensende eisern fest, ansonsten änderte sich allerhand im Haus.
Aber das alles geschah natürlich viel später.
Das Problem ist: Man kann nur aus dem Später heraus erzählen, und ich verzweifele an der unumstößlichen Tatsache, dass später nur noch die Erinnerung bleibt und dass die Erinnerung nur noch ein Abglanz ist, umgrenzt von den Gitterstangen der Imagination. Sie ist nicht die reine Wahrheit, nicht die ganze Wahrheit. Meine Sorge ist weniger, dass sich die Geschichte nur halb erzählen lässt, sondern auch und vor allem, dass sie nurso lange unbeschädigt bleibt, wie sie nicht in einen Rahmen gezwängt wird. Ist sie erst einmal eingefangen, nimmt sieunter meinen Händen eine neue Gestalt an, wird in eine feste Form gepresst und in dieser Form zu einem unveränderlichen Teil der Historie zementiert. Aber ich will nicht alle Facetten des Möglichen in Worte schnüren und die Wirklichkeit des Unausgesprochenen verscheuchen.
Noch schlimmer ist, dass ich keine Ruhe habe, solange ich die Geschichte nicht erzähle. An diesem Punkt hänge ich fest, und nur indem ich erzähle, kann ich wieder Bewegungsfreiheit gewinnen.
Ich will von Mai berichten, aber die Wegstrecke von der realen Mai zum Berichten ist so beschwerlich, so voller Widerstände, dass nicht abzusehen ist, was geschehen wird und wie weit ich auf diesem Weg komme.
Ich sehe vor mir eine unbezwingbare Festung, in die ichhineinmuss, um zu Mais Wesen vorzudringen. Eine Festung voll von Geheimtüren, verborgenen Nischen, Labyrinthen, Irrwegen. Man sieht Licht, will voranschreiten und kann doch sogleich mit einem Entsetzensschrei ins Leere stürzen. Vorsichtig, gebückt, gelangt man durch eine verborgene Tür in einen geheimen Gang, in der Hoffnung, an dessen Ende etwas zu finden, und stellt fest, dass man im Kreis gegangen und genau da angekommen ist, von wo man ausgegangen war. Man schreitet voran in der frohen Zuversicht, weiterzukommen, und indiesem Moment gießt ein versteckt stehender Feind irgendwo von oben einen Kessel siedendes Öl aus.
Wie komme ich an Mai heran? Wie soll ich sie, wenn ich zuihr vorgedrungen bin, aus dieser Festung herausholen? Undwenn ich vielleicht irgendwie Bruchstücke von Mai herausbringe, ist das dann noch die wirkliche Mai? Werden nicht Erinne-rung, Zeit und Interpretation ihr Bild durchlöchern wie einSieb? Irgendwo ist Mai, in ihrer unbeschädigten Ganzheit. Wenn ich sie packe, in Worte binde, zerstöre ich dann nicht ihre Ganzheit?
Ich weiß nicht, warum mich der unbändige Drang befallen hat, Mai wiederzubeleben. Es ist ein Verlangen, das mich erfüllt und umhüllt. Ich sauge es mit dem Atem ein, und wenn ich daran zu ersticken drohe, atme ich es notgedrungen aus. Dass Mai, so schwach sie doch von Anfang an war, derart viel Raum in mir ergreifen kann, hätte ich nie für möglich gehalten.
Später. Sehr viel später.
Alles begann – und irgendwann wurde selbst dieser Beginnder Geschichte zweifelhaft – zu einer Zeit vor diesem Später. Damals waren wir sehr klein, Großmutter war alt, Papa war selten zu Hause, Großvater war jähzornig und Mai sehr verängstigt. Diese Personen waren es, die mal einzeln, mal gemeinsam durch unsere unbekümmerte, blühende, luftballonleichte Kindheit schwebten.
Rund um das Haus erstreckten sich damals Felder, Mango- und Guavengärten. Die Leute, die darin arbeiteten, sahen wir nur von ferne. Wenn heute in der eigenen Stadt, im Basar nebenan Unruhen ausbrechen, dann erfahren wir spätestens am nächsten Morgen davon aus der Zeitung. Aber damals wusste nur Großvater etwas über die Angelegenheiten der Arbeiter, und wenn selbst Papa sich vor Großvater fürchtete, was konnten wir zwei Winzlinge dann schon erfahren?
Das heißt nicht, dass wir unterdrückt und verängstigt herumgesessen hätten. Alte Gebäude, offene Flächen, bieten ihre eigenen Freiräume, in denen wir nach Lust und Laune herumtollen konnten. Manchmal versteckten wir uns auf der Dachterrasse und dachten uns Geschichten aus, manchmal sahenwir zu, wie am Ziehbrunnen die Ochsen zur Bewässerung der Felder eine Runde nach der anderen drehten. Wir waren vielleicht nicht besonders geschickt darin, auf Bäume zu klettern, aber wir kannten einige Guavenbäume, an deren Ästen man schaukeln konnte. Auch auf den Feldern war immer irgendetwas zu ergattern, manchmal aßen wir frische Erbsen, manchmal kauten wir das Kraut von Kichererbsen, wir pflückten uns auch unreife Weizenkörner. Es gab reichlich Stellen, wo wir Großvaters Überwachung entzogen waren.
Ohnehin hatten wir recht wenig Kontakt mit ihm. Bis an sein Lebensende war er ständig mit diversen geselligen Zusammenkünften beschäftigt. Er hielt sich den ganzen Tag in seinem zur Straßenseite gelegenen Wohnzimmer auf, dorthin ließ er sich auch sein Essen kommen, dort schlief er, dort fanden sich täglich Besucher ein. Seine Stimme dröhnte allerdings in voller Lautstärke durchs ganze Haus – Gelächter, Wortwechsel, Rufe nach dem Hauspersonal und mitgesungene Lieder von Fayyaz Khan und Abdul Karim Khan:
Phulwan ki gaindan mainka na maro re
Ho re more mita piharva
Bewirf mich nicht mit Blumenbällen,
O mein berückender Geliebter.
Und ob wir gerade in einem entfernten Garten oder auf der Dachterrasse saßen, wir erschraken und eilten lachend los, um in sein Zimmer zu spähen.
Bis zu seinem letzten Tag ließ Großvater auch Platten mit achtundsiebzig Umdrehungen pro Minute auf seinem alten Grammophon laufen. Sein Bezug zu den übrigen Hausbewohnern beschränkte sich aufs Herumkommandieren: »He, ist da jemand? Schick Sherbet her!« (Später: »Ist da jemand? Lass Tee kommen«, auch wenn er selbst keinen Tee trank.) »Lass ein paar Kürbisblüten-Pakodas frittieren!« – »Herrgott, hört denn irgendeiner zu? Hier sind Methi-Laddus aus dem Dorf, lass dazu etwas salziges Knabberzeug kommen.« Großvater sagte nie »Mach das!«, sondern »Lass es machen!«. Das war sein Stil.
Großvater konnte zu jeder Tag- und Nachtstunde rufen,und die Adressatin war meist Mai, die seine Anordnungen unverzüglich ausführte. Wenn Großvaters Reich »draußen« war, der öffentliche Teil des Hauses, und Mais Reich »drinnen«, die privaten Räume, dann bildeten Bhondu und Hardeyi die Brücke zwischen ihnen. Die beiden waren ein Ehepaar, doch Bhondus Welt war draußen, und Hardeyis Territorium war drinnen. An der Grenzlinie wurden Gegenstände und Nachrichten bis hin zu Rügen und Beschimpfungen ausgetauscht.
Außer ihnen war – abgesehen von uns beiden – Papa der Einzige, der ab und zu von drinnen nach draußen, von draußen nach drinnen wechselte. Nach drinnen zu Mai und Großmutter, nach draußen zu Großvater in dessen Wohnraum. Papa setzte sich zwar – verlockt von der Musik – gern zu Großvater, aber ihr Gespräch beschränkte sich auf einsilbige Mitteilungen wie »ja«, »stimmt«, »absolut«.
Alle hatten Angst vor Großvater. Auch Großmutter sahen wir nie mit ihm zusammen, so gut wie nie. Keine Ahnung, was für ein Ehepaar sie waren. Für Großmutter, mit der wir viel Tuchfühlung hatten, war es, als ob Großvater gar nicht existierte, oder jedenfalls außerhalb ihres Horizonts. Vielleicht konnte sie ihrer Zunge auch nur in seiner Abwesenheit in diesem Tempo und mit dieser Schärfe freien Lauf lassen, warum hätte sie sich also einen Tempobrecher herbeiwünschen sollen? Sie breitete auf einem großen Diwan auf der inneren Veranda ein weißes Tuch aus, lehnte sich an ein verwaschenes blaues Polsterkissen und verbrachte so in königlicher Majestät den ganzen Tag. Sie überblickte den Hof und die Küche mit allem, was dort vor sich ging. Alle wichtigeren Zimmer öffneten sich zur Veranda, daher sah und hörte sie alles, was dort ablief. Frisch gebadet, ihr weißes Haar lose herabhängend, setzte Großmutter sich die Brille auf die Nase und demonstrierte, wie sprachgewaltig die Zunge in ihrem zahnlosen Mund noch war. Mit wachsamem Blick wandte sie ihren Kopf flink hin und her. Sie registrierte alles, was um sie her geschah.
Damals, lange ist es her, durften wir uns überall im Haus frei bewegen, allerdings hatte Großvaters Zimmer für uns keinerlei Anziehungskraft. Wenn Großvater uns vorbeiflitzen sah, rief er uns mit laut befehlender Stimme zu sich: »He Subodh, he Sunaina!«, setzte uns auf seinen Schoß und umklammerte uns mit seinen Armen wie ein Python, sodass uns fast die Knochen brachen, kniff uns oder neckte uns mit Kinderreimen wie »Ala bala garam masala«, »Akkar bakkar bambe bo«, oder er streckte einfach seine Hand aus und sagte: »Hier, knackt mir die Finger!« Wir schrien »Au, au!« und versuchten, uns seinem Griff zu ent-winden, aber weglaufen konnten wir erst, wenn er uns los-ließ. Wenn wir auch keinen Spaß an solchen Körperkontakten hatten, sahen wir es doch durchaus als eine Ehre an, von einer so Respekt gebietenden Persönlichkeit gedrückt zu werden.
Aber normalerweise waren wir meist mit den Frauen zusammen, selten mit den Männern. Weder mit Großvater noch mit Papa, noch mit sonst einem. Wir flohen nach drinnen auf Großmutters Schoß, liefen im Kreis um Mai und vergnügten uns draußen nach eigener Lust und Laune. Später wurden wir Großmutters Lieblinge, aber wir selbst hatten Mai am liebsten. So lieb, dass sich die ganze Energie unserer Kindheit auf ein einziges Ziel richtete: sie zu retten und von zu Hause wegzubringen.
Schon von früher Kindheit an schmerzte uns Mais Fügsamkeit. Allmählich begannen wir, sie vor allen anderen zu beschützen: vor Großmutter, vor Papa, vor Großvater. Nur vor ihr selbst konnten wir sie nicht beschützen. Als ihre Wirbelsäule sie im Stich ließ, gab sogar der Doktor auf. Von jetzt an würde sie immer Schmerzen haben. Wir hatten ja von Anfang an über ihre schwache Wirbelsäule Bescheid gewusst. Aber das war später …
2
Mai hielt sich ständig gebeugt, und sie sprach wenig.
Wenn wir aufwachten, hatte sie schon ihr Bad genommen, einen frischen Baumwollsari angezogen und briet in der Küche Parathas mit Erbsen, mit Kartoffeln, mit Blumenkohl, mit Rettich oder mit geröstetem Kichererbsenmehl. Die Großeltern frühstückten nicht, sie aßen gleich eine vollständige Mahlzeit. Von dem, was für sie zubereitet wurde, bekamen wir etwas als Pausenimbiss mit in die Schule. Papa dagegen nahm ein leichtes Frühstück, täglich eine Handvoll von fünf verschiedenen Sprossen: Weizen, Erdnüsse, Linsen, Kichererbsen und Mungbohnen – zusammen eingeweicht und zum Keimen gebracht. Mai servierte sie Papa mit Salz und ein paar Tropfen Zitronensaft, dazu ein großes Glas Buttermilch.
Frische Buttermilch gab es bei uns täglich. In einem großen Tonkrug ließ Mai den hölzernen Quirl kreisen. Sie setzte sich dazu im Innenhof auf einen niedrigen Schemel, klemmte den Topf zwischen ihre Fersen und wirbelte den mit Joghurt gesäuerten Rahm herum. Schließlich schwamm oben die Butter, und die Buttermilch wurde in große Gläser abgegossen.
Alle Arbeiten, die Mai ausführte, erledigte auch Hardeyi.Es ließ sich nicht klar abgrenzen, was ausschließlich Mais Sache war und was Hardeyis. Manchmal quirlte Mai die Butter, manchmal Hardeyi, manchmal zerstampfte Mai Chutney und Linsen, manchmal Hardeyi. Manchmal holte Mai das Brennholz und machte Feuer im Herd, manchmal Hardeyi. Eins aber standfest: Mai selbst war dafür verantwortlich, dass das Essen pünktlich zubereitet war. Hardeyis Aufgabe war es, das Haus zu fegen und zu putzen. Wenn sie damit fertig war, kam Hardeyi kaum noch in die inneren Räume, sie blieb bei Mai und machte sich imInnenhof und auf der Veranda geräuschvoll zu schaffen.
Großvater mochte es nämlich überhaupt nicht, wenn das Dienstpersonal sich frei im Haus bewegte. Da war einmal die Sorge, sie könnten etwas stehlen. Außerdem: Wenn man ihnen solche Freiheiten ließ, würden sie womöglich noch aufmüpfig werden. Er wollte auch verhindern, dass Neuigkeiten aus dem Haus nach draußen gelangten. Interne Dinge sollten im Haus bleiben. Außerdem verbreitete »dieses Volk« Schmutz und Krankheiten. Zwar lebten auf dem Anwesen in der Nähe des Brunnens ein Wasserträger, ein Latrinenreiniger, ein Gärtner, ein Wachmann und sonstige Bedienstete, aber außer Hardeyi und Bhondu durfte keiner von ihnen ins Haus kommen, und auch diese beiden nur streng reglementiert. Bhondu besorgte die Arbeiten in Großvaters Wohnzimmer und auf der äußeren Veranda, und durch die Tür auf der Rückseite des Innenhofs tauschte er mit Hardeyi Aufträge oder Informationen aus. Wenn er zu Großvater ging, streifte er seine Sandalen ab und setzte eine Kappe auf. Auch seine Haare hielt er aus Respekt vor der Reinlichkeitsliebe des Hausherrn immer sehr kurz geschoren. Im Inneren des Hauses arbeitete Hardeyi. Zusammen mit Mai, die alle Arbeiten gebeugt verrichtete: waschen, mahlen, Teig ausrollen, backen.
Ich weiß nicht, warum bei uns um alle mit dem Essen verbundenen Tätigkeiten immer so ein Wirbel gemacht wurde. Die Großeltern verlangten heiße, frisch zubereitete Speisen, Papas Verdauungskraft war schwach, daher durfte Hardeyi mit ihren unsauberen Händen seinen Teller nicht berühren, nur Mai durfte das. Auch wir machten ihr mit unserer kindlichen Lebhaftigkeit und unseren täglichen Sonderwünschen nicht weniger Mühe.
Mai kochte, vielleicht schon seit jeher, sehr abwechslungsreich. Gekochtes und Gebratenes für die Großeltern – Puris, Parathas (Großmutter aß am liebsten Puris, weil sie »leichtes« Essen mochte und Puris in der Frittierpfanne ganz leicht oben schwammen und sich mit heißer Luft aufbliesen!), gebratenes Gemüse, eingedickte gesüßte Milch, Milchreis mit zwei Tropfen Ghee. Für Papa und uns Dal oder Joghurt-Linsen-Suppe, heiße, frisch aufgeblasene Chapatis, Reis, Curry-Gemüse, Salat. Alle aßen als Beilage Papad, Chutney, Raita und scharf gewürzte Pickles. Und gelegentlich, zum Beispiel wenn jemand zu Besuch kam oder die Großeltern darauf drängten oder ohne besonderen Grund, wenn der Regen heftig prasselte, wurden die Teller mit Pakodas, Phulbadis, Linsenbratlingen und Halva vollgeladen. Papa war ein bescheidener Esser – von den »leichten« Puris und Phulbadis kostete er ein wenig, wenn er Appetit darauf hatte, aber hauptsächlich lebte er von Quark mit Honig, Buttermilch und gekeimten Hülsenfrüchten. Später kamen durch uns auch neuartige »englische« Sachen auf den Tisch, von denen Papa einige und Großmutter alle sehr gern aß: Suppe, Gemüsekoteletts, Sandwiches, Eiskrem, Kuchen, Kekse, Schokolade.
In unserem einen Haus gab es somit viele verschiedene Arten von Speisen. Unsere Küche umfasste das ganze Spektrum von der regionalen dörflichen Kost bis zum Londoner Menüplan. Damit wuchsen wir auf, so etwas vergisst man nicht. Wir haben sowohl Zuckerrohrmelasse als auch Kuchen im Blut. Vielleicht sind wir buntscheckige Mischwesen, seltsame exotische Blumen. Aber so sind wir eben, gerade so.
Wir wuchsen also von vielen schützenden Schatten behütet auf, vor allem war Mais Schutzschirm über uns aufgespannt. Aber wir ahnten nicht einmal, dass es diesen Schutzschirm gab.
Wann Mai aufstand, was sie aß, wie sie lebte, daran haben wir anfangs überhaupt nicht gedacht. Und als wir später zu denken anfingen, da haben wir sie geliebt und bemitleidet. Wir gaben unsere Sonderwünsche auf, wie zum Beispiel: »Mai, können wir heute Bati haben? Mach doch bitte Litti. Wie lange haben wir schon keine Gulgule mehr gegessen?« Wir mischten uns sogar ein, wenn sie für die anderen das Essen zubereitete. Subodh zog Mai aus der Küche heraus: »Also, Schluss jetzt! Es reicht! Geh jetzt sofort … komm heraus … Ich mache das jetzt!« Wir versuchten auch, ihr zur Hand zu gehen. Und wir ließen es nicht mehr zu, dass Mai uns bediente, während wir zusammen mit Großmutter schmausten. »Nein, wir warten, bis du auch kommst … Na und, lass es doch kalt werden!« Und als Studentin der Naturwissenschaften begann ich, Papa und Großmutter darüber zu belehren, wie man sich richtig ernährt, wie unser Körper funktioniert und was er braucht: »Iss keine frittierten Speisen, sie verursachen Bauchschmerzen. Gib die Süßigkeiten auf, sie ruinieren die Zähne.« Großvater zu belehren, getraute ich mich natürlich nicht, noch lange nicht.
Die Großeltern waren auf dem Höhepunkt ihrer Autorität – der eine thronte hoheitsvoll im äußeren Wohnzimmer, die andere majestätisch auf der inneren Veranda. Zu Großvaters Zeit kamen körbeweise Laddus und Süßigkeiten ins Haus – vom Dorf Laddus aus Zuckerrohrmelasse, Laddus mit Sesam, Methi oder Hirse, und aus dem Süßwarenladen Barfis und rötliche, leichtkaramellisierte Pedas. Obst auf dem Markt zu kaufen, das kam bei uns erst später auf, als wir darauf drängten. Im Garten wuchsen ja reichlich Guaven, Papayas, Bananen, Rosenäpfel, Jujubefrüchte, Zimtäpfel, an denen sich alle gütlich taten: wir, die Bediensteten, die Vögel. Man sah die Früchte als nichts Besonderes an.
Aber eine Frucht gab es, die in ihrer Saison alle anderen überstrahlte: die Mango! Dann schwelgten wir alle in Mangos der köstlichen Sorten Langda, Dashehri, Chausa und den vor Ort gewachsenen Früchten zum Auslutschen.
Großvater hatte nichts gegen Mangos. Aber seine wahre Leidenschaft waren Süßigkeiten. Er aß unerschütterlich Frittiertes und Zuckerzeug, er ging nicht spazieren, und doch hatte er auch im Alter zwischen siebzig und achtzig erst einen Zahn verloren. »Schau dir meine Zähne an, schau, was für eine gute Verdauung ich habe, und behalte deine Wissenschaft für dich!«, ließ er mich einmal hören.
Einmal ging Großvater zusammen mit sieben oder acht anderen alten Herren spazieren. Einer hatte Bauchschmerzen, einer hatte Rückenschmerzen, einer hatte Verdauungsbeschwerden, einem taten die Gelenke weh, einer konnte nicht schlafen, alle waren kränklich oder leidend. Großvater fragte jeden Einzelnen dieser ehrwürdigen Herren: »Seit wann machen Sie täglich einen Morgenspaziergang, mein Lieber?« Einer antwortete: »Seit zwanzig Jahren«, einer: »Seit zehn Jahren«, ein Dritter arbeitete seit fünf Jahren an seiner Gesundheit. Darauf sagte mein Großvater: »Ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen. Von morgen an werden Siemich hier nicht mehr antreffen. Alles Gute zu Ihrem Morgenspaziergang!« Großvaters Spaziergänge beschränkten sich nun wieder auf den Weg von seinem Wohnzimmer zur äußeren Veranda, von der Veranda zum Wohnzimmer.
Großmutter war, was Essen und Trinken angeht, eine echte Genießerin. Falls es überhaupt Bindeglieder zwischen ihr und Großvater gab, dann war es diese gemeinsame Leidenschaft. Sie verlangte immer brühheiße, scharfe, mächtige Speisen. Alssie keine Zähne mehr hatte, zerstampfte sie, wenn nötig, das ganze Essen zu einem Brei.
Als wir ein paar Kenntnisse über gesunde Ernährungs-weise aufgeschnappt hatten und Porridge essen wollten, musste Mai sich von Großmutter sagen lassen: »Ihnen rohen Haferbrei vorzusetzen! Als ob wir es uns nicht leisten könnten, das Zeug ein wenig zu rösten!«
Mai antwortete ganz ruhig, dass es nicht roh sei und dass die Kinder es nicht mit Ghee geröstet wollten.
Aber wann hätte Großmutter je auf das letzte Wort verzichtet? »Ach ja, die Kinder wollen es so? Eine tolle Ausrede, wenn man einfach nur faul ist.«
Wir waren damals schon halb erwachsen. Ärgerlich riefen wir: »Großmutter, überall im Westen isst man es so, ungeröstet und ohne Ghee!«
Großmutter wurde wütend: »Ihr alle werdet noch zu›Engeländern‹. Geizt nur weiter so mit dem Essen, dann kriegt ihr bestimmt auch eine bleiche Haut!«
Subodh widersprach: »Warum fällst du Mai immer in den Rücken, warum kritisierst du sie immer? Sag doch uns selbst, was du zu sagen hast. Wir wollten es so essen.«
Großmutter traten die Augen aus den Höhlen: »Schau an, so gehts bei den ›Engeländern‹ zu. Kein Respekt vor irgendjemandem!«
Subodh explodierte jetzt: »Aber vor Mai habt ihr alle mächtig Respekt, nicht wahr?«
»Wunderbar«, erwiderte Großmutter sarkastisch. »Jetzt soll ich ihr wohl die Füße waschen und dann das Wasser trinken!«
Mai selbst bemühte sich ängstlich, uns zum Schweigen zu bringen: »Still, sch … sch … sch … Schluss jetzt!«
»Das ist deine ewige Predigt«, griff Subodh jetzt Mai an. »Wie du soll man immer schweigen und alles hinnehmen.«
Es passierte immer öfter, dass er die Beherrschung verlor.
Wir wollten nicht schweigen wie Mai, wollten nicht mit gesenktem Kopf und zur Erde gewandtem Blick auf andere hören und ausführen, was sie verlangten.
Dies war allerdings das Einzige an Mai, das selbst Großmutteranerkannte. Wenigstens diese eine Eigenschaft hatte Mai, um derentwillen sie ihr ab und zu alle ihre sonstigen Mängel verzieh – der ganze Tag konnte vergehen, ohne dass man Mais Stimme auch nur einmal gehört hätte. Auch wenn sie in den Club ging, bedeckte sie den Kopf mit dem Ende ihres Saris. Alle sagten zu Großmutter: »Mataji, aufgrund eurer guten Taten habt ihr eine so bescheidene, gutartige Schwiegertochter bekommen, die nie auch nur die Augen aufhebt.«
Und Großmutter belehrte uns: »Seht ihr, Kinder, das ist der echte Parda.«
Mai verbrachte den ganzen Tag in »Parda«, so viel Kraft entfalteten Großmutters gute Taten.
Wenn es Abend wurde und lange Schatten auf die Bäume fielen und wir vom Spielen nach Hause kamen, erwartete uns Mai mit Gläsern voll frischem Tomatensaft. Sie wusch uns die Hände und Füße, rieb sie mit Rosenwasser und Glyzerincreme ein, servierte allen anderen und uns das Essen und kam dann mit uns in unser Zimmer. Unser Zimmer und auch ihres.
Mai lebte damals in unserem, nicht in Papas Zimmer, wenngleich sie nachts zu ihm ging. Das wussten wir genau, weil wir es ihr nämlich sehr übel nahmen. Wir machten uns Sorgen um sie und riefen sie immer wieder, riefen sie zurück zu uns. Bei uns legte Mai ihren »wahren Parda« schließlich ab.
Wie wir drei zusammen lachten! Es war, als hätten in dem Zimmer drei gleichaltrige Kinder gelebt! Mai verbrachte viel Zeit damit, unsere Hausaufgaben zu überprüfen, auch wenn Papa einmal lachend zu jemandem im Club gesagt hatte, die Kinder sollten nicht sie wegen ihrer Hausaufgaben zurate ziehen, sondern einen gebildeten Menschen. Und als wir einmal Mai danach befragten, sagte sie, sie habe immerhin den Schulabschluss der zwölften Klasse. Wir drei unter uns waren weder ängstlich noch scheu. Wir kicherten in einem fort.
Etwa wenn Mai uns auf dem Bett Geschichten und Witze erzählte. Zum Beispiel: Der Herr fragt den Gärtner: »Warum hast du die Pflanzen nicht gegossen?« Darauf der Gärtner: »Aber Herr, es regnet doch!« Darauf schimpft der Herr: »Dann nimm doch einen Schirm!« Oder: Als der Fahrer den Wagen anhält, fragt der Herr: »Was ist los?« Der Fahrer antwortet: »Vor uns ist ein tiefes Loch.« Darauf befiehlt der Herr: »Dann hupe doch!«
In Mais Witzen waren die Herren immer blöd, und in ihren längeren Geschichten standen die scheinbar unbedarften armen Leute am Schluss als Sieger da.
In der Demut konnte eine siegreiche Kraft stecken, das spürten wir, dachten aber nicht weiter darüber nach.
3
Gedanken machten wir uns auch damals schon, aber über die eigenen Gedanken zu reflektieren, lernten wir erst später. Zunächst konnten deshalb einander widersprechende Ansichten in uns harmonisch koexistieren. Sie stellten sich weder gegenseitig infrage, noch suchten sie Bestätigung ineinander. Wir sahen ja selbst, dass Mai, sobald Papa nur aufblickte, in sich zusammenschrumpfte und sich wie ein Lamm hinter der Tür verkroch. Wir traten dann hervor, um »das arme Ding« zu beschützen. Im nächsten Moment konnte sie einem auf uns gerichteten aggressiven Blick mit einer so festen Haltung entgegentreten, dass Papa oder Großvater, wer immer es war, sich wortlos davonmachte und wir nun ohne Furcht hinter ihrem Sari-Ende Zuflucht nahmen.
Sobald wir über unsere Ansichten nachdachten, begannen uns einige Fragen auf den Nägeln zu brennen: Wer war hier »das arme Ding«? Wer beschützte wen? Jede Antwort provozierte eine neue Frage, stechend wie ein Skorpion. Wie es für Skorpionenstiche weder ein Heilmittel noch ein rasches Ende gibt,so auch für die schmerzhafte Benommenheit und Unruhe in unseren Köpfen, in denen alles um Mai … Mai … Mai … kreiste.
Großmutter sagte oft, dass Mai nur ein Gutes habe: Sie wahrte ihren Parda. Wir aber weinten, wenn wir diesen Parda sahen. Was auch immer geschehen mochte, wir würden uns niemals, niemals diesem Zwang unterordnen. Auch Großmutter stellte mit bitterer Stimme fest: »Heute versteht man unter Parda nur noch einen Vorhang, ein Stück Stoff, das vor der Tür oder dem Fenster hängt.«
Das Überraschende lag für uns aber darin, dass wir genau wussten: Hinter den Vorhängen, die wir an Türen und Fenstern hängen sahen, lagen komplett möblierte und dekorierte Zimmer, ein Zuhause, in dem ein Menschenherz jeden einzelnen Gegenstand berührte und ordnete. Wenn wir an einem unbekannten Ort einen Vorhang hängen sahen, wollten wir auch wissen, was dahintersteckte. Wir dachten nie, es sei ein im leeren Raum schwebender Vorhang mit nichts dahinter und nichts davor, verheddert in seinem eigenen lautlosen Flattern.
Wenn wir Mais Parda sahen, merkten wir nicht, dass noch etwas dahintersteckte.
Dieser Vorhang aus Geduld und Sittsamkeit sicherte Mai ihren Frieden. Als ein reiner, selbstloser Schatten hörte sie auf alle, diente allen.
Sie diente auch Großmutter, die redete, als hätte es gutes Aussehen, Manieren, Talent, Klugheit und sogar Mutterliebe in ihrer Generation zum letzten Mal gegeben und sei dann nie wieder aufgetaucht.
Großmutter ertrug es nicht, hinter irgendjemandem zurückzustehen. Der Einzige, bei dem sie es geduldet hätte, hatte sich von ihr abgewandt. Hellhäutig, die Augen mit Kajal schwarz eingefasst, war sie bis an ihr Lebensende stolz auf ihr gutes Aussehen. Oft zeigte sie mit dem Finger auf Mai und sagte: »Eine junge Frau und schon so gealtert. Wenn sie mal so alt ist wie ich, ist ihr Lack völlig abgeblättert. Noch heute habe ich eine hellere Haut als sie.« Sie bekräftigte das mit einem weit ausholenden Winken der Arme. »Die schwärzliche Farbe hat Sunaina von ihr geerbt. Mein Sohn, mein liebes Prinzchen, ist nach mir geraten. Weiß wie ein ›Engeländer‹.«
Komisch war, dass Großmutter Subodh niemals als »schwärzlich« bezeichnete, und als ich mich in meiner Kindheit einmal darüber beklagte, kicherte sie auf ihre pfiffige Art mit ihrem zahnlosen Mund: »Hihi, er geht doch hinaus in die Sonne. Klar, dass seine Haut dunkler wird. Ein Junge bleibt schließlich ein Junge. Mein kleiner süßer Laddu aus Zucker und Ghee, hi, hi!«
Sie nahm oft meine Hände in ihre und sagte: »Sieh mal, wie deine Adern schon in jungen Jahren hervortreten. Meine Hände waren so zart und seidig. Wer sie berührte, wollte sie gar nicht mehr loslassen.«
Dann erzählte sie, wie in ihrer Jugend ein englischer Freund von Großvater gesagt hatte: »Deine Frau hat so schöne Hände und Füße. Ob es dir passt oder nicht: Eines Tages schüttele ich ihr bestimmt die Hand.« Als Großmutters erster Sohn geboren wurde – Großmutter hatte elf Kinder zur Welt gebracht, aber nur Papa und eine Tante von mir haben überlebt –, da beglückwünschte der Engländer Großmutter, ergriff schnell ihre cremig weichen Hände und hielt sie ein paar Augenblicke lang in den seinen.
Ich erinnere mich gut, dass Großmutters Benehmen auch in ihrem hohen Alter etwas Selbstgefälliges hatte. Wenn sie im Stehen etwas sagte, dann hielt sie ihre Hüfte kess auf einer Seite angehoben, beide Hände elegant hinter dem Kopf verschränkt, mit kokett wiegenden Schultern, den Kopf zu einer Seite geneigt, und schoss einen Blick wie einen Dolch ab.
Für uns war Großmutter eigentlich schon immer alt gewesen. Wenn sie über ihre Jugend sprach, war es, als redete sie von einem früheren Leben! Aber solange sie noch normal gehen konnte, war sie nicht ganz so alt; als sie zu hinken begann, war sie auf einmal wirklich alt.