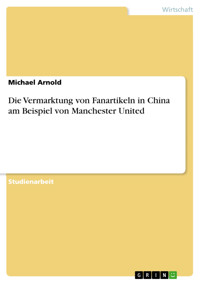Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der sozialkritische Frauen-, Familien- und Schicksalsroman Maik - Der Heimweg beschreibt den Lebensweg des fast volljährigen Maik. Schon vor der Geburt beginnt sein vorgezeichneter Lebensweg, dessen Verlauf er ausgeliefert ist. Angst, Trauer, Sorgen und Enttäuschungen sind mit wenigen Ausnahmen ständige Begleiter in einer Zeit, die eigentlich die schönste im Leben eines Menschen sein sollte, bevor er es eigenverantwortlich gestalten muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort
K1 - Lähmende Angst
K2 - Das darf doch wohl nicht wahr sein
K3 - Alles begann so früh
K4 – Tiefe Erniedrigung
K5 – Folgenreiche Ereignisse
K6 – Bittere Niederlagen
K 7 – Licht und Schatten
K 8 – Einzelschicksale
WIDMUNG
Dieses Werk widme ich meinen Freunden mit elterlich anmutendem Status -
Reinhard & Marina Kretschmer.
»Maik - Der Heimweg soll Euch künftig als Anerkennung für eine gewachsene Freundschaft begleiten, in der ich viel gelernt und ein hohes Maß an persönlicher Prägung erfahren habe. Damit habt Ihr Euch für immer ein besonderes Plätzchen in meinem Herzen erarbeitet.«
Michael Arnold
VORWORT
Sehr geehrte Leserschaft,liebe Freundinnen und Freunde von spannender Literatur,
zum 31. Dezember 2018 betreuten die Jugendämter in der Bundesrepublik Deutschland laut den Angaben des Statistischen Bundesamtes 143.316 Kinder und Jugendliche in Heimerziehung oder einer sonstigen betreuten Wohnform. Hinzu kamen 91.640 Kinder und Jugendliche, die sich in Vollzeitpflege in einer anderen Familie befanden. Voraussetzung für die Betreuung in einer Einrichtung der stationären Jugendhilfe (Heimerziehung) oder aber für den Verbleib in einer Pflegefamilie, ist die Gefährdung des Kindeswohls.
Doch wie sieht eine Gefährdung des Kindeswohls aus? Geschieht sie plötzlich, von heute auf morgen? Eher selten! Meistens stellt die Gefährdung des Kindeswohls einen Prozess dar, der irgendwann mehr oder weniger schleichend für die Betroffenen beginnt. Sind die allmählich ansteigende Gefährdung und ihre Konsequenzen für den Heranwachsenden nicht abzuwenden, folgt für ihn in diesem Prozess die befristete Unterbringung in einem Heim oder in einer Pflegefamilie. Zuvor verhält es sich häufig so, dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen durch falsch getroffene Entscheidungen und/oder durch (vorsätzlich) falsches Handeln der Erziehungsberechtigten in eine Opferrolle gedrängt werden, der sie ohne fremde Hilfe nicht entrinnen können. Unglückliche, von außen wirkende Einflüsse, haben dabei eine beschleunigende Wirkung auf den ganzen Prozess. Das kann z.B. der Tod einer Bezugsperson ebenso sein, wie der Umzug in ein anderes (soziales) Umfeld.
Das vorliegende Werk stellt einen solchen Prozess anschaulich dar, der nicht selten mehrere Jahre andauert. Wegbegleiter der betroffenen Kinder und Jugendlichen sind währenddessen vielfach Enttäuschungen, Entbehrungen, Vernachlässigungen, sowie körperliche und seelische Schmerzen.
Die hohe Anzahl der durch die Jugendämter betreuten Kinder und Jugendlichen rechtfertigt daher durchaus die kritische Frage, welche Umstände dazu führen können, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr in ihren Herkunftsfamilien leben können? Das folgende fiktive Beispiel soll Licht in das Dunkel familiärer Tragödien und dramatischer Verläufe mit katastrophalen Folgen für die Beteiligten bringen. Es skizziert aber auch ein gesellschaftliches System, dass Jahr für Jahr so viele Hilfsbedürftige hervorbringt. Manche schaffen es, ihre Schwierigkeiten hinter sich zu lassen. Viele andere schaffen es aber nicht, resignieren und / oder zerbrechen daran.
Michael Arnold
K1 - LÄHMENDE ANGST
Das Hindernis kommt mit beängstigender Geschwindigkeit näher. Um langsamer zu werden, ist es zu spät. Mit diesem Tempo wächst das eigene Spiegelbild bis zur Lebensgröße heran, bevor es mit einem lauten Knall in unzählige Einzelteile zerbricht.
Station 4, es ist 14.00 Uhr und somit der Beginn einer neuen Mittagschicht auf der Inneren Medizin. Der Ort wirkt auf Eva nach 43 Dienstjahren als Krankenschwester in dieser Klinik auch weiterhin kalt, unfreundlich und vor allem lieblos. Obwohl sie diesen Eindrücken täglich über viele Stunden hinweg ausgesetzt ist, nimmt Schwester Eva sie kaum noch wahr. Zu sehr ist sie im Laufe ihrer Dienstzeit gegenüber vielen Dingen einfach abgestumpft. Oft hatte sie Verbesserungsvorschläge eingereicht, um diese ganzen Räumlichkeiten auch im Sinne der Patienten etwas menschlicher zu gestalten. Aber ihre Vorschläge wurden nie umgesetzt. Auf Anfrage wurde ihr stets zurückgemeldet, dass die Gelder knapp wären und wichtigere Ausgaben anstünden.
So muss auch sie täglich mit einem endlos lang erscheinenden und weiß gestrichenen Flur leben, in dessen Verlauf sich auf der linken Seite eine Türe an die nächste reiht. Die exakten Abstände zwischen den identisch gestalteten Türen perfektionieren diese alltägliche Monotonie. Auf der rechten Flurseite langweilen sich die Augen durch ebenso viele gegenüberliegende Türen weiter, bis sie auf eine Glaswand treffen. Etwas Tageslicht tritt durch das Glas auf den Flur, was der Atmosphäre des langen Ganges gut zu Gesicht steht. Aber es schieben sich in diesem Moment bereits dunkle Wolken vor die Sonne, die ein Wärmegewitter mit kräftigem Regen ankündigen. An dieser Stelle würde man sonst keinerlei Lichtblicke erwarten.
Hinter der Glaswand präsentiert sich das Schwesternzimmer, in dem vier Krankenschwestern und ein Arzt arbeiten. Während zwei Kolleginnen wortlos mit der schnellen Durchsicht von einheitlich grauen Akten beschäftigt sind, verschwindet die Dritte hinter einem Aktenschrank, der mitten im Raum steht. Zu den Wänden rechts und links hält dieser in heutigen Tagen antiquiert anmutende Arbeitsspeicher einen akkuraten Abstand von jeweils zwei Metern.
Eva ist die vierte Schwester im Raum und erwartet zu Dienstbeginn von dem Chefarzt Dr. Brucks ihre täglichen Anweisungen. Wie an jedem Tag darf sie auch heute davon ausgehen, dass er dabei äußerst präzise wird und alle Formulierungen sofort auf den Punkt bringt. Dabei bemüht er stets eine strenge Stimme, die auch von einem General kommen könnte. Doch heute läuft es etwas anders.
Es beginnt damit, dass auch Schwester Eva sich durch die grauen Akten lesen möchte, um sich auf ihren Dienst und auf die Patienten optimal vorbereiten zu können. So streckt sie gerade die Hand aus, um nach einer Akte zu greifen, als sie die Stimme des Chefarztes hört. Dabei schaut er sie noch nicht einmal an, weil er mit einem aufgeschlagenen Bericht in seiner Hand beschäftigt ist.
»Sie brauchen die Patientenakten heute nicht zu lesen, Schwester Eva. Es reicht völlig aus, wenn Sie nur eine, die dafür aber umso genauer, studieren. Setzen Sie sich bitte auf den Stuhl. Auf Sie wartet heute eine andere Aufgabe.«
Während der Arzt weiterhin mit seinem Bericht beschäftigt ist, scheint er gar nicht bemerkt zu haben, dass er soeben erneut die erfahrene Schwester wie einen dummen Schuljungen zum Sitzen auf einem Stuhl degradiert hat. Genau dieses menschlich abwertende Verhalten hasst sie an ihrem Chef. Zu gerne hätte sie ihm das einmal gesagt, aber befürchtete Repressalien hielten sie nicht grundlos immer davon ab. Ihm ist es nach ihrer Ansicht zuzutrauen, dass er auch sie nach einer ausgesprochenen Kritik, selbst wenn die berechtigt wäre, ins Tal des Todes zum Staubwischen versetzen würde. Damit ist innerhalb des Hauses die Pathologie im Keller gemeint, in die schon einige von ihren Kolleginnen nach einer Auseinandersetzung mit Dr. Brucks versetzt worden waren. Dies brachte ihm in den Kreisen des weiblichen Personals den nur vorsichtig geflüsterten Spitznamen »Ladykiller« ein.
Nachdem sie widerwillig Platz genommen und ihren Chef eine Weile erwartungsvoll angeschaut hat, legt dieser endlich seinen Bericht aus der Hand und wendet sich der Schwester zu.Dabei schaut er gewohnt streng mit nach vorne geneigtem Haupt über den Rand seiner Lesebrille, was sie auch heute als Wichtigtuerei interpretiert. In diesem Moment schießt, wie schon so oft in der Vergangenheit, die Frage durch ihren Kopf, ob der Arzt ihr Wissen, ihr Können und ihre Zuverlässigkeit überhaupt bemerken und richtig einschätzen würde. Oder würde sie in seinem Denken vielleicht nur ein zweckdienliches Arbeitsmaterial darstellen? Doch auf eine Art ist sie froh, dass er sich ihr gegenüber zu diesem Thema noch nie äußerte. Vielleicht wäre die Zusammenarbeit danach mit diesem Ekelpaket weitaus unerträglicher, als Schwester Eva sie bislang schon immer empfunden hat.
»Schwester Eva, in Zimmer 422 befindet sich der Patient Maik Harms. Er ist 17 Jahre alt und wurde gegen Mitternacht im Rahmen eines Notfalls mit dem Rettungswagen zu uns gebracht. Aus seiner Akte entnehmen Sie bitte, nach meiner gegebenen Dienstanweisung, alle notwendigen Informationen.«
Naja, denkt sich Schwester Eva eher ernüchtert. Bisher erscheint ihr noch alles im Rahmen des Machbaren. Der Patient Harms wäre nicht die erste Notaufnahme, die sie zu versorgen hätte. Aber sie fragt sich auch, warum der Doktor wegen einer Notaufnahme solch ein Fass aufmacht. Um ihren Gedankengängen keinen verräterischen Ausdruck zu verleihen, schaut sie den Chefarzt weiterhin reg- und kommentarlos an. Er soll wieder einmal auf keinen Fall ihre Verunsicherung und vor allem die Angst spüren, die sie vor ihm und seiner Macht als Chefarzt hat.
»Halten Sie seine Vitalfunktionen genau im Auge! Ich wünsche zudem, dass Sie ihren heutigen Dienst elementar anders gestalten, als Sie es gewohnt sind.«
Seine erweiterte Ausführung lässt Sorgen in der Krankenschwester aufkommen. Vielleicht handelt es sich bei dieser Notaufnahme um einen besonders schwer verletzten Patienten.Aber warum sollte sie dann ihren Dienst anders gestalten? So etwas wurde von ihr noch nie verlangt.
»Leisten Sie dem Patienten bis zu ihrem Dienstende am Abend Gesellschaft, wobei der Schwerpunkt von ihnen auf die Kommunikation zu setzen ist.«
Das sollte es gewesen sein? Mehr nicht! Nur nach den Vitalfunktionen eines Jugendlichen schauen und dann ein wenig mit ihm plaudern? Und für diese Aufgabe wurde ausgerechnet sie ausgesucht? Warum könnte dieser Auftrag nicht von einer jüngeren Kollegin oder vielleicht von einer ehrenamtlichen Schwester erledigt werden? Diese Fragen lassen die Schwester etwas verständnislos in ihren Stuhl zurücksinken. Zunehmend fällt es ihr schwerer, den Grad ihrer Verunsicherung zu verbergen. Sah der Arzt in ihr mittlerweile nur noch eine alte Schachtel, die dem regulären Krankenhausbetrieb nicht mehr gewachsen ist? Mit ungebrochen hoher Aufmerksamkeit, aber auch mit gemischten Gefühlen, lässt sie den Rest dieser Dienstanweisung über sich ergehen.
»Rechnen Sie mit Fluchtgefahr dieses Patienten bei der ersten sich bietenden Gelegenheit. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, weil er sich laut Aussage der Polizei in seinem Verhalten stets ausgesprochen instabil zeigte. Da gegen ihn mal wieder aktuell ermittelt wird, müssen die es ja schließlich wissen.«
Nach diesen Worten ihres Chefarztes ist das Unverständnis in ihrem Kopf komplett, da es völlig unüblich ist, solche Dienstanweisungen an Krankenschwestern zu vergeben. Wäre dies nicht eher ein Fall für einen Psychologen? Doch auch ein zunehmendes Interesse an dem Patienten macht sich in ihr breit.Vielleicht müsste sie sich nicht allein dieser Aufgabe stellen und könnte eventuell Unterstützung erwarten. Also fragt sie nach und ist dabei um Sachlichkeit mit einer gespielten Sicherheit bemüht. Dabei ist ihr klar, dass sie sich bei Dr. Brucks keine Unsicherheiten leisten darf. Er würde solche Gefühle garantiert sofort bemerken und sich dann sicherlich noch mächtiger fühlen. Diesen Triumph will sie ihm nicht gönnen.
»Hat der jugendliche Patient Eltern oder Angehörige? Dürften diese zu dem Patienten ins Zimmer?«
Dr. Brucks hebt die Augenbrauen, was sie noch weiter verunsichert. Hatte Schwester Eva vielleicht etwas Falsches gefragt?
»Das ist eine gute Frage und zugleich das zentrale Problem, Schwester. Dieser Patient befindet sich in einer Maßnahme der stationären Jugendhilfe, die allgemein als Heimerziehung bekannt ist. Demnach dürfen Sie bei der Bewältigung ihrer Aufgabe nicht auf Hilfe von außen hoffen.«
Nach diesen als gefühllos empfundenen Worten ihres Chefs, hätte sich Schwester Eva nur allzu gerne krankgemeldet.Eine solche Dienstanweisung erscheint ihr wie eine lupenreine Schikane und im ersten Augenblick als kaum umsetzbar.Offensichtlich handelt es sich bei diesem Patienten um einen unberechenbaren und zugleich kriminellen Jugendlichen, der schwer verletzt zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle über sich verlieren könnte. Was hätte sie ihm da schon entgegenzusetzen?Doch es breitet sich auch ein zartes Pflänzchen der Hoffnung in ihr aus. Denn der Arzt war mit seiner Dienstanweisung noch nicht am Ende. Vielleicht käme noch so etwas wie ein mildernder Umstand, der ihre Arbeit an diesem Tage wenigstens etwas kalkulierbarer gestalten würde.
»Ich wünsche ausdrücklich, dass dieser Patient einen unauffälligen Aufenthalt in unserem Hause hat. Hierzu ist es erforderlich, dass er sich angemessen verhält. Ich gebe ihnen hierzu den Rat, ihre eigenen Normvorstellungen von Kommunikation in diesem Fall nicht als verbindlich und allgemeingültig zu betrachten. Vor gut vier Jahren hat unser Haus in einem ähnlichen Fall Erfahrungen gesammelt, die ich nicht weiter ausführen möchte. Ich hoffe, dass wir uns verstanden haben, Schwester.«
Spätestens seit diesem Augenblick weiß Schwester Eva, wie sich ein zartes Pflänzchen der Hoffnung fühlen muss, auf dem gerade ein Elefant seinen Fuß parkt. Ebenso, wie ein solches Gewächs, fühlt sich auch die Krankenschwester ziemlich geplättet. Wie konnte sie nur wieder annehmen, dass von ihrem Chef mildernde Umstände zu erwarten wären, ärgert sie sich über ihre Naivität.
Der Arzt greift zu dem Schreibtisch und nimmt sich die einzige dort liegende graue Akte mit der Aufschrift »Harms«.Während er sie der Schwester reicht, schaut er gleichzeitig kurz auf seine Armbanduhr, die akkurat unter seinem Kittelärmel bei ausgestrecktem Arm hervortritt. Wortlos empfängt Schwester Eva die handschriftlich angelegte Datensammlung.
Nun bleibt ihr nichts anderes übrig als dabei zuzuschauen, wie der Arzt sich wortlos von ihr abwendet. Gottlob hat der Teufel in seinem weißen Kittel hinten keine Augen und kann nicht sehen, dass Schwester Eva um Fassung ringt. Sie in ihrem Alter mit einem schier unlösbar erscheinenden Auftrag in die Wüste zu schicken, erscheint ihr als eine bodenlose Frechheit.Erschwerend kommt aber noch hinzu, wie er das tat: ohne Hilfestellungen, gefühlskalt, mit einer gekannt widerlich arroganten Tonart und dann kam auch noch das menschenverachtende Zuwenden des Rückens hinzu. Das alles ist für den Geschmack der betagten Krankenschwester zu viel.
Tief holt sie Luft und erhebt sich, wie mit Bleigewichten auf ihren Schultern beschwert, aus ihrem Stuhl. Dabei schaut sie eher zufällig in das junge Gesicht ihrer Schwesterkollegin Gabi.Diese erwidert den Augenkontakt und schaut die dienstälteste Schwester der Station für einen Moment lang an. Ohne Worte miteinander auszutauschen, bemerkt Schwester Eva, dass zumindest Gabi so etwas wie ein Mitgefühl für ihre Lage zu empfinden vermag. Sie erkennt es daran, dass Gabi verlegen lächelnd ihre Lippen zusammenpresst und kurz ermutigend nickt. Jedoch getraut sich keine der beiden Frauen in der Anwesenheit des Chefarztes auch nur ein Wort über diese Dienstanweisung zu verlieren. Das würde Dr. Brucks sofort als Untergrabung seiner Autorität bewerten und hätte Folgen für beide Kolleginnen. Somit bleibt Schwester Eva nicht viel mehr übrig, als erhobenen Hauptes zur Türe des Schwesternzimmers zu gehen, den Raum zu verlassen und die Türe hinter sich zu schließen.
Es ist das erste Mal, seitdem sie auf dieser Station arbeitet, dass sie das vom Tageslicht durchflutete Schwesternzimmer als beklemmend empfindet und den kurzen Aufenthalt auf dem von ihr so ungeliebten, weil tristen Flur, genießen kann. Nun muss sie wenigstens nicht die direkte Nähe zu ihrem Chef ertragen. Diese Erleichterung verhilft ihr sogleich dazu, einige Blicke in die Akte zu werfen. Doch die liest sie, ohne sie wirklich zu lesen. Es ist vielmehr die Abwechslung, wenigstens für eine Minute an etwas anderes als die Dienstanweisung und den bevorstehenden Kontakt zu dem Patienten denken zu müssen. Doch diese Ablenkung, das stellt sie sehr schnell fest, ist vergleichbar mit der Wirkung eines Alkoholrausches: Ist der vorbei, sind die Probleme weiterhin da.
Nun schaut auch sie auf ihre zierliche Damenarmbanduhr.Ohne Brille erkennt sie sofort: 14.11 Uhr. Es warten noch sieben Stunden und neunundvierzig Minuten auf sie, bevor der Feierabend sie von dieser Schicht erlöst. Es sind aber auch sieben Stunden und neunundvierzig Minuten, in denen sie sich dem unbekannten Patienten namens Maik Harms mit seinen bekannten Verhaltensweisen zu stellen hat. Das behagt ihr gar nicht, weil sie ihre Situation nicht einzuschätzen vermag.
Nun wird es ihr auch noch etwas kalt und ein wenig übel.So fühlte sie sich doch noch nicht zu ihrem Dienstbeginn. Würde sie vielleicht krank werden und käme tatsächlich so um die Erfüllung ihrer Dienstanweisung herum? Da das zu schön wäre, um wahr zu sein, lässt sie sich von realen Gedankengängen einholen. Die erinnern Schwester Eva daran, dass sie einst aus einer tiefen inneren Überzeugung heraus Krankenschwester geworden ist. Die gründete darin, dass sie kranken Menschen aus der Nächstenliebe heraus helfen wollte. Und genau dieser Wunsch lebt auch heute noch unverändert in ihr.
Also klemmt sie sich die Akte unter ihren Arm und beginnt damit, den mit grünem Linoleum verlegten Flur entlangzugehen. Dabei bemerkt sie, dass dort eine beängstigende Totenstille herrscht. Ihr Blick geht entlang der rechten Flurseite in Richtung des Zimmers 422. Zwangsläufig schaut sie dabei auf das große Fenster am Ende des Flures, als ihr eine gewisse Ironie der eigenen Situation bewusst wird. Sollte ihr jetzt jemand erzählen, dass dieser Tag ein guter Tag für sie werden könnte, möchte sie nicht wissen, was ein ganz guter Tag für sie bereithalten würde. Draußen beginnt Regen wie ein vom Himmel gesandtes Orchester gegen die Scheibe zu prasseln, während es dabei fast so dunkel ist wie zum Einbruch einer Nacht.Einsetzende Blitze und Donner lassen Schwester Eva denken, dass sie nach einem Donnerwetter in doppelter Hinsicht im Regen steht. Dabei ist es letztendlich egal, ob sie sich nun hier drinnen im Krankenhaus oder draußen vor dem Gebäude befindet – ungemütlich ist es beider Orte.
Hinter dem Schwesternzimmer liegt das Zimmer 416. Auf dieser rechten Seite befinden sich alle gerade nummerierten Räume der Station. Danach kommt bereits das Zimmer 418, das sie auch hinter sich lässt. Dann kommt auch schon das Zimmer 420. Unzählige Male lief sie bereits in den letzten Jahren diesen Gang entlang: Rein in die Zimmer, raus aus den Zimmern. Mittlerweile schaut sie dabei nicht einmal mehr auf die Türschilder, die jeweils rechtsseitig in einheitlicher Sichthöhe neben den Türen angebracht sind. Sich ihrer Aufgabe bewusst, redet sie sich ein, an Selbstsicherheit gewonnen zu haben. Aufkommende Neugierde und die Sorge um das Wohl des Patienten scheinen sie dabei anzutreiben.
Während Schwester Eva das Zimmer Nummer 422 erreicht, hebt sie ihre Hand, um noch im Laufen an die Türe zu klopfen und zielsicher nach der Klinke zu greifen. Erneut spürt sie Kälte, die jetzt aber von der Metallklinke ausgeht und sich auf ihrer Handinnenfläche rasch ausbreitet. Kurz atmet sie durch, drückt die Klinke nach unten und öffnet die Türe. Nun gibt es für sie kein Zurück mehr. Ihr erscheint das Motto »Augen zu und durch« als einzig probates Mittel, sich ihrer aufgebürdeten Dienstanweisung zu stellen. Dabei will sie sich keine Blöße geben und begrüßt diesen Patienten so freundlich wie jeden anderen Patienten tagtäglich auch.
»Guten Tag, Herr Harms.«
Überrascht vernimmt sie das kurze Echo ihrer eigenen Worte. Außer dem Krankenbett mit beistehendem Nachttisch, einem Kleiderschrank und zwei mit grünlichem Stoff spärlich bezogenen Stühlen, die sich an einem Tischchen befinden, steht in diesem Zimmer sonst nichts mehr. Die Leere des grünen Bodens und der weißen Tapeten wird auch nicht durch die grünen Fenstervorhänge und die weiße Lampe an der ebenso weißen Decke gemildert.
Ausgesprochen merkwürdig und zugleich aussagekräftig ist daran, dass der Patient allein in diesem Zimmer liegt.Schwester Eva erinnert sich an ein Gespräch vom Vortag, dass mit einer Überbelegung der Station zu rechnen sei. Demnach sollte in alle Mehrbettzimmer, in denen sich noch kein Extra-Bett befand, ein weiteres Bett hinzugeschoben werden. Jetzt dämmert es ihr. Offensichtlich nahm der Chefarzt nach der Aufnahme des Patienten Harms bewusst die Überbelegung anderer Zimmer in Kauf, um diesen Patienten einzeln unterbringen zu können. Dies wirft sogleich zwei Fragen in ihr auf: Wie tief muss ein Mensch sinken, um auf solche absurden Ideen wie Dr. Brucks zu kommen, und würde der mit seiner Einschätzung des Verhaltens dieses Patienten richtig liegen? Während ihr die erste Frage kaum zu beantworten erscheint, wirkt eine Antwort auf die zweite für sie nicht unmöglich.
Vor ihr liegt ein nahezu bewegungsunfähiger Mensch. Der Kopf des jungen Mannes ist mit einem Turban bandagiert, was auf eine Kopfverletzung hinweist. Der Hals ist ummantelt von einer Halskrause, die den Kopf stützt. Dies deutet auf Probleme mit den Halswirbeln hin. Über dem linken Auge des Patienten befindet sich ein weißes Kissen. Es wird durch einen Klebestreifen, quer über das Gesicht von der dunkelblonden Augenbraue bis zum linken Jochbein verlaufend, fixiert und deutet auf eine Augenverletzung hin. Sein rechter Arm liegt bis zur Schulter in einer Gipsschiene und ist bandagiert. Das schaut zumindest nach einer Fraktur aus. Die weiße Bettdecke verbirgt seinen Körper ab der Brust, bis über die Füße hinweg. Aber gerade noch sichtbar ist eine Bandage des Oberkörpers. Lediglich sein linker Arm scheint unverletzt zu sein. Ihn hält der Patient nach oben gestreckt, um sich leger mit der Hand am Galgen über dem Bett festzuhalten. Schwester Eva ist auf Anhieb klar, dass dieser Patient sich ohne fremde Hilfe kaum bewegen könnte und garantiert auf Hilfe angewiesen wäre, wenn er sich bewegen wollte. Das Einzige, das er in dieser Verfassung tun könnte, wäre Schwester Evas Anwesenheit mehr oder weniger schroff abzulehnen. Aber ob er sich ihr gegenüber so verhalten möchte, steht für sie noch lange nicht fest. Folglich dürfte seine Einzelunterbringung zu diesem Zeitpunkt schwer zu begründen sein.
Sie schließt die Türe, geht auf den Patienten zu und legt dabei die graue Patientenakte auf das kleine Tischchen im Zimmer. Leider zeigt der junge Mann auf ihre Begrüßung keinerlei Reaktion. Das scheint ihr nicht vorteilhaft für sie zu sein, denn sie ist sich der prägenden Wirkung des ersten Eindrucks durchaus bewusst. Also versucht sie es erneut in unveränderter Stimmlage.
»Guten Tag, Herr Harms. Ich heiße Sie herzlich willkommen auf unserer Station 4 des St.-Anna- Krankenhauses. Mein Name ist Schwester Eva.«
Ihr entgegnet eine ruhige und für einen fast volljährigen Mann unerwartet hohe Stimme, die ein kurzes »Hallo« verlauten lässt. Damit scheint ein Anfang getan zu sein. Also folgt nun der zweite Schritt.
»Wie geht es ihnen, Herr Harms? Haben Sie Schmerzen?«, möchte sie von ihm wissen. Diesmal lässt die Antwort etwas länger auf sich warten.
»Es geht so. Ich kann es aushalten«, ist seine knappe Antwort.
Die Schwester glaubt, sie habe auch diesen zweiten Schritt erfolgreich vollzogen. Doch das kann noch nicht alles gewesen sein. Weiterhin merkt sie, wie sie ihren gemischten Gefühlen unterliegt, die einfach keine Sicherheit im Umgang mit diesem Patienten aufkommen lassen wollen. So spürt sie jetzt in erster Linie Mitleid gegenüber einem jungen Menschen, der ihr sehr stark verletzt zu sein scheint. Darin schwingt auch die Sorge mit, ob dieser junge Mensch jemals wieder ganz gesund werden würde. Als nicht weniger stark empfindet sie das Gefühl einer wachsenden Neugierde in sich. Die resultiert schlichtweg aus dem Interesse an der Person als solcher. Welche charakterlichen Schemen schlummern in diesem Patienten?Daraus erwächst die Frage, ob die Erfüllung ihrer Dienstanweisung tatsächlich so unmöglich ist, wie sie es befürchtet. Und genau das will sie jetzt herausfinden.
»Gibt es etwas, das ich für Sie tun kann? Wie wäre es mit einem Glas Wasser?«, lautet ihre nächste Frage.
Ohne den Kopf zu bewegen oder den Galgen mit seiner gesunden Hand loszulassen, antwortet der Patient schlagfertig.»Trinken? Gerne. Aber nur dann, wenn kein Alkohol darin ist.«
Mit Verwunderung schaut Schwester Eva zu diesem Patienten herab und bemerkt, wie ihr diese als locker erscheinende Antwort ein ehrliches Lächeln auf die Lippen zu zaubern vermag. Mit einer solchen Reaktion hätte sie niemals gerechnet, was sie sich ehrlich eingestehen muss. Aber unkommentiert möchte sie diese Bemerkung auch nicht lassen. Somit beschließt sie, gleich mal ihre Grenzen bei diesem Patienten auszutesten und so in Erfahrung zu bringen, ob der junge Mann für Humor vielleicht etwas mehr übrig hat. Sollte dem so sein, könnte sie darauf eventuell aufbauen.
»In unserem Wasser ist bestimmt kein Alkohol enthalten. Was ich ihnen dazu aber mit Bestimmtheit sagen kann, ist, dass es einem ausgezeichneten Jahrgang entstammt.«
Diese Bemerkung provoziert sogleich eine Reaktion, die Schwester Eva zwar insgeheim erhofft, aber nicht unbedingt erwartet hätte. Er dreht seinen Kopf etwas in ihre Richtung, wobei sein gesundes Auge sie zum ersten Mal kritisch mustert.Dabei entgeht ihr nicht, dass auch er ansatzweise lächelt.
»Lachen Sie mich an oder lachen Sie mich aus?«, möchte der Patient entspannt klingend wissen.
»Ich lache Sie an, da mir Ihre Antwort gut gefallen hat. Solche lockeren Sprüche vernehme ich hier selten, aber durchaus gerne.«
»Sie waren aber auch gut drauf, Schwester«, lobt sie der Patient.
Schwester Eva greift zu der grünen Glasflasche auf dem weiß lackierten Nachttisch direkt neben dem Bett und dreht den Flaschenverschluss gut hörbar mit dem charakteristischen Zischen ab. Sie nimmt eines der beiden auf den Kopf gestellten Gläser, dreht es um und schenkt das kühle Nass aus der Flasche ein. Das ihm gereichte Glas veranlasst den Patienten dazu, den Galgen loszulassen und sicher nach dem Trinkgefäß zu greifen.Er führt es zu seinem Mund und leert es mit einigen Zügen. Danach reicht er es wortlos der Krankenschwester, die es gerne annimmt.
»Darf es noch ein Schluck sein?«, bietet sie erneut ihre Hilfe an.
»Nein danke, sonst gewöhne ich mich noch daran«, ist der nächste lockere Spruch, der seine Lippen verlässt.
Sofort bemerkt sie, dass er mit seiner Art den humorvollen Weg weiter beschreitet. Also beschließt sie ihm zu folgen. Da auch sie im Grunde ein humorvoller Mensch ist, fällt ihr das noch nicht einmal sonderlich schwer.
»Sie scheinen sich nicht sicher zu sein, ob Sie dem Alkohol zusprechen sollen oder sich mit dem Wasser anfreunden möchten. Gibt es dafür einen Grund?«
Der Patient überlegt eine Weile, bevor er antwortet. Für Schwester Eva ist es der Moment in dessen Verlauf sie sich überlegt, ob diese Frage nicht vielleicht etwas zu gewagt von ihr war. Aber auch im Nachhinein fällt ihr nichts Besseres ein, das sie hätte fragen können. Doch bevor sie negative Folgen befürchten kann, erhält sie eine Antwort.
»Nachdem, was passiert ist, habe ich keinen Bock mehr auf Schädelwasser. Aber davon haben Sie doch bestimmt schon gehört, oder? Ich kenne es nicht anders, als dass sich solche Sachen sehr schnell herumsprechen.«
Sollte das eine Antwort gewesen sein, dann bestünde sie aus zwei Teilen. Der erste Teil drückt eine zumindest kurzzeitige Ablehnung gegenüber Alkoholgenuss aus. Der zweite Teil offenbart ihr pures Misstrauen gegenüber anderen Menschen.Anscheinend ist Herr Harms es gewohnt, dass Dritte über ihn sprechen, anstatt mit ihm zu reden. Doch sie lässt sich nicht von ihrem Gesprächsfaden abbringen und schaut dem Patienten weiterhin ins Gesicht. Dies lächelt zwar immer noch, doch es kommt ihr in diesem Moment wie ein versteinertes Lächeln vor. Unbestreitbar ist aber, dass der junge Mann jetzt etwas von ihr hören möchte, das auf jeden Fall ehrlich ist. Und genau da liegt das Problem. Würde sie jetzt mit ihrem Wissen über die Heimkarriere und den polizeilichen Ermittlungen auftrumpfen, wäre das Gespräch unzweifelhaft sofort für ihn erledigt.Also beschließt sie, auch um ihm eine faire Chance zu geben, etwas zu flunkern. Gerne macht sie so etwas zwar nicht, aber es erscheint ihr als der richtige und vor allem der sichere Weg.
»Nein, Herr Harms. Ich habe nichts Genaues gehört. Mir ist nur bekannt, dass Sie in der vergangenen Nacht mit dem RTW hier eingeliefert und danach umgehend operiert wurden. Gäbe es denn etwas, das ich besser von ihnen als von anderen hören sollte?«, möchte sie selbstsicher klingend wissen.
Dabei hat sie nicht unbedingt das Gefühl, dass das Gespräch auf der Kippe zu stehen scheint. Um dies einschätzen zu können, hört sie einfach auf ihre gesunde Menschenkenntnis und vertraut dabei auf unzählige Erfahrungen mit Patienten aus den letzten Jahrzehnten.
Gerade holt der Patient Luft, um einen weiteren Gesprächsbeitrag zu liefern, als es kurz an der Türe klopft und diese zeitgleich geöffnet wird. Herein tritt, wie sollte es auch anders sein, Herr Dr. Brucks. Ohne die Türe hinter sich zu schließen, geht er schnurstracks auf das Krankenbett zu. Unterwegs nimmt er die graue Patientenakte vom Tischchen an sich, schlägt sie auf und beginnt darin zu blättern. Am Fußende des Bettes bleibt der Chefarzt stehen, ohne dem Patienten auch nur einen einzigen Blick zu gönnen. Erst nachdem er mit dem Blättern fertig ist, widmet er sich dem Patienten, der ihn breit grinsend anschaut.
Mit seiner tiefen Stimme und der strengen Tonlage spricht der Doktor den jungen Mann an.
»Guten Tag, Herr Harms. Wie geht es ihnen?«
»Bis gerade eben ging es noch«, antwortet dieser knapp.
Nach diesen sechs Worten hat Schwester Eva keinen Zweifel daran, dass sich in dem Bruchteil einer Sekunde ein schweres Unwetter zusammenbraut. Ein Blick in das Gesicht ihres Chefs lässt sie dessen ihr nur zu gut bekannten Züge erkennen.Der Chefarzt wird sofort todernst, da er, wie Schwester Eva auch, den pampigen Unterton des Patienten vernommen hatte.Er atmet deutlich hörbar ein für das, was er sagen möchte.
»Herr Harms, ich darf mich ihnen als Chefarzt Dr. Brucks dieses Krankenhauses vorstellen. Ihrer auf mich respektlos im Ton wirkenden Antwort entnehme ich, dass Sie offensichtlich noch nicht darüber in Kenntnis gesetzt wurden, unter welchen Umständen Sie zu uns kamen und in welcher Situation Sie sich befinden.«
Schwester Eva weiß ganz genau, dass das noch nicht alles von ihrem Chef gewesen sein kann. Doch sie beginnt in Erinnerung an ihre Dienstanweisung zu hoffen, dass die Schärfe des Dialogs nicht zunimmt. Es käme eben nur darauf an, wie sich der Patient ab jetzt gegenüber dem Chefarzt verhalten würde.Doch das kann sie absolut nicht einschätzen.
»Sie werden es mir sicherlich gleich erzählen«, hält der Patient weiterhin pampig und zugleich stramm grinsend dagegen. Aber das war ein weiterer Fehler von ihm, den auch der Arzt bemerkt und abermals Luft holt.
»Dem will ich gerne nachkommen. Sie wurden in der vergangenen Nacht mit dem Notarzt in unsere Klinik gebracht, nachdem ein Notarztwagen gerade noch bremsen konnte, als Sie dem mit einem Mofa die Vorfahrt nahmen und dann direkt ohne Sturzhelm ungebremst in eine Schaufensterscheibe rasten.«
Während der Patient diese Worte in der strengen Tonlage des Chefarztes vernimmt, verliert er zunehmend sein provokant wirkendes Grinsen. Die Lippen verkümmern zu einem beschämten Lächeln, was den Chefarzt ruckartig in eine führende Gesprächsposition bringt. Der bemerkt das natürlich und legt nach.
»Dabei verletzten Sie sich zwei Halswirbel und zogen sich einen offenen Bruch ihres rechten Arms zu. Glassplitter der zerstörten Schaufensterscheibe verletzten ihr linkes Auge nicht unerheblich, während weitere 96 Splitter für zum Teil erhebliche Schnittverletzungen gesorgt haben. Diese Glassplitter mussten wir operativ aus ihrem Körper entfernen. Insgesamt haben Sie eine vierstündige Operation hinter sich, wobei Sie es uns nicht unbedingt leicht machten, Sie zu operieren.«
Selbst von dem beschämten Lächeln ist in diesem Moment bei dem jungen Mann nichts mehr übrig geblieben. Was bleibt, ist die versteinerte Mimik eines Hilflosen.
»Sie wiesen einen Blutalkoholspiegel von 2,1 Promille auf, wobei wir zusätzlich noch deutliche Rückstände einer chemischen Substanz nachweisen konnten, die allgemein als Ecstasy bekannt ist. Dabei hatten Sie noch unfassbares Glück im Unglück. Es gibt etliche Schnittverletzungen, die sehr tief sind und in der unmittelbaren Nähe großer Blutgefäße liegen. Aber diese Gefäße blieben wie durch ein Wunder unverletzt.«
Für Schwester Eva ist klar, dass der Chefarzt sich immer noch nicht mit dem Gesagten zufrieden geben wird. Die Tatsache, dass der Patient jetzt schon, wie ein geprügelter Hund in einer Ecke wirkt, dürfte ihn unbeeindruckt lassen. Somit erwartet sie den finalen Schlag ihres Chefs.
»Da sich der Notarztwagen in ihrer unmittelbaren Nähe befand, konnten Sie sofort ärztlich versorgt werden, was ihnen einen erheblichen Zeitvorteil einbrachte. Ich mag mir gar nicht vorstellen was passiert wäre, wenn Sie erst auf einen Notarzt hätten warten müssen. Kann ich ihnen noch weitere Fragen beantworten, Herr Harms?«, will er siegessicher und dabei todernst wissen.
Diese Ausführungen des Chefarztes wirken sowohl beim Patienten als auch bei der Krankenschwester absolut niederschmetternd. Während der junge Mann sichtlich geschockt über die geschilderten Ereignisse ist, verzweifelt Schwester Eva innerlich. Wie soll sie jetzt nur ihrer Dienstanweisung gerecht werden, nachdem der Chefarzt den Patienten derartig vor ihr bloßstellte? Wäre eine Kommunikation überhaupt noch möglich oder würde sie am späten Abend ebenso von ihrem Chef heruntergeknüppelt werden, wie er es soeben mit dem Patienten tat? Denn es wäre für den Arzt ein Leichtes zu behaupten, dass es ihr Unvermögen gewesen sei, das die Umsetzung seiner Anweisung scheitern ließ. Auf keinen Fall würde er es dann zugeben, dass er ihren Gesprächsaufbau mit seiner herablassenden Art völlig versaut hatte. Diese Gedanken lassen die ganze Angelegenheit für sie zu einem miesen Spiel verkommen, bei dem es aus hierarchischen Gründen wie immer nur einen Verlierer gibt – und der wäre sie selbst. Doch das Gespräch zwischen den beiden Männern ist noch nicht beendet. Würde der Arzt nun weiter die Keule schwingen und ihre Arbeit dadurch völlig unmöglich machen, beginnt sie sich zunehmend verzweifelter zu fragen.
»Werde ich wieder gesund werden und wie lange werde ich hierbleiben müssen?«, möchte der Patient mittlerweile mit vorsichtiger Zurückhaltung wissen.
Auch das entgeht dem Arzt nicht, was ihn dazu veranlasst, sich ebenfalls anzupassen. Ein solches Verhalten war immer schon typisch für diesen Arzt. Wenn er sich alles erkämpft und andere gedemütigt hatte, was das Zeug hielt, konnte er von der einen Sekunde auf die nächste den Schongang einlegen.
»Ich hoffe das Beste für Sie. Wie die Verletzungen insgesamt gesehen verheilen, vermag ich jetzt noch nicht zu beurteilen. Demnach kann ich ihnen noch nichts über die Dauer ihres Aufenthaltes bei uns sagen. Jedoch können Sie durch ihr Verhalten maßgeblich dazu beitragen, den Heilungsprozess zu optimieren und ihren Aufenthalt bei uns zu verkürzen.«
»Was muss ich dafür tun?«, kommt es wie aus der Pistole geschossen.
»Behalten Sie eine strenge Bettruhe bei und nehmen Sie pünktlich ihre Medikamente ein. Mit leichter Kost werden wir ab morgen beginnen. Ich werde in der Frühe wieder nach ihnen sehen. Dann kann ich ihnen vielleicht schon etwas mehr sagen.Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, würde ich nun gerne nach meinen anderen Patienten sehen und wünsche ihnen eine gute Besserung.«
Mit Beendigung dieses Satzes dreht sich der Chefarzt auf dem Absatz um und geht in Richtung des Ausgangs. Die Akte nimmt er dabei mit. Er verlässt den Raum und schließt gut hörbar die Türe hinter sich. In dem Krankenzimmer scheint ab diesem Moment die Atmosphäre fühl- und hörbar zu knistern, obwohl bis auf gegen die Fensterscheiben klopfenden Regens Stille herrscht.
Verantwortlich dafür sind beide zurückgelassenen Anwesenden. Der Patient, weil er die Ladung Backpfeifen des Chefarztes zu verdauen hat und ihm eine gewisse Sorge um seine Gesundheit auf die Stirn geschrieben zu sein scheint. Die Schwester, weil sie nun befürchtet, wieder von vorn anfangen zu müssen. Doch was gerade eben noch funktionierte, ließe sich sicherlich wiederholen.
Dieser Gedanke lässt sie Hoffnung schöpfen. Zu ihrer Überraschung sucht der Patient die Weiterführung des Gespräches.Sie ahnt dabei, dass sie sich vielleicht zu viele Sorgen um ihre Dienstanweisung macht. Ist es nicht der kranke Mensch, der eigentlich in ihrem Denken im Vordergrund stehen müsste?
»Das war hart«, durchdringt die Patientenstimme diese von beiden als unbequem empfundene Ruhe.
»Das denke ich mir auch«, entgegnet Schwester Eva. »Aber so sind nun einmal viele Chefs. Ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, würde ich gerne von ihnen wissen, was Sie dazu veranlasst hat, ihn so anzugrinsen und ihm gegenüber eine solch provokante Tonart zu wählen. Damit hätte ich, ehrlich gesagt, nicht gerechnet.«
»Klar dürfen Sie mich das fragen«, meldet der Patient selbstbewusst und vielleicht ein bisschen um sein eigenes Ansehen bei der Schwester besorgt, zurück. »Haben Sie sich diesen Vogel einmal näher angeschaut?«
Schwester Eva fällt auf diese Frage spontan keine Antwort ein. Aber eigentlich möchte sie diese Frage auch gar nicht beantworten. Stattdessen zuckt sie nur kurz mit den Schultern und hofft, dass er genau in dieser, seiner individuellen Art, weiterspricht. Das beginnt sie an ihm zu mögen. Außerdem geht es gerade gegen ihren Chef. Und in solchen Fällen hört sie mit größter Vorliebe zu, wenn andere Menschen einen Kübel Unrat nach dem anderen über seinem Haupt ausschütten.
»Der kommt hier einfach hereingestürmt, ohne sich vorzustellen, und zieht sofort fett vom Leder. Sein Auftritt ging gar nicht. Das fand ich schon ziemlich asi. In solchen Augenblicken kann ich Typen wie den einfach nicht anders behandeln.«
Diese Worte klingen für Schwester Eva wie der Gesang eines himmlischen Chores. Zudem sind sie aus ihrer Sicht auch absolut nachvollziehbar. Dies wiederum lässt bei der Krankenschwester so etwas wie Neid aufkommen. Neid, weil sie nicht, ohne arbeitsrechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen, so mit ihrem Chef umgehen kann. Was der Patient dort gerade gesagt hat, hört sich daher für sie wie ein Stück der ganz großen Freiheit an.
»Zu seiner asihaften Art passen auch seine Körpergröße und die Knubbelnase mit der dämlichen Brille darauf. Das erinnert mich an einen Gartenzwerg, der gerade von einem Dackel angepinkelt wurde und der deshalb ziemlich sauer ist. Wer da nicht grinsen muss, ist vermutlich schon tot, ohne das Sterben mitbekommen zu haben.«
Um ihr aufkommendes breites Lächeln zu verbergen, hält Schwester Eva ihre Hand vor ihren Mund. Doch diese Geste vermag ihr ehrliches Schmunzeln kaum zu verstecken.
»Herr Harms, so habe ich mir den Chefarzt noch nie vorgestellt. Aber ich werde ihre Worte gut im Hinterkopf behalten und zu gegebener Zeit darauf zurückgreifen. Doch während Sie mir ihre gut nachvollziehbare Meinung über ihn mitteilten, finde ich das, was er sagte, sehr viel besorgniserregender als seine Erscheinung und sein Verhalten.«