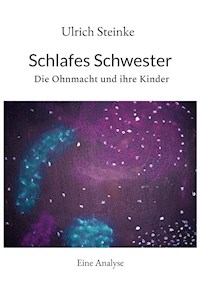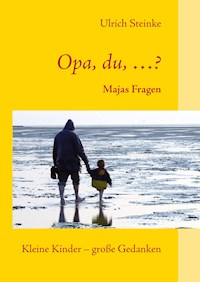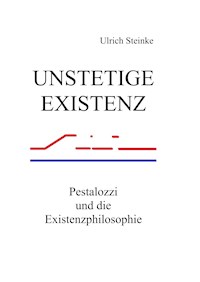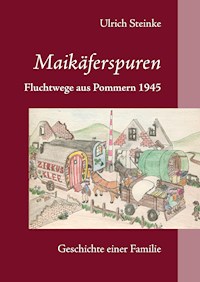
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Befehl: Sammeln auf dem Marktplatz! - Treck!" Mit diesem Ruf und lautem Klopfen and das Hoftor werden Bauer Armin Ranke und seine Frau Irmgard aus dem Deutsch Krone in dieser eisigen Winternacht Ende Januar 1945 geweckt. Die pommersche Kreisstadt liegt bereits unter dem Beschuss der anrückenden Roten Armee. Hastig werden die drei Kinder auf dem Leiterwagen verstaut, der mit den beiden Pferden abfahrtsbereits in der Scheune gestanden hat, dann brechen sie auf, über vereiste Straßen, bei zwanzig Grad unter Null. Der kleine Martin und adere Angehörige der Großfamilie Ranke sind inzwischen in beschlagnahmten Zirkuswagen oder mit dem letzten Eisenbahnzug auf den nach Westen. Nicht allen gelingt die Flucht. Die Spuren verlieren sich in diesen Tagen. Die Erzählung mit Autobiographischem Hintergrund schildert nicht nur die Flucht der Rankes, sie verfolgt auch deren Lebensspuren in der Nachkriegszeit. Aus den Kindheitserinnerungen des kleinen Martin Ranke und den späteren Familienberichten wächst ein exemplarisches Bild dieser Epoche. Die Vaterstadt der rankes hat im Laufe der Geschiochte oft den Besitzer, die Nationalität und den Namen gewechselt, mal war sie deutsch, dann, viel länger, wieder polnisch, mal hieß sie Deutsch Krone, dann wieder Walcz. Entsprechend gemischt war die Einwohnerschaft nach nationaler Herkunft und Religion, wofür die Familie Ranke ein Beispiel darstellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Emma
Aus Kirschblütenschnee
Steigt die Möwe weit
Ins Blau über See,
Horizont so breit,
Der wilde Kurs gesäumt
Von Gischt und Licht, geträumt
In banger Nacht,
Und Emma lacht.
Ulrich Steinke
Maikäferspuren
Fluchtwege aus Pommern 1945
Geschichte einer Familie
Books on Demand
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Nachwort
Ihn fröstelt.
Als Martin aus der Haustür tritt, haben sich erste Schneeflocken unter den morgendlichen Regen gemischt, gleiten an den Scheiben des Wohnmobils herunter und bilden schmutzigweiße Ränder. Beate lädt noch die beiden Rucksäcke der Kinder ein, dann ist alles abfahrbereit. Aber sie zögern, warten, dass der Regen nachlässt, und Martin kämpft gegen ein beklemmendes Kältegefühl angesichts der bevorstehenden Erlebnisse dieser Reise nach Osten, ein halbes Jahrhundert nach seiner winterlichen Flucht aus Pommern, ein halbes Jahr nach dem Mauerfall.
Dabei haben sie alles gründlich vorbereitet. Der Proviant reicht für zwei Wochen, die polnischen Visa wurden gestern abgeholt, und seine Cousine Elisabeth hat extra noch einmal aus Flatow angerufen, um zu sagen, dass sie das Fahrzeug in ihrem abschließbaren Hof sicher abstellen können.
Am frühen Nachmittag fahren sie los. Sie kommen vor Dunkelheit nur bis Bad Hersfeld, übernachten dort auf einem Campingplatz mit Blick auf eine Salzhalde, die sich wie ein verirrter Eisberg gegen den Abendhimmel abhebt, und sind froh, dass die Gasheizung an Bord funktioniert.
Am nächsten Morgen passieren sie die DDR-Grenze. Der Kontrollpunkt mit den ausgedehnten Anlagen wirkt verwaist. Sie werden nicht kontrolliert, können einfach durchfahren, weiter nach Weimar. Zwei Tage lang erkunden sie die Hauptstadt der deutschen Klassik. Dann geht es weiter nach Frankfurt an der Oder. Sie dürfen sich bei Privatleuten auf dem Hof abstellen, werden gastfreundlich aufgenommen und am nächsten Morgen zu einem üppigen Osterfrühstück in das bescheidene selbst erbaute Haus gebeten.
*
Die Grenzkontrolle an der Oderbrücke ist langwierig. Bis Deutsch Krone sind es noch zwei Stunden. Die Landstraße ist gut und kaum befahren. Die alten Buchenwälder rechts und links zeigen den ersten Grünschimmer. In den Ortschaften mit den verfallenen Häusern und Gärten und den auffallend gepflegten Kirchen kann das Wohnmobil wegen des Katzenkopfpflasters nur Schritttempo fahren.
Am frühen Nachmittag kommt auf der linken Seite der Deutsch Kroner Radun-See ins Blickfeld. Durch den Buchwald fahren sie zum Friedhof, suchen nach der Grabstelle von Martins Großeltern, finden den verwahrlosten Platz an der Friedhofsmauer, Sockel ohne Grabstein, jeder Hinweis auf das Familiengrab der Rankes ist ausgelöscht. Am Krankenhaus vorbei, in dem der Großvater Boleslaus vor 60 Jahren starb, fahren sie zum Marktplatz von Wałcz, wie Martins Geburtsort heute wieder heißt. Hier, vor der katholischen Kirche, in der Martin getauft wurde, stellen sie das Fahrzeug ab und machen einen Rundgang durch die Stadt.
Es ist sonnig, aber kalt an diesem Apriltag. Martin geht den Wegen seiner Kindheit nach, so, wie sie ihm nach 45 Jahren immer noch deutlich vor Augen liegen, und er findet sie fast unverändert wieder. Aber sein Gang ist unsicher, leichter Schwindel befällt ihn, seine Füße scheinen über dem Straßenpflaster zu schweben, er bewegt sich wie ein Schlafwandler. An der Kirche vorbei gehen sie zum Schloss-See hinunter und bleiben vor dem Haus der Großmutter Anna Boreta am Seeufer stehen. Der Garten ist ein wüster Platz, Käfige einer ehemaligen Nutriafarm stehen herum, das Haus ist baufällig, aber bewohnt. Sie folgen der früheren Uferpromenade, biegen in die Poststraße ein, gehen zum neugotischen Postgebäude, das erhalten geblieben ist, und stoßen auf die Königstraße. Dort, wo Benno Rankes Elektroladen, Martins Geburtshaus, gestanden hat, ragt jetzt die Betonfassade eines Kaufhauses auf. Vom mehrstöckigen Wohnhaus der Rankes gegenüber der Post ist nichts mehr zu sehen. Die Kriegsruine hatte zwei Wohnblöcken in Plattenbauweise weichen müssen. Durch die Königstraße und den Poetensteig, vorbei am früheren Hermann-Löns-Gymnasium, gelangen sie zum Judenfließ, dem sie bis zur Molkerei am Stadt-See folgen. Der von Wäldern eingerahmte Stadt- oder Radun-See schimmert im milden Licht der Nachmittagssonne. Über die Seepromenade und einige Gassen mit verfallenen, im Krieg zerstörten Häusern finden sie zum Marktplatz zurück.
Dort treffen sie auf eine westdeutsche Familie, die ebenfalls auf Erinnerungsreise ist. Ihre Eltern hatten hier am Markt ein Fahrradgeschäft. Für die neuen polnischen Besitzer haben sie zur Begrüßung Geschenke mitgebracht, Kaffee, Schokolade, Sekt, möchten einen Blick in ihr altes Haus werfen. Die Begrüßung misslingt. Sie werden umgehend hinausgebeten. Noch ist die Angst zu groß vor einer Rückkehr der Deutschen. Denn die Polen, die in der Stadt leben, sind selbst Heimatvertriebene, Teil der Bevölkerung Ostpolens, die nach Kriegsende auf Befehl Stalins in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus ihren Dörfern und Städten in Ostpolen evakuiert wurde. Nur mit Handgepäck versehen hat man sie in Güterzüge verladen und auf dem Bahnhof in Deutsch Krone abgesetzt, wo sie sich neue Unterkünfte in den Häusern der vertriebenen Deutschen suchen mussten.
Durch die Königstraße und die Schneidemühler Straße fahren sie zum ehemals Ranke’schen Bauernhof, auf dem Benno aufgewachsen ist. Die Gebäude sehen unverändert aus. Der Hof wird von einer polnischen Familie bewirtschaftet. Drei Kinder kommen zögernd aus dem Hoftor und beobachten neugierig das Wohnmobil. Durch das geöffnete Fenster macht Beate einige Fotos, sie wollen nicht stören. Der Abend dämmert schon, als sie Richtung Flatow aufbrechen. Dort müssen sie sich durchfragen. Das ist nicht einfach, denn sie können nicht Polnisch und niemand hier spricht Deutsch, Englisch oder Französisch.
Elisabeth begrüßt sie herzlich. Sie hat ihren Cousin Martin zuletzt als 5-Jährigen gesehen, Beate und die Kinder Hilke und Frauke kennt sie nur von Fotos, aber die Gespräche an diesem Abend reißen nicht ab, kreisen immer wieder um die Kriegsereignisse. Vier polnische Verwandte von Elisabeth wurden ermordet, ein Onkel von den Sowjets in Katyn, einer von den Deutschen im KZ, zwei starben schon zu Beginn des Krieges, von den deutschen Angreifern lebendig begraben.
In der Nacht liegt Martin lange schlaflos im Bett, die Bilder von damals und heute vermischen sich vor seinen Augen, verschwimmen und werden wieder gestochen scharf, verstoßen gegen die Ordnung von Raum und Zeit und verdichten sich schließlich in einem Traum.
*
Es schneit.
Dicke Flocken taumeln unstet und lautlos, weißen Schmetterlingen gleich, am Fenster vorbei. Auf den Tulpen und Narzissen im Blumenkasten, die eben noch in der Mittagssonne geleuchtet haben, wachsen weiße Häubchen.
Die Wehen haben vor einer halben Stunde eingesetzt, nachdem der letzte Kunde gegangen war. Emmi hat ihm einen der neuen Volksempfänger verkauft. Jetzt ruft sie Frau Matheis an, die Hebamme, die in der Nachbarschaft wohnt und schon vorbereitet ist. Die Geburt des Jungen verläuft schnell und ohne Komplikationen, anders als bei Herbert vor acht Jahren, obwohl Emmi nun schon fast 40 Jahre alt ist. Als die beiden Geschwister Christa und Herbert an diesem Donnerstag im April 1940 auf dem Heimweg von der Schule die Tür des Elektroladens von Benno Ranke in der Königstraße öffnen, hören sie das neugeborene Baby im Hinterzimmer schreien. Sie schleichen sich hinein und begrüßen die Mutter und den Kleinen und staunen immer wieder über das zierliche, langfingrige Wesen. Während die 11-jährige Christa der Hebamme beim Aufräumen hilft, wird Herbert in die Färberstraße am Schloss-See geschickt, um die Großmutter Anna Boreta zu benachrichtigen, die kein Telefon besitzt. Er läuft über den Poetensteig zur Seepromenade, an die der Garten von Großmutters Haus grenzt, steigt die Treppe zur Veranda hinauf, betritt das Haus, in dem Christa vor elf Jahren geboren wurde, und meldet der Großmutter die Neuigkeit.
Anna Boreta, Witwe des vor drei Jahren verstorbenen Oberpostschaffners Boleslaus Boreta, leidet nach ihrem Sturz in den winterlichen Schloss-See schon lange an Gelenkschmerzen und kann sich mit ihrem Stock nur mühsam bewegen. So dauert es trotz der kurzen Entfernung fast eine halbe Stunde, bis die beiden bei Emmi und dem neuen Erdenbürger eintreffen. Wie er denn heißen solle, will Oma Boreta wissen. Emmi hat die Namen Eberhard beziehungsweise Martin ausgesucht. Die Kinder sind für Martin.
Der Vater, Elektromeister Benno Ranke, nur elf Tage älter als seine Frau, kann nicht befragt werden. Er ist seit August des vorigen Jahres Soldat bei einem Fernmelde-Regiment in Bremen und muss per Telegramm benachrichtigt werden. Er erhält drei Tage Sonderurlaub und kann zur Kindtaufe nach Hause kommen.
Als die beiden Eheleute sich vergangenen Sommer in jener warmen Julinacht, an Emmis Geburtstag, in die verschwiegene Gartenlaube auf Oma Boretas Grundstück am Schloss-See zu einem Schäferstündchen zurückzogen, hatte Benno schon seinen Einberufungsbescheid zu einem Manöver erhalten. Ihr Liebesakt muss etwas von einem Fluchtversuch vor ihren bösen Ahnungen oder von Hoffnungstrotz gehabt haben, obwohl sie nicht damit rechneten, dass schon einen Monat später mit dem Überfall auf Großvater Boretas Heimatland der Zweite Weltkrieg ausbrechen würde.
Martins Taufe findet zwei Tage nach seiner Geburt, am Samstagnachmittag, in der katholischen Pfarrkirche in Deutsch Krone statt. Er wird von Probst Wilkens auf den Namen Martin Eberhard getauft. Taufpaten sind Maria Olbert, eine 53-jährige Cousine von Anna Boreta, die aus Berlin-Hermsdorf angereist ist, und Bennos jüngster Bruder Armin, der vor vier Jahren als 29-Jähriger nach dem Tod des Vaters den verschuldeten elterlichen Bauernhof an der Schneidemühler Straße übernommen hat.
Gefeiert wird im neuen Wohnhaus in der Königstraße, einem repräsentativen Stadthaus gegenüber der Post, das Benno vor einem Jahr von der jüdischen Witwe Martha Brendel gekauft hat.
*
Benno und Emmi sind in den letzten Jahren durch seine solide Handwerksleistung und ihr Verkaufsgeschick zu einigem Wohlstand gekommen. Emmi verdient als ausgebildete Schneiderin noch manche Mark hinzu. Abends näht sie seidene Lampenschirme auf Bestellung.
Für seine Fahrten über Land hat Benno zunächst ein NSU-Leichtmotorrad benutzt. 1935 kann er dann einen Opel P4 für 1.850 Reichsmark kaufen. Der Betrieb wird vergrößert und Benno stellt einen Gesellen ein, Herrn Sawitzki. Auf ein Erbe aus dem verschuldeten Bauernhof seiner Eltern kann Benno nicht hoffen. Aber Emmi ist das einzige Kind ihrer Eltern und wird einmal das Grundstück am Schloss-See erben. Zunächst kann man auf dieses Grundstück für den Kauf des jüdischen Stadthauses eine Hypothek eintragen lassen.
Frau Brendel erhält die Ausreisegenehmigung nach Israel nur unter der Bedingung, dass sie gegenüber dem »Vorschuss«, der Deutsch Kroner Stadtsparkasse, die angeblich die eingezahlte Kaufpreissumme treuhänderisch verwaltet, schriftlich auf die Auszahlung des Geldes verzichtet. Als Folge dieses kriminellen Verfahrens wird Frau Brendel nach dem Kriege im Rahmen der Wiedergutmachungsregelungen eine entsprechende Entschädigung erhalten, dafür wird Benno Ranke beim Lastenausgleichsverfahren leer ausgehen, was er bis zu seinem Tode nicht verwinden kann.
*
Sechs glückliche Jahre verbringt die Familie Ranke in dem großen Haus. Da Benno zur Wehrmacht eingezogen wird, muss Emmi das Elektrogeschäft allein betreiben. Auch der Geselle ist nicht mehr da. Er ist zur SS gegangen und wird den Rankes bei einem Besuch nach dem Kriege von den Massenerschießungen jüdischer Kinder, Frauen und Männer hinter der Ostfront berichten, einem Teil der vielen Millionen Morde, die von deutschen Männern während dieses Krieges an unschuldigen Zivilpersonen, überwiegend jüdischen Menschen, begangen werden.
Er wird auch berichten, dass die Massenmörder nach ihren Erschießungsaktionen mit Sonderurlaub belohnt werden, um zu Hause mit ihren Familien Weihnachten feiern zu können.
Martin wird sich später oft fragen, wo diese Männer geblieben sind.
*
Um das neue Haus und die Kinder kümmern sich ein polnisches Hausmädchen und Martha Krieger, eine alte, verwitwete Cousine von Anna Boreta, die von allen nur »Tante« genannt wird und ebenfalls im Hause wohnt.
Das Haus mit einer Straßenfront von 15 Metern steht auf einem nach rückwärts lang gezogenen Grundstück. Die drei Etagen haben jeweils eine Grundfläche von etwa 200 Quadratmetern. Im Erdgeschoss gibt es eine Toreinfahrt zum Hof, von der im Innern eine lange Holztreppe zur ersten Etage führt. Die übrigen Räume des Erdgeschosses, die von der Königstraße und dem Hof jeweils durch eine Freitreppe zugänglich sind, hat die Brennerei »Tetzel und Wenzlaf« gemietet. Der Hof wird ringsum von vier Schuppen und einer Mauer gesäumt. Im vordersten Schuppen ist die Waschküche, im hintersten sind Hühner und Gänse untergebracht, die von den Kindern gern besucht werden, um Eier aus den Nestern zu holen. Die Gänse werden nach pommerscher Art »genudelt«, d. h., sie werden gemästet, indem man ihnen »Nudeln«, kleine Würstchen aus einem Kleie-Teig, in den Schlund steckt und durch den langen Hals massiert – eine Prozedur, gegen die sie sich natürlich sträuben. Martin darf seiner Mutter das Nudelblech über den Hof tragen und zuschauen, wie sie die Gänse »nudelt«. Der Kleie-Geschmack der »Nudeln«, von denen er immer einige selbst isst, wird ihm auf der Zunge bleiben.
Die hohen Räume der ersten Etage sind mit Stuckdecken, Dielenböden und Kachelöfen ausgestattet. Auf der nach Süden gelegenen Straßenseite liegen Wohnzimmer, Esszimmer und Gästezimmer, auf der Rückseite Schlafzimmer, Kinderzimmer und Küche. Bad und ein weiteres Kinderzimmer befinden sich im Hofanbau. Alle Räume werden mit Kohle geheizt. Die Kachelöfen haben so genannte Bratröhren, in denen Speisen gewärmt oder Bratäpfel geschmort werden. In der zweiten Etage wohnen die Tante und das polnische Hausmädchen. Einen Dachboden gibt es nicht, wohl aber mehrere Kellerräume für Kohlen- und Lebensmittelvorräte: Kartoffeln in einer großen Holzkiste, ein Fass mit Sauerkraut, Weckgläser mit Fleisch, Gemüse, Früchten und Marmelade.
*
Die Königstraße, an der das Haus liegt, ist die Hauptdurchgangsstraße der Stadt und zugleich ein Teilstück der Reichsstraße 1, die Deutschland von Westen nach Osten durchquert, von Aachen über Dortmund, Hildesheim, Magdeburg, Berlin, Küstrin, Marienburg bis nach Königsberg. Da diese Straße während des Krieges von großer strategischer Bedeutung ist, gehört die Durchfahrt von Militärtransporten zum täglichen Straßenbild.
Der kleine Martin hört vom ersten Tage an das quietschende Rasseln vorbeifahrender Panzer, die Decken, Wände und Fensterscheiben erzittern lassen. Im nächsten Sommer kann er als Einjähriger vom Wohnzimmerfenster aus die endlosen Militärkolonnen beobachten, die in Richtung Osten vorbeifahren, um den Überfall auf die Sowjetunion vorzubereiten.
Später, im Erwachsenenalter, tauchen in Martins Tagträumen immer wieder andere Bilder, Geräusche und Gerüche aus der frühen Kindheit auf:
Er sieht sich bei den häufigen Einladungen und Familienfeiern als kleiner Junge unter dem Tisch des Esszimmers herumkriechen, um nach imitiertem Hundegebell den Damen in die Beine zu beißen, was immer ein lautes Gekreisch hervorruft.
Er hört die Anweisung seiner Schwester hinter dem Fotoapparat: »Mach ein Schweineschnütchen«, worauf er den Mund spitzen, die Nase rümpfen und die Augen zu blinzelnden Schlitzen zusammenkneifen muss.
Er spürt die panische Angst, die die Gerüche von Äther und Sagrotan und der Anblick der Impfnadel in der Praxis des Dr. Brose bei ihm auslösen.
Er hat die unheimlichen, dunklen, durchsichtigen Stellen des Eises auf dem Schloss-See an der Brennerei vor Augen, als er im Winter mit dem Schlitten über den zugefrorenen See gezogen wird.
Er leidet das Heimweh nach, das ihn zu wilder, zorniger Flucht aus der Gärtnerei von Onkel Thomas Boreta in Flatow auf die Straße Richtung Bahnhof treibt, taub für die Rufe der Mutter, besessen von dem Willen, wieder zu seiner geliebten Großmutter zurückzukehren.
Seine Nase erinnert sich an den würzigen Duft von Pilzen und Fichtennadeln, als er mit seiner Mutter bei Onkel Leo und Tante Jutta, entfernten Verwandten von Anna Boreta, die auf einem armseligen abgelegenen Bauernhof in Schulzenbruch wohnen, im umliegenden finsteren Wald auf Pilzsuche geht.
Unvergesslich bleibt auch der Geruch von warmem, feuchtem Sand und abgerissener Erika aus dem Panzergraben, den er zusammen mit seiner Mutter und vielen anderen Frauen, Jugendlichen und Kindern südöstlich der Stadt an der Straße nach Schneidemühl mit seiner kleinen Schaufel ausheben darf. Der Geruch vermischt sich mit dem Geschmack von Erbsensuppe aus der Feldküche und von Wurstbrot, das aus Pergamentpapier gewickelt wird.
Bei der Rückfahrt vom »Schippen« lernt er die Gesetze von Trägheit und Schwerkraft kennen, als Mutter Emmi ihn, am offenen Ende des Leiterwagens stehend, abhält und die Pferde, während er eine vollendete ballistische Kurve in die Luft pinkelt, plötzlich ruckartig anziehen, worauf Emmi mit ihm im dünenweichen Mahlsand des Sommerweges landet, der zum Glück neben der gepflasterten Straße verläuft.
Er erinnert sich an die Fahrt auf dem Großen Radun- oder Stadt-See im kippeligen Ruderboot von Paul Nowak, einem guten Freund der Familie, und an die Besuche des am Ufer des Sees gelegenen Buchwald-Restaurants hinter der Klotzow-Brücke, die sein Großonkel, der Dekan Eduard Hanke aus Tütz, so oft gemalt hat.