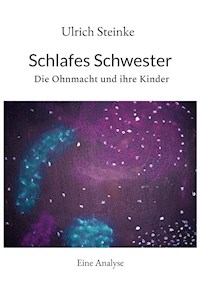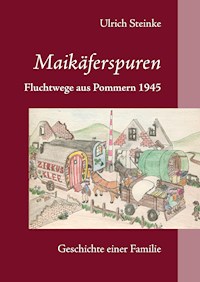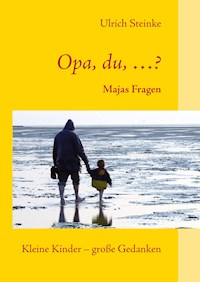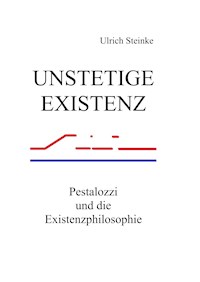
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das philosophische Fundament für seine Pädagogik legte Johann Heinrich Pestalozzi 1797 dar in seiner Schrift Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts. In diesem Werk schildert er mit leidenschaftlicher, bildkräftiger Sprache seine Sicht der Welt und des Menschen, und die darin enthaltenen Bausteine nehmen auf erstaunliche Weise viele Aussagen vorweg, die hundert Jahre später von den Vertretern der Existenzphilosophie zu diesen Themen gemacht werden, insbesondere zum Unstetigkeitscharakter der Existenz. Deshalb könnte Pestalozzi sozusagen als ein Vorbote der Existenzphilosophie gelten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 68
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Silke, Elke und Rainer
Vorwort
Der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827) hat mit seiner praktischen pädagogischen Arbeit im Waisenhaus in Stans und seinem Erziehungsinstitut im Schloss Burgdorf, später in Yverdon-les-Bains, und mit zahlreichen pädagogischen Schriften die Entwicklung der Pädagogik in den beiden folgenden Jahrhunderten nachhaltig beeinflusst. Seine Grundsätze der Elementarbildung (Kopf, Herz, Hand) und seine von den Ideen der Aufklärung bestimmten Prinzipien einer humanen, kinderfreundlichen Erziehung zur Entwicklung einer verantwortlichen, sittlichen Persönlichkeit haben viele bedeutende Pädagogen nach ihm geprägt.
Sein Schüler Friedrich Fröbel (1782 - 1852) gründete 1840 den ersten Kindergarten und löste damit eine weltweite Entwicklung für die frühkindliche Bildung und Erziehung aus.
Zum Ende des 19. Jahrhunderts setzten intensive Bewegungen der Reformpädagogik ein, die auf der Basis von Pestalozzis Ideen eine selbsttätige Bildung vom Kinde aus propagierte. Eine der bedeutendsten Vertreterinnen dieser Methode war Maria Montessori (1870 - 1952). Ihr pädagogisches Bildungskonzept, das Kind als Baumeister seines Selbst zu betrachten mit der Aufforderung Hilf mir, es selbst zu tun, hat bis heute in vielen Schulsystemen der Welt seinen festen Platz.
Die Bedeutsamkeit der frühkindlichen Bildung für die gesamte Entwicklung des Menschen, auf die Pestalozzi aufmerksam gemacht hat, wurde im 20. Jahrhundert bestätigt durch die Intelligenzforschung und die experimentelle Hirnforschung.
Der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget wies in seinem Werk Psychologie der Intelligenz (1966) nach, dass die Intelligenz des Menschen bereits im frühen Kindesalter ausgebildet wird und entsprechend gefördert werden kann, und die Hirnforschungen von Rita Carter, Manfred Spitzer, Nicole Strüber, u.a. konnten entsprechende Ergebnisse bestätigen.
Das philosophische Fundament für seine Pädagogik legte Pestalozzi 1797 dar in seiner Schrift Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts. In diesem Werk schildert er mit leidenschaftlicher, bildkräftiger Sprache seine Sicht der Welt und des Menschen, und die darin enthaltenen Bausteine nehmen auf erstaunliche Weise viele Aussagen vorweg, die hundert Jahre später von den Vertretern der Existenzphilosophie zu diesen Themen, insbesondere zur Unstetigkeit der Existenz, gemacht werden. Deshalb könnte Pestalozzi sozusagen als Vorbote der Existenzphilosophie gelten.
Diese letztere These fand ich so reizvoll, dass ich sie während meines Philosophie- und Pädagogikstudiums an der Universität Köln zum Thema einer Dissertation bei meinem verehrten Lehrer Professor Dr. Clemens Menze machen wollte, der mich dabei tatkräftig unterstützte. Leider musste ich mein Vorhaben aus persönlichen Gründen aufgeben, so dass ein unfertiger Entwurf übrig blieb.
Die existenzphilosophische Basis des Entwurfs stammte zunächst überwiegend aus den Schriften Existenzphilosophie sowie Existenzphilosophie und Pädagogik von Otto Friedrich Bollnow. In der letzteren geht es um den Zusammenhang von Pädagogik und Existenzphilosophie. Zur Ergänzung wurde weitere Literatur der Existenzphilosophie herangezogen, z.B. von Martin Heidegger, Karl Jaspers, Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, und Heinrich Barth, um den Begriff der Existenz hinsichtlich ihres Unstetigkeitscharakters zu differenzieren und insbesondere die anthropologischen Parallelen zu Pestalozzis Aussagen in seinen Nachforschungen aufzuzeigen.
Zum Format der Zitate und Anmerkungen sei noch darauf hingewiesen, dass Zitate in den Kursivdruck gesetzt sind und die Anmerkungen für Quellennachweise in hochgesetzten Zahlen erscheinen. Das Literatur- und Quellenverzeichnis sowie die Anmerkungen befinden sich am Ende des Buches.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Zur Aufgabenstellung
Vorbemerkungen zur Methode
Elemente des Menschenbildes der Existenzphilosophie in Pestalozzis
Nachforschungen
Existenz oder Sittlichkeit
Mensch und Welt
Das In-der-Welt-Sein
Die Unheimlíchkeit der Welt
Die Geworfenheit des Daseins und die Situationsgebundenheit
Mensch und Gemeinschaft
Das Mitsein
Der Einzelne und das „man“
Freiheit und Verantwortung
Offenheit und Wagnis
Grenzsituationen
Scheitern und Tod
Angst und Nichts
Langeweile
Die Unstetigkeit der Existenz
Die pädagogischen Folgerungen aus dem von Pestalozzi und der Existenzphilosophie entworfenen Menschenbild
Die Frage nach der Bildsamkeit
Die Krise und ihre Bewältigung
Die Erweckung
Die Ermahnung
Die Beratung
Die Begegnung
Die gemeinsame Struktur der unstetigen Erziehungsformen und Pestalozzis Parallele
Schlussbemerkung
Literatur- und Quellenverzeichnis
Anmerkungen
I. Einleitung
1. Zur Aufgabenstellung
Die Aufgabe lautet, in Pestalozzis Bild der Welt und des Menschen, das er in seinen Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts1) zeichnet, Elemente der späteren Existenzphilosophie aufzuzeigen.
Die folgende Untersuchung soll anknüpfen an eine Bemerkung, die Otto Friedrich Bollnow in seiner Schrift Existenzphilosophie und Pädagogik macht:
Vielleicht aber braucht man diese Grundbegriffe nicht einmal neu zu schaffen, vielleicht ist schon vieles in dieser Richtung (der Unstetigkeitspädagogik) in der pädagogischen Überlieferung enthalten..., was sich bisher nur der besonderen Aufmerksamkeit der pädagogischen Theorie entzogen hatte, weil sie es von ihrem speziellen anthropologischen Ansatz her nicht sehen konnte oder nicht sehen wollte. 2)
Ich vertrete nun die Auffassung, dass das existenzphilosophische Menschenbild eines unstetigen Daseins, das Bollnow als Modellvorstellung seinem Versuch über unstetige Erziehungsformen zugrunde legt, im wesentlichen bereits in Pestalozzis Nachforschungen zu finden ist. Sollte es sich so verhalten, so könnten Bollnows Überlegungen schon durch die Nachforschungen gestützt werden und Pestalozzi könnte sozusagen als ein Vorbote der Existenzphilosophie gelten.
Eine ähnliche Einschätzung findet sich auch bei dem Baseler Existenzphilosophen Heinrich Barth in seiner Vorlesung über den Grundriss einer Philosophie der Existenz:
Pestalozzi ist uns bis heute darin wegweisend, dass er nicht nur vergangene und zukünftige Möglichkeiten, sondern die wirkliche Existenz des Menschen im Blickpunkte hatte…
Von ihm hat die Philosophie der Existenz in der Weise ihrer Zuwendung zum Menschen Entscheidendes zu lernen. 3)
Der Begriff der Unstetigkeit stammt im übrigen aus der Mathematik und den Naturwissenschaften:
In der klassischen Physik von Newton galt der Satz: Die Natur macht keine Sprünge, sondern alles verläuft kontinuierlich, das heißt stetig. Seit der Einführung der Quantenphysik durch Max Planck gilt das nicht mehr.
In der Mathematik gilt eine Funktion als unstetig an einer Stelle, wenn ihr dort der Funktionswert oder der Grenzwert fehlen oder wenn beide verschieden sind. Der Grenzwert fehlt zum Beispiel, wenn linksseitiger oder rechtsseitiger Grenzwert fehlen oder beide verschieden sind. Die Funktionskurve hat dann an der betreffenden Stelle eine Lücke oder einen separat liegenden Punkt („Einsiedler“) oder einen Sprung. Sie lässt sich nicht als kontinuierliche Linie durchziehen. Mangelnde Kontinuität oder Sprunghaftigkeit sind also Kennzeichen der Unstetigkeit.
In diesem Sinne wird der Begriff hier verwendet.
2. Vorbemerkungen zur Methode
Lange hat Pestalozzi nach dem Menschenbild gesucht, das die Basis der Pädagogik und das Ziel von Bildung und Erziehung darstellen könnte. Und er hat nach dem „roten Faden“ bei der Entwicklung des Menschenbildes geforscht. Er folgt dabei zeitgemäß den Spuren von Jean Jacques Rousseau und den Ideen der Aufklärung und richtet den Fokus auf die Gesetze der Natur:
Ich trug die Frage: Was bin ich? jahrelang schwankend im Busen, bis mir endlich nach langem und langem Suchen folgende Sätze den Faden zu enthalten schienen, an welchem ich den Pfad der Natur in jeder Entwicklung des Menschengeschlechts mit Sicherheit nachspüren und ihn von seinem Anfang an bis zu seiner Vollendung verfolgen könnte.4)
Pestalozzi macht ein Drei-Stufen-Modell des menschlichen Wesens zu seiner Arbeithypothese:
So, wie meine Vorstellungen von Wahrheit und Recht in mir selbst eine Folge meines tierischen Instinkts oder meiner gesellschaftlichen Ansprüche oder meiner sittlichen Kraft sind, also bin ich in mir selbst ein dreifach verschiedenes, ein tierisches, ein gesellschaftliches und ein sittliches Wesen,…5)
Daraus folgt, dass die Elemente aus allen drei Zuständen als konstitutiv für das Menschenbild angesehen werden müssen, nicht etwa nur diejenigen aus dem gesellschaftlichen Zustand. Dabei ist allerdings die Einschränkung zu machen, dass im wirklichen Leben der verdorbene Naturzustand und der gesellschaftliche Zustand überwiegen; denn der sorgenfreie, unverdorbene Naturzustand geht mit dem ersten weinenden Laut6) des neugeborenen Kindes verloren, und der sittliche Zustand wird nur selten und auch dann nur momentan erreicht.
Zur Beurteilung der Zitate aus den Nachforschungen ist es wichtig zu bemerken, dass das, was Pestalozzi über sich selbst sagt, exemplarischen Charakter für sein Menschenbild überhaupt hat und somit Allgemeingültigkeit beansprucht:
Der Gang meiner Untersuchungen kann seiner Natur nach keine andere Richtung nehmen als diejenige, die die Natur meiner individuellen Entwicklung selbst gegeben, ich kann also in derselben in keinem Stück von irgendeinem bestimmten philosophischen Grundsatz ausgehen, ich muss sogar von dem Punkt der Erleuchtung, auf welchem unser Jahrhundert über diesen Gegenstand steht, keine Notiz nehmen. Ich kann und soll hier eigentlich nichts wissen und nichts suchen als die Wahrheit, die in mir selbst liegt, das ist, die einfachen Resultate, zu welchen die Erfahrungen meines Lebens mich hingeführt haben; …7)