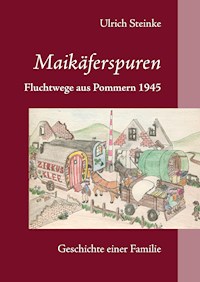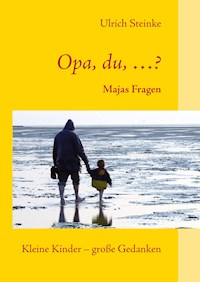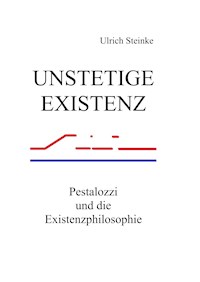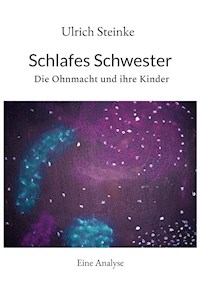
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Ohnmacht ist ein Phänomen, das viele Menschen erleben. Der kurzzeitige Verlust der Körperkontrolle und des Bewusstseins irritiert und ängstigt uns, weil er uns an unser Ende, den Tod, erinnert, der auch als Schlafes Bruder bezeichnet worden ist. Entsprechend kann die Ohnmacht Schlafes Schwester heißen, hat sie doch auch viele Ähnlichkeiten mit dem Schlaf. Die Ohnmacht zeigt bei genauem Hinschauen aber viele Gesichter in ihren Abkömmlingen. Sie setzt sich fort in zahlreichen Varianten, von denen einige leicht zu erkennen sind, wie die Narkose, andere aber nur schwer, wie die Ideologien mit ihrer subtil betäubenden Wirkung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für
Maja, Emma, Hanna, Pia
Inhalt
Schlaf
Schlafes Bruder ist der Tod
Schlafes Schwester ist die Ohnmacht
„ La petite mort“
Tagträume
Hypnose
Placebo-Effekt
Halluzination
Erscheinung
Rausch und Trance
Nahtoderfahrung
Narkose
Koma
Epileptischer Anfall
Schlafwandel
Traum
Albtraum
Religion
Ideologie
Medien
Politik
Erinnerungen, Geschichte und Kultur
Anhang
Vortrag über Kinderphilosophie
Schlaf
Jeder kennt den Bewusstseinsverlust des wachen Gehirns nachwachsender Müdigkeit, das Hinübergleiten in die Welt der Träume und Albträume, von den einen ersehnt, von den anderen gefürchtet. Manchmal wehrt sich unser Gehirn gegen den Kontrollverlust durch ein kurzes Aufbäumen, bekannt als gefühlter Fehltritt von einer Bordsteinkante. Doch der todesähnliche Schlaf, in dem wir nicht entschlafen, ist endlich, ein begrenzter Zustand, bis zum zufälligen oder erzwungenen Erwachen. Die immer wiederkehrende Traumwelt, im Gewitter der Hirnströme erzeugt, hat sicher die Vorlage geliefert für die Vorstellung eines Lebens nach dem Tode. Denn in den Träumen erschienen den Schlafenden immer wieder ihre verstorbenen Verwandten und Bekannten, mit denen sie sich austauschen konnten, und in Albträumen kehrten durchlebte Gefahren und Ängste auf realistische Weise zurück. Die fantastische Ausschmückung einer Jenseits-Welt besorgten dann Religionsfunktionäre wie Moses, Paulus und Mohammet und entwickelten daraus, unter Ausnutzung naturwissenschaftlicher Unkenntnisse, ein erfolgreiches Geschäftsmodell für den Gewinn von Macht, Herrschaft und Reichtum.
Der Schlaf hat zwei Geschwister:
Schlafes Bruder ist der Tod
Allen Lebewesen, die entstehen, setzt er die Zeitgrenze. Er schlägt plötzlich zu, wie ein Meteorit aus heiterem Himmel, oder schleicht sich langsam und unbemerkt an, wie eine Würgeschlange. Selten tötet er sanft, meistens gewaltsam, grausam und schmerzhaft. Die Arbeit des Tötens besorgen seine Helfer, Wasser und Feuer, Frost und Hitze, Bakterien und Viren, Nahrung suchende Tiere und Raubtiere, am gründlichsten aber der Mensch, der maßlos Lebewesen aller Art, sogar seiner eigenen, vernichtet. Niemand konnte den Tod bisher genau beschreiben, denn wer ihn erlebt, der schreibt nicht mehr, sondern löst sich auf in die Moleküle und Atome, aus denen er zusammengesetzt war und die sich nun mit den Atomen der Umgebung vermischen, in der Erde eines Friedhofs oder Friedwaldes oder im Meer. Die Form des Menschen aber verschwindet für immer, wie eine Schneeflocke im Wasser.
Der Tod lebt von der Zeit.
Wir versuchen, ihn weit weg zu schieben, aber die Zeit ist wie eine optische Täuschung.
Wie lange dauert die vor uns liegende Zeit noch? 50 Jahre, 10 Jahre, 1 Jahr, 1Monat, 1 Tag, 1Minute? Wir wissen es nicht, und alle kommenden Zeiten sind relativ, subjektiv und letztlich gleich. Wir spüren das plötzlich, wenn wir sie mit den zurückliegenden Zeitereignissen vergleichen, etwa mit der Geburt eines Kindes oder einem Reiseerlebnis. War das nicht wie gestern? Da schrumpft die Zeit auf einen Punkt zusammen, einen Wimpernschlag, genauso auch die Zukunft. Was bleibt? Nichts, zeitlos. Das ist der Tod.
Schlafes Schwester ist die Ohnmacht
Die Ohnmacht ist in der Regel eine leichtere, zeitlich begrenzte und nicht beabsichtigte Bewusstlosigkeit. Sie schleicht sich gewöhnlich an wie der Tod, aber sie tötet nicht. Sie kann psychische oder somatische Ursachen haben. Oft aber ist sie auch der Schlusspunkt der Panik, jener unbeherrschbaren, würgenden Angst vor der Angst.
Martin war acht Jahre alt, als ihn Schlafes Schwester zum ersten Mal würgte. Er lebte als Flüchtlingskind unter primitiven Verhältnissen auf einem Bauernhof in Dithmarschen und musste beim Toilettengang zum Plums-Klo im Geräteschuppen um den Bauernhof herum laufen, vorbei an dem großen Scheunentor, hinter dem der schwarze Schäferhund Wache hielt. Der Hund, größer als Martin, war zwar angekettet, aber das Kettenende lief an einem langen, vor dem Hof gespannten Stahlseil. In seiner Eile hatte Martin den Hund vergessen und lief zu dicht am Scheunentor vorbei, der Hund schoss heraus, warf Martin um und verbiss sich in seinem linken Oberschenkel. Martin wälzte sich geistesgegenwärtig aus dem Laufbereich des Hundes und konnte so Schlimmeres verhindern. Er humpelte zurück in die Stube seiner Eltern, die benachrichtigten einen Arzt und der kam mit einer Tetanusspritze. Bei deren Anblick, jetzt erst, wurde ihm schlecht, er musste sich hinlegen, mit weißem Gesicht, verschwommenem Blick und schrillem Singen in den Ohren. Er hatte Angst zu sterben. Wie lange er so lag, bis er wieder zu sich kam, weiß er nicht.
Auch gegen Weihrauch ist er anfällig. Öfter muss er,13, eine Messe verlassen, weil ihm schlecht wird. Schon der Gedanke an eine Ohnmacht kann ausreichen, ihren schleichenden Prozess in Gang zu setzen. Das Zufügen von Schmerz, etwa das Knien auf der harten Holzbank, kann den Vorgang verlangsamen, aber nicht immer hält das bis zum Ende des Gottesdienstes. Dabei ist für ihn die Übelkeit nicht einmal das Schlimmste. Viel schlimmer ist die Peinlichkeit der Situation, das Auffallen in der Gruppe der Normalen. Vor ihnen muss er sein Problem unter allen Umständen verbergen.
Martins Vater ist am Kopf wegen Hautkrebs operiert worden. Martin, 16, besucht ihn im Krankenhaus. Schon am Eingang zieht sich ihm die Brust zusammen, als ihm das Geruchsgemisch von Patienten und Desinfektionsmitteln entgegenschlägt. Im Krankenzimmer, beim Anblick seines Vaters, verstärkt sich der Zugriff von Schlafes Schwester. Nach wenigen Minuten muss er nach draußen flüchten und sich auf der Eingangstreppe hinsetzen, den Kopf in die Hände gestützt. Seine zufällig anwesende Tante nimmt ihn mit zu sich nach Hause und macht ihm einen starken Kaffee, der ihn wieder wach werden lässt, das Blut in das bleiche Gesicht zurückbringt und die Übelkeit beseitigt. Jetzt kann er wieder frei durchatmen. Aber auf medizinische Gerüche reagiert er in Zukunft allergisch.
Im Frisörstuhl fühlt Martin, 17, sich wie angekettet und gefesselt. Der Nebel von Gerüchen nach Kosmetika und Zigarettenrauch wirkt leicht betäubend. Während der Frisör mit Schere, Kamm, Rasierapparat und Rasiermesser an Martins Kopf hantiert, wächst in Martin schleichend die Angst, ohnmächtig zu werden. Er hat ständig das Bild vor Augen, wie der Frisör ihm ins Ohr schneidet. Durch Krampfen der Zehen und Kneifen der unter dem Umhang versteckten Oberschenkel gelingt es ihm, sich über die Zeit des Haareschneidens zu retten. Aber vor künftigen Frisörbesuchen hat er Angst.
Da sich Martin immer wieder von Schlafes Schwester bedroht fühlt, geht er lange Zeit ungern auf Gesellschaften und Veranstaltungen, bei denen er keine unauffälligen Fluchtmöglichkeiten hat. Aber auch in normalen Alltagssituationen kann ihm schlecht werden, langsam, aber stetig und unaufhaltsam, wie an einem Vorweihnachtstag 1961. Er ist 21 und Student, wohnt noch bei seinen Eltern. Auf dem Fußweg aus der Stadt nach Hause wird ihm schlecht. Er torkelt vor einem Bus auf die Straße und im letzten Moment wieder zurück auf den Bürgersteig. Dann muss er sich hinlegen, auf das Schaufensterbrett eines Ladens. Sein verschleierter Blick nimmt erstaunte Gesichter von Passanten wahr, die aber weitergehen, ihn für betrunken halten.
Auf einer Familienfeier erzählt ein Gast sehr anschaulich, wie er sich aus Versehen mit einer Schrotflinte in den Bauch geschossen hat und wie ihm im Krankenhaus die kleinen Bleikugeln herausoperiert wurden. Martin, 25, versinkt in den Bildern und Empfindungen der Geschichte, spürt, wie Schlafes Schwester langsam, aber unerbittlich nach ihm greift und verbringt eine halbe Stunde auf der Toilette, von der er kreidebleich zurück zur Feiergesellschaft kommt.
Martin, 45 Jahre alt, arbeitet im Vorgarten seines Hauses. Der Zweig eines Wacholderbusches schnellt zurück und trifft sein rechtes Auge. Das Auge schmerzt und die Hornhaut zeigt einen Kratzer. Ein Freund fährt ihn zum Augenarzt, der den Kratzer als leicht einstuft und mit Tropfen behandelt, aber eine begrenzte Netzhautablösung feststellt. Die Netzhaut befestigt er mit einigen Laserimpulsen. Während der nur mäßig schmerzhaften Setzung der Schmelzpunkte spürt er, wie Schlafes Schwester ihn langsam in den Griff nimmt. Er kann noch sagen, dass ihm schlecht wird, bevor er aus dem Behandlungsstuhl gleitet und die Helfer ihn auf den Fußboden legen. Er sieht zwar nichts mehr, hört aber durch das Singen im Ohr hindurch die aufgeregten Stimmen des Personals, die er noch zu beruhigen versucht. Nach etwa zehn Minuten kann er wieder aufstehen und bleich und etwas wackelig die Praxis verlassen.
Als Martin, 60, sich in der Kölner Philharmonie durch die Reihe zwängt, um seinen Platz einzunehmen, spürt er, dass das beklemmende Gefühl im Brust- und Bauchbereich, das er schon am Eingang hatte, zunimmt. Auf seinem Sitz fühlt er sich wie gefangen. Die Peinlichkeit einer Ohnmacht während der Aufführung und die entsprechenden Folgen muss er auf jeden Fall vermeiden. Das gelingt ihm durch anhaltendes Zufügen von körperlichem Schmerz, Krümmung der Zehen, Kneifen in Beine und Arme, Beißen von Zunge, Lippen und Mundschleimhaut. Nach dem Konzert verlässt er zittrig, schwindlig und schweißnass das Haus.
Eine totale, minutenlange Ohnmacht erleidet Martin, 64, nach seiner Prostataoperation in der Uniklinik. Die Operation, die Vorbereitungen und die 10 Tage danach bis zur Entlassung hat er passabel überstanden. Bevor er die Klinik verlässt, steht er einige Minuten in einer Schlange vor dem Schwesternzimmer. Er will sich mit einer Schachtel Pralinen bei den Schwestern bedanken. Als er schließlich im Zimmer ist, wird ihm schlecht, er muss sich setzen, dann wird das Blickfeld unscharf und dunkel, das Singen im Ohr verklingt bis zur Stille. Als das Gehör wiederkehrt, registriert er aufgeregtes Stimmengewirr, spürt, wie er in einem Bett liegend gefahren wird, in Kurven bis in sein Zimmer. Die Bilder kehren wieder und er sieht einen jungen Arzt, der ihm mit zittrigen Fingern einen Infusionszugang auf der Außenfläche der rechten Hand legt. Sein Bewusstsein ist schon wieder so klar, dass er den Arzt zu beruhigen versucht mit der Bemerkung, er solle ruhig langsam machen, diese Situation komme bei ihm öfter vor und sei nicht so schlimm. Die Ärzte aber sind anderer Meinung und schicken ihn sofort für einige Tage zu Untersuchungen in die Kardiologie, wo dann festgestellt wird, dass sein Herz gesund ist.
Die Ohnmacht selbst aber hat Kinder, die alle durch ein mehr oder weniger eingeschränktes Realitätsbewusstsein gekennzeichnet sind:
„ La petite mort“
So heißt im Französischen der Orgasmus. Die meisten Menschen haben ihn erlebt und erleben ihn oftmals und genießen ihn. Auch er ist, für Viele bedauernswerterweise, endlich. Aber dafür lässt er sich willentlich herbeiführen durch sexuelle Praktiken, durch Masturbation, mit oder ohne Hilfsmittel, durch Koitus, vaginal, anal oder oral. Das Lustempfinden dabei wird gesteigert bis zum Zerreißen des Bewusstseins in einer Grenzerfahrung der Realität, worauf ein beglückender Erschöpfungszustand folgt. Das Leben aber geht weiter.
Tagträume
Martin sitzt im stehenden Zug auf dem Bahnhof und schaut gedankenverloren aus dem Fenster. Langsam und unmerklich rollt der Zug an, wird schneller und schneller, bis der letzte Wagen des Zuges auf dem Nachbargleis vorbeizieht und der eigene Wagen unbeweglich am Bahnsteig steht, wie zuvor. Der kurze Schreck über die optische Täuschung ist ihm peinlich, aber er ist zurück in der Wirklichkeit.
Einen ähnlichen Tagtraum erlebt er in seinem Auto in der Waschanlage. Während er nach vorne durch die Windschutzscheibe auf den herablaufenden Wasserfall schaut, hebt sich plötzlich das ganze Fahrzeug nach oben, leichter Schwindel befällt ihn, und er befürchtet, bald an das Dach der Waschanlage zu stoßen. Erst als er den Blick auf Boden und Wände der Waschanlage konzentriert, verschwindet das irritierende Traumbild und er erwacht in der Realität.
Der hypnotische Charakter solcher Tagträume ist offensichtlich.
Hypnose
Die Hypnose ist ein von einer fremden Person, in der Regel einem Arzt, mit definierten Methoden induzierter Bewusstseinsverlust, bei dem zeitlich begrenzt bestimmte Areale des Gehirns, zum Beispiel das Schmerzzentrum, ausgeschaltet werden, während andere Bereiche wach und funktionsfähig bleiben, zum Beispiel das Bewegungszentrum. Die Hypnose kann als Ersatz für leichtere Narkosen verwendet werden, zum Beispiel in der Zahnheilkunde.
Placebo-Effekt
Eine milde Variante der Hypnose ist die Suggestion als eine Art Selbsthypnose durch den Placebo-Effekt:
Neue psychologische und neurologische Studien zeigen, dass Placebos die gleiche Wirkung bei Schmerzen und anderen Empfindungen erzielen können wie erprobte pharmazeutische Medikamente. Als Erklärung wird genannt, dass beide Mittel in den für die Produktion solcher Empfindungen zuständigen Hirnarealen die gleichen elektro-chemischen Prozesse in Gang setzen. Entscheidend ist dabei der selbstsuggestive Glaube an die Wirksamkeit des Mittels. Zu solchen Mitteln gehören auch die Anwendungen der Homöopathie, der Hypnose, der sogenannten „Heiler“ oder einfache Berührungen wie das Handauflegen und Streicheln, Massagen, Atemtechniken des Yoga oder therapeutische Gespräche.