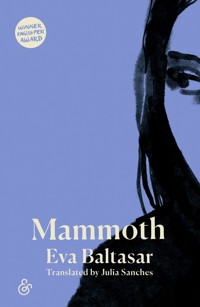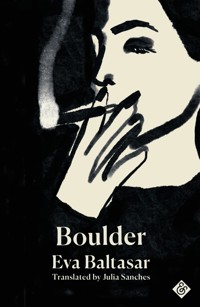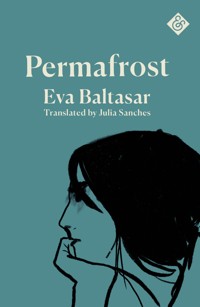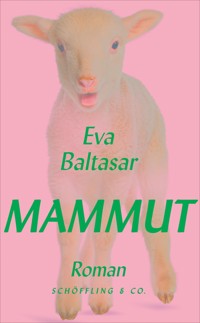
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tagsüber mit Senior:innen im Altersheim Interviews für eine wissenschaftliche Studie führen, nachts ungeschützter Sex mit fremden Männern: Frustriert von ihrem schlecht bezahlten Uni-Job und ihren erfolglosen Versuchen, schwanger zu werden, beschließt die Erzählerin von Mammut, in ihren rostigen Peugeot zu steigen und die Stadt zu verlassen. Was sie sucht, ist ein ursprünglicheres, einfacheres Leben, fernab der Gesellschaft und der Menschen, die sie so unerträglich machen. Doch auch auf dem Land sind die Mieten wucherisch, und das Geld reicht gerade mal für ein halb verfallenes Bauernhaus. Was sie dort findet, ist kein ländliches Idyll, sondern ein arbeits- und entbehrungsreicher Alltag. Sie putzt, hackt Holz, legt Vorräte für den Winter an und gibt Lämmern die Flasche. Ihre einzige Gesellschaft: ein alter Schäfer und ein dreckiger Hund. Und schon bald wird sie eins mit ihrer Umgebung, als würde das Wilde wie ein Keim in ihr austreiben. Schonungs- und schnörkellos und mit einer ordentlichen Portion schwarzem Humor schreibt Eva Baltasar über die Widersprüche des modernen Lebens und der Versuche, daraus auszubrechen. Eine ungewöhnliche Aussteigerinnengeschichte, die auf beklemmend-faszinierende Weise das Urzeitliche freilegt, das noch immer in uns schlummert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eva Baltasar
Mammut
Aus dem Katalanischen von Petra Zickmann
Schöffling & Co.
»An idea hungers for your body.«
Les Murray, Subhuman Redneck Poems
I
Der Tag, an dem ich schwanger werden sollte, war mein vierundzwanzigster Geburtstag, und ich organisierte eine Party, die in Wahrheit eine verkappte Zeugungsfeier war. Einige meiner Mitbewohner halfen mir. Sie riefen Freunde und Bekannte an, die ihre eigenen Bekannten mitbringen sollten. Ich brauchte Leute, je mehr, desto besser. Massen von Menschen, ein Gewimmel, in dem epische Akte untergehen. Ich wollte eine alleinerziehende Mutter sein, kein Vater sollte je Anspruch auf seinen Teil erheben. Es war April, und der Frühling warf sich gegen die Fenster mit der gewaltigen Wucht von Leben in Sprungbereitschaft. In diesem übermächtigen Licht fühlte ich mich fruchtbar, ich schluckte es wie Medizin, vertraute auf seine Kraft, meinen Leib in eine Kapelle zu verwandeln. Nach dem Essen legte ich mich in meinem Zimmer auf die Schlafcouch, die Beine schlaff und schwer, lehnte mich an das Fenster, das auf den Zoo hinausging, und gab mich diesem Leuchten hin, in dem meine Haut golden und die Härchen auf den Armen weizenhell aussahen. Ich masturbierte in der Sonne und wünschte mir dabei ein Kind. Beim Zwitschern der Käfigvögel schlummerte ich ein und erwachte gegen Abend, als die glatte Stille den Hang bereitete, über den in Kürze, uralt und dröhnend, das Leid der Löwen herabstürzen würde.
Zu dieser Zeit arbeitete ich an der Universität in einer Forschungsgruppe des Fachbereichs Soziologie zum Thema Demografie und Langlebigkeit. Wir befanden uns in der ersten, der umfangreichsten Phase der Studie: dem Sammeln von Daten. Ganze Vormittage verbrachte ich mit einer repräsentativen Umfrage in Altenheimen und Seniorenresidenzen. Eine Aufgabe für die Ewigkeit, häufig unterbrochen von Hustenanfällen und Schleimspucken. Fast nie schaffte ich den gesamten Fragebogen in einer Sitzung und musste am nächsten Tag noch einmal hin. Wenn ich mich verabschiedete, hielten mich manche auf. Sie drückten mir die Hände, als könnten sie Lebenszeit aus mir herauspressen, den zähen Saft, der die Jahre nährt. In zwei Fällen war es am nächsten Tag zu spät. Es war eine Zeit kleiner Entdeckungen: Die Alten starben im Schlaf, nachts, kurz vor dem Morgengrauen. Und: In den Heimen starben sie immer zu dritt. Ein Mysterium, aber so war es. Niemand kommt allein auf die Welt, doch wenn Menschen allein sterben müssen, verbrüdern sie sich im Tod wie Völker, wie Musketiere.
Stipendiatsstellen sind schlecht bezahlt, aber ich kam zurecht. Während des Studiums hatte ich mich mit einer Doktorandin angefreundet, und zusammen mit noch zwei anderen Frauen mieteten wir eine Wohnung in der Nähe vom Parc de la Ciutadella. Der Vater der einen bürgte für uns. Gleich, nachdem der Vertrag unterschrieben war, zogen wir alle gemeinsam dort ein. Wir betraten das Haus schweigend, wie man eine Gruft oder einen Juwelierladen betritt, mit ungläubigem Lächeln, als durchschritten wir Gemächer von ungeahnter Pracht. Wir losten um die Zimmer, und ich bekam das kleinste. Die Idee war, nach einem halben Jahr die Zimmer zu tauschen, aber das geschah nie. Jede richtete sich ihr Reich ein, verrückte die Möbel, ließ überall Haare fallen und veränderte den Raum, seine Haut, nach ihrem Geschmack. An meinem vierundzwanzigsten Geburtstag war nur noch ich übrig. Ich vermietete Zimmer an ausländische Studentinnen unter und sah zu, dass ich ihnen niemals begegnete. So war das Zusammenleben erträglich. Außerhalb meiner Wohnung schien mir alles lästig zu sein.
Das Erste, was ich jeden Tag tat, noch vor dem Aufstehen, war, das große Fenster zu öffnen und die Morgenluft einzuatmen. Ich wickelte mich in die Bettdecke und blieb noch ein paar Minuten liegen. Barcelona bei Tagesanbruch hat etwas von einem Sakrileg. Es stürzt sich auf die dem offenen Meer entsteigende, noch bleiche Lichtmasse und packt sie mit einem effizienten Ruck seiner Geburtszange. Es ist die Stunde der Wecker und Aufputschmittel, der Hetze, der knallenden Türen und Kopfschmerzen. Ein gewaltiges Räderwerk räuspert sich und läuft an, gut geschmiert von der Sprache, einer leidenschaftslosen, groben Sprache, die den ursprünglichen Sinn von Sprache pervertiert. Während ich mich im Bett rekelte, wurde ich mir dieser Profanierung bewusst. Danach ging ich ins Bad, wusch mich, zog frische Sachen an, frühstückte etwas Hochverarbeitetes. Wenn ich auf die Straße trat und bevor ich mich zur U-Bahn unter die Erde begab, schaute ich kurz zum Montjuїc hinüber und stellte mir höhere, kahlere Berge vor. Ich wurde zum gefangenen Tier, das die Schnauze reckt und ins Grübeln gerät, weil es Kinderfinger gerochen und Appetit bekommen hat.
Die Wände in manchen geriatrischen Einrichtungen beunruhigten mich. Ich hatte Dutzende von Heimen in sämtlichen Stadtteilen besucht. In den wohlhabenden Vierteln waren die Seniorenresidenzen gepflegt wie Museen. Stille Leere, schwer von menschlicher Gebrechlichkeit in all ihren Stadien. Hier und da in den Sälen und am Ende der Flure Reproduktionen von Monet, Renoir, Degas. Wände mit feinen Stofftapeten. Die alten Herrschaften passten dort hinein wie in eine Vitrine. Für gewöhnlich waren sie gut gekleidet, trugen Hosen mit korrekten Bügelfalten und Jockeyjacken und hatten eine Vorliebe für Halstücher und dunkle Rottöne. Sie hatten ihr ganzes Leben den Kopf hoch getragen und wollten nun auf dieselbe Weise sterben, das schüttere Haar strahlend weiß, Nase und Ohren depiliert. Die Einsamkeit umschlich sie wie ein Geier. Sie ignorierten sie, ohne jemals die Kinder zu rechtfertigen, ohne auch nur das Foto des jüngsten Enkels zu zeigen. Sie verschönerten sich ihren Lebensabend mit Vivaldi-Konzerten und Bach-Suiten, schienen aber schon tot zu sein, als würde ihr Herz aus purer Gewohnheit weiterschlagen. Die meisten von ihnen waren in Begleitung robuster Pflegerinnen mit Kurzhaarschnitt und strammer Uniform. Die Alten verließen sich auf sie wie Kinder auf die Mutter und schikanierten sie mit den Überresten ihrer Macht: Sie beauftragten sie mit Besorgungen, bestanden darauf, im Rollstuhl über die Kieswege des Gartens geschoben zu werden. Und die Frauen fuhren sie spazieren, lasen ihnen die Post vor, rieben ihnen die Diabetikerfüße mit Hautöl ein. Abends deckten sie sie zu und parkten die Rollstühle im Flur, ehe sie in die Eingangshalle hinuntergingen, wo sie aufeinander warteten, in Mänteln, unter denen die Kittel hervorschauten, die Schulterriemen ihrer kunstledernen Handtaschen diagonal über der Brust. Manchmal schloss ich mich ihnen an. Sie redeten pausenlos, egal, wie erschöpft sie waren. Das erste Stück Weg legten wir im selben Bus zurück. Dann stieg jede in ihre U-Bahn. Je weiter wir das Heim hinter uns ließen, desto belebter wurden die Straßen. In der Ferne, auf der Schwelle zwischen Leben und Tod, blieben die Ballerinen von Degas als stumme Zeuginnen zurück.
Zweiter fruchtbarer Tag, Mitternacht. In die Wohnung passte niemand mehr hinein, und immer noch klingelte es ab und zu. Ich machte nicht mehr auf. Am Morgen hatte ich mir im Eisenwarenladen einen Riegel gekauft. Jetzt konnte man mein Zimmer von innen abschließen. Seit einer Woche masturbierte ich täglich mit dem Vibrator. Wenn ich ihn eine Zeit lang nicht benutzt hatte, zog sich meine Vagina zusammen, als wäre ich als Mann geboren und hätte sie mir nachträglich aufschneiden lassen, und dann war das nächste Mal immer unangenehm. Ich musste vorsichtig sein, den Vibrator mit Gleitmittel bestreichen und ganz langsam einführen. So konnte das nichts werden, ich musste auf Anhieb schwanger werden. Es gab Musik, Essen, Getränke, Aschenbecher und Leute, einen Haufen Leute. Meine persönlichen Sachen hatte ich im Schrank versteckt. Mein Zuhause war eine Bühne, ein öffentlicher Platz, der einladende Empfangssaal eines Versuchslabors. Ich hatte Erdnüsse gegessen, ich hatte Flaschen geöffnet, keine Geschenke. Um zwei Uhr morgens kam noch ein zweiter Schwung Gäste. Das Klo sah fürchterlich aus. Die Zeit war reif. Ich fand ihn auf der Terrasse. Ich trat auf ihn zu, nahm ihm das Glas ab, drückte seine Zigarette aus, und wir tanzten. Er drückte mich an sich. Er war gerade dabei, sein Masterstudium zu beenden, und er war Schwimmlehrer. Als ich das hörte, dachte ich an breitschultrige Spermien, an ausgezeichnete Stromaufwärtsschwimmer und beschloss, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Ich küsste seinen Gin-Atem über eine Minute lang, zum ersten Mal einen Mann. Er küsste gut, aber mir gefiel es nicht, ebenso wenig wie seine glatt rasierte Haut, seine üppigen Frauenlippen oder die Tatsache, dass sich mein eigener Körper, vibrierend wie eine Oberleitung, gegen meinen Geist erhob, indem er sich so autonom, so mutig einem Körper des anderen Geschlechts öffnete. Ich lotste ihn in mein Zimmer, scheuchte fünf oder sechs Leute hinaus und legte den Riegel vor. Wenig Licht, nur was durch die Ritzen der Jalousie sickerte. Wieder küssten wir uns. Ich durfte ihn nicht gehen lassen, musste dem Instinkt folgen. Ich raffte mein Kleid. Er zog sein T-Shirt aus. Ich knöpfte seine Jeans auf und schob ihn zum Bett. Da holte er ein Kondom hervor, und mir stockte das Herz. Was jetzt? Ihm sagen, das sei nicht nötig? Dass ich es ohne besser fände? Er streifte es mit alarmierendem Geschick über, direkt vor meiner Nase. Das Denken fällt schwer, wenn der Körper die Oberhand hat, aber irgendwie gelangte ich zu einem Entschluss: Ich musste es zweimal mit ihm tun, das erste Mal mit dem Kondom, das zweite Mal ohne. Es war die einzige Lösung. Genau genommen war es eine Lösung, mit der ich mich wappnete. Ich betrachtete ihn für einen Augenblick, bewunderte ihn in Wahrheit, und staunte zugleich über mich selbst. Das konnte nicht ich sein. Der Penis stand vor mir wie ein Mast, und ich hätte am liebsten aufgegeben. Doch kaum hatte ich das gedacht, wurde ich von zwei Armen hochgehoben. Ich war die Puppe, die auf allen vieren ins Gras fällt, bevor sie jemand fickt, nur so zum Spaß.
Es war langwierig, eklig, ein unglaubliches Gerüttel, wie eine Kutschfahrt oder ein epileptischer Anfall. Ich wollte davonlaufen, ich wollte schwanger werden, und ich wollte mit der ganzen Sache keinesfalls noch mal von vorne anfangen müssen. Als er Anstalten machte, aufzustehen und sich anzuziehen, hielt ich ihn zurück. Die Musik schleppte sich dahin. Er schlief ein. Ich holte ein Red Bull aus meinem Rucksack und trank es in drei Zügen. Dann setzte ich mich auf, rauchte und wartete. Er schlief wie ein prächtiges Tier, ein Gepard oder ein Löwe. Er war ein Fleischfresser, ein paarungsfähiges Männchen, und ich überwachte seine Regeneration. Ich sperrte die Uhr in die Schublade, warf das Kondom in den Papierkorb und roch an mir. Überall laue Algenwärme, Geruch nach Schweiß, nach Teichufer, nach stehendem Gewässer, in dem Heerscharen winziger Eier reiften. Ich wartete auf das erste Zwitschern der Vögel mit den gestutzten Flügeln. Mit einem Mal loderten die Ritzen der Jalousie auf, als spähten Raubkatzenaugen ins Zimmer. Es war so weit. Ich nahm von dem Gleitmittel auf die Finger und steckte sie mir rein. Ich dachte an Teer, an Schmierfett, an Marinieröle. Dann kroch ich wieder ins Bett, griff nach seinem Penis und animierte ihn zur Fortsetzung. Behutsam, als wäre er etwas Kostbares, begann ich ihn zu reiten. Ich ließ zu, dass sich in meinem Körper viel mehr öffnete als nur das Fleisch: jeder Nerv, jedes mentale Gatter, bis hinein zu den Epizentren, den wahren, geheimen, wohin ich meine Geliebten einlud. Kurz vor dem Höhepunkt zog ich ihn auf mich. Ich musste in der Horizontalen sein, um ein ideales Nest zu bieten, die Welle auszulösen, den Wirbel, der den Samennebel einsaugen würde. Auf mir lag das brünstige Tier, die Bestie mit den Schwimmermuskeln, hervorgegangen aus dem ältesten aller Königreiche: dem Leben, dieser intelligenten Kraft.
Ein paar Tage später bekam ich meine Regel. Der Blutfleck in der Unterhose war eine Beleidigung. Was glaubst du, wer du bist?, schien er mich zu verhöhnen. Das Blut, das die abgestorbenen Eier fortspült, ist sich seiner Herrschaft bewusst, unwirsch gemahnt es an die Vormacht des den Launen externer Begierden ausgesetzten Körpers. Ich saß in der Küche auf dem Boden, wo mich eine meiner Untermieterinnen fand. »Non è la fine del mondo«, sagte sie. Ich betrachtete sie für ein paar Sekunden, bildhübsch mit der marineblauen Arbeitskleidung einer Eisdiele und dem violett schimmernden Haar, das sich um ihren Hals und in den Blusenausschnitt schmiegte. Sie war wie eine Pflaume, ich konnte sie nicht ansehen, ohne sie zu begehren. Dennoch hätte ich nicht sagen können, warum ich nie versucht hatte, etwas mit ihr anzufangen. Vielleicht, weil wir zusammenwohnten und räumliche Nähe, wie ein dünner Wandschirm, in Form von Schüchternheit zwischen zwei Körpern steht. Vielleicht auch, weil ich mich in persönlichen Beziehungen, richtigen Beziehungen, treiben ließ, große Herausforderungen reizten mich nicht. Ich hatte den Eindruck, mich um die Begegnung mit anderen nie zu bemühen, sondern eher die anderen auf mich zukommen zu lassen. Es war, als hätte man mich dazu erzogen, fremde Erwartungen und Bedürfnisse zu erfüllen. War es das, wozu man Frauen erzog? Manchmal sah ich mich selbst als kleinen Nager im Unterholz, ein emsiges Säugetierchen, gedacht als Nahrung für größere Tiere jeglicher Spezies.
Freitagmorgen. Ein blauer Himmel, freigefegt vom Wind. Die Sonne ergoss sich darüber wie Benzin. Ich erreichte das Altenheim im Eixample, wo ich am Vortag gewesen war. Ich hatte nur noch ein Interview zu Ende zu führen und könnte dann wieder nach Hause gehen. Die Pflegerin empfing mich mit einer Warnung: »Heute sind sie ein bisschen unruhig.« Ich betrat den Saal, wo die alten Leute auf den Beginn ihres Tagesprogramms warteten, und merkte es sofort. Die meisten waren auf den Beinen. Sie bewegten sich zwischen den Stühlen umher wie in einem Maisfeld, tasteten nach den Blättern der stehengebliebenen Zeit, schoben sie zur Seite, blickten sich um. Sie wollten raus! Die stets glasigen Augen glänzten kristallin. Sie schnauften und sahen aus wie Frettchen, sie schauten mich an, und ich dachte an Wölfe. Ich verstaute den Laptop im Rucksack und kehrte um, ohne ein Wort zu sagen. Draußen triumphierte der Morgen über die Stadt und lockte Kinder, Hunde und Alte an die Fenster.