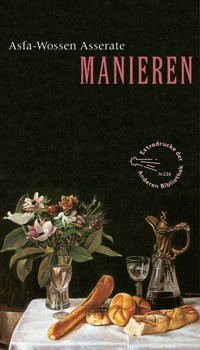
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Die Andere Bibliothek
- Sprache: Deutsch
»Ein grandioses, sprachmächtiges Sittenbild unserer Zeit.« Süddeutsche Zeitung
Es liegtAsfa-Wossen Asseratefern, dem Leser Vorschriften zu machen –Manierenist kein Anstandsbuch. Doch die ungeschriebenen Regeln unseres Umgangs miteinander fasst er genau ins Auge. Es lohnt sich, intelligent mit ihnen umzugehen.
Ist der Handkuss peinlich? Stirbt das Kompliment aus? Wie vulgär ist die Mode? Kann man den Spießer loben? Gibt es Damen und Herren oder nur Männer und Frauen? Solche und hundert andere Fragen werden hier erörtert.
»Der beste Kenner eines Landes und seiner Gesellschaft«, schrieb einst der große Soziologe Georg Simmel, »ist der Fremde, der bleibt.« Der Autor dieses Buches, der äthiopische Prinz Asfa-Wossen Asserate, der seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, ist ein solcher Fremder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
»Ein grandioses, sprachmächtiges Sittenbild unserer Zeit.« Süddeutsche Zeitung
Es liegt Asfa-Wossen Asserate fern, dem Leser Vorschriften zu machen – Manieren ist kein Anstandsbuch. Doch die ungeschriebenen Regeln unseres Umgangs miteinander fasst er genau ins Auge. Es lohnt sich, intelligent mit ihnen umzugehen.
Ist der Handkuss peinlich? Stirbt das Kompliment aus? Wie vulgär ist die Mode? Kann man den Spießer loben? Gibt es Damen und Herren oder nur Männer und Frauen? Solche und hundert andere Fragen werden hier erörtert.
»Der beste Kenner eines Landes und seiner Gesellschaft«, schrieb einst der große Soziologe Georg Simmel, »ist der Fremde, der bleibt.« Der Autor dieses Buches, der äthiopische Prinz Asfa-Wossen Asserate, der seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, ist ein solcher Fremder.
»Wahrhaft elegant – geschrieben in herrlichem Deutsch, humorvoll, gelehrt und unterhaltsam, von dezidiert persönlichem Charme und geradezu universellem Reiz.« Felicitas von Lovenberg, FAZ
Über Asfa-Wossen Asserate
Asfa-Wossen Asserate, 1948 in Addis Abeba geboren, Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie, lebt seit über fünfzig Jahren in Deutschland. Er ist Unternehmensberater für Afrika und den Mittleren Osten in Frankfurt am Main, politischer Analyst und Autor zahlreicher erfolgreicher Bücher zum Thema Deutschland und Afrika. Sein 2003 in der Anderen Bibliothek erschienenes Buch »Manieren« wurde zum gefeierten Bestseller.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Asfa-Wossen Asserate
Manieren
Übersicht
Titelinformationen
Titelseite
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Mein Weg nach Deutschland
Warum Manieren?
Die Ehre
Aufmerksamkeit & Nachlässigkeit
Die Dame
Versuch über den Herrn
Der schöne Schein
Körperliche Haltung & Seelische Contenance
Diskretion & Understatement
Pünktlichkeit & Unpünktlichkeit
Die Manieren und die Religion
Das Komische an den Zeremonien
Das Malheur
Lob des Spiessers
Vulgarität
Der Grobianismus
Mode & Zeitstil
Die Untergebenen
Umgang mit Feinden
Der Adel in der Republik
Manieren im Kommunismus
Man zieht sich an
Die Sprache
Die Begrüssung
Anreden und Titel (I)
Anreden und Titel (II)
Der Handkuss
Die Konversation
Das Loben
Drucksachen & Briefe
Familienanzeigen
Bei Tisch
Betrunkensein
Die Taufe und die Namen
Die Hochzeit
Geschenke
Blumen
Gleichheit & Ungleichheit
Epilog
Sachregister
Personenregister
Biographische Notiz
Impressum
Wer von diesem Buch begeistert ist, liest auch ...
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
Dieses Buch ist Deutschland, dem Land, das mir Zuflucht gewährt hat, und meinen deutschen Freunden in Dankbarkeit gewidmet.
Mein Weg nach Deutschland
Mir scheint, als habe meine Erziehung von Kindesbeinen an kein anderes Ziel gehabt, als mich auf das vorzubereiten, was dann auch schließlich, von meinen Eltern allerdings weder gewünscht noch vorhergesehen, mein Schicksal wurde: ein Leben in Deutschland. Die Deutschen galten viel im Äthiopien des Kaisers Haile Selassie, der mein Großonkel war. Es war ihnen nicht vergessen, daß sie als eine der wenigen Nationen Äthiopien Beistand leisteten, als Mussolini das Land überfiel und Äthiopien sich vom Völkerbund im Stich gelassen sah. Vielen älteren Deutschen wurde der damals noch jugendliche Kaiser Haile Selassie zur vertrauten Figur, wenn er in der Wochenschau zu sehen war, wie er in der weißen Shamma, unserem togaartigen Nationalgewand, vor dem Völkerbund in Genf seine bewegenden, aber erfolglosen Reden hielt. Kaiser Haile Selassie fühlte sich den Deutschen so sehr verbunden, daß er 1954 die Einladung der jungen Bundesrepublik annahm und Deutschland einen Staatsbesuch abstattete, den ersten eines ausländischen Staatsoberhauptes überhaupt – vom Gesellschaftlichen her gesehen vergleichbar mit der berühmten Tasse Tee, die Johanna Schopenhauer Goethes nicht standesgemäßer Ehefrau Christiane Vulpius anbot und damit den allgemein über sie verhängten Bann aufhob. Man vergißt angesichts des Elends, in dem mein Land nach der Revolution versunken ist, sehr leicht, welche Stimme der Kaiser von Äthiopien in den fünfziger und sechziger Jahren im Konzert der Mächte besaß. Konzert klingt freilich zu harmonisch, gemeint sind die gef ährlich dissonanten, sich über Jahrzehnte hinweg nicht auflösenden Akkorde einer durch viele Stellvertreterkriege gekennzeichneten Friedenszeit, und einem dieser Stellvertreterkonflikte ist Äthiopien dann schließlich auch zum Opfer gefallen. Aber bis es soweit war, drängten sich die Abgesandten der ganzen Welt am Hof des Kaisers, und wir selbst waren, und dies betrifft auch meine Kindheit und Jugend, in der ganzen Welt als geschätzte und umworbene Gäste zu Hause. Es war für meine Eltern eine Selbstverständlichkeit, mich und meine sechs Geschwister auf ein Leben vorzubereiten, das im Umgang mit Ausländern bestehen würde. Aber welchen Ausländern? Nördlich von Äthiopien liegen der Sudan und Ägypten, südlich Kenia. Mit Ägypten war Äthiopien durch das orientalische Christentum als älteste christliche Nation eng verbunden – warum nennt Frankreich sich eigentlich immerfort und unwidersprochen »Älteste Tochter der Kirche«? Der Stuhl von Alexandria war über Jahrhunderte hinweg unser »Heiliger Stuhl« – warum lernten wir nicht Koptisch? Der Sudan ist zum Teil arabisch und muslimisch, und die Äthiopier sind das einzige Volk auf Erden, das im Koran ausdrücklich vom Heiligen Krieg ausgenommen worden ist, weil Mohammed sich einmal äthiopischer Hilfe erfreute – warum lernten wir nicht Arabisch? Italien hatte uns im neunzehnten und im zwanzigsten Jahrhundert in der verspäteten Sehnsucht nach Kolonien mit Krieg überzogen; aber obwohl diese Kriege grausam waren und alles gekannt hatten, was anderswo »Kriegsverbrechen« genannt wird, waren viele Kolonial-Italiener nach dem Ende der italienischen Herrschaft im Land geblieben, hatten äthiopische Frauen geheiratet und lebten als Farmer und Handwerker – warum lernten wir nicht Italienisch? Nein, Deutsch war die Sprache, mit der ich als erster Fremdsprache aufwachsen sollte (das Englische verstand sich von selbst), und eine Fremdsprache kann man kaum nennen, was einen schon vor der Grundschule täglich umgeben hat.
Am Kaiserhof in Addis Abeba lebte eine deutsche Familie, die dort seit langem einen gewissen Einfluß besaß. Aus Schwaben waren die Halls während der Regierung von Kaiser Theodorus in den sechziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts als Missionare ins Land gekommen. Das Christentum konnten sie uns christlichen Äthiopiern nicht mehr bringen, aber was sie von europäischer Technik und Gesundheitswesen wußten, stieß auf großes Interesse. David Hall, der Sohn des Missionars, organisierte unter Kaiser Haile Selassie das Post- und Fernmeldewesen und wurde Kaiserlicher Staatsrat. Seine Schwester Vera Schuhmacher, geborene Hall, war eine Freundin meiner Eltern; sie war die erste Deutsche, die ich gesehen habe. Aus ihrem Mund habe ich die ersten deutschen Laute vernommen. Wie es immer in der Emigration geschieht – ich weiß, wovon ich rede –, bewahrten die Halls in ihren Gedanken und Erinnerungen, ihren Gewohnheiten und Gebräuchen ein Deutschland, das zu ihrer Jugend gehörte, und das war für uns Kinder der Inbegriff ihres Vaterlandes: Tante Vera war höflich bis zur Feierlichkeit, redlich bis zur Selbstaufgabe, ein wenig kühl, aber zuverlässig wie der Lauf der Sterne. Sie sprach gern deutsch, und sie sprach es, wenn ich mir dies Urteil erlauben darf, gut. Es ist bekannt, daß jede Sprache auch mit einer bestimmten Formung des Charakters, der Denkungsart, der Art zu sein einhergeht. Worin der Charakter des Deutschen nun genau besteht, will ich und kann ich in wenigen Worten nicht sagen, aber ich fühle bis heute, daß ich eine andere Wesensart annehme, wenn ich deutsch spreche.
Tante Vera war es auch, die meinen Eltern die österreichische Kindergärtnerin Louise Haunold vermittelte, die meine erste deutschsprachige Erzieherin wurde. Tante Louise verdanke ich meine erste deutsche Fibel und meine Liebe zu Vanillekipferln. Als einer der ersten Schüler trat ich 1955 in die soeben in Addis Abeba gegründete deutsche Schule ein, die mich nach im fernen Deutschland entwickelten Lehrplänen bis zum Abitur geführt hat. Eine bessere Vorbereitung für das Studium in Deutschland war nicht möglich. Und nun begannen auch die Reisen nach England, die mir die grandiosen, die hochherrschaftlichen Seiten der europäischen Kultur zeigten. England, das war für Leute wie für meinen Vater immer noch das Empire, die glanzvolle Entfaltung einer Macht, die den halben Erdball umspannte. In Afrika und Asien schauten die gebildeten Schichten gebannt auf den englischen Lebensstil, die Organisation der englischen Politik – die so modellhaft erschien und die so unnachahmlich war –, auf englischen Hochmut und englische Weltläufigkeit.
Blieb bei soviel europäischen Einflüssen eigentlich noch Raum für Afrikanisches und spezifisch Äthiopisches? Man könnte meinen, nicht, und als ich als junger Mann in Äthiopien lebte, fühlte ich mich von manchem, was ich dort als Volksbrauch mitbekam, so befremdet wie vielleicht ein gleichaltriger Europäer es empfunden hätte. Ich erinnere mich eines feierlichen Besuches, den mein Vater den Ben Amir, einem im Westen Eritreas lebenden muslimischen Stamm, abstattete, bei dem ich ihn begleiten durfte. Beim Festmahl wurde uns dort die größte Köstlichkeit bereitet, die sich die Mitglieder dieses Stammes denken konnten, ein gefülltes Kamel. In dem Kamel steckte ein Kalb, in dem Kalb ein junges Lamm, in dem Lamm ein Huhn und in dem Huhn ein Ei. Die Kunst des Tranchierens wurde hier ebenso hochgehalten wie am Hof von Burgund, wo es galt, einen vergoldeten Pfauen in hundert exakt gleich große Teile zerlegen zu können: Hier bei dem Kamel mußten die Schnitte so durchgeführt werden, daß auf jedem Teller, oder besser Pfannkuchen, der sowohl als Teller wie als Instrument diente, die Bissen zu fassen, von allen Fleischarten bis hinunter zum Ei ein Stückchen landete. Ich bewunderte zwar diese Kunst, aber sie war mir fremd und etwas unheimlich. Wie stark Afrika mich geprägt hat, ohne daß ich es mitbekam, habe ich erst im Exil begriffen: Der Umgang mit der Religion, der Respekt und die Verehrung in der Familie, das beglückende Erlebnis traditioneller Zeremonien, wie ich sie bei meinem Großvater Ras Kassa erlebt habe, der trotz seiner Machtfülle in mönchischer Askese lebte, die Freude über jede Art von Fest und das Rechnen in größeren Zeiträumen als der schnellen Epochenabfolge der Europäer gehören zu den Erinnerungen, die mich wie eine Nabelschnur mit meinem Geburtsland verbinden.
Im Umgang mit England waren wir viel unbefangener als andere Afrikaner, weil Äthiopien niemals Kolonie gewesen war und weil das Kaiserhaus während der italienischen Besatzung (1936‒1941) in England Zuflucht gefunden hatte. So wie ich England erleben durfte, war es für mich ein Sonntagsland. Deutschland war für mich immer das Werktagsland. Was ich an englischen Traditionen kennenlernte, war angefochten, aber hinter hohen und bis heute erstaunlich sicheren Bastionen verschanzt. In Deutschland erlebte ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Gesellschaft in konfliktreicher Entwicklung. Ich weiß wohl, daß der alte Cambridge-Stil, von dem ich noch so viel mitbekommen habe, daß ich glaube, mich gleichfalls nostalgisch wie Evelyn Waugh an Jahre voller Glück erinnern zu dürfen, in den sechziger Jahren keineswegs mehr sicher in sich ruhte, aber von der Fassade stand noch viel. In Deutschland wurde ich, wie mein Vater es sich vorgestellt hatte, Mitglied eines Studentencorps in Tübingen, des altehrwürdigen Corps Suevia, um den wirklich »deutschen« Stil mitzubekommen. Hier konnte ich viele Freundschaften schließen, die auch in schweren Zeiten standhielten, und zugleich geriet ich mitten in die 68er-Bewegung hinein. Im Cambridge Union habe ich mit Trotzkisten und Maoisten im Smoking debattiert, und in Frankfurt sah ich, wie die Professoren unter einem Hagel fauler Eier aus den Hörsälen flohen. Die äthiopische Revolution, die sich sehr bald schon nicht mehr mit dem Werfen fauler Eier zufriedengab, hielt mich dann in Deutschland fest.
Ich studierte damals am Leo-Frobenius-Institut in Frankfurt am Main Geschichte und Ethnologie und beschäftigte mich mit unveröffentlichten Schriften der äthiopischen Geschichtsschreibung. Mein Vater wurde kurz nach dem Sturz des Kaisers ohne Urteil welchen Gerichtes auch immer erschossen; für meine Mutter und meine Geschwister begann eine über fünfzehnjährige Gefangenschaft mit gelegentlich sehr trüben Aussichten, denn den zweiundsechzig Männern, die mit meinem Vater zusammen erschossen worden waren, folgten, wie man heute weiß, noch Millionen Tote. Der alte Kaiser wurde gleichsam nebenbei mit seinem Kopfkissen erstickt. Man warf ihm vor, ein mittelalterliches Regiment geführt zu haben.
Dies ist nicht der Ort, die Geschichte Haile Selassies aufzurollen, die ohnehin noch ihrer eingehenden Darstellung harrt. Nur eine Bemerkung sei hier gestattet: Es ist richtig, daß vieles an der Herrschaft des letzten äthiopischen Kaisers in die Welt des Mittelalters gehörte – aber gerade an diesen mittelalterlichen Elementen ist der Kaiser gewiß zuallerletzt gescheitert. Man müßte vielmehr sagen: er ist zuwenig mittelalterlicher Herrscher gewesen. Er versuchte, nach dem Vorbild Nehrus oder Nkrumahs oder Maos einen modernen industrialisierten Zentralstaat zu erzwingen, und schuf damit in der äthiopischen Gesellschaft großen Konfliktstoff. Wie Äthiopien dann zu einer sowjetischen Kolonie unter einem besonders blutrünstigen Satrapen wurde, kann erst recht nicht mehr Gegenstand dieser Erklärungen sein, mit denen ich mich dem Leser vorstellen möchte.
Die Brücken zurück waren abgebrochen, und ich mußte darangehen, ein Land, das ich bis dahin als meine Schule angesehen hatte, zu meiner Heimat zu machen. Das Gefühl, mit dem ich nach langen Jahren meinen deutschen Paß entgegennahm, kann nur verstehen, wer schon einmal mit einem Fremdenpaß gelebt hat. Deutschland hat sich mir in den fünfunddreißig Jahren meines Lebens hier, wie ich glaube, von allen erdenklichen Seiten erschlossen. Ich habe das Glück gehabt, Freunde in allen vorstellbaren Milieus der deutschen Gesellschaft zu finden. Ich habe das noch größere Glück gehabt, viele alte Leute kennenlernen zu dürfen, deren Erzählungen mir geholfen haben, das, was ich splitterweise von Deutschland erfuhr, in ein größeres Bild einzuordnen. Sehr langsam habe ich meine Verblüffung überwunden, als ich bemerkte, daß jenes Deutschland, das mein Vater und Tante Vera und viele andere Deutschlandkenner in Äthiopien und ganz Afrika mit höchstem Respekt und Bewunderung betrachteten, sich selbst mißtrauisch und kleinmütig sah. Unvergeßlich ist mir ein Erlebnis in Paris, wo ich mit französischen Freunden, die sehr gut Deutsch sprachen, eine Ausstellung besuchte. Wir beugten uns gemeinsam über eine Vitrine und tauschten uns auf deutsch darüber aus, was wir sahen, als mich von hinten eine deutsche Dame, dem Aussehen nach eine Intellektuelle, anstieß und mir zuraunte: »Sprechen Sie doch nicht so laut, es merkt ja jeder, daß Sie Deutsche sind!« Als ich mich umwandte, war ihr Erschrecken größer als das des Papageno beim Anblick des Monostatos.
Ich nehme dies Erlebnis als ein pars pro toto für viele ähnliche, die mich gegenüber einem Land beunruhigten, dem ich vor allem Dank schulde. Klug aus den Deutschen werden, das ist nicht so leicht. Wenn Afrikaner oder Europäer aus anderen Ländern mich fragen, wie sie denn nun seien, die Deutschen, unter denen ich seit so vielen Jahren lebe, dann kann es passieren, daß ich antworte: »Ich weiß es nicht.« Deutschland ist nicht nur ein Land vieler sehr unterschiedlicher Regionen, sondern auch vieler, überraschend vieler Individuen, die ich jedenfalls nicht auf einen nationalen Nenner bringen kann. Deutschland ist nicht scharf abgegrenzt wie die britischen Inseln oder wie das »Heilige Sechseck« Frankreich oder wie der italienische Stiefel oder das Viereck der iberischen Halbinsel. Es ist ein großes Land mit verschiebbaren Grenzen; zu den verschiedenen Zeiten seiner Geschichte war es größer und kleiner als heute. Neben dem realen Deutschland scheint es mir immer auch ein potentielles Deutschland zu geben. Eine kleine Phantasie: Man stelle sich vor, Italien sei in eine kommunistische und in eine kapitalistische Hälfte geteilt worden. Wären deshalb daraus zwei Länder mit sehr unterschiedlichem Gepräge entstanden? Ich wette, nein. In Deutschland wäre das beinahe gelungen. Die Deutschen können sich auf ein Gedankenexperiment einlassen und es todernst nehmen. Sie sind in der Lage, eine andere Lebensart anzunehmen, als habe sie immer schon zu ihnen gehört. Im neunzehnten Jahrhundert waren die deutschen Prinzen und Prinzessinnen als Ehegatten ausländischer Fürsten sehr begehrt, denn man wußte: Kaum hatte ein Deutscher oder eine Deutsche die Landesgrenzen überschritten, wurden sie zu den perfektesten Engländern, Russen, Bulgaren oder Belgiern aller Zeiten. Es gibt Freunde von mir, die behaupten, daß die Deutschen mich mit ihrer proteushaften Wandlungsf ähigkeit angesteckt hätten und ich sei ein deutscher Äthiopier, vielleicht sogar ein äthiopischer Deutscher geworden. Aber sie haben natürlich nicht mit meiner afrikanischen Seele gerechnet!
Warum Manieren?
Mit dem Gedanken, eine Betrachtung über deutsche und europäische Manieren zu schreiben, gehe ich schon eine Weile umher. Ich hatte mir sogar schon einen Zettelkasten angeschafft, in dem ich nach dem Vorbild der berühmten japanischen Hofdame Sei Shonagon zum Beispiel zusammentrug: »Was häßlich ist.« Was war nach meinem Dafürhalten häßlich?
»Fremden Leuten ins Gesicht fassen.
Das Fernsehen laufen lassen, wenn Besucher den Raum betreten.
Rotweingläser zu voll schenken.
Über sein Gewicht sprechen.
In der Brusttasche ein Taschentuch aus demselben Stoff wie die Krawatte tragen.
Sich wundern.
Medizinische Ratschläge geben: Wußten Sie nicht, daß so viel Salz gesundheitsschädlich ist?
Sich im Theater mit dem Rücken zu den Sitzenden durch die Stuhlreihe zwängen.
Mit nacktem Oberkörper am Eßtisch sitzen.
Fremde Leute beim Abendessen fragen: Glauben Sie an Gott?«
Es wurde mir sehr schnell klar, daß diese Liste, so lange sie sich fortsetzen ließe, kein hilfreiches Konzept für ein Buch über die Manieren, wie ich es plante, barg. Ich wollte mich ja nicht als arbiter elegantiarum betätigen. Nichts wäre in der gegenwärtigen Verfassung der deutschen Gesellschaft lächerlicher, nichts vergeblicher. Ich habe deshalb auch keinen der vielen Ratgeber gelesen, die sich mit den Manieren befassen, obwohl viele davon gewiß sehr lesenswert sind. Die Leute fühlen offenbar ein gewisses Bedürfnis, sich über die Regeln der Verhaltensweisen in Gesellschaft zu unterrichten. Ist dieses Interesse nicht verblüffend? Man muß sich doch fragen, wer die Autorität sein soll, die über die Fragen der Manieren heute verbindlich Auskunft geben könnte. Gelegentlich meldet sich in solchen Fragen der Tanzlehrerverband zu Wort. Die Damen und Herren Tanzlehrer tagen offenbar in regelmäßigen Abständen und geben bei dieser Gelegenheit zu Protokoll, was sie dem deutschen Volk bezüglich der Manieren raten. In den Zeitungen erscheinen dann in der Saure-Gurken-Zeit Auszüge solcher Empfehlungen. »Spargel darf man neuerdings auch mit dem Messer schneiden«, heißt eine solche kleine Sensation auf dem Gebiet der Sitten, oder: »Smoking darf jetzt auch nachmittags getragen werden.« Gibt es irgend jemanden, der solche Ratschläge ernst nimmt? Es stimmt schon, daß in der Vergangenheit die Tanzlehrer häufig die Aufgabe übernommen haben, jungen Leuten außer den Tanzschritten auch einen gewissen Grundstock an Benimm-Regeln beizubringen. Nach der Französischen Revolution waren in der neuen Schicht der Mächtigen die Tanzlehrer des Ancien régime sehr gefragt, um die neugebackenen Herzoginnen den Umgang mit der Schleppe zu lehren, und sogar Napoleon, der auf seinen kurzen Beinen durch die Enfiladen zu stürmen pflegte, soll sich von einem Tanzlehrer der untergegangenen Zeit im Schreiten haben unterrichten lassen. Allerdings waren es nicht die Tanzlehrer, die die Etikette bestimmten; sie hatten aber die Leute gekannt, die einstmals kompetent gewesen waren, und waren nun Informanten, vor denen man sich nicht genieren mußte.
Es kennzeichnet unsere Epoche, daß diese eigentümliche Mischung aus Herablassung gegenüber den Manieren und verstohlener Neugier, wie sie die Jahre nach der Französischen Revolution hervorbrachte, die öffentliche Atmosphäre wieder bestimmt. Die politischen Rupturen waren in Deutschland so stark, daß man sich als Deutscher offenbar nicht vorstellen konnte, es gebe Regionen in Europa, die von diesen Brüchen und Erschütterungen verschont geblieben sein könnten. Seitdem die Deutschen sich in wachsendem Maße vertraut in Europa bewegen, haben sie, zum Teil mit nicht geringem Erstaunen, feststellen dürfen, daß die Welt der Manieren, die in Deutschland so gründlich untergegangen zu sein schien, in den Nachbarländern keineswegs obsolet geworden ist. Sind diese Länder nun rückständiger als Deutschland? Mancher ist sich da sicher, daß die verschiedenen Umstürze in Deutschland neben großem Schaden auch großen Fortschritt gegenüber den anderen europäischen Ländern gebracht haben. Wer nun für die Einführung der Gleichheit in Deutschland ursächlich verantwortlich zu machen ist (Napoleon, die Weimarer Verfassung, Hitler, die Kommunisten, die amerikanische re-education stehen zur Auswahl): man kann sagen, daß er oder sie Erfolg mit ihrem Programm gehabt haben.
So gilt es zunächst festzustellen: Eine Instanz, die in Deutschland den berechtigten Anspruch erheben dürfte, eine Aussage über die Manieren zu machen, gibt es nicht mehr. Manieren haben autoritären Charakter. Sie entziehen sich der Diskussion. »Über Geschmack läßt sich nicht streiten« gehört zu den vielen Zitaten aus der Antike, denen aus Unkenntnis ihres Zusammenhangs ein falscher Sinn untergeschoben worden ist. Man kann über den Geschmack nicht etwa nicht streiten, weil er Privatsache ist und im Belieben des Individuums liegt, sondern weil es nur einen einzigen guten Geschmack gibt, der aber ist ein Axiom. Wer ihn in Frage stellt, zeigt nur, daß er diesen axiomatischen Charakter nicht verstanden hat und sich auf der Ebene der Rationalität mit dem Geschmack beschäftigt, anstatt auf der einzig angemessenen, der des halb vegetativen, selbstverständlichen Vollzugs.
Die großen Lehrer der Manieren haben sich deshalb zu allen Zeiten niemals als Gesetzgeber verstanden, sondern als Deuter und Interpreten eines bereits vorliegenden, nach ihrer Vorstellung immer schon vorhanden gewesenen Korpus von Regeln, das mit anderen Grundsätzen aus der Kunst, der Philosophie und der Religion in Harmonie stand und noch in der kleinsten Geste mit dem Gesetz des ganzen Kosmos verbunden war. Die dem eigenen Stande angemessenen Manieren wiesen dem einzelnen seinen Platz in diesem Kosmos zu und machten ihn dadurch überhaupt erst zum Menschen. Erzogen werden, Manieren annehmen, das waren Menschwerdungsakte. An erster Stelle vermittelte die Familie die Manieren. In der Familie fand das Kind die ganze Welt beispielhaft abgebildet: Gottes Barmherzigkeit in der Mutter, Gottes Gerechtigkeit im Vater verkörpert, Vater und Mutter als König und Königin, Mann und Frau in beispielhafter Weise. Die Eltern waren durch ihren Stand geformt, eine kollektive Formung, die schon deswegen nicht bezweifelt werden konnte, weil niemand daran dachte, seinen Stand zu verlassen. Es ist für die soziale Entwicklung Italiens gewiß bezeichnend, daß der Zeitgenosse von Tizian und Raffael, der Conte Baldassare Castiglione gerade hier seinen Cortigiano, das Buch über die Manieren des vollendeten Höflings, schrieb – in Italien kannte man immer schon den Aufstieg über die Klassenschranken hinweg, weswegen für den Neuankömmling an höherem Ort aber auch ein Bedürfnis der Unterrichtung bestand.
Erzieher wurden in der Neuzeit, für die der gesellschaftliche Wandel, der Ortswechsel vieler Menschen, der moderne Staat stehen, die großen Institutionen: der Jesuitenorden, das preußische Militär – man unterschätze aber auch nicht den Einfluß des englischen und des österreichischen Militärs auf die Manieren. Ernst Jünger nennt auch die Stadt Paris als große Anstalt der Menschenformung. Weiterhin könnte man die immer systematischer ausgebauten diplomatischen Dienste in der Prägung durch Talleyrand und den Fürsten Metternich nennen; auf jeden Fall auch die englischen Public schools und die Colleges von Oxford und Cambridge, die ihre Zöglinge im Punkt der Formgebung radikaler in die Zange nehmen als jede andere Institution Europas – von der Erziehung zum Mandarin sei hier geschwiegen. Nach einem Wort von Joubert ist die Grundlage der Manieren die katholische Liturgie – in diesem Sinne war jeder Ministrantenunterricht, der die kleinen Buben in den Ritus einführte, Unterweisung und Formung der Manieren. Wieweit die deutschen Höfe an der Ausbildung der schließlich nach ihnen benannten »Höflichkeit« beteiligt waren, wage ich nicht zu sagen. Wien hatte selbstverständlich großen Stil, Berlin viel weniger, und die übrigen Höfe waren jedenfalls nicht »mondän«; die Verhältnisse im neunzehnten Jahrhundert waren überall bereits sehr bürgerlich, was teilweise übrigens sympathisch war, aber eben nicht stilbildend.
Wenn wir uns die großen gesellschaftlichen Korporationen von heute ansehen, erkennen wir leicht, daß sie von ganz anderem Charakter sind als die der Vergangenheit; auch das, was sie als Stil vermittelt haben und vermitteln, muß deshalb etwas anderes sein. Die politischen Parteien und Gewerkschaften – gleichgültig ob demokratischer oder diktatorischer Tendenz – haben sämtlich versucht, bis tief ins Familienleben der Staatsbürger hineinzuwirken, und sie müssen das auch tun, denn im Kampf um die Zustimmung gilt es, Bindungen zu begründen, die über die bloße Befürwortung des Parteiprogramms weit hinausgehen. Die öffentliche Schule hat einen allumfassenden Anspruch auf die Erziehung der Kinder angemeldet, die sich nolens volens in die Hände des Staates und der von ihm propagierten Pädagogik begeben müssen. Die großen Unternehmen haben in der Arbeitszivilisation Staaten im Staat gebildet, die alle Betriebsangehörigen einem eigenen, allumfassenden Firmenstil unterwerfen. Statt einer maßgebenden »Capitale du monde« ist der Großstadtlebensstil selbst für kleine Gemeinden verbindlich geworden, während zugleich immer riesigere Städte den wesentlichen Teil der Bevölkerung jedes Landes anziehen; hier ist Deutschland sogar eher untypisch mit seinen beinahe über die ganze Fläche des Landes verstreuten mittelgroßen Städten. Warum ist es derart machtvollen Körperschaften, die jeden unserer Zeitgenossen auf die eine oder andere Weise fest in ihrem Griff halten, trotz vielfacher Versuche nicht gelungen, in bezug auf den Umgang der Menschen miteinander verbindliche, von jedermann akzeptierte Manieren hervorzubringen und sie im öffentlichen Bewußtsein zu verankern?
Eine Erklärung unter vielen möglichen mag eine in der gesamten Geschichte neuartige Erscheinung sein: die Erfindung des Privatlebens. In Afrika und Asien kann man, wenn die Verhältnisse nur genügend rückständig sind, immer noch beobachten, was ein ungeteiltes Leben, die Existenz aus einem Guß bedeuten kann. In der vorindustriellen Welt gab es kein Privatleben. Das Leben war immer öffentlich. Tallemant des Réaux kolportiert eine Äußerung eines Edelmannes zu König Ludwig XIII.: »Sire, ich möchte nicht an Ihrer Stelle sein: immer allein essen und immer in Gesellschaft scheißen müssen!« Allein essen hieß im übrigen nicht, daß der König allein im Zimmer war, sein Hof stand während der Mahlzeit um ihn herum, »machte Umstände«, wie wir immer noch sagen, und bediente ihn zeremoniell so feierlich, daß die Speisen meist kalt auf seinen Teller kamen. Die Königin mußte ihr Kind in Anwesenheit des ganzen Hofes zur Welt bringen. Im Schlafzimmer des Königs mußte stets ein Diener schlafen, der mit dem Monarchen mit einer Schnur von Handgelenk zu Handgelenk verbunden war.
Royale Existenz war beispielhaft; so lebte, nach den Verhältnissen abgestuft, jedermann. In fast allen Schichten schliefen die Leute zu mehreren in einem Bett, keineswegs nur bei den Armen, auch in den Schlössern trieb die Kälte die Bewohner zusammen. Alle Stände lebten in größter Nähe zueinander. Der Reiche war bis in seine letzten Gewohnheiten beständig vom Armen beobachtet. Der Satz, niemand sei ein Held vor seinem Kammerdiener, stammt schon aus der Zeit des beginnenden Privatlebens. Weder Gottfried von Bouillon noch Ludwig XIV. hätten das Gefühl gehabt, in den Augen ihres Dieners weniger ehrfurchtgebietend zu sein als für den Rest der Welt, nur weil der Mann sie unbekleidet gesehen hatte.
Niemand konnte allein sein wie heute jeder Mann und jede Frau, die allein in ihrer kleinen Wohnung leben und nach der Arbeit die Tür hinter sich schließen. Eine Aufteilung des Lebens in einen öffentlichen und einen privaten Teil mit unterschiedlichen Verhaltensweisen, Kleidungsutensilien, Sprachstilen, womöglich sogar Denkstilen ist erst in der westlichen industriellen oder postindustriellen Massengesellschaft möglich geworden. Damit ist es den stilbildenden großen Korporationen aber auch verwehrt, mit ihrer Formation in das Privatleben einzudringen. Gegenüber dem enormen mentalen Druck des Lebens in der Öffentlichkeit, dem er sich beugen muß, setzt der Zeitgenosse seine Hoffnung auf die verschließbare Tür seiner Wohnung. Noch nicht einmal die Diktatoren des Jahrhunderts konnten ihm hierhin folgen, obwohl doch schon bald ein Radioapparat dort stand. Im Privatleben verliert der Zeitgenosse seinen Beruf, seinen Stand, jede Art von Verpflichtung. Die Freiheit, die die Demokratie allen verheißen hatte, ist im Privatleben zu Hause. Die Freiheit ist die Freizeit. Hier gilt kein Gesetz und keine Regel. Selbstverständlich hat auch diese Regellosigkeit alsbald einen äußerst geregelten, durch einen überall verbreiteten Freizeitstil gekennzeichneten Charakter angenommen, aber dieser Charakter ist sehr weit von dem entfernt, was man mit Manieren bezeichnen würde; Manieren gelten in dieser Freizeitzone des Privatlebens sogar als Last und Bedrückung, der nach der Arbeitswoche zu entkommen man sich für berechtigt hält.
Ein weiterer Grund für die Gespaltenheit, mit der die Gegenwart auf die Manieren blickt, sei skizziert. In der Gründungsepoche der Demokratie während der Französischen Revolution spielten ästhetische Fragen für die Revolutionäre eine zentrale Rolle. Der befreite Bürger, der citoyen, sollte ein Wesen sein, dessen Würde und Anstand die Könige beschämte. Das Beispiel des Königs war, auch im negativen Sinn, allgegenwärtig. Das außergewöhnliche Prestige der französischen Könige kam der Revolution zugute: Wer einen König von Frankreich in seiner Gottähnlichkeit köpfte, mußte selbst mindestens Prometheus, vielleicht gar ein jugendlicher Jupiter sein. Nach diesem Titanenaufstand mußten aus dem Bourgeois des alten Regimes Römer voll gravitas,Tugend und Pflichtbewußtsein werden. Nun, sie wurden es nicht, wie wir wissen. Die Hochstimmung der Gründungsphase der Demokratie dauerte nicht an, obwohl sie mit der Verkündung der Menschenrechte ein Dokument von quasi religiöser Feierlichkeit in ihre Fundamente eingemauert bekam.
Was war es, das den Bürger einer Demokratie seinen Stolz, ein Republikaner zu sein, verlieren ließ? War es die hochgespannte Rhetorik vom »Souverän«, die sich im republikanischen Alltag nur in den enttäuschenden Alternativen am Wahltag erfüllte? War es das Gefühl der Ohnmacht, das den einzelnen im egalitären Massenstaat erfüllte, das eindringliche Gefühl, es komme auf ihn und seine Wünsche nicht an? War es die Leichtigkeit, mit der sich die demokratische Ideologie mißbrauchen ließ, die Allgegenwart der Demagogie, die Scham darüber, unablässig von den Politikern belogen zu werden, aber zugleich den Politikern etwas anderes als die Lüge gar nicht zu gestatten – ein Verhältnis zwischen Politikern und Bürgern, das mit dem zwischen Rauschgiftsüchtigen und Dealern verglichen wurde? Ganz gewiß ist für den Mangel an Stolz, mit dem die europäischen Demokraten auf ihre Gemeinwesen blicken, auch verantwortlich, daß die Geschichte der Demokratisierung Europas mit dem politischen Niedergang Europas verbunden war. Die Demokratie in Europa ist die Geschichte eines gigantischen, in der Geschichte der Menschheit einzigartigen ökonomischen Erfolges, der mit einem für Europa ebenfalls neuartigen Verlust an Macht und politischem Einfluß einherging. Die modernen Europäer teilen das Schicksal Venedigs nach der Entdeckung Amerikas: Sie sind reich, aber der Takt der Musik wird anderswo angegeben.
Und es bewahrheitet sich, daß der Mensch für ökonomische Gaben nicht lange dankbar ist. Der Luxus wird selbstverständlich, um so mehr als der neue europäische Luxus mit heizbaren Swimmingpools und Garage für den Zweitwagen keinerlei Charme besitzt. Was die Europäer besitzen, sind nicht die »Berge aus Gold«, die Eldorado zum Ziel der Abenteurer machten. Ein Swimmingpool für jedermann ist ein beinahe erreichbares Ziel; der Kapitalismus hat das Märchenland des Karl Marx, in dem der Überfluß herrschte, in greifbare Nähe gerückt, man ahnt, wie es aussehen könnte, in manchen Gegenden der Erde ist es bereits verwirklicht – mit dem Ergebnis, daß sich alle Leute von Geist in Regionen flüchten, die von diesem Ziel so weit wie irgend möglich entfernt sind. Das Grab Christi zu befreien konnte über Jahrhunderte die Herzen der Armen und der Reichen mit wilden Träumen und der Bereitschaft zu äußersten Opfern erfüllen; der Traum vom heizbaren Swimmingpool bewegt die müden Hinterteile schon heute nicht mehr zehn unbezahlte Schritte über die Straße.
Es wäre vollkommen falsch, aus dieser grundsätzlichen Mißvergnügtheit gegenüber der Demokratie auch nur die bescheidenste Tendenz einer Sehnsucht nach anderen Zeiten, gar vergangenen, ableiten zu wollen. Keiner derjenigen, die den Enthusiasmus für die Demokratie verloren haben, wünscht sich eine andere Welt ernsthaft herbei oder zurück. Es ist wie mit einem Fünfzigjährigen, der schlecht gelaunt und halb ungläubig von seinem leidenschaftlichen Betragen von vor dreißig Jahren hört und doch keinen Tag noch einmal erleben möchte.
Die Manieren der vorindustriellen Jahrtausende, besonders des abendländischen Jahrtausends, waren mit dem Begriff der Repräsentation auf das engste verbunden. Der einzelne stellte durch seine Manieren mehr dar als sich selbst: Er repräsentierte seine Familie und seinen Stand, gegebenenfalls auch seinen Glauben, seinen König und sein Land, ja sogar, um noch größere Einheiten zu nennen, sein Geschlecht: Durch die Manieren wurden der Mann und die Frau zum Mann schlechthin und zur Frau schlechthin. Alle Übereinkünfte, auf die sich diese Kategorien stützten, sind aufgehoben. Wer in seinem nach den Regeln von Manieren stilisierten Verhalten irgend etwas anderes als sich selbst darstellen wollte, wäre so verrückt wie die große in Vorahnung der kommenden Welt erfundene Figur des Cervantes, der Don Quixote. Und ebenso verrückt und lächerlich wäre jeder, der in einem Buch die Regeln der Manieren einer atomisierten und radikal individualisierten Gesellschaft als etwas Verbindliches vorschreiben wollte. Verbindliche Regeln, wie man Menschen begrüßt, wie man sie anredet, wie man sie anzieht, wie man ißt, wie man Gäste empf ängt, wie man heiratet und wie man stirbt, gibt es in Deutschland nicht mehr, und auch das übrige Europa hat eine deutliche Tendenz, sich von solchen Verbindlichkeiten zu verabschieden.
Jeder löst diese Vorgänge, wie es ihm Spaß macht oder wie er glaubt, daß es am bequemsten ist, und es ist auch niemand in Sicht, der sich über den vollständigen Mangel an Form entrüstet. Frauenzeitschriften und Gastronomieführer unterrichten zwar ihr Publikum in den Künsten des gehobenen Konsums und stellen die interessantesten Neuentwicklungen vor, die man auch noch auf den Tisch stellen kann, aber auch der begeistertste Schüler solcher Ratgeber wird hoffentlich nicht behaupten wollen, so etwas habe auch nur im entferntesten etwas mit Manieren zu tun.
Es zeigt sich allerdings, daß in der sich in starker Bewegung und ständiger Umwälzung befindlichen Gesellschaft ein eigentümliches Potential an romantischen Vorstellungen vorhanden ist. Die einzige Kraft, die nach Abschaffung der Stände die Gesellschaft allgemein anerkannt zu gliedern vermag, ist weder Bildung noch Leistung, sondern das Geld. Das Geld ist, wie man nicht erst seit Lessing weiß, unterschiedlich verteilt – »›Es ist doch sonderbar bestellt‹ / Sprach Hänschen Schlau zu Vetter Fritzen / ›Daß nur die Reichen in der Welt / Das meiste Geld besitzen.‹« Aber dieser Besitz ist nichts Statisches. Unablässig sieht das Publikum große Vermögen entstehen und vergehen. Möglicherweise hält diese Bewegung den Neid in Grenzen. Jeder muß sich sagen, daß ein großer Geldhaufen etwas ist, das von den dümmsten und primitivsten Gestalten erworben werden kann. Das Geld ist – jedenfalls scheinbar – in der Reichweite eines jeden. Wer kein Geld hat, heißt es, muß sich das selbst zuschreiben und gehört völlig zu Recht ganz nach unten auf der sozialen Stufenleiter. Die Zeiten, in denen in Deutschland der reiche Kaufmann viele Stufen unter dem armen Major stand, sind gründlich vergangen.
Mit Staunen betrachtet das Publikum die Reichen. Sie lösen das ein, was den anderen bloß verheißen ist: Sie sind frei. Erst bei ihnen entfaltet das Privatleben seine unbegrenzten Möglichkeiten. Regeln, über die sie sich hinwegsetzen könnten, gibt es nicht, aber sie sind auch dem tristen Rhythmus aus Ins-Büro-Gehen und den »schönsten Wochen des Jahres«, wie der Urlaub vielsagend heißt, nicht unterworfen. Ihre Launen, ihre Verschwendung, ihr stets gestillter sexueller Appetit, ihre Fähigkeit, den äußeren Zeichen des Alterns lange zu entkommen, lassen die Reichen in der Phantasie der Nicht-Reichen wie olympische Riesensäuglinge erscheinen, die der grauen Notwendigkeit enthoben sind und noch nicht einmal Opfer und Gebet der gedrückten Menschenschar fordern, weil sie auch von den Massen vollständig unabhängig sind. Wird ihnen ein Land zu unbequem, wechseln sie es mit Leichtigkeit und ohne Reue. Politische Systeme bestimmen das Schicksal der Massen, nicht der Reichen. Ohne die Erde verlassen zu müssen, leben sie jetzt schon wie auf einem anderen Stern.
Um auf diesen Stern zu gelangen, der so greifbar nah an den Wohnstätten der vielen vorbeizieht, muß man sich freilich eine Weile plagen. Und in diesem Zusammenhang kommen auch die Manieren wieder ins Spiel. Die Soziologen haben festgestellt, daß es in dem Dauerwandel der Gesellschaft auch Konstanten gibt. Man glaubt zu sehen, daß die Abkömmlinge »guter« Familien bessere Karrierechancen besitzen. Wo in den früheren Generationen schon einmal Geld war, da komme auch jetzt leichter wieder welches hin. In den früheren Generationen – das war die Zeit, die von den Manieren geprägt war. Manieren haben bedeutet, aus einem Milieu zu stammen, das schon seit eh und je mit Geld versehen oder jedenfalls in der Nähe von großem Geld angesiedelt war, das den Geruch des Geldes schon in der Nase gehabt hatte, das wußte, wie das Geld sich anfühlte und welche Leichtigkeit es verlieh. Die gesamte Leichtigkeit der Manieren war schließlich nichts anderes als die genetische Gewohnheit, vom Geld über die Lebenshindernisse hinweggetragen zu werden.
Es liegt mir fern, über Aufsteiger zu spotten, deren Klugheit und Energie oft genug bewundernswert sind und deren schöpferischer Ehrgeiz die Welt verändert. Aber ich kann nicht anders, als über die Vorstellung zu lächeln, das Erlernen der Manieren sei auf dem Weg nach oben hilfreich. Gewiß, die Welt besteht nicht nur aus Aufsteigern. Dem Aufsteiger begegnen auf seiner gefahrvollen Expedition ans Licht manche »Mitglieder der alten Eliten«, wie Nachkommen des Adels und der vermögenden Bourgeoisie gern f älschlich genannt werden. Adel ist eben gerade keine Elite, er ist nicht das Ergebnis einer »Auswahl«, eines wie immer gearteten Wettstreites, in dem die beste Leistung siegt, sondern Ergebnis von Zucht und Tradition; Elite und Adel stehen nebeneinander, decken sich nur gelegentlich und haben unterschiedliche Funktionen. Diesen »alten Eliten« in Bank- und Industrievorständen und als Inhaber großer Vermögen wird nun eine Schwäche für Manieren nachgesagt; meist haben sie in Wahrheit ein überaus nüchternes Verhältnis dazu und erwarten außerhalb des Familienkreises gar nichts mehr.
Manieren schön und gut – aber welche? Der Aufsteiger hat ein Gerücht gehört, schlimmer als schlechte oder gar keine Manieren seien die falschen. Was ihn seine Eltern gelehrt haben, sind vermutlich die falschen. Ein Gespenst geht um in der klassenlosen Gesellschaft Deutschlands: die Angst, für kleinbürgerlich oder spießig gehalten zu werden. Alles, nur das nicht. Wer sind denn nun diese gefürchteten Kleinbürger, die Klasse, zu der niemand gezählt werden möchte? Wenn man nach einem möglichst grundsätzlichen Maßstab Ausschau halten wollte, könnte man vielleicht sagen: Die Kleinbürger bilden die Klasse, die weder befiehlt noch dient.
Wer diese Definition zuläßt, wird sich womöglich verblüfft die Augen reiben. Gibt es nach ihr eigentlich überhaupt noch etwas anderes als Kleinbürger? Befehls- und Gehorsamsverhältnisse gibt es nur noch beim Militär und in der religiösen Hierarchie; bei den Beamten wird ihr Abbau mit Energie betrieben. Alle übrigen Leistungsverhältnisse sind privatrechtlich oder arbeitsrechtlich geregelt, nach dem Prinzip von gegenseitigen Forderungen aus einem Vertragsverhältnis. Die Lebensformen gleichen sich immer mehr an: die Ein-Kind-Ehe, die Drei-Zimmer-Wohnung, später das Vororthäuschen mit dem Grillplatz im Garten, Büro und Urlaub, schließlich das gepflegte Seniorenstift und ein Grab, das eine Art Wiederholung des längst schon wieder verkauften Vorgartens ist – das sind die Lebensumstände des Elektromonteurs und des Feuilletonredakteurs, des Augenarztes und des Immobilienmaklers, des Prokuristen und des Studienrates.
Das so geführte Leben muß wahrlich kein schlechtes Leben sein; es ist eine Torheit, von interessanteren Lebensumständen größere Höhen und gef ährlichere Tiefen der Empfindung zu erhoffen. In Harar in der äthiopischen Provinz Hararge stand lange noch das schäbige weiße Haus, das der große Rimbaud bewohnte, nachdem es ihm unerträglich gewesen war, in Charleroi über einem Gemüseladen zu leben. Ich habe das Haus in Harar gesehen, bevor ich wußte, welche Gedichte Rimbaud geschrieben hat. Aus einem gewissen Abstand gesehen, ist es beinahe gleichgültig, ob einer mit Waffen oder Gemüse handelt. Nur eines steht fest: Nichts von dem, was Rimbaud in Harar erlebte, kann an das herangekommen sein, was er sah, als er seine Jahreszeit in der Hölle oder auf dem Trunkenen Schiff verbrachte, während er sich kümmerlich in Europa durchschlug.
Dies sei nur vor dem Hintergrund bemerkt, wie schändlich und beschämend der Vorwurf der Kleinbürgerlichkeit in einer Welt empfunden wird, die beinahe vollständig dem kleinbürgerlichen Erscheinungsbild und der kleinbürgerlichen Wirklichkeit entspricht. An diesem Zustand soll und kann nun gar nichts geändert werden; auch der Aufsteiger hat kein anderes Ziel, als das kleinbürgerliche Lebensideal in größerem Rahmen fortzusetzen, falls er nicht durch die Wolkendecke zu den göttlichen Reichen vorstoßen sollte. Es soll nun nur scheinen, als habe ein Schwanenei im Entennest gelegen; der Aufsteiger will sich als von Anfang an anderer Artung und Herkommens darstellen. Wenn er Erfolg hat, wird er die bis dahin gut ausgewachsenen Schwanenflügel ausbreiten und jeder wird sehen, daß er schon von Anfang an für Großes vorgesehen war. Und nun beugt er sich in den schmal bemessenen Mußestunden über Weinführer und studiert Ratgeber für die richtige Lagerung der Zigarren. Er läßt sich in teuren Geschäften von versierten Verkäufern bei der Auswahl der Krawatten beraten – den Typ solcher in den mondänen Gepflogenheiten unterrichteten Verkäufer gab es schon in der Antike; Juvenal nennt sie die »servi culti«, die kultivierten, erzogenen, eleganten Sklaven, die er zu den Plagen der Großstadt Rom zählte. Dann gibt es Bücher, die über Briefformeln unterrichten oder über die »richtige Art« des Briefpapiers, und das Tischdecken und das Vorstellen. Manchmal stellt einer über der Lektüre fest, daß er dies alles sich wohl würde aneignen können, seine Frau aber wohl nicht. Dann muß eine andere Frau her, hübsch wie ein Mannequin, weltläufig wie eine Stewardeß, mit den Fremdsprachenkenntnissen einer Sekretärin mit Auslandserfahrung, geübt im Speisekartenlesen und im Kleider-Einkaufen.
Es ist inzwischen klar, daß dieses Buch ein solcher Führer durch die Manieren nicht sein kann und nicht sein will, und das, obwohl auch in ihm vom Tischdecken und vom Briefeschreiben die Rede ist. Seine Andersartigkeit verdankt dieses Buch einem anderen Blick auf seinen Gegenstand. Was ich zusammengetragen habe, entspricht nur dem, was ich gesehen habe oder was mir von glaubwürdigen Zeugen berichtet worden ist. Meine Fragen waren: Was ist das ästhetische Gesetz der Manieren, wie sie heute in Deutschland anzutreffen sind? Welche Milieus in Deutschland halten Manieren für wichtig? Wieviel Geschichte ist in dem, was an Manieren geübt wird, noch lebendig? Wie verhalten sich die Manieren der Deutschen zu denen in anderen europäischen Ländern?
Keine dieser Fragen bin ich systematisch angegangen, und ich glaube, damit dem Geist meines Themas zu entsprechen, denn die Manieren sind kein System, sie sind logisch nicht erschließbar und sie entziehen sich der exakten Fixierung. Gerade in Deutschland wird es immer wieder vorkommen, daß irgendeine Sitte, die man sicher sistiert zu haben glaubt, andernorts in vergleichbarem Milieu überhaupt nicht bekannt ist oder ganz anders gehandhabt wird. Obwohl ich die europäischen Manieren schon als kleiner Junge kennengelernt habe, ist es ein Blick von außen. Da erscheinen die europäischen Manieren als die weithin auff ällige, weithin strahlende Oberfläche eines großen Massivs aus Geschichte, Traditionen, Glaube und Moral, so wie der Schnee auf einer vielf ältig geformten Berglandschaft liegt und ihre Silhouette teils betont und teils verschleiert. Wer die Manieren der Europäer und insbesondere der Deutschen beschreiben will, muß das Schönheitsideal dieses Kontinents kennen, das für Europa typische Verhältnis von Mann und Frau, die Rolle der Religion, die Geschichte der Stände und aus ihr heraus den Umgang mit der Ungleichheit der Menschen, und das Bild Europas vom geformten, gelungenen Leben. Ideale werden selten verwirklicht oder nie, aber es verrät tiefe Unkenntnis der menschlichen Verhältnisse, sie deshalb nicht ernst zu nehmen, eine Schläue, die den Wert der Dinge nicht ermitteln kann, wenn sie deren Preis nicht kennt. Im Ganzen muß es bei einer Beschreibung der europäischen Manieren viel eher um das Herausbilden eines bestimmten Menschentypus gehen als um die Aufzählung von Regeln; und auch die Regeln, wo sie dennoch aufgezählt werden, sollten stets auf den menschlichen Charakter hin betrachtet werden, den sie verlangen, um ungezwungen ausgeführt zu werden.
Dem Autor konnte freilich nicht verborgen bleiben, daß die historischen, politischen und sozialen Umstände der Herausbildung dem Weiterleben dieses europäischen Typus im letzten Jahrhundert nicht günstig waren und in diesem, gerade angebrochenen, vielleicht noch viel weniger günstig sein werden. Europa befindet sich seit zweihundert Jahren in einem Umbruch, der keineswegs sein Ende erreicht hat. Neue Lebensformen zeichnen sich ab, alte bestehen noch fort. Dem Europäer wird eher auffallen, was sich geändert hat, dem Nicht-Europäer fallen auch die Konstanten auf. Vieles von dem, was dem Europäer untergegangen zu sein scheint, lebt in Wahrheit, manchmal in nicht sofort erkennbarer Form, fort. Man denke auch daran, daß starke Rupturen für die europäische Geschichte charakteristisch sind, ebenso wie Renaissancen.
Damit soll nicht die Hoffnung ausgedrückt werden, daß die Umstände, deren Zeugnis die Manieren sind, wiederkehren. Die Manieren sind ein gegenwärtiges Phänomen, undeutlich sichtbar, aber nicht aus der Welt und, was noch wichtiger ist, nicht aus der Phantasie geschafft. Die Absicht dieses Buches ist ganz ausdrücklich nicht, irgendwelche Regeln zu den Manieren zu verkünden. Einige wenige Leser könnten ihm jedoch die Anregung entnehmen, zu versuchen, eine Person zu sein, zu der Manieren passen, und dann womöglich eigene zu erfinden und alles ganz anders zu machen. Etwas von einer der Schlüsselfiguren der Moderne, dem schon erwähnten Don Quixote, gehört dazu, der ritterlich sein wollte, obwohl es schon lange keine Ritter mehr gab. Und man erinnere sich: Don Quixote hatte Erfolg. Ein »neues goldenes Zeitalter« wollte er für Spanien heraufführen, wie er Sancho Pansa erklärte; und er führte wirklich ein »goldenes Zeitalter« herauf, das zu Recht so genannte siglo de oro der spanischen Kunst, das golden vor allem auch wegen der Narreteien war, die Don Quixote in der Mancha mit erfundenen Damen getrieben hatte.
Die Ehre
Wenn man die Person betrachtet, die Manieren hat und auf die sich alle Betrachtungen über die Manieren notwendig beziehen müssen, kommt man nicht darum herum, auf den einen Begriff einzugehen, der unserer gesellschaftlichen Realität wohl am allerfernsten liegt: die Ehre. Die Ehre scheint endgültig untergegangenen Zeiten anzugehören. Vielleicht ist im Begriff der Ehre am allermeisten von dem enthalten, was uns von der Vergangenheit trennt. Das würde mancher zwar abstreiten. Ist nicht auch heute noch in Verleumdungsprozessen etwa von der Ehre eines Klägers die Rede? Wenn in einem modernen Strafverfahren jedoch einmal die Ehre einer Person ins Spiel gerät, kann man sicher sein, daß es sich nicht um das Institut handelt, das der alteuropäische Ehrenbegriff meinte. Eine Ehre, deren Rechte ein Gericht unter Abwägung anderer Rechtsgüter dem »Ehreninhaber« zugesteht, eingrenzt, für betroffen oder nicht betroffen erklären kann, hat mit dem Begriff der Ehre, der tausend Jahre lang die europäische Welt beherrschte, nichts zu tun. Die Ehre entstammt einer Zeit, in der Kollektive, auch Stände genannt, viel galten, die Zentralgewalt aber wenig. Sie war Ausdruck einer der zahlreichen Paradoxien der ständisch gegliederten Welt: auf der einen Seite forderte sie vom einzelnen Unterordnung und Gehorsam, auf der anderen gebot sie, daß jeder seine Ehre höchstpersönlich mit allen Mitteln zu schützen habe, auch wenn er sich dadurch mit allen Mächten und Gesetzen anlegen mußte und schließlich den kürzeren zog und unterlag. Der alte Begriff der Ehre pflanzte den Samen der Anarchie in die gesellschaftliche und staatliche Ordnung. Lange Zeit war das Duell streng verboten, wer aber nach einer Ehrverletzung der Duellforderung auswich, hatte, als Soldat etwa, eine Entlassung in Unehren zu befürchten.
Das Duell war im übrigen eine streng geregelte Prozedur, auf deren Gesetze wir hier nur deshalb nicht eingehen, weil sie gegenwärtig nicht von praktischem Interesse sind. Die Wahl der Waffen, die Sekundanten, die Überbringung der Forderung, die Distanzen zwischen den Kombattanten waren genau festgelegt. Eine Metzelei sollte ein Duell nicht werden, das »Übers-Schnupftuch-Schießen«, bei dem die Tötung wenigstens eines Duellanten sicher war, war verboten. Auch nach der »Satisfaktionsf ähigkeit« des Herausforderers wurde gefragt, aber es war nicht geraten, sich hinter vermeintlicher »Satisfaktionsunf ähigkeit« zu verstecken.
Die Ehre war der Ausdruck des Glaubens, daß nicht alle Fragen des menschlichen Zusammenlebens staatlich, gesetzlich und gesellschaftlich zu lösen sind. Sie forderte vom einzelnen eine Kampfbereitschaft, die den eigenen Untergang einschloß. Die Ehre führte zu gräßlichen Katastrophen: Väter verstießen oder töteten gar ihre Töchter, Familien führten blutige Kriege gegeneinander, bis sie sich vollständig ausgelöscht hatten. Familienväter schossen sich gegenseitig im Duell tot, oder töteten sich selbst, um der Schande zu entgehen. Die Literatur hat sich vielfach, zwischen Michael Kohlhaas und Effi Briest, solcher Verbrechen »aus verlorener Ehre« angenommen. Wer das Unglück, das aus dem alten Ehrbegriff stammte, in Betracht zieht, wird dem Erlöschen dieses alteuropäischen Ehrgefühls schwerlich nachtrauern können. Und doch muß ich bekennen, daß ich mich an die eigentümliche Zahmheit des gesellschaftlichen Lebens in Europa erst gewöhnen mußte, als ich aus Afrika hierherkam.
Der äthiopische Kaiser führte, wie man gerade auch in Deutschland allgemein wußte, den Titel »Negus Negest« – das heißt »König der Könige«, und mit diesen Königen waren die Stammeskönigreiche gemeint, die zusammen das äthiopische Kaiserreich bildeten, aber auch in einem anderen Sinn paßte dieser Titel nicht schlecht: auch als Herrscher über den Vielvölkerstaat war der Kaiser ein »König der Könige«, weil jeder Untertan, und sei es der ärmste Bauer, sich mit seiner rostigen Flinte in der Hand als König fühlte, als souveräne letzte Instanz in allen Fragen seiner Person und seiner Familie. Man mag es für absurd halten, wenn ein solcher Mann sich unter der Herrschaft eines absoluten Monarchen für frei hielt, aber ich schwöre, daß er das tat. Und ich bin mir nicht so sicher, ob sich der durchschnittliche Europäer mit seinem Wohlstand und seiner Freizügigkeit in seinem tiefsten Innern wirklich genauso frei fühlt, oder ob er sich nicht vielmehr mit tausend Fäden in die gesichtslose gesellschaftliche Maschinerie eingebunden sieht. Die Frage der Ehre jedenfalls hat sich für den Europäer erledigt. Wer gekränkt und verletzt, wer beleidigt und gemobbt wird, muß, sofern diese Verfolgungen so intelligent angelegt sind, daß kein Gesetz verletzt wird, seinen Groll herunterschlucken. Die Unmöglichkeit, die Verletzung der eigenen Ehre zu rächen, schafft übrigens auch die Unmöglichkeit, aus vollem Herzen zu verzeihen. Wird aus dieser Disposition nun ein edlerer Menschentypus entstehen als der ehrenstolze und ehrenverrückte Duellant und Totschläger der Vergangenheit? Diese Frage ist so lange unerheblich, als die Strahlkraft des Begriffs noch nicht vollends erloschen ist, und ich meine, hier, bei manchen Menschen jedenfalls, immer noch eine gewisse Wärme und Faszination zu spüren. Was die alte Ehre auszeichnete, ist in abstracto auch heute noch nachvollziehbar: das starke Bewußtsein, unter einem eigenen, für niemanden als einen selbst geltenden Gesetz zu stehen, für dessen Einhaltung man ganz allein verantwortlich ist. Die heidnischen Römer glaubten, mit jedem Menschen werde zugleich ein Genius geboren, die Geburtsgottheit dieses Menschen, der dann übrigens auch die Ehrung am Geburtstag galt. Die Ehre ist im Grunde nichts anderes als ein solcher Genius: man selbst noch einmal in Überlebensgröße. Der Ehrbewußte sieht durchaus den Abstand, der ihn von diesem überlebensgroßen zweiten Ich trennt; daraus entsteht für ihn eine Spannung, die ihn nicht zur Ruhe kommen läßt. Sich mit dem zufriedenzugeben, »wie man nun einmal sei« – »sich mit all seinen Fehlern und Schwächen annehmen können«, wie das in der Sprache psychologischer Ratgeber gerne heißt –, ist seine Sache nicht. Der Ehrbewußte will wachsen, und dabei geht es ihm nicht darum, der eigenen Größe »noch eine Elle hinzuzufügen«, sondern die eigene Größe überhaupt erst einmal zu erreichen. Es ist bei dieser Verfaßtheit der Person beinahe gleichgültig, mit welchen Werten und Inhalten sich dies Ehrgefühl füllt, wichtig ist nur, daß es unbedingt und von anderen unbeeinflußbar ist. Es ist typisch für den Ehrbewußten, daß es ihn drängt, gewisse Dinge, die ihn womöglich viel kosten, unbezahlt zu tun.
Alle Tätigkeiten von staatstragendem Charakter hatten einstmals unentgeltlich geleistet zu werden. Daß es immer Lumpen gab, die sich dabei dennoch die Taschen zu füllen wußten, liegt auf der Hand, aber es gab immer auch viele, die sich für den Staat als Offiziere, die auf eigene Kosten ihr Regiment ausrüsteten, oder als Botschafter, die auf eigene Kosten für ihren König Pracht entfalteten, ruinierten. Dichter bekamen, wenn sie Glück hatten, ein Ehrengeschenk, aber sie verkauften ihre Dichtung nicht. Ärzte durften gleichfalls keinen Werklohn für ihre Mühe einfordern. Der Hausarzt stellte bis zu Beginn des letzten Jahrhunderts keine Rechnungen, sondern erhielt einmal im Jahr ein Ehrengeschenk, das uns wohlvertraute »Honorar«, und zwar gleichgültig, ob er zu Rate gezogen worden war oder nicht. Natürlich war die Ehre ein Klassenideal, aber das hieß nicht, daß es keine Handwerksehre gegeben hätte, Arbeiten »zünftig« auszuführen, nach den von der Zunft aufgestellten Maßstäben, und nicht betrügerischen Pfusch abzuliefern, der einen höheren Gewinn versprach. Auch die »Ganovenehre« soll nicht vergessen werden, ein Rechts- und Anstandsempfinden mitten im Unrechtlichen und Unanständigen. Nostalgische Kriminalbeamte können davon geradezu rührende Geschichten erzählen; auch die Ganovenehre sei der Globalisierung des Verbrechens geopfert worden.
Im »Ehrenamt« ist von solcher Gesinnung oft noch etwas lebendig. Das Ehrenamt besteht ja darin, daß man für seine Arbeit kein Geld, sondern Ehre erhält. Aber was für eine Ehre soll denn das sein, die der Kassenwart des Gesangsvereins für sein Ämtchen einheimst? Viele werden sich unter dieser Ehre nichts vorstellen können, aber der Kassenwart kann es, auch wenn ihn seine Frau einen Narren nennt, der soviel Zeit an den idiotischen Verein verschwendet. Närrisch sind die Ehrbewußten mehr oder weniger alle. Sie kennen ihren Vorteil nicht, oder besser: sie suchen ihn, wo kein vernünftiger Mensch ihn suchen würde.
Erstaunlicherweise empfinden viele Leute, die sonst nicht hoch von der Ehre denken, welche Orden für den Ausgezeichneten eine Ehre darstellen und welche nicht. Ehre ist etwas Persönliches und kann auch nur von einer Person, nicht von einer Institution vermittelt werden. Eine Ehre auf Mehrheitsbeschluß ist eine sonderbare Ehre. Die ironische Betrachtung der republikanischen Ehrungen und das Prestige, das heute noch Ehrungen aus den Händen eines Monarchen genießen, sind etwas ungerecht, denn die honour’s list der englischen Königin kommt genauso zustande wie die Ordensliste des deutschen Bundespräsidenten, nämlich durch den Parteienproporz und irgendwelche Gef älligkeiten, aber der bloße Unterschied, daß der eine Orden im Namen einer Person und der andere im Namen des Volkes verliehen wird, gibt dem einen Glanz, während, zu meiner Verblüffung, der andere nicht einmal überzeugte Republikaner mit allzu großem Stolz erfüllt. Ich bin davon überzeugt, daß der Nobelpreis einen bedeutenden Teil seines Ansehens aus der Tatsache bezieht, daß man ihn aus den Händen eines regierenden Monarchen empf ängt. Wer kennt schon die Mitglieder der Schwedischen Akademie? Manchmal hört man Unrühmliches über sie, aber so schlecht, daß der Nobelpreis darunter litte, können sich die gelehrten Damen und Herren gar nicht benehmen, solange es zum Schluß der König ist, der den Preis überreicht. Die königsgleichen amerikanischen und französischen Präsidenten können, bei gleichzeitigem Heraufschrauben des nationalistischen Überdrucks übrigens, noch ebensolche als wirklich ehrenvoll empfundene Wirkungen erzielen.
Was hat dies alles nun mit den Manieren zu tun? Sehr viel. Manieren schweben nicht in der Luft wie das Lächeln der Cheshire-Cat aus Alice im Wunderland. Sie sind die Verhaltensweisen von Menschen, und dabei läßt sich feststellen, daß die besonders ehrbewußten Menschen die besten Manieren haben, auch wenn sie in dieser Hinsicht nie unterwiesen worden sind. Manieren scheinen »Ehrensache« zu sein. Es scheint, als ob Menschen mit Ehrgefühl, das, wie gesagt, stets mit einer gewissen Narrheit einhergeht, auch für das Närrische an den Manieren ein natürliches, zwangloses Verständnis haben. So eng verknüpft sind die Ehre und Manieren, daß man sagen könnte, die Manieren seien das Gewand, in das die Ehre sich auf ihren Weg durch die Welt kleidet.
Aufmerksamkeit & Nachlässigkeit
»Et surtout pas de zèle!«
Talleyrand, Anweisung an die Beamten des Außenministeriums
Die folgenden beiden kurzen Überlegungen müßte man eigentlich auf zwei gegenüberliegenden Seiten drucken und versuchen, sie auf einmal zu lesen. Jedes Stück enthält die ganze Wahrheit über einen wichtigen Aspekt der Manieren; beide Wahrheiten werden voneinander nicht relativiert oder geschwächt oder sind irgendwie kunstvoll zu mischen – nein, beide erheben den Anspruch auf vollständige Verwirklichung. Wer das leisten soll, das mag der alte Gurnemanz, der Erzieher des Parzival, oder der noch ältere Zentaur Chiron, der Erzieher des Herkules, wissen.
Die erste Überlegung gilt der Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ist ein derart wichtiger Bestandteil der Manieren, daß man gelegentlich die Begriffe dafür austauscht und einen höflichen Menschen »aufmerksam« nennt. Die Aufmerksamkeit ist keine Regel, die man kennt und einhält oder verletzt; sie gehört zum Fundament der Person. Aufmerksamkeit ist eine Grundhaltung des Menschen der Welt gegenüber. Der Aufmerksame hat sich dazu entschieden, nicht sich selbst, sondern die ihn umgebenden Phänomene zu betrachten, man könnte auch sagen, sich selbst ausschließlich im Spiegel der anderen wahrzunehmen. Der Aufmerksame ist darauf konzentriert, die Lage, in der er sich befindet, zu erkennen. Er blickt die Menschen, die ihm begegnen, an. Diese Menschen sind ihm wichtig. Es gibt keine unwichtigen Menschen und unwichtigen Beobachtungen. Was in der jeweiligen Situation vernachlässigt werden kann, muß zunächst wahrgenommen werden. Auf jeden Fall zu vernachlässigen ist die eigene Person. Sie kennt im Zusammenspiel mit den anderen keine eigenen Bedürfnisse, ist nicht hungrig, nicht durstig, es zieht ihr nicht, sie braucht keinen Stuhl und kein Kissen. Es kommt auf ihr Befinden nicht an; dafür um so mehr auf das Befinden jedes einzelnen Anwesenden.





























