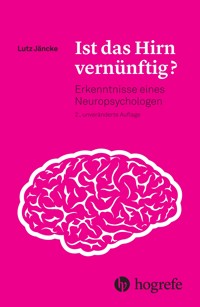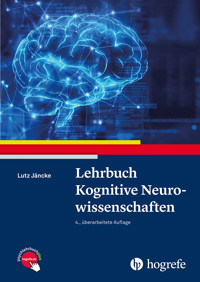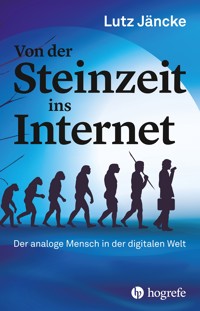24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Existieren zwei Geschlechter oder ist das Geschlechtsspektrum vielfältiger? Gibt es nur zwei Geschlechter, oder sollten wir von einem Geschlechtskontinuum ausgehen? Steuern wir auf ein Unisex-Wesen zu? Wenn Geschlechtsunterschiede im Verhalten und Denken existieren, wo sind sie zu finden? Diese Diskussion wird häufig mit großer Vehemenz, Emotionalität und manchmal auch Aggressivität geführt. Dabei werden vor allem die wissenschaftlichen, insbesondere die naturwissenschaftlichen Perspektiven infrage gestellt. Oft werden biologische Erkenntnisse angezweifelt. In diesem Sachbuch beschäftigt sich der renommierte Neurowissenschaftler Lutz Jäncke mit diesen Fragen. Er legt einen besonderen Fokus auf die bemerkenswerte Lern- und Interpretationsfähigkeit des menschlichen Gehirns. Das Gehirn ist in der Lage, neue Formen des Umgangs der Geschlechter miteinander zu erfinden und das Gefühl zu entwickeln, dass diese vollkommen normal seien. Doch wie weit kann diese Interpretationsfähigkeit gehen? Können wir die Existenz der Geschlechter einfach weginterpretieren? Lutz Jäncke liefert fundierte, klare Antworten – pointiert, mit Witz und Eleganz und stets auf der Grundlage neurowissenschaftlicher Erkenntnisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lutz Jäncke
Mann und Frau – ein Auslaufmodell?
Mann und Frau – ein Auslaufmodell?
Lutz Jäncke
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Psychologie:
Prof. Dr. Guy Bodenmann, Zürich; Prof. Dr. Björn Rasch, Freiburg i. Üe.; Prof. Dr. Astrid Schütz, Bamberg; Prof. Dr. Martina Zemp, Wien
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten.
Verantwortliche Person in der EU: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Merkelstraße 3, 37085 Göttingen, [email protected]
Anregungen und Zuschriften bitte an den Hersteller:
Hogrefe AG
Lektorat Psychologie
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Dr. Susanne Lauri
Bearbeitung: Tobias Gaudin, Gießen
Herstellung: Daniel Berger
Umschlagabbildung: Getty Images/Viacheslav Besputin
Umschlag: Hogrefe Verlag
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Format: EPUB
1. Auflage 2025
© 2025 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96410-2)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76410-8)
ISBN 978-3-456-86410-5
https://doi.org/10.1024/86410-000
Nutzungsbedingungen
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Die Inhalte dürfen nicht zur Entwicklung, zum Training und/oder zur Anreicherung von KI-Systemen, insbesondere von generativen KI-Systemen, verwendet werden. Das Verbot gilt nicht, soweit eine gesetzliche Ausnahme vorliegt.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet umrandete Seitenzahlen (Beispiel: 1) und in einer Seitenliste, die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Inhalt
Der Autor
5Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Von Jägern und Sammlerinnen
1.1 Geschlechtsdimorphismus bei ausgestorbenen Urmenschen
1.2 Geschlechtsspezifisches Verhalten bei Naturvölkern
1.3 Geschlechtsdimorphismus in der Antike
1.4 Zusammenfassung
2 Mann vs. Frau – der biologische Unterschied
2.1 Die Gene
2.2 Die Geschlechtshormone
2.3 Was nun?
2.4 Transgender und Transsexualität
2.5 Zusammenfassung
3 Über die psychische (Un-)Ähnlichkeit von Männern und Frauen
3.1 Die Hypothese der Geschlechterähnlichkeiten
3.2 Die geheimnisvolle Effektgröße zur Messung von Geschlechtsunterschieden
3.3 Kleine, aber bedeutungslose Unterschiede
3.4 Mentale Rotation
3.5 Sind Frauen bessere Multitasker?
3.6 Sind Frauen Quasselstrippen?
3.7 Noch etwas zu mathematischen und verbalen Fähigkeiten
3.8 Sind Männer begabter für herausragende mathematische Leistungen?
3.9 Zusammenfassung
4 Weibliches und männliches Gehirn
4.1 Allgemeines zum Gehirn
4.2 Das plastische Hirn
4.3 Anatomische Geschlechtsunterschiede
4.4 Das Corpus callosum – die Straßen zwischen den Hemisphären
4.5 Vom Schädelvolumen zur Kortex-Oberfläche
4.6 Wer laut ruft, hat trotzdem nicht recht
4.7 Das reifende Gehirn
4.8 Zusammenfassung
5 Feuernde Neurone
5.1 Hormone und Hirnaktivität
5.2 Geschlecht, Lernen und Erfahrung
5.3 Zusammenfassung
6 Das Geschlechtsgleichheits-Paradox
6.1 Ein merkwürdiger Befund?
6.2 Kritik und Erklärungsversuche
6.3 Geschlechtsverteilungen in verschiedenen Berufen
6.4 Zusammenfassung
7 Der interpretierende Mensch
7.1 Eine kleine Geschichte der Unvernunft
7.2 Typische Denkfehler
7.3 Das Gehirn – eine Vorhersagemaschine?
7.4 Zusammenfassung
8 Ich fühle etwas, was du nicht fühlst
8.1 Die Perspektive entscheidet alles
8.2 Passt etwas nicht zusammen, was eigentlich zusammengehört?
8.3 Unbewusste Prozesse
8.4 Gedankenlesen?
8.5 Was hat das mit dem Thema des Buches zu tun?
8.6 Zusammenfassung
9 Über den biologischen Sinn des Lebens und seine Folgen
9.1 Das biologische Geschlecht
9.2 Anziehungskräfte und Triebe
9.3 Werbeverhalten
9.4 Das Zusammenspiel automatischer und langsamer Mechanismen
9.5 Sex im Labor
9.6 Der wichtigste Einfluss des Top-down-Systems
9.7 Zusammenfassung
10 Gegenwart und Zukunft
10.1 Werden die Geschlechter aus unserem Blickwinkel verschwinden?
10.2 Zusammenfassung
11 Thesen dieses Buches
12 Anhang – Gene, Gonaden, Hormone: ein genauerer Blick
12.1 Chromosomenvariationen
12.2 Gonadale Varianten
12.3 Hormonelle Störungen
12.4 Anatomische Varianten
12.5 Kombinationen und seltene Varianten
12.6 Polyzystisches Ovar-Syndrom (PCOS)
12.7 Mikrochimärismus
12.8 Häufigkeit von Intersex-Varianten
12.9 Noch ein Wort zur Publikation von Claire Ainsworth
Literatur
Der Autor
Tabellenverzeichnis
Tabelle 3-1: Typische Geschlechtsunterschiede, wie sie in der Vergangenheit von prominenten Wissenschaftlern propagiert wurden (nach [19])
Tabelle 3-2: Sehr große Geschlechtsunterschiede gemäß der Metaanalyse von Hyde [21]. Die Effektgrößen sind alle > 1,5.
Tabelle 3-3: Große Geschlechtsunterschiede gemäß der Metaanalyse von Hyde [21]. Die Effektgrößen sind alle zwischen > 0,8 und < 0,5.
Tabelle 3-4: Häufigkeitsverhältnis von Jungs/Mädchen von mathematischen Wunderkindern (nach [37])
Tabelle 4-1: Mittlere Kennwerte für Gehirndaten getrennt für Männer und Frauen
Tabelle 4-2: Geschlechtsunterschiede für unterschiedliche Messgrößen des Gehirns. Diese Kennwerte sind unter der Annahme der Normalverteilung mittels geeigneter Programme berechnet worden.
Tabelle 6-1: Anteil von Frauen in verschiedenen Berufsgruppen in Deutschland am 30. Juni 2023 (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte). Aufgeführt sind die fünf Berufe mit dem niedrigsten und dem höchsten Anteil von Frauen.
Tabelle 6-2: Anteil von Frauen und Männern in 30 beliebten Berufen in der Schweiz.
Tabelle 6-3: Rollenmuster bei den abgeschlossenen Lehrverträgen. Prozentualer Anteil von Frauen und Männern der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Jahr 2023 in Deutschland. Aufgeführt sind die Top-5-Berufsgruppen der beiden Geschlechter.
Tabelle 9-1: Zusammenfassung der an der sexuellen Erregung beteiligten Hirngebiete
Tabelle 9-2: Die Dreieckstheorie der Liebe
Tabelle 10-1: Ergebnisse der Gallup-Studie aus dem Jahr 2023 (LGBTQ+ Identity Among U. S. Adults and LGBTQ+ Adults, 2023). Frage: Für welche der folgenden Personen halten Sie sich? Sie können so viele auswählen, wie zutreffen: heterosexuell; lesbisch; schwul; bisexuell; transgender …
Tabelle 10-2: Selbstidentifikation von Amerikanern hinsichtlich ihrer Geschlechtsidentität getrennt für die unterschiedlichen Generationen
Tabelle 12-1: Tabelle aus der Nature-Publikation von Claire Ainsworth*
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
9Vorwort
Eine der kontroversesten aktuellen Debatten in der westlichen Welt betrifft die Frage, ob nur zwei Geschlechter existieren oder ob das Geschlechtsspektrum vielfältiger ist. Diese Diskussion wird oft mit großer Vehemenz, Emotionalität und manchmal auch Aggressivität geführt. In diesen hitzigen Debatten wird deutlich, dass die Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Ansichten zutiefst von ihren Überzeugungen geprägt sind. Aber weshalb ist dies der Fall?
Es scheint, als ob die Diskussion nicht nur wissenschaftliche und biologische Aspekte berührt, sondern auch tief verwurzelte soziale und kulturelle Werte und Normen. In vielen Gesellschaften sind Geschlechtsrollen und -identitäten fest etabliert und eng mit persönlichen sowie kollektiven Identitäten verknüpft. Jede Herausforderung dieser etablierten Normen kann daher als bedrohlich empfunden werden und intensive Reaktionen hervorrufen. Zudem spiegelt die Debatte über die Anzahl der Geschlechter auch den breiteren gesellschaftlichen Kampf um Inklusion, Anerkennung und Gleichberechtigung wider. Es handelt sich hierbei nicht nur um eine theoretische Diskussion, sondern um eine, die das Leben und die Identität vieler Menschen direkt beeinflusst.
Bei diesen Kontroversen sind auch die wissenschaftlichen und vor allem die naturwissenschaftlichen Perspektiven herausgefordert. Wieso werden die biologischen Erkenntnisse oft angezweifelt? Gibt es zwei Geschlechter oder müssen wir von einem Geschlechtskontinuum ausgehen? Ist die Biologie unwichtig und zu vernachlässigen? Sind wir auf dem Wege zu einem Unisex-Wesen?
Es besteht kein Zweifel, dass sich biologische Männer und Frauen hinsichtlich vieler morphologischer und physiologischer Aspekte unterscheiden. Allein schon die unterschiedlichen genetischen Voraussetzungen sind bis auf wenige Ausnahmen eindeutig. Sie bestimmen im Wesentlichen Körperbau, Aussehen, Hormonkonzentrationen und viele physiologische Vorgänge.
Dass diese genetischen Voraussetzungen und Unterschiede auch das Denken, Verhalten und Empfinden grundsätzlich bestimmen, wird 10von Traditionalisten als vollkommen logisch vorausgesetzt. Herkömmliche Sichtweisen scheinen in der Tat zu bestätigen, dass sich Frauen im Durchschnitt von Männern im Sozialverhalten, bei Denkprozessen, beim Multitasking und bei vielen Kognitionen deutlich unterscheiden. Oft werden auch Unterschiede zwischen den Gehirnen von Frauen und Männern berichtet, die als eine weitere Erklärungsgrundlage für das unterschiedliche Verhalten von Männern und Frauen herangezogen werden. Befeuert werden diese Erklärungsansätze durch Weltbestseller wie die Bücher von Pease und Pease [1, 2, 3, 4] oder auch Brizendine [5, 6]. Diese Bücher landen unter Weihnachtsbäumen und werden gerne gelesen, um tief verwurzelte Ansichten über Geschlechtsunterschiede bestätigen zu lassen.
Bemerkenswert ist, dass diese Bücher, die fundamentale Unterschiede zwischen Männern und Frauen konstatieren, einen derart großen Absatzmarkt finden. Und das in einer Zeit, in der unsere Gesellschaft alles Mögliche unternimmt, die vermeintliche Kluft zwischen den Geschlechtern zu überwinden. Offenbar scheint uns die Frage zu faszinieren, ob Geschlechtsunterschiede im Verhalten, Fühlen und Denken wirklich existieren. Man könnte auch vermuten, dass uns die „kleine Ungleichheit“ zwischen Männern und Frauen derart fesselt, dass wir uns unbewusst und automatisch mit diesen Fragen beschäftigen. Wahrscheinlich ist kaum etwas im menschlichen Zusammenleben so interessant wie der Umgang der Geschlechter miteinander. Wirkt hier vielleicht eine bis jetzt nicht gänzlich verstandene biologische Kraft?
Wenn Geschlechtsunterschiede im Verhalten und Denken existieren, wo sind sie zu finden? Das ist eine Frage, die ich in diesem Buch zu beantworten versuche. Ich betrachte den Geschlechtsunterschied, aber auch die modernen Varianten der Geschlechtsauffassung (trans, queer, non-binär etc.) aus der Perspektive eines Neurowissenschaftlers, der sich über viele Jahrzehnte mit dem menschlichen Gehirn und dessen Bedeutung für das Verhalten beschäftigt hat. Diese Position ist zwar neurobiologisch fundiert, unterscheidet sich aber massiv von Positionen, die Tierforscher einnehmen. Im Tierreich sind die Rollen der Geschlechter eindeutiger definiert als beim Menschen. Deswegen ist die Übertragbarkeit von Tierbefunden auf den Menschen nicht immer hilfreich.
11Obwohl der Mensch ein Tier ist, das viele Gemeinsamkeiten mit seinen nächsten Verwandten, den Affen, teilt, ist sein Gehirn speziell und einzigartig. Dieses fantastische Organ mit seinen über 80 Milliarden Nervenzellen ermöglicht dem Menschen besondere Fähigkeiten. Dadurch verfügt er nicht nur über eine (im Vergleich zu den anderen Tieren) herausragende Intelligenz. Mit dieser Zunahme geistiger Fähigkeiten vergrößerten sich auch seine Vorstellungskraft, Kreativität und Individualität. In diesem Zusammenhang entwickelte der Mensch Kulturen und Vorstellungen über die Welt und das Miteinander der Menschen in seiner Umgebung. Kein anderes Tier auf dieser Welt ist in der Lage, solch differenzierte Kulturen zu entwickeln, genauer gesagt zu erfinden.
Mit dieser besonderen Intelligenz und Kreativität sind allerdings auch vermeintliche Probleme verbunden. Wie passt sich ein Mensch, der eigentlich per Zufall in eine spezifische Kultur hineingeboren wird, so an, dass er in dieser Kultur überlebt? Dazu hat uns die Natur ein plastisches, also anpassungsfähiges, Gehirn geschenkt. Dieses Organ ermöglicht uns, uns in jedwede Kultur hineinzulernen, mag sie aus verschiedenen Perspektiven betrachtet auch noch so speziell, kurios oder gar abstrus sein. Das ultimative biologische Ziel des Menschen ist das Überleben. Um dies zu gewährleisten, müssen Neugeborene über die Fähigkeit verfügen, sich problemlos in Kulturen und Regelsysteme hineinzulernen.
Dieser Mechanismus ist für die aktuelle Debatte über Geschlechterfragen von herausragender Bedeutung. Wir können nicht nur neue Regelsysteme erdenken und etablieren, sondern wir können sie auch so verinnerlichen, dass wir ihnen unbewusst folgen. Sie bestimmen gewissermaßen „im Hintergrund“ unser Denken, Handeln und Fühlen. Das Gehirn kann demzufolge auch neue Umgangsformen der Geschlechter miteinander erfinden und das Gefühl entwickeln, diese wären vollkommen normal. Aber wie weit kann diese Interpretationsneigung gehen? Können wir die Existenz der Geschlechter einfach weginterpretieren? Wie funktionierten dann die Fortpflanzung und Aufzucht der Nachkommen?
In diesem Buch beschäftige ich mich in 11 Kapiteln mit Geschlechtsunterschieden, wobei ich sie biologisch und vor allem neurowissenschaftlich erkläre. Dabei fokussiere ich mich auch auf die bemerkens12werte Lern- und Interpretationsneigung des menschlichen Gehirns. Dessen besonderen Eigenschaften beeinflussen unsere Selbstwahrnehmung und damit auch die Art und Weise, wie wir uns in das Geschlechtsspektrum einsortieren.
Ich hoffe, Sie finden beim Lesen dieses Buches nicht nur interessante und neurowissenschaftlich fundierte Erkenntnisse im Hinblick auf Geschlechtsunterschiede beim modernen Menschen, sondern entwickeln auch ein wenig Freude oder Unterhaltung. Ich wünsche Ihnen eine anregende innere Diskussion über dieses interessante Thema.
Lutz Jäncke
Zürich im Februar 2025
131 Von Jägern und Sammlerinnen
„Je weiter man zurückblicken kann, desto weiter wird man vorausschauen.“ Winston Churchill 1
Die Männer waren Jäger und die Frauen Sammlerinnen. So oder so ähnlich stellen wir uns vor, wie unsere Vorfahren in der Steinzeit2 lebten. Männer mussten mutig sein, sich auf die gefährliche Jagd begeben und dort Erfolg haben. Frauen verharrten im Camp und bewältigten dort andere Aufgaben. Männer waren gezwungen, sich in ungewohnten Gegenden zu orientieren, Strapazen zu überwinden, Mut zu beweisen, Speere zu werfen und sich in den Jagdgruppen zu bewähren. Frauen mussten sich um die Nachkommen kümmern, Essen zubereiten, geschickt mit den Gruppenmitgliedern umgehen und wichtige Aufgaben für den Clan organisieren. Dieser Blick auf das steinzeitliche Leben vor vielen 10.000 Jahren wird gerne als Anlass genommen, vermeintliche Geschlechtsunterschiede im Denken, Fühlen und Verhalten in der heutigen Zeit zu erklären.
Die Grundidee dieser Jäger-Sammlerinnen-Hypothese ist, dass sich im Zuge der Evolution Geschlechterrollen biologisch – also genetisch – im Verhaltensrepertoire der Menschen verankert hätten, die noch heute Geschlechtsunterschiede weitestgehend bestimmen würden. Frauen sollen deshalb genetisch für die Kommunikation mit Gruppenmitgliedern vorbereitet sein. Sie wären aus dem gleichen Grund auch den Männern bei der Aufzucht und Pflege der Kinder, im sozialen Umgang und bei der Empathie überlegen. Männer würden hingegen zu mehr Mut, Aggressivität und Risikobereitschaft vorprogrammiert sein. Auch 14müssten sie sich besser in der meist fremden Umgebung orientieren können, um die Jagd und die Rückkehr zum Camp zu gewährleisten.
Kann diese Sichtweise wirklich herangezogen werden, um das aktuelle Verhalten von Männern und Frauen zu erklären und zu verstehen? Erklärt sie, warum Jungs lieber mit Spielzeugautos spielen und Mädchen mit Puppen? Welche Erkenntnisse existieren, um diese Sicht auf die vermeintlichen Geschlechterrollen des Urzeitmenschen zu rechtfertigen? Mit diesen und ähnlichen Fragen werde ich mich im Folgenden beschäftigen.
1.1 Geschlechtsdimorphismus bei ausgestorbenen Urmenschen
„Geschlechtsdimorphismus“ ist ein etwas holpriger Begriff. Er wird in der Biologie benutzt, um Unterschiede zwischen den Geschlechtern innerhalb einer Art zu beschreiben. Diese Unterschiede können verschiedene Formen annehmen, einschließlich physischer Merkmale, Verhaltensweisen und Reproduktionsstrategien. Ich werde diesen Begriff noch häufiger verwenden.
Kannten die Urmenschen bereits eine Arbeitsteilung der Geschlechter? Verhielten sich Männer und Frauen, Jungs und Mädchen geschlechtsspezifisch? Genau genommen wissen wir nicht viel darüber, wie die Urmenschen gelebt haben. Wir verfügen kaum über Informationen über eventuelle Geschlechtertrennungen bei den ausgestorbenen Urzeitmenschen. Erst mit den ersten schriftlichen Zeugnissen über die Lebensform des modernen Menschen gewinnen wir mehr Einblicke in das Verhalten von Männern und Frauen. Vor diesen schriftlichen Zeugnissen müssen wir uns auf archäologische und fossile Funde verlassen, die vielleicht Indizien für unterschiedliche Geschlechterrollen liefern.3
15So liefern Untersuchungen von Skeletten Aufschlüsse über Geschlechtsunterschiede in Bezug auf Körperbau und Muskulatur. Diese lassen Rückschlüsse auf unterschiedliche körperliche Aktivitäten zu. Größere, kräftigere Skelette weisen auf Individuen hin, die möglicherweise anstrengendere Tätigkeiten ausführten, während kleinere, feinere Knochenstrukturen auf weniger physische Beanspruchung hindeuten könnten. Größere und kräftigere Körper sind wahrscheinlich auch imposanter und fördern die Dominanz in den Gruppen. Individuen mit mehr Kraft sind bei sozialen Auseinandersetzungen häufiger siegreich und bei der Jagd auch erfolgreicher, was ihre Stellung innerhalb der Gruppe günstig beeinflussen könnte.
Die Art und Weise, wie Individuen bestattet wurden, inklusive der Gegenstände, die ihnen ins Grab gelegt wurden, liefern weitere Hinweise auf ihren sozialen Status und ihre Rollen in der Gemeinschaft. So könnten etwa Waffen und Jagdwerkzeuge, die mit männlichen Skeletten gefunden wurden, darauf hinweisen, dass Jagd eine männliche Domäne war. Viele Gräber aus der Jungsteinzeit zeigen Geschlechterunterschiede in den Beigaben, mit Werkzeugen und Waffen, die häufig in männlichen Gräbern gefunden wurden, und Haushalts- oder Schmuckgegenständen in weiblichen Gräbern.
Neue archäologische Funde lassen vermuten, dass auch die Damen wie die Männer an der Jagd teilnahmen. Eine kürzlich publizierte Arbeit offenbarte, dass bereits in 9000 Jahre alten Gräbern in Südamerika Frauenskelette gefunden wurden, die mit Steinzeitwerkzeugen bestattet wurden, die man auch für Großwildjagd benötigt hat [10]. Andere Arbeiten lassen vermuten, dass Frauen in Jäger-Sammler-Kulturen bereits vor etwa 12.000 Jahren sogar zwischen 30 und 50 % der prähistorischen Großwildjäger ausmachten [11]. Das klassische Bild des jagenden Mannes und der sammelnden Frau ist offenbar korrekturbedürftig.
Trotzdem: Das meiste, was aus archäologischen und fossilen Befunden bezüglich unterschiedlicher Geschlechterrollen abgeleitet wird, ist (noch) spekulativ. Da wenig strapazierfähige Datenquellen vorliegen, helfen gegebenenfalls auch theoretische Überlegungen wei16ter, um sich die mögliche Arbeitsteilung bei den Menschen zu erklären. Anhand der Analyse stabiler Isotope in Neandertalerskeletten kann man erschließen, dass pflanzliche Nahrungsmittel bei den Neandertalern nur eine geringe Bedeutung für die Ernährung hatten.4 Sie haben vorrangig Tiere gejagt, um sich von deren Fleisch zu ernähren. Insofern ist eine geschlechtstypische Ernährungsversorgung bei den Neandertalern eher unwahrscheinlich. Deshalb vermuten einflussreiche Anthropologen, dass bei den Neandertalern lediglich eine geringfügige geschlechtliche Arbeitsteilung praktiziert wurde. Neandertalerfrauen haben wahrscheinlich ebenso wie Neandertalermänner an Jagden teilgenommen; aber genau weiß man es nicht. Vermutet wird, dass sich erst ab dem Homo sapiens (also vor gut 70.000–150.000 Jahren) die auch bei heutigen Jägern und Sammlern vermuteten Formen geschlechtlicher Arbeitsteilung etabliert haben. Vielleicht könnte dies zu einem Selektionsvorteil des Homo sapiens gegenüber dem Neandertaler geführt haben.
Es sind also einige Anzeichen für Arbeitsteilungen zwischen den Geschlechtern vermutbar, aber nicht belegt. Möglicherweise waren Frauen für körperlich anspruchsvolle Varianten der Jagd weniger geeignet als Männer. Ein weiterer Aspekt ist das mit der Großwildjagd verbundene Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, mit leeren Händen heimzukommen, ist recht hoch, und die Jagd ist in der Regel mit tagelangen Streifzügen fern des Heimatcamps verbunden. Zudem ist die Gefahr beträchtlich, bei der Jagd ernsthaft und sogar lebensbedrohend verletzt zu werden. Sammeln und Kleintierjagd sind dagegen weitaus risikoarmer, und man bewegt sich während dieser Beschäftigungen näher am Basiscamp. Die Arbeit kann auch jederzeit unterbrochen werden. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, einen guten Ertrag zu erzielen, beim Sammeln und Jagen von Kleintieren weitaus höher. Diese Unterschiede lassen es sehr wahrscheinlich erscheinen, dass Frauen aufgrund der Sorge für die Aufzucht von Nachkommen eher das Sammeln plus Kleintierjagd wählen. Zudem wäre eine Großwildjagd für eine 17Mutter, die ein Baby zu versorgen hat, oder für eine schwangere Frau zu gefährlich, vorwiegend für das Leben des Nachwuchses. Dafür spricht auch, dass in extremen und nahezu lebensfeindlichen Lebensumwelten die geschlechtliche Arbeitsteilung sogar extreme Formen annehmen kann. So zum Beispiel bei arktischen Jägergesellschaften, bei denen fast ausschließlich Männer die Jagd bestreiten, während Frauen und Kinder sich kaum an der Nahrungsbeschaffung beteiligen. Je reicher und lebensfreundlicher die Lebensumwelten werden, desto geringer ist die Ausprägung geschlechtlicher Arbeitsteilung [12, 13].
Aber Vorsicht: In den neuen Publikationen zu diesem Thema wird sogar vermutet, dass Frauen in der Steinzeit gejagt haben könnten, obwohl sie schwanger waren oder gegebenenfalls sogar ihre Kinder dabeihatten [11]. Möglich wäre es, aber wir wissen es nicht genau. Wie auch immer, in vielen Köpfen fügen sich immer noch traditionelle Überlegungen zu einer einprägsamen Geschichte zusammen:
Männer streifen durch den Wald, jagen nach wilden Tieren, kämpfen mit Widersachern, verteidigen ihre Familie und starren abends schweigend und dumpf ins Lagerfeuer. Frauen sitzen in der Höhle, verwöhnen ihre Kinder und sammeln gelegentlich in der Nähe des Camps Beeren, Pilze und Kleintiere. Dabei reden sie viel, sind sozial geschickt und vor allem zurückhaltend und weniger aggressiv als Männer.
Kann diese Vorstellung vermeintliche Geschlechtsunterschiede im Verhalten erklären? Wir tragen immer noch die Gene aus dieser Zeit in uns. Männer, die damals weite Strecken zurücklegten, hätten sich demnach ein ausgeprägtes Orientierungsvermögen angeeignet, während Frauen das nicht so sehr benötigten. Dank der Jagd, von der Frauen angeblich ausgeschlossen waren, hätten Männer außerdem die Fähigkeit zur mentalen Rotation entwickelt. Und die Emotionen? Tja, die haben Männer angeblich einfach an ihre Frauen abgegeben und leiden deshalb heute an einem emotionalen Defizit.
Noch ein Wort zur vermeintlichen Dominanz der Urzeitmänner. Körpergröße, Kraft und Jagderfolg sind sicherlich nicht die einzigen Eigenschaften, aus denen sich Dominanz in der Gruppe ableiten lässt. Wir vergessen bei der Steinzeitbetrachtung oft die Intelligenz, die ja mit dem größer gewordenen Gehirn auch beim Urzeitmenschen Einzug gehalten hat. Nicht alle Urmenschen waren kleine Einsteins; aber da und dort blühte sicherlich ein cleveres Kerlchen mit schmächtigem 18Körperbau oder eine clevere und zarte Steinzeitdame. Es ist denkbar, dass sie die heimlichen Führer der Gruppe waren. Vielleicht nicht in der ersten Reihe, sondern als graue Eminenzen, die in der zweiten und dritten Reihe Entscheidungen elegant vorbereiteten. Die gefährlichen Rangordnungskämpfe und alles Weitere, was körperlichen Einsatz vonnöten mache, hätten sie den kräftigeren und vermeintlich dominanteren Männern übriggelassen. Das verspricht ein gefahrloses, aber gleichwohl erfolgreiches Leben. Also: Kraft ist nicht alles. Intelligenz und Raffinesse sind nicht an Körpergröße und Kraft gebunden.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ohne direkte Beobachtung des Verhaltens und ohne schriftliche Aufzeichnungen oder bildliche Darstellungen alle Annahmen über die Geschlechterrollen und Sozialstrukturen von Hominiden hypothetisch bleiben.
1.2 Geschlechtsspezifisches Verhalten bei Naturvölkern
Geschlechtsspezifische Verhaltensweisen und Geschlechtertrennungen sind in verschiedenen Kulturen und Naturvölkern weltweit zu beobachten. Die spezifischen Rollen und Erwartungen variieren allerdings. Bei vielen indigenen Völkern, wie den San der Kalahari oder den Ureinwohnern Australiens, ist die Jagd traditionell eine Domäne der Männer, während Frauen oft das Sammeln von Nahrungsmitteln wie Früchten und Wurzeln übernehmen. In vielen Kulturen sind Frauen für die Aufzucht der Kinder, das Kochen und andere häusliche Tätigkeiten verantwortlich, während Männer sich um Außenarbeiten wie den Bau von Häusern oder die Bewirtschaftung von Land kümmern. Geschlechtertrennung findet man auch in spirituellen Rollen. Bei einigen indigenen nordamerikanischen Stämmen werden bestimmte Zeremonien nur von Männern oder ausschließlich von Frauen durchgeführt. In manchen Kulturen sind bestimmte Handwerke oder Kunstformen geschlechtsspezifisch. Beispielsweise ist das Weben in vielen südamerikanischen Kulturen eine Aufgabe, die traditionell von Frauen ausgeführt wird. In einigen Gesellschaften haben Männer eher Zugang zu formaler Bildung, während Frauen in ihren Bildungsmöglichkeiten eingeschränkt sind und eher informell zu Hause erzogen werden. In vielen 19traditionellen Gesellschaften üben Männer die politische Macht aus und treffen Gemeinschaftsentscheidungen, während Frauen manchmal separate Einflussbereiche haben, die sich oft auf Familie und Haushalt konzentrieren. Geschlechtsspezifische Kleidung und Schmuck können ebenfalls eine Rolle spielen und sind oft kulturell stark codiert. Beispiele sind die Kilt-ähnlichen Dhotis, die von Männern in Teilen Indiens getragen werden, oder die ausgiebig verzierten Kleider, die von Frauen bei vielen afrikanischen Stämmen getragen werden.
Diese Rollen und Trennungen sind tief in den Traditionen und der sozialen Struktur der jeweiligen Kulturen verwurzelt. Es ist wichtig zu beachten, dass es auch innerhalb dieser Gesellschaften Variabilität und Überschneidungen gibt und dass viele Gemeinschaften zunehmend Einflüsse von außen aufnehmen und ihre sozialen Strukturen ändern.
In Naturvölkern mit geringem Kontakt zur modernen zivilisierten Welt findet man gehäuft ein bestimmtes Grundmuster der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern: Männer jagen große oder gefährliche Beutetiere, während Frauen und Kinder in erster Linie vegetarische Nahrung sammeln oder kleine, weniger gefährliche Tiere jagen oder fischen. In einigen Gesellschaften praktizieren beide Geschlechter die Jagd, während einige wenige Gesellschaften bekannt sind, in denen ausschließlich Frauen jagen. Es konnte auch gezeigt werden, dass die Übergänge zwischen den Geschlechtern bezüglich des Jagens und Sammelns variabel sein können [11]: Auch Männer, die normalerweise jagen, sammeln gelegentlich Nahrung, während Frauen Kleintiere jagen und sich sogar an den Jagden der Männer beteiligen. Oft wird das Jagdverhalten durch die Muskelkraft bestimmt oder zumindest beeinflusst. Männer jagen oft mit Speeren, die sie mit großer Kraft und Geschick auf ihre Beute schleudern.
Es sind auch Berichte von Naturvölkern bekannt, wonach keine strikte Trennung zwischen den Geschlechtern im Hinblick auf die Nahrungsbeschaffung zu finden sind. Beispiele hierfür sind die !Kung im südlichen Afrika. Hier betreiben die Männer überwiegend Großtierjagd. Sie sammeln allerdings auch häufig pflanzliche Nahrung und jagen Kleintiere. In anderen Kulturen findet man eine deutliche Beteiligung von Frauen an der Jagd (zum Beispiel bei tropischen Netzjägern wie den Efe, Lese und Bambuti im zentralafrikanischen Regenwald, den Bison-Jägern in den nordamerikanischen Plains oder den arkti20schen Rentierjägern). Hier beteiligen sich Frauen vorrangig als Treiberinnen. Bei den Aka-Pygmäen in Zentralafrika teilen Männer und Frauen traditionell die Verantwortung für die Jagd und die Erziehung der Kinder. Frauen haben einen hohen sozialen Status und eine starke Rolle in der Gemeinschaft.
Es existieren auch Gesellschaften, in denen Frauen eine dominantere Rolle in der sozialen Struktur einnehmen. Diese „matrilinearen“ Gesellschaften5 sind allerdings relativ selten. Beispiele hierfür sind die Mosuo in China, die Khasi in Indien, die Minangkabau in Indonesien und die Bribri in Costa Rica. In diesen Gesellschaften werden das Eigentum und der Familienname über die weibliche Linie weitergegeben. Männer haben in diesen Gesellschaften wichtige politische und soziale Funktionen, die aber vollkommen anders als in patrilinealen Gesellschaften sind. In diesen matrilinearen Gesellschaften sind Männer oft religiöse oder politische Führer, übernehmen die wirtschaftliche Verantwortung der Gesellschaft und üben beratende sowie unterstützende Funktionen aus. Sie leben normalerweise im Haus ihrer Mütter oder Schwestern und sind in die Erziehung der Kinder involviert, auch wenn diese Kinder ihrer mütterlichen Linie angehören.
Das „Paarungsverhalten“ und die sozialen Bindungen zwischen den Geschlechtern werden in diesen Gesellschaften von kulturellen Normen und sozialen Regeln geleitet, die sich von westlichen Vorstellungen teilweise massiv unterscheiden. Die Mosuo-Gesellschaft praktiziert das sogenannte „Walking Marriage“ (Zou Hun). Frauen können männliche Partner in ihr Zimmer zum sexuellen Verkehr einladen. Die Männer verbringen allerdings nicht den ganzen Tag im Zimmer der Frau und kehren oft zu ihrem mütterlichen Haushalt zurück. Diese Art der Beziehung unterstreicht die Unabhängigkeit von Frauen innerhalb der Mosuo-Gesellschaft und vermeidet womöglich den Aufbau patriarchaler Strukturen. Die Minangkabau folgen islamischen Ehegesetzen, die monogame oder polygyne (ein Mann mit mehreren Frauen) Ehen erlauben, aber nicht Promiskuität im westlichen Sinne fördern. Ihre matrilineare Struktur gibt Frauen beträchtliche Kontrolle über Eigentum und Erbschaft, was auch ihre soziale Position innerhalb der Ehe beeinflusst. In der Khasi-Gesellschaft existieren auch Ehen. Es 21gibt allerdings wenig Informationen über das Paarungsverhalten in dieser Gesellschaft.
Diese Gesellschaften haben Systeme entwickelt, in denen Frauen in Bezug auf Erbe, Haushaltsführung und soziale Organisation eine zentrale Rolle spielen. Es ist jedoch wichtig, zwischen „matriarchalen“ und „matrilinearen“ Gesellschaften zu unterscheiden. Während matrilineare Systeme das Erbe und die Abstammung über die Mutterlinie definieren, sind matriarchale Systeme solche, in denen Frauen eine dominante Position in der politischen Macht und Autorität einnehmen. Echte matriarchale Gesellschaften sind in der anthropologischen Forschung umstritten und schwer zu definieren, da die meisten bekannten Gesellschaften eine gewisse Form der Geschlechterkooperation aufweisen, auch wenn Frauen eine zentrale Rolle in der Gesellschaft spielen.
Also man merke: Streng genommen existieren keine matriarchalen Gesellschaftssysteme.
Offenbar ist der Mythos der Amazonen eine Erfindung des Menschen, gleichwohl eine faszinierende. Die Amazonen wurden traditionell als eine Gesellschaft von Kriegerinnen dargestellt, die in der Region des heutigen Nordostens der Türkei oder in der Umgebung des Schwarzen Meeres gelebt haben sollen. Sie wurden als mutige und geschickte Kämpferinnen beschrieben, die ohne Männer lebten und ein Leben unabhängig von ihnen führten. Der Mythos der Amazonen enthält verschiedene Geschichten und Abenteuer, darunter auch Begegnungen mit berühmten griechischen Helden wie Herakles und Theseus. In einigen Versionen der Mythen werden Amazonen als Verbündete oder Gegner dieser Helden dargestellt. Obwohl sie in verschiedenen antiken Texten erwähnt werden, gibt es keine historischen Beweise für die Existenz einer solchen Gesellschaft von kriegerischen und dominanten Frauen wie den Amazonen. Stattdessen repräsentieren sie in der griechischen Kultur die faszinierende (vielleicht sogar prickelnde) Idee einer Kombination von Weiblichkeit und Macht. In der Literatur und Kunst wird diese Idee gerne als Symbol für starke und unabhängige Frauen verwendet. Comics, Filme, Bücher und Videospiele haben die Amazonen als Figuren aktuell wiederbelebt. Zum Beispiel sind die Amazonen ein wichtiger Bestandteil des DC-Comics-Universums, insbesondere in Gestalt der Figur Wonder Woman.
221.3 Geschlechtsdimorphismus in der Antike
Erst mit der Entwicklung der Schrift konnten die Menschen ihre Gedanken, Gefühle, aber auch Lebenserfahrungen für die Nachwelt festhalten. Diese schriftlichen Zeugnisse liefern uns weitere Informationen über geschlechtsspezifische Unterschiede bei Menschen. Die Entwicklung der Schriftsprache begann vor etwa 5000 bis 6000 Jahren. Die ersten allgemein anerkannten Schriftsysteme entstanden um das 4. Jahrtausend v. Chr. in Stadtstaaten. Die ältesten bekannten Schriften sind die altägyptischen Hieroglyphen aus dem Königsfriedhof von Abydos, datiert auf 3320 bis 3150 v. Chr., sowie die sumerische Keilschrift aus Mesopotamien, die etwa auf 2600 v. Chr. zurückgeht. Diese frühen Schriftsysteme wurden zunächst für die Buchführung und Verwaltung verwendet. Das weist darauf hin, dass die Entwicklung der Schrift eng mit der Entstehung komplexer Gesellschaften und der Notwendigkeit verbunden war, Transaktionen und Ereignisse dauerhaft festzuhalten.
Mit dem Aufkommen der Schrift wurden religiöse Ideen und Mythen schriftlich festgehalten. Aus diesen Schriften geht eindeutig hervor, dass in antiken Gesellschaften Geschlechtsunterschiede und Geschlechterrollen zentrale Elemente waren. Männer wurden oft als Krieger, Jäger und politische Führer dargestellt, während Frauen häufig die Rolle von Müttern, Hausfrauen und fürsorglichen Familienmitgliedern einnahmen. In der griechischen Mythologie zum Beispiel gab es eine Vielzahl von Göttinnen wie Hera, Athene und Aphrodite sowie Götter wie Zeus, Poseidon und Apollo, die unterschiedliche Aspekte der Geschlechter repräsentierten. Schöpfungsmythen in verschiedenen Kulturen betonten oft Geschlechtsunterschiede. Ein bekanntes Beispiel ist die biblische Schöpfungsgeschichte, in der Gott Adam zuerst erschuf und dann Eva aus seiner Rippe formte. Geschlechtssymbole, wie der Phallus als männliches Symbol und die Vulva als weibliches Symbol, waren in vielen Kulturen präsent und repräsentierten die Fruchtbarkeit und Macht der Geschlechter. Antike Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität unterschieden sich oft von den heutigen. Einige Kulturen tolerierten Homosexualität und Bisexualität, während andere strenge Heteronormativität praktizierten. Rituale und Kulte hatten oft geschlechtsspezifische Elemente und konnten Initiationen, 23Opfergaben und spezielle Verehrungspraktiken umfassen. In vielen antiken Gesellschaften existierten klare Geschlechterhierarchien, in denen Männer eine höhere soziale und politische Position als Frauen einnahmen. Einige Kulturen betonten die Verehrung der weiblichen Gottheit, wie die Verehrung der Muttergöttin, um die Bedeutung von Weiblichkeit und Fruchtbarkeit hervorzuheben. Geschlechtsbezogene Kleidung und Symbole waren ebenfalls wichtig, um die Geschlechtsidentität zu betonen und soziale Normen zu festigen.
Es ist wichtig, zu betonen, dass Geschlechtsvorstellungen in der Antike äußerst vielfältig waren und stark von Kultur zu Kultur und im Laufe der Zeit variierten. Es gab keine einheitliche Darstellung von Geschlecht in der Antike, sondern eine breite Palette von Vorstellungen und Praktiken, die in den verschiedenen Kulturen existierten.
1.4 Zusammenfassung
Die Jäger-Sammlerinnen-Hypothese besagt, dass Männer und Frauen im Laufe der Evolution spezifische Rollen einnehmen. So sollen in der Steinzeit Männer Jäger und Frauen Sammlerinnen gewesen sein.
Grundlage dieser Hypothese ist, dass Männer kräftiger und dominanter waren. Frauen waren dagegen graziler und weniger kräftig.
Den Männern werden im Zusammenhang mit dieser Hypothese gerne folgende Eigenschaften zugeordnet, die biologisch, also genetisch verankert sein sollen: Mut, Aggressivität, Risikobereitschaft und Orientierungsfähigkeit.
Frauen werden in diesem Zusammenhang folgende Eigenschaften zugeordnet: Kommunikationsfähigkeit, Kinderpflege, Gruppenfähigkeit und stärker ausgeprägte Emotionalität.
Kann dieses steinzeitliche Rollenbild heutiges Verhalten erklären, und existieren wissenschaftlich haltbare Befunde aus der Steinzeit, die diese Hypothese unterstützen?
Für die ausgestorbenen Urmenschen existieren nur archäologische und fossile Funde, anhand denen Geschlechtsunterschiede lediglich spekulativ interpretiert werden können.
24Skelettuntersuchungen zeigen Unterschiede in Körperbau und Muskulatur zwischen den Geschlechtern. Größere Skelette weisen auf anstrengende Tätigkeiten und Dominanz hin.
Bestattungen und Grabbeigaben liefern Hinweise auf sozialen Status und Geschlechterrollen. In Männergräbern finden sich häufig Waffen und Jagdwerkzeuge. In Frauengräbern finden sich Haushalts- oder Schmuckgegenstände.
Anhand solcher Befunde wird vermutet, dass Männer dominant waren, auf Jagd gingen und für die Verteidigung spezialisiert waren. Frauen sollten für das Sammeln, die Kinderpflege und die Nahrungszubereitung spezialisiert sein.
Neue archäologische Befunde belegen, dass Frauen auch in der Urzeit dominante Rollen einnahmen. Sie waren wahrscheinlich auch Jägerinnen, sodass die klassische Trennung von männlichen Jägern und weiblichen Sammlerinnen wahrscheinlich widerlegt ist.
Im Grunde weiß man wenig bis nichts über geschlechtsspezifisches Verhalten in der Steinzeit. Man kann allerdings einige theoretische Überlegungen vorschlagen, die eine Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern nahelegen (Stichworte: Sicherheit, Risiko, Nachwuchs etc.).
Unterschiedliche, aber nicht starre Geschlechterrollen und -trennungen sind in fast allen Naturvölkern feststellbar: Die Großtierjagd ist tendenziell eine männliche Domäne, während das Sammeln und die Kleintierjagd eher von den weiblichen Mitgliedern der Gruppe durchgeführt werden.
Trotzdem sind die Grenzen fließend. Die Arbeitsteilung hängt auch von vielen anderen Bedingungen ab (Lebensraum, Nahrungsmittelverfügbarkeit, Gruppengröße etc.).
Es existieren einige wenige matrilineare Gesellschaften mit weiblicher Erbfolge und eher weiblicher sozialer Organisation.
In matrilinearen Gesellschaften findet man eine kulturell bedingte Variabilität im Paarungsverhalten und in den sozialen Bindungen.
Matriarchalische Gesellschaften existieren in der Realität nicht. Sie werden lediglich in Kunst, Literatur und neuerdings auch im Film thematisiert.
Mit der Entwicklung der Schrift vor etwa 5000 bis 6000 Jahren existieren auch nachvollziehbare schriftliche Dokumente, anhand 25derer man Geschlechterrollen in verschiedenen antiken Gesellschaften nachvollziehen kann.
Geschlechtsunterschiede und -rollen waren zentrale Elemente in antiken Gesellschaften.
Männer werden als Krieger, Jäger und Führer dargestellt, Frauen hingegen als Mütter und Hausfrauen.
Geschlechtssymbole und -rituale sind allen Kulturen weltweit fest verankert. Dies zeigt sich auch in geschlechtsspezifischen Kleidungen.
Die Vorstellungen über Geschlecht und Sexualität weichen in den antiken Kulturen von den heutigen Vorstellungen deutlich ab.
In den antiken Darstellungen existieren Geschlechterhierarchien, mit Männern in höherer sozialer und politischer Position.
1
https://zitate.weisewortwahl.de/weisheit/je-weiter-man-zuruckblicken-kann-desto-weiter-wird-man-vorausschauen-winston-churchill/
2