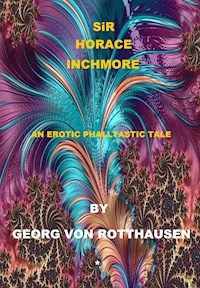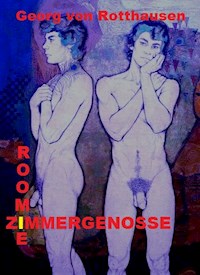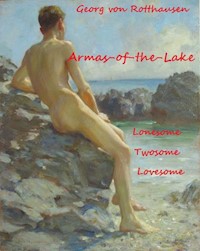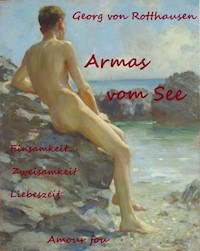Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Lernen Sie den frisch beförderten Ersten Kriminalhauptkommissar Martin Freiherrn von Malvoisin des K1 Lübeck, kennen, der seit kurzem in dem beschaulichen Ostseebadeort Kellenhusen hinter dem Eutiner Staatsforst - oder vor ihm, wenn Sie die Ortslage vom Strand aus betrachten - mit seiner Familie lebt und dort mit seinem ersten schweren Fall konfrontiert wird, der sich ausgerechnet am Strand ereignet, den er seit seiner frühesten Kindheit kennt und außer Kinderraufereien, Liebesgeschichten und sehr eifrig betriebenen Burgenwettbewerben seit dem Zweiten Weltkrieg keine nachhaltigen Aufregungen zu bieten hatte. Sie treffen bei seiner kniffligen Aufklärungsarbeit auch seinen deutsch-dänischen Freundkollegen Kriminalkommissar Frederic Langeland und den bodenständigen, eher schweigsamen Kriminalhauptkommissar Hauke Tewes, der es nach wie vor liebt, sich in seiner plattdeutschen Muttersprache mitzuteilen. Wir begegnen auch Malvoisins Familie, seiner schönen und selbstbewußten Frau Maren und seinen drei lebhaften Teenagerkindern, Christian, Karin und Tessa mit all ihren Problemen, die in ihrem Alter für sie sehr aufregend sind. Sie werden den aparten Lübecker Polizeichef kennenlernen, der beweist, daß auch "hohe Tiere" nur Menschen sind. Malvoisins erster dokumentierter Fall hat intensiv Begleitung durch den Gevatter Tod, dem in den Weg zu stellen Malvoisin nicht immer gelingt. 'Und da ist auch die bildschöne Photographin Silke, die mehr mit dem Fall zu tun bekommt, als ihr lieb sein kann, und Malvoisins Jugendfreund Christian v. Langfuhr, ein neugieriger Kriminalschriftsteller. Es menschelt allzumal, aber lesen Sie selbst!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 766
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Imprint
Mannesstolz
Georg von Rotthausen
published by epubli GmbH, Berlin
Copyright: © by Georg von Rotthausen
ISBN:
Inhaltsverzeichnis:
Imprint
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Zwei Jahre später
Etwa vier Monate später
Knapp sechsdreiviertel Jahre später, zwei Wochen vor dem Morgen, an dem das Unheil verstummt sein wird, nur um damit weiteres heraufzubeschwören
Einen Tag später
13 Tage später
1. Tag
2. Tag
3. Tag
4. Tag
5. Tag
Am Tag zuvor
6. Tag
7. Tag
8. Tag
Am Tag nach der Aufklärung
Epilog
Danksagung
Schlußerklärung
Kontakt zum Autor
Georg von Rotthausen
Mannesstolz
“Die Liebe ist ein Wunder, das immer wieder möglich ist. Das Böse eine Tatsache, die immer vorhanden ist.”
Friedrich Dürrenmatt
Prolog
In einer schmalen Einbahnstraße kommt es zum Gegenverkehr. Ein Verkehrsteilnehmer hatte nicht damit gerechnet und erlebt eine böse Überraschung, als drei Verkehrsteilnehmer den Verkehr in die verkehrte Richtung lenken und es so zu einem verkehrten Verkehr kommt, der ihm auf fatale Weise verkehrt vorkommt. Das verkehrte Verhalten der drei Verkehrsteilnehmer hatte ihn derart gefesselt, daß er nicht mehr ausweichen konnte und nun inmitten des verkehrten Verkehrs nicht umhin kann, zu denken, daß sei alles reichlich verkehrt und er selbst sei auch verkehrt − irgendwie, denn so hat er noch keinen Verkehr erlebt und so verkehrt verkehrt. Gemessen an seinem Alter ist er schon recht lang Verkehrsteilnehmer, aber dieser Verkehr an diesem schönen 11. September neben einem sonst eher verkehrsberuhigten, ja idyllischen kleinen bayerischen See ist ein gefährlich verkehrter Verkehr, der mit einem harten Schlag endet und sein bisheriges Verkehrsverhalten ins Gegenteil verkehrt. Dies wird sich alsbald gegenüber den drei Verkehrsteilnehmern zeigen, nachdem sie Verkehrsflucht begangen haben. Er bleibt nach dem Verkehrszusammenstoß liegen. Am Ende der Einbahnstraße lassen sie Blut zurück. Es rinnt in das klare Wasser des idyllischen bayerischen Sees, wo es glücklicherweise keine Rauschwirkung auf Haie hat, denn die haben sich zurückgezogen, nachdem unbändige Naturgewalten ihren Lebensraum trockenfallen und zum Aufmarschgebiet des gefährlichsten Lebewesens unter der Sonne werden ließen. Aber eine Wirkung hat es, das vergossene Blut des verkehrten Verkehrs: Es verkehrt eine Seele und vermählt einen schlafenden Hai mit der gefährlichsten Gefahr. Unter der besten Tarnung, der Schönheit, erwacht das Böse.
*
Zwei Jahre später.
Ein junger blonder, blauäugiger Bursche schlingt sich ein großes Badetuch um die Hüften, betätigt die Spülung und verläßt den Raum. Sein Gesichtsausdruck läßt erkennen, daß er gerade an etwas sehr lustiges denkt. Es ist ein fröhlicher, unbekümmerter Junge, ein hübscher Kerl gar, den sich jede Mutter als Freund für ihre Tochter und für sich selbst als Schwiegersohn wünscht, wenn sie ihn schon nicht als eigenen Sohn hat − oder als Geliebten genießen kann.
In der Dusche trifft er auf ein bekanntes Gesicht. Sonst ist niemand da. Er nimmt sein Tuch ab, legt es auf einen Schemel und dreht die Brause an. Während er sich unter dem langsam heißer werdenden Wasserstrahl hin und her dreht, wird er genau beobachtet, was er zunächst nicht bemerkt. Ohne zu seinem Nachbarn zu sehen fragt er ihn:
„Auch nicht nach Hause gefahren? −−− Ich muß noch auf die nächste Prüfung lernen, zu Hause habe ich keine Ruhe, die Mädels eben”, und er lacht. Es kommt keine Antwort, was ihn nicht weiter stört. „Kannst Du mich mal hinten einseifen?” Er dreht sich um. „Denkst wohl auch gerade an scharfe Dinger, wie? Geile Pracht, Mann!” Sein ebenmäßiges Gesicht ist ein einziges breites Lächeln, seine eigene Männlichkeit schickt sich an, zu erblühen.
Sein Nachbar sagt noch immer nichts, nimmt aber sein Duschgel und seift ihn ein − erst wohltuend, dann fest und gründlich.
„Du, da mach’ ich’s selber, danke.”
Er wird unvermittelt gegen die Kachelwand gestoßen …
„He, was soll das?”
Da wird er hart im Genick gepackt, mit dem Gesicht gegen die Wand gedrückt und sieht nur den erhobenen rechten Zeigefinger, der ihm wortloses Stillhalten befiehlt, während es ihn im selben Augenblick heiß durchfährt, und seine linke Wange reibt an den kühlen Kacheln … und reibt … und reibt ... und reibt … und eine Seele wird verwundet, während ein schönes Lächeln stirbt.
*
Etwa vier Monate später.
In einer Hamburger Villa, in Eppendorf, um genau zu sein, nicht wirklich groß, aber groß genug, um noch als Villa zu gelten, nicht an der Pfeffersackmeile, aber doch vornehm genug, um die Bewohner für wohlhabend zu halten, läßt ein schönes Mädchen sich zwei Tage vor Heiligabend ein heißes Bad ein. Es ist fast ein wenig zu heiß, aber es soll seine Wirkung nicht verfehlen, und ein langes Badeerlebnis hat sie ohnehin nicht vor, die junge Schöne. Sie hat etwas ganz bestimmtes im Sinn: sie will baden wie eine römische Adlige. Das Haus ist ruhig, außer ihr ist niemand da. Sie hat ihr hübsches Zimmer aufgeräumt und ihre Kleidung sorgfältig aufs Bett gelegt. Sie wendet sich vor dem Betreten des Bades, das sich gleich an ihr Zimmer anschließt, um, läßt ihren Blick schweifen, als wolle sie sich vergewissern, daß alles in Ordnung ist und ihr niemand folgt, dann geht sie ins Bad, wo sich die hellblaue Wanne mit dem dampfenden Wasser füllt. Sie hat keinen Blick für den schönen Raum, bleibt vor dem hellblauen Waschbecken stehen, betrachtet sich im Spiegel, löst ihre Haare, schüttelt sie aus und nimmt etwas aus dem Toilettschrank.
An der Wanne stellt sie das Wasser ab, verzieht etwas das Gesicht, als sie ihren rechten Fuß kurz eintaucht, aber dann mit heftig eingesogener Atemluft in die Wanne steigt, kurz innehält und sich dann langsam setzt. Die eingetauchte Haut rötet sich augenblicklich. Sie legt den kleinen Gegenstand in die Seifenschale an der Wandseite, lehnt sich mit dem Kopf zurück und schließt die Augen. Sie schwimmt in ihren Gedanken. Sie weiß genau was sie will, ist völlig mit sich einig und absolut ruhig.
„Jetzt werde ich zu meinem Kind schwimmen, so wie es davongeschwommen ist − in meinem Blut. Ich habe es nicht halten können, so wie ich mich nicht mehr halten kann. Niemand kann mich halten, niemand. Mein Blut wird mich zu meinem Kind bringen und dann trennt uns niemand mehr. − Es muß gelingen, da kein Freund mir hilft, ganz alleine muß ich auf die Reise gehen. − Lebt alle wohl, ich muß zu einem Wiedersehen, muß sehen, ob mein Kind doch lächelt.”
Sie greift zur Seifenschale. Ganz in Gedanken tritt die Schöne ihre Reise an. Kurz zucken ihre Mundwinkel, begleitet von einem kurzen Zusammenkneifen ihrer Augen. Und wie so manches Mal bei einer Überlandtour sie ihren linken Arm im Übermut in den Fahrtwind hielt, so hält sie ihn nun hinaus aus der Wanne als wolle sie zum letzten Mal im Diesseits fröhlich winken. Mit Blut kam sie ins Leben, mit Blut geht sie auf die Reise, einem Leben nach, das nicht bei ihr bleiben konnte − und langsam schwinden ihr die Sinne. Zuletzt hört sie ein Kinderlachen. Es verschönt ihr sterbendes Gesicht mit einem letzten Lächeln.
*
Knapp sechsdreiviertel Jahre später, zwei Wochen vor dem Morgen, an dem das Unheil verstummt sein wird, nur um damit weiteres heraufzubeschwören.
Ein schöner junger Mann, blond, blauäugig, dessen ebenmäßige Gesichtszüge für sein Alter ein wenig zu ernst wirken, bleibt an einem Briefkasten an der Ecke der Straße, in der er wohnt, stehen, prüft die Leerungszeiten, sieht auf seine Armbanduhr, nickt unmerklich, hebt die Klappe an der Vorderseite hoch und wirft einen hellblauen Briefumschlag ein.
„So, das ist erledigt.”
Als er weitergeht, begegnet ihm ein Ehepaar mittleren Alters, das, seiner angesichtig, zeitgleich ein ehrliches Wie-schön-Sie-zu-sehen-Lächeln aufsetzt und seinen Gruß erwartet, der ausbleibt. Er geht wie abwesend an ihnen vorbei. Leicht konsterniert bleiben beide stehen.
„Moin, Herr …”
Der Rest bleibt dem Mann im Halse stecken. Beide sehen sich verwundert an.
„Hast Du Töne, geht einfach vorbei.”
„Hast Du seinen Gesichtsausdruck nicht gesehen?” Dem geht’s nicht gut.”
„Sagen Sie, Herr …”, ruft der Mann ihm nach.
„Laß ihn. Der Junge will nicht reden. Ich geh’ morgen mal zu ihm hin.”
„Vielleicht hat Warendorff ihn angesch …, ich meine angepfiffen”, verbessert er sich, nachdem seine Frau ihm blitzschnell das Sag-es-ja-nicht-Augenbrauensignal gegeben hat. „Mann, der muß lernen, das zu ertragen.”
Beide sehen ihm kurz nach und gehen weiter. Fünf Schritte später hat er es schon abgehakt, sie macht sich Sorgen.
Der junge Mann hat inzwischen das Haus erreicht, in dem er wohnt, betritt es und ist froh, daß niemand von den Nachbarn ihn gesehen hat, als er seine Tür aufschließt. Er wirft den Schlüsselbund auf den Schuhschrank gegenüber dem Flurspiegel, ohne die Tür wieder abgeschlossen zu haben. Für einige Augenblicke lehnt er sich gegen die Haustür und schließt seine Augen.
Dann stößt er sich ab, legt seine weiße Schirmmütze auf die Hutablage der Garderobe und geht in sein Schlafzimmer. Dort entkleidet er sich vollständig, legt fein säuberlich alle Stücke weg und betrachtet noch einmal sein textiles Statussymbol mit dem goldenen Streifen und Seestern darüber. Er war so stolz darauf, als er es das erste Mal tragen durfte. Bald wäre der zweite Streifen dazugekommen. Und dann hängt er es weg.
„So, das ist erledigt.”
Er betritt seine kleine Küche und richtet sich ein Abendbrot. Es ist wie jeden Abend, wenn er zu Hause sein kann. Nicht zu viel und nicht zu wenig, er achtet sehr auf seine Figur, beim Training und bei dem, was er zu sich nimmt. Er ißt mit Genuß, atmet nach dem letzten Bissen und letztem Schluck Weißbier tief durch, trägt ab, reinigt das Geschirr und stellt alles ordentlich weg. Eine Pantry muß immer klarschiff sein.
„So, das ist erledigt.”
Nach einem letzten Blick umher geht er in sein Wohnzimmer und setzt sich an den alten Schreibtisch, den sein Vater ihm geschenkt hatte. Zwei Briefe schreibt er, mit ruhiger, schöner Handschrift, faltet jeden Bogen sorgfältig, steckt jeden in einen Umschlag, den er anleckt und verklebt und zusätzlich petschiert. Er muß schmunzeln: Nicht nur die Briefe sind petschiert − er ist es auch. Aber bald ist er frei.
„So, das ist erledigt.”
Mit einem tiefen Durchatmen läßt er sich in seinen Lieblingssessel fallen, lehnt sich zurück und schließt die Augen. Sein Kopfkino springt an und spielt ihm die schönsten Filme seines Lebens vor, so schön, daß sein Lächeln für eine kurze Weile zurückkehrt und er sich selber zu lieben beginnt. Nach dem Höhepunkt atmet er tief durch.
„So, das ist erledigt.”
Nach einem letzten Blick umher geht er in sein Bad und holt sein Reisemittel heraus. Er will es gleich verwenden, aber vorher genießt er eine heiße Dusche, die ihn reinigt und doch nochmals an den Beginn erinnert, so wie sie ihn jedes Mal erinnerte, wo es begann und wie es begann − sein Unheil, seine Schmach, sein Verderben.
Nach zehn Minuten trocknet er sich ab und hängt die Handtücher fein säuberlich auf.
„So, das ist erledigt.”
Er nimmt sein Reisemittel in die Hand, blickt sich ein letztes Mal um und geht in sein Schlafzimmer, denn das will er nun tun − schlafen.
Er schlägt das Oberbett zurück, setzt sich auf die Bettkante. Die Uhrzeit nimmt er nicht mehr wahr; sie ist unwichtig geworden. Zwei Kopfkissen türmt er auf und setzt sich dagegen. Er macht mit der linken Hand eine Faust, an seinem sehnigen Arm zeigt sich die Reisestrecke, mit der leeren Spritze schickt er eine Luftblase los, zieht die Nadel heraus, ein kleiner Blutstropfen quillt hervor, er läßt die Spritze fallen, lehnt sich zurück und schließt die Augen.
„So, das ist er ...”
*
Einen Tag später.
Zwei junge Männer rennen zur Mittagszeit auf das Haus zu, in dem der schöne, junge Mann wohnt. Als der erste gerade läuten will, wird die Haustür geöffnet, und beide drücken ohne Rücksichtnahme hinein.
„He, können Sie nicht aufpassen?” Ein empörter älterer Mann sieht ihnen böse nach.
Nein, es schert sie nicht. Beide stürmen zwei Stockwerke hoch und beginnen, an der Tür des schönen, jungen Mannes zu klingeln und gegen sie zu hämmern.
„Mach’ auf, mach’ endlich auf. Mann, mach’ keinen Scheiß!” Beide sehen sich entsetzt an.
„Kannst Du nicht aufschließen oder sie einfach eintreten?”
„Fußmatte!”
Der das sagt bückt sich und findet einen Sicherheitsschlüssel. Gerade als sie die Tür öffnen, kommt der Nachbar heraus.
„Was machen Sie da, was soll das? Ich kenn‘ Sie nicht”, aber er bekommt keine Antwort. „Sie, ich hol’ die Polizei!” ruft er noch, findet aber kein Gehör.
Die jungen Männer sind längst in die Wohnung gestürmt, sehen jeder in ein anderes Zimmer und erstarren, als sie den schönen, jungen Mann entdecken. Einer tritt mit weit aufgerissenen Augen, stoßatmend an das Bett heran, fällt auf die Knie und ergreift die rechte Hand des Gesuchten.
„Das zahlt er mir, das zahlt er mir. Ich schwöre Dir, das zahlt er mir.”
Der in der Tür stehengebliebene junge Mann wendet sich entsetzt ab, sucht einen Stuhl und entdeckt im Wohnzimmer auf dem Tisch zwei Briefe und daneben einen Siegelring. Die Briefe sind adressiert an „Vater und Mutter” und „S.”
*
13 Tage später.
Es ist eine klare Mondnacht. Sie ist warm. Der Ort liegt ruhig. Der Tag war heiß. Man könnte noch immer in Shorts am Strand spazierengehen, den angenehm warmen Sand unter seinen Füßen spürend, Hand in Hand mit dem liebsten Menschen, oder auch allein, wenn einem das lieber ist. Doch es ist ruhig. Kein lebhaftes Schwatzen mehr vor den Strandcafés und kleinen Gaststätten. Kein Liebespärchen, das lieber im warmen Sand liegt als in den Federn oder daneben oder wo auch immer.
Bis Mitternacht wird es still. Es ist nicht Westerland drüben auf jener schmalen, ach so mondänen Nordseeinsel, wo es schon teuer ist ein kühles Bier auch nur anzusehen, geschweige denn sich servieren zu lassen und die kühlen Blonden manchen Mann erst um den Verstand und dann sein letztes Geld bringen, wo es auch nach Mitternacht noch lebhaft zugeht. Es ist auch kein Weltbad, wie es einst Zoppot vor Danzig in Westpreußen war, wo die große Welt verkehrte, als noch Traverser Schöner aufspielte, das Kasino gesellschaftlicher Treffpunkt war, Blumenkorsi die Menschen entzückten und selbst im Winter schöne Frauen in ihren Pelzen auf Seesteg und Promenade die Aufmerksamkeit auf sich zogen, ehe die Welt verrückt wurde und die Schüsse des Linienschiffes „Schleswig-Holstein” den Untergang der alten Ostseewelt ankündigten, weil dumme Führer vieler Staaten meinten, man müsse Clausewitz allzu wörtlich nehmen und sich wieder einmal zeigen, was man rüstungstechnisch drauf hatte. Ausgerechnet „Schleswig-Holstein” mußte dieses Schiff heißen, mit dem es losging, ein schönes, ein stolzes Schiff, mit einem fähigen Kommandanten, der es bis zum Vizeadmiral bringen sollte, und der doch nicht ahnen konnte, daß nun gerade seine Artillerie nicht nur die feindliche Stellung auf der Westerplatte vor dem deutschen Danzig niederkämpfte, sondern auch dazu beitragen sollte, wenn auch indirekt, daß wunderschöne Ostseebäder wie Rauschen, Cranz und Kolberg ihren Glanz verlieren würden und deutsche Urlauber sich andere Ziele suchen müßten. Und so kam es, daß ein kleines Ostseebad in Ostholstein, obwohl es schon zu Kaiser Wilhelms Zeiten, dem mit dem Es-ist-erreicht-Schnurrbart, ein kleines Ostseebad in Ostholstein war, ausgerechnet der Artillerie der „Schleswig-Holstein” und weltumspannender Dummheit es verdankte, nachdem man sich wieder beruhigt hatte und vom Wirtschaftswunder erholen mußte, einen für ruhige norddeutsche Verhältnisse ungeheuren Aufschwung zu nehmen, als viele Gäste, die nun nicht mehr nach Rauschen, Cranz und Zoppot fahren konnten, sich Ersatz suchten und neben manch weiterer Perle in der Kette der holsteinischen Badeorte in der Lübecker Bucht auch und ungemein treu in dieses kleine Ostseebad hinter dem Eutiner Staatsforst fahren sollten. Manche kamen wohl auch von der Seeseite her, dann lag und liegt es natürlich vor dem Eutiner Staatsforst. Aber immerhin liegt es da, denn glücklicherweise hat die große Flut von 1872 es verschont, sonst läge es nicht mehr da, wäre verschwunden, wie einst Vineta. Das immerhin kennt man noch als Sage, das kleine Ostseebad wäre nie eines geworden und das weggespülte Fischerdorf hätte man völlig vergessen, man erzählte sich wohl nicht einmal mehr eine Sage davon, denn es hat keine. Es käme niemand, denn die Leute müßten ja ihre Kurtaxe woanders abgeben, ob es ihnen paßt oder nicht, und die Wasserstandseiche im Eutiner Staatsforst würde auch niemand kennen, denn es hätte niemand den Wasserstand von 1872 dort angezeichnet, und dann würde sie niemand Wasserstandseiche genannt haben − warum auch. Es wäre niemand da, den es interessiert hätte, höchstens den Förster des Eutiner Staatsforstes, der die Wasserstandseiche, die nie zu diesem Namen gekommen wäre, kurzerhand verkauft hätte, um die öffentliche Kasse mit seiner guten Holzwirtschaft zu entlasten. Eine unbekannte Wasserstandseiche hätte sich vortrefflich zu Möbeln verarbeiten lassen, die dann von einem Menschen mit Geschmack gekauft worden wären, der nie etwas von einer Wasserstandseiche erfahren hätte, aber möglicherweise nun in diesem kleinen Ostseebad Urlaub machte und nach ihm seine Kinder und Enkel, die allesamt die Wasserstandseiche mindestens einmal in ihrem Leben bestaunt haben und sich fragten, warum denn dort das Wasser so hoch stand und das kleine Ostseebad noch steht. Das, was damals nicht weggespült wurde, haben heimatlose Bürgermeister zur Förderung des Baugewerbes und ihres Egos nach und nach abreißen lassen, denn wenn die Flut 1872 das kleine Ostseebad erreicht hätte, wäre ja sowieso alles weg gewesen. Warum also diese Aufregung?
Und so liegt das kleine Ostseebad ruhig und ahnungslos da. Fast so ruhig wie im Winter, wenn außer den wenigen Einheimischen und der Atmosphäre einer wunderbaren Ruhe kaum jemand da ist. Die wird dann noch ruhiger, die Atmosphäre, wenn die gar nicht so ruhigen Winterstürme, die sehr stürmisch sind, wie ihr Name schon sagt, drei Meter hohe Schneewehen aufwehen, denn dann gilt: Keen een rin un keen een rut. Man tut dann gut daran, vorher ausreichend eingekauft zu haben, denn der kleine Eckladen am Ring, so emsig seine Besitzer auch sind, hat auch nicht alles. Und selbst wenn er alles hätte − man muß erst einmal hinkommen, wenn die Schneewehen aufgeweht sind, und das ist gar nicht so einfach, wenn es von achtern und von vorn weht, als wäre man am Kap Hoorn. Beneidenswert sind die, die am Ring wohnen und es nicht weit haben, aber auch die müssen bannig aufpassen, daß der Wind, der nichts anderes kann als zu wehen, sie nicht am Laden vorbei die Waldstraße entlangweht und sie erst am Waldrand zum Stehen kommen und der Förster in seinem schmucken neuen Forsthaus sich wundert, wer denn da zu Besuch vorbeigeweht kommt. Die Verlegenheitsausrede, man wolle bloß ein Ster Holz kaufen, kommentierte er nur noch kurz mit einem gemurmelten „Bregenklöterig, hm?” und ermahnte etwas deutlicher „Bliev to Huus, dat weiht ut Noord!” − und Tür zu, denn es weht. Seine liebe Frau mag es gar nicht, wenn es ihr weiter hinten im Haus das gute Geschirr vom Tisch fegt.
Manchmal aber versuchen die Stürme das nachzuholen, was die Flut von 1872 nicht geschafft hat. Sie peitschen das Wasser, was soll man im Winter auch anderes damit machen, denn zum Baden ist es viel zu kalt, aber schöne hohe Wellen lassen sich auftürmen und damit spülen sie schon mal den ganzen Strand weg oder versuchen, den Landesdeich zu durchbrechen. Dann wird es etwas unruhig, die Schäden müssen repariert werden, und dann beruhigt man sich wieder, damit man die Kraft und Ruhe hat, die Gäste mit der ruhigen Freundlichkeit zu empfangen, die das kleine Ostseebad auszeichnet, damit die anfänglich immer noch etwas aufgeregten Gäste, die aus weniger ruhigen Gegenden und Lebensumständen kommen, langsam die Ruhe finden, derethalben sie angereist sind, um davon nach ihrer Abreise etwas mitzunehmen, um die unruhigen Gegenden und die Lebensumstände, aus denen sie gekommen sind, etwas ruhiger zu machen und sich selbst natürlich auch. Und wenn sie denn alle wieder fort sind, finden die Einheimischen erneut die Ruhe, die sie brauchen, um die Kraft zu sammeln, den langsam wieder unruhig gewordenen Binnenländern im kommenden Jahr wieder zu der Ruhe zu verhelfen, wenn die Unruhe sie erneut an die Küste treibt. Die Einheimischen freuen sich übrigens jedes Jahr, wenn die Gäste wieder all das Geld mitbringen, das zu verdienen sie die Ruhe hatten, nachdem sie in dem kleinen Ostseebad zur Ruhe gekommen waren, und es nun da lassen, und das wiederum beruhigt die Einheimischen ungemein, denn sie leben ganz gut davon, auch wenn sie es nicht immer zugeben mögen. Im übrigen haben die Einheimischen hier die Ruhe weg. Das gehört in dem kleinen Ostseebad einfach dazu.
Und so ist auch dies eine ruhige Nacht, noch warm von der Hitze des Tages, milde erleuchtet von einem ohne Wolken behinderten silbernen Mond. Noch ahnt niemand, daß Gottes Nachttischlampe die Ruhe vor dem Sturm bescheint.
Eine schlanke junge Frau geht im matten Licht auf die Promenade zu. Die leichte Brise in der Nähe des Strandes läßt sie ebenso leicht frösteln, wobei sie sich, unbewußt natürlich, nicht sicher ist, ob es nicht die zitternde Aufregung dessen ist, worauf sie sich freut − zu freuen glaubt.
Sie bleibt in dem schmalen Schatten stehen, den das Strandcasino wirft. Ihr Blick richtet sich auf die Seebrücke und die sich auf der angebauten Badeinsel abspielende Szene, derer sie nun Zeugin wird, was sie nicht erwartet hat.
Sie sieht fünf junge Männer, die der Reihe nach nackt ins Wasser springen. Nackte junge Männer findet sie schön, aber das hier ist ihr zuviel. Sie verschränkt die Arme vor der Brust, schaut enttäuscht, wippt mit beiden Füßen einige Male auf und ab, schaut zu Boden, sieht noch einmal zu den im Wasser tobenden jungen Männern hin. Dann dreht sie sich um und geht, gesenkten Hauptes, mit verschränkten Armen, den Weg zurück, den sie gekommen ist. Am Seemannsdenkmal wendet sie sich noch einmal um, hört einen kurzen Augenblick dem fröhlichen Getobe zu, dreht sich in Richtung des Theehauses und beginnt zu laufen, als wäre der Leibhaftige hinter ihr her. Hinter dem Landesdeich verschluckt die Nacht die Lebensfreude.
Daß ein weiteres Augenpaar die Szenerie beobachtet, hat sie nicht bemerkt. Sie selbst ist nicht unentdeckt geblieben und seit ihrem Erscheinen im Blickfeld gehalten worden. Nun, da sie fort ist, wenden sich diese Augen, verborgen im Schatten eines Korbes schräg gegenüber der Badeinsel, wieder den nackten jungen Männern zu und verfolgen funkelnd das lebhafte Treiben.
*
Die junge Frau kommt atemlos zurück in ihre Ferienwohnung. Sie schließt ab, läßt den Schlüssel stecken, lehnt sich tief atmend gegen die Tür. Nach ein paar Augenblicken drückt sie sich ab, geht ins Wohnzimmer, zieht die Jalousien herunter und wirft sich in einen Sessel. Sie sieht traurig aus, starrt an die Decke. Nach einem Augenblick springt sie auf, murmelt „Was soll’s”, geht in ihr kleines Schlafzimmer, entkleidet sich, sucht das Bad auf und steigt unter die Dusche.
Sie dreht sich unter dem prasselnden Wasser, hält ihr Gesicht hinein, ihre langen schwarzen Haare fließen an ihrem Rücken herunter. Ihre schöne Haut schimmert golden im Badezimmerlicht, gespendet von einer der letzten Glühbirnen, ist übersät von immer wieder sich erneuernden Wassertropfen, die wie kleine Kristalle blinken. Ihre Hände gleiten über ihre wohlgeformten Brüste, ihren flachen Bauch, suchen ihren schwarzen Schoß, als wollten sie das Geschenk nachliefern, das am Strand nicht gegeben wurde.
Abrupt dreht sie das Wasser ab, steigt hinaus, trocknet Haare und Körper. Sie wirft ihren Bademantel über und windet sich einen Handtuchturban.
In der Küche macht sie sich den letzten Tee des Tages, setzt sich und schreibt Tagebuch, begleitet von einem leisen Weinen, dessen sie sich nicht erwehren kann. Nachdem ihre Erinnerungen notiert sind, läßt sie ihren Bademantel auf der Küchenbank zurück. Die Schöne legt sich schlafen und entflieht der Enttäuschung der Nacht in die sanften Arme des Schlafes.
*
1. Tag
Die kleine Uhr neben ihrem Bett zeigt 6.30 Uhr. Nicole liest blinzelnd die Zeit ab, rekelt sich noch einmal und kehrt aus der Traumwelt in die noch stille Wirklichkeit des Morgen zurück. Das Haus ist noch ganz ruhig. So wie es sich in einem Haus in dem kleinen, ruhigen Ostseebad gehört.
Sie steht auf, kämmt sich die Haare sorgfältig durch. Nicole geht, nackt wie sie ist, in die Küche, läßt die Jalousie hochlaufen und trinkt ihren morgendlichen Orangensaft am Fenster stehend. Sichtlich besser gelaunt schaut sie anschließend in den Spiegel, nickt sich selbstzufrieden zu; sie schaut sich um, entdeckt ihren weißen Bademantel, zieht ihn über, schlüpft in ihre Strandsandalen, steckt ihr kleines Portemonnaie ein und verläßt das Haus.
Es ist noch niemand auf den Straßen. Die Bäckereien öffnen erst um sieben; den Brötchenkauf plant sie für den Rückweg. Sie geht die Strandstraße entlang, kommt an dem schön renovierten Theehaus vorbei, passiert das Seemannsdenkmal, wo sie kurz stehen bleibt und in die Morgensonne blinzelt. Sie reckt und streckt sich, als wäre sie gerade aufgestanden. Dann steckt sie beide Hände in die Bademanteltaschen und schlendert vorbei an den kleinen Becken mit den plätschernden Wasserspielen über die Bodensteine mit dem Wellenmuster weiter Richtung Haupteingang Promenade und Strand, wobei sie sich rechts hält.
Nicole biegt um die Ecke des Strandcasinos, bleibt kurz stehen, sieht sich um, stellt mit einem feinen Lächeln fest, daß sie allein ist, löst den Gürtelknoten, faßt in Brusthöhe die Aufschläge undöffnet sie, als wolle sie die ersten Sonnenstrahlen einfangen. Die ersten Schwalben sausen im Tiefflug über die Promenade und dem Sand zwischen den Strandkörben.
Nicole bewundert die Manövrierfähigkeit der pfeilschnellen kleinen Vögel, sieht ihnen einige Augenblicke zu. Noch sitzen gelassene Möwen auf den Strandkörben, einige stolzieren durch die Korbreihen, um nach Essensresten zu suchen, die die Badegäste am Abend zuvor absichtlich in den Sand geworfen hatten und bei der ersten Aufpickrunde übersehen worden waren.
In Scharen sitzen große weiße Möwen und die kleineren Schwarzkopfmöwen auf der Seebrücke. Die ersten Gäste werden sie verscheuchen und auf Abstand halten. Wehe, wenn diese Möwen es lernten, den Menschen die Eistüten aus der Hand zu picken, wie die aufdringliche Bande auf Sylt es bereits gelernt hat.
Nicole vergewissert sich erneut, unbeobachtet zu sein, läßt die Aufschläge los, nimmt leicht Anlauf und springt auf den Sand, der noch etwas feucht von der Nacht ist, und strebt einem Strandkorb in der ersten Reihe zu. Einige der Möwen fliegen auf und machen sich davon. Beim Näherkommen sucht sie etwas in den Taschen, bleibt kurz stehen, prüft nochmals − und murmelt leise vor sich hin: „Jetzt habe ich doch den Schlüssel vergessen”, geht aber weiter und zwar gezielt auf den Strandkorb H 55 zu. Nicole wundert sich im Stillen, daß links neben dem etwas nach rechts gedrehten Korb das Gitter steht, will aber nicht weiter darüber nachdenken, läßt den Bademantel heruntergleiten, hängt ihn am Gitter auf und geht weiter zur Wasserlinie.
Nicole schaut nochmals links und rechts, sich absichernd, daß sie allein ist, prüft mit den Füßen die Wassertemperatur und bekommt eine leichte Gänsehaut.
„Ach was”, macht sie sich selber Mut und geht hinein. Es kostet sie etwas Überwindung, aber mit leisem Juchen schaufelt sie sich das frische Wasser an den Oberkörper, ihre schönen Brustwarzen sind augenblicklich aufgerichtet und fest. Dann taucht sie kurz unter, kommt wieder hoch und ist schließlich so weit fortgekommen, daß sie mit einem Sprung nach vorn in das ruhige Ostseewasser gleitet und kraulend Distanz zum Strand gewinnt.
Nicole zieht weiter draußen einige Bahnen, kehrt zur Sandbank zurück, wo sie in Hocke kurz verweilt und die verwaiste Badeinsel betrachtet, auf der sie zum Mondscheinschwimmen einen einzigen schönen Mann zu treffen trachtete, der ihrer offensichtlich nicht gedacht und sich stattdessen mit vier Kameraden getroffen hatte. Sie nimmt sich vor, ihn deshalb energisch zur Rede zu stellen. Jetzt sitzen dort nur einige Möwen, die die nackte Schöne zwar im Auge behalten, aber für ihre Erotik ganz sicher keinen Blick haben. Was zählt menschliche Schönheit für eine Möwe? Die wird erst interessant, wenn sie ihr einen Keks entgegenhält.
Nicole wendet sich dem Ufer zu, schwimmt noch einige Züge, richtet sich auf − und entdeckt, daß aus ihrem Strandkorb zwei Beine herausragen, als hätte sich jemand hineingesetzt und wäre eingeschlafen. Sie verläßt die See, nimmt ihre am Körper klebenden Haare mit der Rechten zusammen, läßt sie durch ihre geschlossene Hand laufen, um das Wasser herauszudrücken und läßt sie überrascht los, denn sie bemerkt beim Näherkommen, daß es sich um Männerbeine handelt. Nicht behaart, aber doch Männerbeine. Zu einer anderen Tageszeit hätte sie vielleicht gedacht „Hm, schöne, trainierte, lange Beine, da hängt bestimmt ein großer hübscher Kerl dran und noch ‘was anderes Großes”, aber daran denkt sie jetzt am frühen Morgen, einsam am Strand, überhaupt nicht. Um nicht Opfer einer unerwünschten Betrachtung ihrer Nacktheit zu werden, unterläßt sie jeden Anruf, geht seitwärts auf ihren Korb zu, nimmt ihren Bademantel vom Gitter, wirft ihn über, bindet den Gürtelknoten, geht herum, holt Luft, um ein herzhaftes „Sagen Sie mal, was machen Sie in meinem Korb?” anzubringen − reißt schreckgeweitet ihre Augen auf und vergißt ihre Worte in einem gellenden Schrei.
*
Auf dem mittlerweile belebten Strand stehen zahlreiche Personen um den Strandkorb H 55 herum. Nebenan, im H 76, bemüht sich eine junge Kriminalbeamtin um die schöne Frühschwimmerin, die noch immer völlig aufgelöst ist. Ein Notarzt fragt sie:
„Möchten Sie ein Beruhigungsmittel?”
Sie schüttelt mit dem Kopf und macht eine abwehrende Handbewegung. „Nein, nein, es geht bald wieder.” Sie zittert am ganzen Körper, ist mit verschränkten Armen ein einziges ‚,Geht doch alle weg!“
Der Kriminalkommissar Frederic Langeland, ein großer blonder Mann von 30 Jahren, versucht, Neugierige fernzuhalten. Er ist sonst ein fröhlicher Typ, locker, tolerant, läßt auch mal Fünfe gerade sein, aber die Sensationsneugier einiger Leute geht ihm an diesem Morgen auf die Nerven. Wer genau hinhört, erkennt einen leichten, einen wirklich nur leichten dänischen Akzent.
„Herrschaften, gehen Sie zu Ihren Körben oder in Ihre Quartiere. Außer einem Toten gibt es hier nichts zu sehen” und macht wegwinkende Handbewegungen. Als einige Kinder zu nahe kommen wird er energisch und lauter „… und halten Sie Ihre Kinder fern, das ist hier kein Spielfilm!”
„Na hören Sie mal, wofür zahlen wir denn Kurtaxe?”, protestiert ein bauchiger Mann.
„Sicher nicht, um eine Leiche anzusehen und unsere Arbeit zu stören” − und sein Ton wird deutlicher − „Entfernen Sie sich!”
Langeland beobachtet kopfschüttelnd, wie der Dicke sich grummelnd zurückzieht. Auch andere Neugierige verlaufen sich, von Uniformierten mit ausgebreiteten Armen zurückgedrängt.
Recht aufgeregt kommt eine weibliche Person gehobenen Alters heran:
„Was ist hier los? Wer hat hier das Kommando?“
An der noch nicht vollständigen Absperrung versucht einer der Beamten aus Grube gar nicht erst, das nahende Ungewitter aufzuhalten, denn er weiß, was, bzw. wer da kommt, und macht angesichts der ihm entgegengeworfenen gebieterischen Handbewegung „Weg da!” schleunigst Platz. Sie stürmt an Langeland vorbei, der ihr mit Stirnrunzeln nachsieht. Dann wendet er sich dem gehorsamen Beamten mit stumm-fragend erhobenen Händen zu und formuliert lautlos „Wer ist das?”, worauf mit lautloser Lippenformulierung zurückkommt „Die Bürgermeisterin”; dazu die Handbewegung, er solle bloß nichts sagen.
Das „Ungewitter” ist 63 Jahre alt, von asketischer Figur, mittelgroß, mit einer flotten Kurzhaarfrisur, die fast jedem Sturm standhält, auch im Gemeinderat oder im Landratsamt, wo immer es stürmisch werden kann; einmal gewuschelt − wieder in Ordnung. Man sieht es gerade nicht, aber sie kann sehr freundlich dreinschauen − wenn sie will, aber sie kann auch verbal draufhauen, wie Blücher bei Waterloo. Keine Gefangenen! Sie drückt sehr viel für ihren Ort durch, plündert jeden erreichbaren Zuschußtopf. Als sie bei der Einweihung der neuen Promenade 2003 einen Staatsminister aus Kiel unentrinnbar vor sich hatte, da machte sie ihm coram publico schon klar, wieviel Geld sie für die neue Seebrücke benötigte, was der dann auch mit einem breiten Schmunzeln und einem Beckenbauer’schen „Schau’n wir mal” beantwortet hatte. Sie schaffte es dann tatsächlich, das entsprechende Geld aus den Kieler Rippen zu leiern und die neue Seebrücke steht; mit ein paar Schwierigkeiten, aber sie steht. Fragt sich nur, wie lange, bei den Winterstürmen. Und wenn Jugendliche einen Arbeitsplatz suchen oder erst einmal eine Lehrstelle brauchen, da ist sie zur Stelle und hilft. Hin und wieder müssen gleichaltrige Einheimische, mit denen sie zur Schule ging und sie gut kennen, sie ein wenig einnorden, aber das gehört zum menschlichen Miteinander dazu. Man ist ja im Dorf, man kennt sich. Aber bei der Straßenumlage, da wird sie zum Tier, langt gnadenlos zu. Da kann es schon mal sein, daß sie Hausbesitzern sagt, sie sollen halt verkaufen, wenn sie es sich nicht leisten können. Sie hängt sich wirklich ’rein, ist ständig auf Achse im Dienst an der Gemeinde, obwohl sie „nur” eine Ehrenamtliche mit Aufwandsentschädigung ist. Da beneidet sie schon ihren Kollegen in Grömitz, der rund 7.700 Einwohner verwaltet und ein fixes Gehalt bezieht. Und dann erst die lieben Beamten im Landratsamt, die alles besser wissen − mit Gehalt. Aber sie ist überall präsent, stellt ihre Plakate nicht nur zur Wahl auf. Aufmerksame Gäste, die Einheimischen sehen das schon gar nicht mehr, finden vor vielen Häusern ihren Namen auf kleinen Schildern. Man kann nämlich Ferienwohnungen bei ihr mieten. Da ist sie sehr geschäftstüchtig, und wer sie sehen will, und das muß man schließlich, wenn man eines der hübschen Feriendomizile ergattern will, der trifft sie dort, wo einst das schöne weiße Hotel zur Post stand, ungefähr da, wo man früher das Hotel betrat und rechts in den großen Speisesaal ging. Doch an diesem Morgen ist sie Bürgermeisterin, und nur Bürgermeisterin, mit der ganzen Energie ihrer Amtsführung.
Sie entdeckt ein ihr bekanntes Gesicht.
„Ah, guten Morgen, Hans …”
„Guten Morgen, Hanne!” erwidert der Angesprochene, geht der Bürgermeisterin entgegen, und beide geben sich die Hand.
„… was ist passiert?” bohrt die Bürgermeisterin nach, „Kannst Du mir mal sagen…?” Sie sieht Hans von Greiff fragend an.
Ein großer Mann von 44 Jahren, imponierende 1,90 Meter groß, in heller, sommerlicher Kleidung, mit Rembrandt auf dem Kopf, tritt heran. Er hat ein angenehmes Gesicht, mit gepflegtem Schnurrbart und Spanischem Dreieck, man könnte ihn fast als „schönen Mann” bezeichnen. Seine kräftigen, gepflegten Hände zieren an den Ringfingern ein breiter goldener Ehering rechts und ein alter Siegelring links. Er wirkt noch etwas abgespannt, zeigt dabei immer noch leichte Züge von Verärgerung.
Man hatte ihn an seinem freien Tag aus dem Bett geholt, wohlgemerkt nach einer heißen Liebesnacht. Auch nach fast 20 Ehejahren hat er sich nicht auf gelegentliche Alibi-Blumensträuße zurückgezogen, seiner schönen Frau seine Liebe zu zeigen; er weiß sehr wohl, daß Frauen bei plötzlich mitgebrachten Rosensträußen eher zu einem kaum noch fortzubringenden Mißtrauen neigen, und wenn sie sich noch so erfreut geben. Es wird immer mit brüllender Schweigsamkeit die Frage aufkommen, ob der Kerl ’was angestellt hat oder sich frische Jugend bei einer Jüngeren holt. Rosen sind ja ein so offensichtliches Ablenkungsmanöver. Seine Maren pflegt seit Jahren ihre hübschen Portulac-Röschen, die im Sommer so fleißig blühen, egal, wo sie bisher einen Garten zur Verfügung hatte; nun auch auf dem Grund ihres neuen Heims. Das genügte. Sie hatte sich dem, kaum, daß das Haus eingerichtet war, mit Feuereifer gewidmet. Und ebenso hatten sie sich in der vergangenen Nacht geliebt. In den Sommerferien mußte auch sein geliebtes Frauchen, wie er sie für sich gern nennt, nicht auf die Zeit achten. Lehrerprivilegien eben. Ihre drei Teenager hatten es längst gelernt, sich ohne elterliches Gluckenverhalten das Frühstück zu machen. Also waren beide eng aneinandergekuschelt beim Morgengrauen eingeschlafen, in der Zuversicht, irgendwann am Vormittag miteinander aufzuwachen und fortzusetzen, was sie in der Nacht so stürmisch begonnen hatten. Das Telephon war leise gestellt. So hatte er es nicht gehört, aber die Haustürklingel, obschon ein schöner Dreiklang − er haßte diese schnarrenden Terrorklingeln, wie er sie schon als Kind empfunden hatte, aller früheren Quartiere − bedient von seinem Kollegen Fritz Langeland, hatte ihn erbarmungslos aus seinen Liebesträumen geholt und mürrisch an die Haustür geführt − der Einfachheit halber nackt wie er war. Langeland hatte sich nicht einmal geräuspert. Dessen dänische Toleranz übersah das einfach. Die Meldung einer Tötung ließ ihn aufwachen, allerdings auch seinen Kollegen anmaulen, warum er nicht den Diensthabenden vom KDD aufgescheucht habe. Der sei anderweitig unterwegs − Raubüberfall, mal wieder bei einer Tankstelle. Er solle Malle aus dem Bett holen, der wohne ja gleich „um die Ecke”. Malvoisins Gesicht verzog sich und er selbst wieder ins Haus. Langeland hatte anschließend auf einer praktischerweise vor der Tür stehenden Bank gewartet, während sein Chef sich in aller Ruhe zurecht machte. Der Tote würde ihm eh keine Fragen mehr beantworten. Warum also eine unnötige und wegen der Störung nicht gewollte Eile an den Tag legen? Warum? So hatte er sich der norddeutschen Ruhe hingegeben. Man jümmers suutje. Die Hingabe an seine Frau war dagegen bedeutend temperamentvoller ausgefallen. Jetzt lag sie zusammengerollt friedlich schlummernd da, als er sich angezogen und noch einmal nach ihr gesehen hatte. Ein leise schnurrendes Kätzchen. Kein Vergleich zu der wilden Katze wenige Stunden zuvor. Er nahm sich die Zeit dieses weibliche Wesen zu betrachten, das er so unendlich liebte und das ihn so sehr liebte. Er kann das zwar nach all den Jahren noch immer nicht begreifen, aber warum soll er auch? Er findet es einfach nur schön. Dann riß er sich los. Fruchtsaft mit einem Tropfen besten griechischen Olivenöls, kaltgepreßt, selbst-verständlich, und grüner Tee mußten sein. Ohne das war er morgens kein Mensch. Er hatte noch drei Löffel seines am Abend zuvor angesetzten Matjestopfes genascht und war dann zum Dienst erschienen. Herr von Greiff stellt ihm die Bürgermeisterin vor:
„Herr Kollege, ich darf Ihnen unsere Bürgermeisterin vorstellen: Frau Hanne von Bauwitz.”
Der Angesprochene nimmt seinen Hut ab.
„Hanne, ich darf Dir meinen Kollegen vorstellen: Kriminalhauptkommissar von Malvoisin … oder schon Erster?“
„Seit kurzem, aber ‚Erster’ ist für mich nur eine geradezu österreichische Rangverliebtheit, Generalobersargträger und dergleichen. Oder dieser Quatsch mit Stabshauptmann oder Stabskaleu. Es kommt auf den Mann an, nicht auf den Dienstgrad, aber lassen wir das”
„Na, da ist ja die ganze preußische Rangliste beisammen …” Die Bürgermeisterin hat ihre „spitzen” fünf Minuten. Malvoisin bleibt gelassen, verneigt sich kurz.
„Ja, ja, 400 Jahre Franzosen, 300 Jahre Preußen, aber das ist jetzt auch unwichtig.”
„Sagen Sie mal, sind Sie nicht gerade erst zugezogen?”
„Ganz richtig, Madame, vor einem guten Jahr.”
Er seufzt leise, hört an ihrer rauchigen Stimme, daß sie an der Kette hängt, und ein kurzes Einziehen der Luft bestätigt ihm: sie ist Raucherin.
„Keine Zeit, sich vorzustellen.”
„Das kann man doch von einem vielbeschäftigten Gemeindeoberhaupt nicht erwarten.”
Frau von Bauwitz sieht Malvoisin indigniert an. Der hält das aus, fragt:
„Madame, sind Sie schreckhaft?” und sieht das Gemeindeoberhaupt forschend an.
„Junger Mann, ich bin fast 40 Jahre verheiratet, mich erschreckt gar nichts mehr! Aber ich habe es schon einmal gefragt: Was ist hier los?”
Greiff wirft hinter vorgehaltener Hand leise ein: „Harte Admiralstochter…”
„Na dann kommen Sie mal …”
Malvoisin wendet sich dem H 55 zu und die Bürgermeisterin stapft im Sand hinter ihm her.
Malvoisin bleibt stehen und wendet den Blick dem Korbinneren zu. Bauwitz tritt heran − und der schreckgeweitete Blick wird von einer Ohnmacht ausgelöscht. Ehe Malvoisin und Greiff zufassen können liegt Bauwitz im Sand.
Malvoisin murmelt: „Da fehlen wohl noch 10 Ehejahre zur Abhärtung, wie?”
Beide Männer knien nieder, um die am Boden liegende Bauwitz aufzuheben, dochkaum angefaßt, berappelt sie sich und wehrt die helfenden Hände ab.
„Laßt mich, ich kann das allein!”
Bauwitz steht auf und sieht, etwas nähertretend, zur Sitzseite des H 55.
Im Strandkorb sitztliegt, etwas zur Seite geneigt, ein großer junger Mann, dem ersten Augenschein nach 23 bis 26 Jahre alt, durchtrainierter Körper, kurze pechschwarze Haare, Dreitage-Bart, nackt bis auf eine knappe Badehose. Um den Hals hängt ein Seil mit Henkerknoten, etwas oberhalb sauber abgeschnitten. Die weiße Badehose ist blutgetränkt. Daß sie mal ganz weiß war, ist kaum noch zu sehen.
Malvoisin bemerkt Unruhe hinter sich, sieht sich um und bemerkt, daß Strandgäste immer näher kommen
„Habt Ihr schon mal ’was von Tatortsicherung gehört? Mann, Weber …” − ein Polizeihauptmeister macht sich straff −
„… haben Sie vergessen, wie man absperrt?”
„Natürlich nicht, Herr Hauptkommissar!” erwidert der Gerüffelte fast empört.
„Na − und wo ist die Absperrung? Wenn die Leute die Bänder nicht respektieren, dann verschafft dem Respekt!” Er wird lauter. „Ausführung!” und zeigt auf die Promenade und auf den Strandbereich um den Fundort herum.
Weber winkt zwei Kollegen heran, und sie machen sich zu Dritt an die Verbesserung der Absperrung. Einige frühe Gäste protestieren, da sie den Strandabschnitt verlassen sollen.
Weber ruft einem Kollegen zu:
„… und notiert die Namen und Adressen der Leute, Urlaub und zu Hause!”
„Verstanden!” kommt es zurück.
Ein älterer Herr gibt sich empört:
„Junger Mann, ich bin der Oberlandesgerichtsrat Dr. Ach …”
Weber unterbricht, gibt sich betont höflich, aber etwas spitz:
„Auch im Ruhestand, Euer Ehren, sollte Ihnen noch erinnerlich sein, daß Tatorte von Unbeteiligten zu räumen sind.”
Er macht eine zum Gehen auffordernde Handbewegung.
„Impertinent!” schimpft der Fortgewiesene.
„Komm’, Lieber …” spricht ihn seine vornehm aussehende Gattin an, „… Die jungen Leute machen doch nur ihren Dienst. Früher warst Du streng, jetzt ist man es mit Dir. Polizei ist Polizei. ”
„Nichts für ungut, Herr Hauptwachtmeister”, brummt Ach vor sich hin. Der überhört das -wacht. Aber wer zählt schon am Morgen grüne Sterne …
Weber reicht der Richtergattin galant den Arm, um beim Überstieg auf den Absatz der Promenade behilflich zu sein, nimmt auf festem Boden leicht Haltung an, legt die Hand an die Schirmmütze.
„Danke, junger Mann!” schnarrt der alte Richter und wendet sich mit seiner Frau am Arm zum Gehen. „Untergrabe nicht immer meine Autorität …“ hört Weber noch und atmet durch. Die Absperrung läuft weiter.
Ein Mann mit Brille und Arzttasche stapft auf den H 55 zu.
Malvoisin fragt etwas ungehalten:
„Ist die Spurensicherung endlich da?”
„Nein!” ruft ein Kollege.
„Verdammt, wo bleiben die denn heute?”
Malvoisin wirft einen Blick auf die Seebrücke:
„Weber! WE-BER!”
„Ja?”
„Mann, Weber, holen Sie mir die Neugierigen von der Brücke und machen Sie da dicht!”
„Jawohl, Chef!” ruft Weber zurück und rennt mit Absperrband zur Brücke. „WEBER!“
Der erneute Anruf bremst ihn in vollem Lauf und ein winkender Zeigefinger holt ihn zu Malvoisin zurück. „Die Gaffer haben vermutlich Spuren auf der Brücke hinterlassen. Personalien aufnehmen, merken Sie sich genau, was die Männer an Kleidung tragen. Bestellen Sie sie ein. Fingerabdrücke und Faserproben nehmen, am besten gleich. Ausführung.”
Hauptmeister Weber strebt nun auf die Neugierigen zu, die merken, daß sie gemeint sind und sich verdrücken wollen.
„Halt, bleiben Sie stehen.” Weber hat die Männer erreicht und setzt das dienstlichste aller Gesichter auf. „Weisen Sie sich bitte aus.” Die Männer sehen sich und dann den Polizisten fragend an.
„Wir gucken doch nur. Endlich ist schon morgens richtig ‘was los”, meint einer.
„Sie haben einen Tatort betreten und weisen sich jetzt bitte aus.”
Achselzuckend ziehen die Männer ihre Börsen aus den Gesäßtaschen und zeigen ihre Ausweise vor. Weber notiert. „Und wo wohnen Sie in Kellenhusen?”
Die Männer sagen es ihm und verstehen noch immer nicht.
„Sie kommen bitte unverzüglich mit nach Grömitz. Dort werden Ihre Fingerabdrücke und Gewebeproben Ihrer Kleidung genommen. Reine Routine.”
„Warum das denn? Glauben Sie etwa …?”
„Ich und der Hauptkommissar glauben gar nichts, aber sie haben Fingerabdrücke auf dem Brückengeländer hinterlassen, wie sicher auch die Täter. Wir müssen sicher sein, Sie ausschließen zu können.
„Wie bitte?”, protestiert einer der drei.
„Wir hatten schon den Fall, daß Täter sich dreist unsere erste Ermittlungsarbeit angesehen haben. Also, bitte, meine Herren. Den ganzen Vormittag wird es nicht dauern. Es sei denn, Sie möchten nach Lübeck mitkommen.” Weber macht eine einladende Handbewegung.
„Das haben wir jetzt von Deiner verdammten Neugier!”
„Hättest ja nicht mitzukommen brauchen”, kommt es patzig zurück.
„Also bitte, wir drehen keinen Film, das ist echt! Bitte verlassen Sie jetzt die Brücke und warten Sie hinter dem Strandcasino bei unseren Dienstfahrzeugen.”
Maulend gehen die drei Männer weg.
„Immer wenn es interessant wird, und jetzt auch noch Fingerabdrücke abgeben, verdammte Scheiße.”
„Früher schickten uns die Eltern ’raus, jetzt verscheuchen einen die …”, mault einer weiter. „Schlucks ’runter, der kann Dich noch hören. Auf B-U-L-L-E paßt sicher ‘was im Bußgeldkatalog, oder hast Du Geld zuviel?”
Eifriges, stummes Kopfschütteln.
Derweil kommt der Arzt am H 55 an.
„Moin, Malle.”
„Moin, Klinge.” Die Männer geben sich die Hand. Der gerade Eingetroffene ist der Leiter der Rechtsmedizin in Lübeck, Prof. Dr. Karl Anderson, wegen seines scharfen Berufes von einigen ganz wenigen „Klinge” genannt, von denen er sich das auch gefallen läßt. Er ist ein jovialer Herr, 60 Jahre alt, für sein Alter ungewöhnlich schlank, mit schlohweißen, vollen Haaren, mit einem schönen, weißen, kurz geschnittenen Bart und erstaunlicherweise fast schwarzen Augenbrauen, was ihm hin und wieder die schmunzelnd, hinter vorgehaltener Hand geäußerte Verdächtigung einträgt „Ob er wohl färbt?” Er weiß das, aber es stört ihn nicht, denn er weiß, daß er nicht färbt, im Gegensatz zu manchen Politikern, die auch mit über 60 und 70 Jahren angeblich schwarze Haare haben, die so gar nicht zu ihrer Parteifarbe passen. Ihm genügt es, daß seine süße kleine Frau ihn immer noch attraktiv findet. Anderson hat sich einen gelassenen Humor zugelegt, gewachsen in all den Jahren, gewachsen mit jeder Leiche. Und er findet seinen Beruf immer noch hochinteressant. Andere Menschen lesen Bücher, er liest Menschen.
„Was hast Du denn heute Schönes?” Der Rechtsmediziner sieht Malvoisin fragend an.
„Na, sieh selbst” und deutet auf den Toten.
„Oh, eine Hinrichtung!”
Hier müßten jetzt hochgezogene Augenbrauen folgen, aber die wollen nicht. Gelassenheit.
„Wieso Hinrichtung?”
„Na, Henkerknoten, oder kennst Du so etwas nicht mehr?”
„Ja, richtig.”
Malvoisin nimmt den Rembrandt ab, kratzt sich am Kopf.
„Oder hast Du gedacht, der Tote hat sich den Knoten selbst geknüpft?”
„Na, wenn er tot war, konnte er wohl kaum noch Knoten knüpfen! Sei nicht so pingelig!”
„Wenn unsereins nicht pingelig wäre, wie Du das nennst, würdet Ihr manchen Toten als natürlichen Fall bestatten!”
Anderson sieht Malvoisin nun doch mit hochgezogenen Augenbrauen über den Brillenrand schauend an, während er sich die Einweghandschuhe überstreift. Der Professor prüft mit beiden Händen den Hals.
„Genickbruch?” greift Malvoisin der Diagnose vor.
„Sicher! Wenn der Knoten richtig gesetzt wurde − knack und weg!” Anderson macht eine ruckartige Doppelhandbewegung, als würde er einen stärkeren Zweig durchbrechen wollen.
„Tatzeit?” Anderson legt für einige Sekunden seine rechte Hand auf den Oberkörper des Toten.
„Ungefähr Mitternacht, nicht später als zwei Uhr, aber Du weißt ja …”
„Ja, ja, nach der Obduktion …”
Anderson besieht sich den Oberkörper des Toten nochmals.
„Er hat Salz auf der Haut, also war er im Wasser und hat nicht mehr geduscht.”
Dann sieht er nach dem großen Blutfleck auf der weißen Badehose, die sorgfältig zugebunden ist, löst den Knoten, zieht sie leicht herunter − ein dichter schwarzer Pelz ist zu sehen. Er zuckt zusammen, dreht sich um.
Anderson wendet sich aufgerichtet an Malvoisin:
„Ich habe das mal in einem Mafiafilm gesehen, aber noch nie im Dienst. Schau Dir das an − er ist kein Mann mehr!”
„Wie bitte?”
Malvoisins Mimik zeigt Ungläubigkeit, er beugt sich zu dem Toten vor, Anderson zieht die nun schlabberige Badehose herunter − Malvoisin prallt zurück. Das Ungläubige in seiner Mimik weicht dem blanken Entsetzen.
„Mein Gott, wer macht denn so ‘was?” stößt Malvoisin hervor.
„Wenn Du mich fragst, mein Lieber, jemand der sehr haßt oder sehr liebt − und Du weißt, das liegt nicht weit auseinander!”
Der Professor zieht die Handschuhe aus. Im Hintergrund stapfen die Sargträger der Rechtsmedizin heran.
„Kann ich ihn mitnehmen?” fragt Anderson.
„Nein, noch nicht. Die Spusi war doch noch nicht hier −” Malvoisin ringt mit der Fassung.
„Weber! − WE-BER!”
Der Gerufene eilt herbei.
„Ja, Herr Hauptkommissar?”
„Mensch, rufen Sie das K6 an! Wo bleiben die denn?”
„Mach’ ich.”
Weber zieht sein Funktelephon, tippt die Nummer ein, hält sich das Gerät ans rechte Ohr, wartet.
„K6? − Weber, Einsatzort Kellenhusen. Mensch, wo bleibt Ihr denn? Malvoisin wird schon grätig! − Was, Trecker? − Dann fahrt doch ‘rum! − Ende!”
„Übrigens, er ist nicht hier gehenkt worden -”
Malvoisin ist noch etwas verwirrt: „Wie?”
„Der Strandkorb ist nicht hoch genug, um ihm das Genick zu brechen.”
„Schlaumeier, das weiß ich auch!”
„Na, ich mein’ ja nur. Ein Galgen steht hier weit und breit nicht, aber such’ doch mal die Seebrücke ab … Von den Aussichtstürmen wird ihn keiner hergeschleppt haben, hm?”
„Verstehst Du das, Klinge?” Malvoisin grübelt.
„Hals durch, Messer im Bauch, Kopfschuß, aber Hängen und … Du weißt schon … ab − wer macht denn so etwas?”
„Malle, Du wiederholst Dich! − Na ja, Fräulein Kronborg wird sich freuen. Endlich hat sie mal etwas Schönes auf dem Tisch, nicht immer nur Wasserleichen und erbbereinigte Opas, obwohl das Seil des Glockenspiels fehlt …”
„Klinge! − Dein Humor ist wie immer unübertrefflich!”
Malvoisin sieht ihn mit hochgezogener rechter Augenbraue an.
Der Professor grient, wie nur ein langgedienter Profi seines Faches in des Todes Nachbarschaft lächeln kann und geht weg.
Weber kommt heran und meldet Malvoisin:
„Herr Hauptkommissar …”
„Ja?”
„K6 meldet unterwegs Treckerhindernis.”
„Wie bitte?“ Er zieht eine gespielt gleichgültige Miene, innerlich ist er sauer. „Na ja, wi hebbt jo Tiet. Gott schuf die Zeit, hat der ‘was von Eile gesagt?” Weber muß grinsen.
Nun schaltet sich rauchig die Bürgermeisterin wieder ein.
„Und was wird hier jetzt weiter passieren, Herr Kommissar? Der Strandbetrieb muß weiterlaufen! Wir verlieren sonst Gäste und Kurtaxe!”
Malvoisin wird deutlich.
„Frau Bürgermeisterin, hier laufen erst einmal unsere Ermittlungen und sonst gar nichts. Es hat ein junger Mensch sein Leben verloren, und ich will zum Donnerwetter wissen, warum!”
„Aber unser guter Ruf”, protestiert sie.
„Erstens haben wir auch einen guten Ruf zu verlieren, oder wollen Sie, daß die Tat nur deshalb nicht aufgeklärt wird, weil wir zu früh Ihre Gäste hier herumlaufen lassen und wertvolle Spuren vernichtet werden? Und zweitens ist das hier ein Tatort und Sie stehen im Weg. Also bitte!” Malvoisin macht eine verabschiedende Handbewegung mit Aufforderung zum Gehen.
„Impertinent!”
Die Bürgermeisterin stapft mit zorniger Miene davon.
„Oh, diese Verwaltungsleute”, murmelt Malvoisin leise und schüttelt den Kopf.
Malvoisin wendet sich zunächst an die junge Kriminalbeamtin.
„Sie können gehen, Frau Kollegin, ich übernehme jetzt hier.”
Die Angesprochene steht vom Strandkorb auf und entfernt sich. Malvoisin spricht betont leise die schwarzhaarige Schöne im H 76 an.
„Mein Name ist Malvoisin, Kripo Lübeck. Ich leite hier die Ermittlungen. Darf ich fragen, wie Sie heißen?”
Sie schaut hoch, sieht ihn verweint, aber gefaßt an:
„Nicole. Nicole Neumayer.”
„Sind Sie im Urlaub hier?”
„Ja, wir haben Semesterferien.”
„Oh, Sie studieren?”
„Ja, Kunstgeschichte und Französisch.”
„Wo?”
„In Tübingen.”
„Ah, aus dem Ländle, hört man aber gar nicht …”
„Nein, ich bin aus Essen. Meine Eltern leben noch dort. Sie kommen bald her.”
„Sie haben hier eine Ferienwohnung?”
„Ja, im Haus Lehmann”
„Ah, bei Mama Lehmann.”
„Sie kennen sie?”
„Oh ja. Bitte gehen Sie jetzt, ruhen Sie sich aus, halten sich aber zu unserer Verfügung.”
Malvoisin wendet sich ihr im Weggehen nochmals zu.
„Wie lange haben Sie den Korb H 55 schon?”
Nicole steht auf.
„Eine Woche.”
„Haben Sie den Toten schon vorher gesehen, ich meine, als er noch lebte?”
Malvoisin sieht sie forschend an.
„Oh ja, er gehört zu den Rettungsschwimmern. So wie der sich vor der Rettungsstation immer aufbaute war er nicht zu übersehen. Na ja,” − sie schaut traurig − „ein Angeber, aber ein schöner Typ war er schon, irgendwie. Ist ja auch groß, äh, war …”
Sie schnieft.
„Dankeschön. Wir kommen auf Sie zu. Übrigens, wie lange bleiben Sie noch?”
„Drei Wochen.”
Nicole verschränkt die Arme und will weggehen.
„Fritz! FRITZ!”
Malvoisin sieht sich nach seinem Assistenten um. Er spricht Nicole nochmals an.
„Ich danke Ihnen für Ihre Auskunft. Sollte Ihnen doch noch etwas einfallen, hier haben Sie meine Karte. Bitte melden Sie sich gleich. Auch Kleinigkeiten sind wichtig.”
Nicole nimmt wortlos die Karte, steckt sie ein und entfernt sich.
Langeland dreht sich in die Richtung des Rufes. „Komme!” Er stapft auf seinen Chef zu. „Der Gast da hinten …“ Malvoisin folgt der angedeuteten Blicklinie Langelands Kopfdeuten. „… ist gestern abend noch am Strand spazieren gegangen, hat aber nichts gesehen, was uns weiterhelfen könnte. Aber …?”.
Langeland sieht Malvoisin fragend an.
„Fritz. Ruf’ mal die Schiffsdienste in Timmendorfer Strand an, daß sie heute vormittag hier nicht anlegen können. Die Brücke bleibt dicht.”
Langeland verzieht sein Gesicht.
„Na, das Gemaule wegen des entgangenen Umsatzes hör’ ich schon.”
„Mach’s einfach.”
Langeland zückt sein Handy.
Inzwischen „eilt” die Spurensicherung herbei. Malvoisin entdeckt sie und geht gleich den ersten Kollegen an.
„Moin Hans. Mensch, wo bleibt Ihr denn? Das ist hier doch nicht Brigadoon, das auf keiner Karte verzeichnet ist!”
„Das mag ja sein, aber wir hatten drei Trecker vor uns und immer Gegenverkehr.”
„Hat man Euch das Blaulicht weggenommen?”
„Hast Du vergessen, wo wir hier sind?”
Hans Nielsen sieht ihn grinsend an.
„Vertell mol de Buern wat ‘ne Einsatzsirene is! Und wenn ich dem zugerufen hätte, wir müßten zu einem Tötungsdelikt, da sagt der glatt zurück: ‚Man jümmers sinnig, de is doch al dood, de hett nix mehr to vertellen’ und dann tuckert der gemütlich weiter. In Lübeck kannst de Lüüd mit Blaulicht beeindrucken, aber hier doch nich‘. Man jümmers suutje un damit is allens seggt.”
Jetzt kann selbst Malvoisin sich ein Grienen nicht verkneifen und sagt bloß noch schulterklopfend: „Nu mook mol Dien Kram.”
Malvoisin läßt die Spurensicherung ihre Arbeit machen und stapft zum Strandkorbhäuschen der Frau Horch. Sie steht bereits aufgeregt an der Sperre, neben ihr ihr Lebenspartner, der pensionierte Kriminalrat von Greiff.
„Herr von Malvoisin, was ist denn nun los hier? Stimmt das mit dem Toten? Mein Mann sagte mir gerade, wir müßten mit bis zu sechs Stunden Sperre rechnen. Kommt das wohl hin?”
Marga Horch bleibt auch angesichts der ungewöhnlichen und aufregenden Situation bei ihrer ruhigen und liebenswürdigen Art, die ihre Gäste so sehr an ihr schätzen. Nur ihr Gesicht weiß nicht so recht, ob es nun blaß oder von rötlich frischer Farbe sein soll. So wechselt es sie hin und her.
„Moin, moin, liebe Frau Horch.”
Malvoisin bleibt vor ihr stehen.
„Es ist leider so. In Ihrem Korb 55 befindet sich die Leiche eines jungen Mannes … Moment.” Er unterbricht sich selbst.
„Weber! WE-BER!”
Augenblicke später.
„Herr Hauptkommissar …”
„Hier haben Sie mein Handy. Bild vom Toten, dann wieder zu mir. Hier draufdrücken.“
„Für wie dämlich hält er mich! Jawohl, Herr Hauptkommissar! Bild vom Toten.“
Weber stapft zum H 55 und verdreht die Augen.
Malvoisin wendet sich Horch und Greiff zu.
„In diesen unmittelbaren Abschnitt des Strandes einschließlich der Brücke können Ihre und dritte Gäste bis zum Ende der Spusi-Arbeit nicht. Es geht nicht anders.“
„Sie werden sicher den Strandkorb mitnehmen müssen, Herr Kollege.“
„Oh ja, das müssen wir, Herr Kriminalrat. Selten können wir einen Tatort abtransportieren, aber hier können und müssen wir. Sie bekommen ihn so bald als möglich zurück.“
„Dürfen wir die Lücke mit einem Reservekorb auffüllen?“, fragt Frau Horch, besorgt über den möglichen Verdienstausfall. Dreißig €uro die Woche oder acht €uro Tageskorb − das ist auch Geld.
„Aber selbstverständlich“, beeilt sich Malvoisin, sie zu beruhigen. „Sobald die Spusi ihre Arbeit beendet hat, der Sand durchgesiebt ist und wir abgezogen sind, steht dem nichts im Wege.“
Horch und Greiff verständigen sich wortlos mit Blicken. Der Mann hat seinen Auftrag.
„Herr Hauptkommissar. Bitte, Ihr Handy mit Bildern des Toten.“
Hauptmeister Weber reicht Malvoisin das photographierende Telephon. Der hält es Horch und Greiff hin.
„Kennen Sie den jungen Mann?“
Das Vermieterehepaar betrachtet das Bild im Anzeigenfeld genau.
„Tjoo“, setzt Frau Horch an. „Das ist doch einer der Rettungsschwimmer. Der zog alle Blicke auf sich, über ein Meter neunzig groß. Weißt Du nicht, wie er heißt?“ Marga Horch sieht ihren Mann an.
„Jo, doch. Den hat hier mal jemand ‚Malte‘ gerufen, aber weiter weiß ich auch nicht.“
Malvoisin ist zufrieden.
„Danke. Sie haben uns schon sehr geholfen. Ich muß dann mal.“
Malvoisin setzt seinen Rembrandt auf, verneigt sich kurz.
„Denn tschüs zusammen, Und falls Ihnen zu dem Toten etwas einfällt …“
Greiff macht stumm das Handzeichen des Telephonierens.
„Danke. Wir sehen uns.“
„Und viel Erfolg“, lächelt Frau Horch Malvoisin an.
„Tja, mal sehn.“
Malvoisin wendet sich ab und kehrt zum H 55 zurück.
„Nee, is dat nich allens gresig“, hört er sie noch murmeln. Er sagt nichts, er sagt nie viel, ist in Gedanken schon auf dem Weg zum Strandkorblager.
„Hans, was habt Ihr?”
„Eine Reihe Fingerabdrücke, wenig frisches. Abgeriebene Sonnencreme, ein paar schwarze Haare in der Korbritze. Und auf den ersten Blick hat der Tote Salz auf der Haut …”
„Das sagte Klinge schon, und die schwarzen Haare sind entweder vom Toten …”
„Es sind lange Haare.”
„… dann sind sie sehr wahrscheinlich von der Korbmieterin.” Malvoisin sieht sich um. „Kann Anderson den Toten jetzt mitnehmen?”
„Photos haben wir, sonst auch alles. Übrigens, neben der Brücke muß einer sein Brett vor dem Kopf verloren haben. Erste Kollegenbefragungen haben nichts ergeben. Keiner vermißt eines.” Er grinst schelmisch. Malvoisins rechte Augenbraue fährt hoch. Ihm ist gerade nicht nach Witzen. Nielsen räuspert sich. „Wir nehmen es mal mit. Man könnte es für eine Planke halten, doch es ist nicht glatt. Aber ab dafür. Das Sandaussieben dauert noch ‘n Weilchen. Bringt vermutlich nur jede Menge alter Kippen, die die Schweinigels einfach in den Sand stecken. Methode ‚Wozu ‘nen kleinen Aschbecher festhalten, wenn ich für den großen Kurtaxe zahle‘.” Malvoisin sieht sich um und entdeckt, was er sucht.
„Hans, die Korbmieterin steht da hinten am Strandkaufhaus. Nicole Neumayer heißt sie. Lauf man fix hin und laß Dir ‘ne Haarprobe geben; dann könnt Ihr sofort vergleichen.”
Hans Nielsen rennt gleich los. Er erwischt die junge Frau noch. Sie sieht ihn erst überrascht an, zupft sich dann aber doch gleich Haare aus und läßt sie in die ihr hingehaltene Plastiktüte gleiten. Nielsen bedankt sich, Nicole verschränkt die Arme und geht mit gesenktem Kopf über den Vorplatz am Seemannsdenkmal vorbei zur Strandstraße. Sie will nur noch ins Bett und heulen.
An ihr vorbei strömen die Badegäste, ein paar Senioren Arm in Arm, junge Eltern mit quicklebendigen Kindern, schöne Mädchen, hübsche Burschen, einige viel zu dicke Teenager. Sie hat für niemanden einen Blick übrig. Neben dem Strandkaufhaus baut die Obstverkäuferin ihren Stand auf. Sie hat schon gehört, was passiert ist. „Wird der wieder lebendig, wenn ich mich jetzt aufrege”, denkt sie bei sich. „Der kauft mein Obst nicht mehr und die 20 Neugeborenen von Hamburg heute morgen auch nicht, aber die Gäste, die heute zum Strand kommen. Also bau ich mein gutes Obst auf − fertig.” Gemütsruhe ist etwas Wunderbares.
Der Tote wird in den Sarg gelegt. Der wird geschlossen und weggetragen.
Professor Anderson sieht dem Abtransport kurz hinterher und wendet sich Malvoisin zu.
„Du hast meinen Bericht heute abend, bekommst eine schöne Bettlektüre.”
„Hau schon ab!”
Malvoisin spricht seinen stumm das Geschehen beobachtenden Kollegen Hauke Tewes an.
„Kommst Du, Mokwi? DLRG.“
„Jou.“
Malvoisin und sein schweigsamer Kollege stapfen im Sand auf die Promenade zu und wenden sich dort in Richtung der DLRG-Station. Die Spusi-Leute betreten gerade die Seebrücke und suchen auf beiden Seiten die Geländer ab.
*
„Was ist denn da los?“
„Haben Sie schon gehört was da passiert ist?
„Einen Toten soll es gegeben haben!“
Einige Leute sind stehengeblieben und beobachten jenseits der inzwischen funktionierenden Sperre, was am sonst so beschaulichen Strand los ist. Es kommen erste Gäste, um sich über die Absperrung zu beschweren, aber sie müssen wieder gehen. Drei Kinder nörgeln:
„Mami, warum dürfen wir nicht an den Strand?”
„Keine Ahnung. − Frau Horch, was ist denn hier los?”
„Frau Hansen, wir haben einen Toten …”
„Bitte was? Um Gottes Willen, was ist denn passiert?”
Herr von Greiff übernimmt.
„Kommen Sie bitte gegen Mittag wieder, dann ist der Strand sicher wieder frei”, und sieht sie freundlich an.
„Kommt Kinder, wir gehen zum Waldspielplatz” und zu Horch und Greiff gewandt, „… und den halben Tag bekommen wir doch erstattet, nicht wahr?”
Herr von Greiff macht gute Miene zum bösen Spiel. „Selbstverständlich, Frau Hansen, immer Dienst am Gast!”
„Na, wenn das so ist, sehr freundlich”, und schiebt damit ihre Kinder in Richtung Strandcasino und Ausgang.
„Hört von einem Toten und denkt nur ans Geld.” Greiff schüttelt verständnislos den Kopf.
Ein die Szene beobachtender Mann meint trocken zu seiner Frau:
„Na Liebling, dann machen wir heute unseren Ausflug nach Fehmarn.”
Horch und Greiff verschwinden kopfschüttelnd im Strandkorbhäuschen.
*
Malvoisin, begleitet von seinem Assistenten Hauke Tewes, genannt Mokwi, der zu ihm aufgeschlossen hat, nähert sich der DLRG-Station. Es ist baulich eine optische Beleidigung.
Malvoisin kannte die wunderbar altmodische Lesehalle seit seiner Kindheit. Auf dem Platz vor ihr fanden früher die sommerlichen Platzkonzerte statt. Wie oft war er mit anderen Kindern dem Blasorchester zur Waldstraße entgegengelaufen und hatte den Musikern in ihren marineähnlichen, blauen Jacken mit goldenen Knöpfen und den weißen Mützen bis zur Promenade Marschgeleit gegeben. Die Einheimischen waren dagegen, aber ein traditionsloser Bürgermeister ließ den hübschen Bau in einer Nacht- und Nebelaktion abreißen. Malvoisin konnte sich damit nie abfinden. Aber es war ja auch das schöne alte Hotel zur Post am Ring beseitigt und gegen belanglose Architektur ausgetauscht worden. Die alte Schule, die Heimatmuseum werden sollte, verschwand über Nacht. Gewachsene Geschichte wird gegen geltungssüchtige Bürgermeister immer verlieren. Daß künftige Generationen damit bestohlen werden − wer fragt danach. An dem Betonmonster hochschauend murmelt vor sich hin:
„Der Kasten wird auch nicht mehr schöner… dat süht ut as hinscheten.”
Vor dem Bau steht ein etwa 45jähriger Mann mit roter DLRG-Kleidung und Fernglas in der Hand.
Malvoisin und Tewes grüßen knapp.
„Moin! − Moin.”
Der DLRG-Mann sieht sie kaum an.
„Moin!”
„Wir suchen den Chef der Mannschaft …”
Der DLRG-Mann sieht Malvoisin und Tewes prüfend an.
„Sie haben ihn gefunden.”
Malvoisin zückt seinen Ausweis.