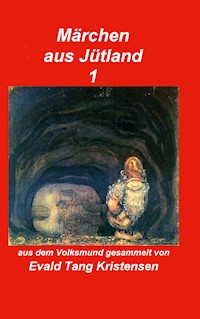
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Märchen aus Jütland
- Sprache: Deutsch
Im Rahmen seiner zwischen 1871 und 1897 erschienenen Buchreihe Jyske Folkeminder (Jütische Volksüberlieferungen) veröffentlichte Evald Tang Kristensen, der mit Abstand bedeutendste dänische Sammler traditioneller Lieder, Sagen und Märchen, unter anderem vier Bände mit Märchen aus Jütland (Æventyr fra Jylland). Ganze neun dieser Märchen waren in deutscher Sprache im 1915 erschienenen ersten Band der "Nordischen Volksmärchen" von Klara Stroebe in der Reihe "Die Märchen der Weltliteratur" enthalten. Ansonsten sind die Märchen unserer nördlichen Nachbarn in Deutschland nur wenig bekannt. Dem soll mit dieser vollständigen Übersetzung des 1. Bandes abgeholfen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Umschlagbild wurde mit leichter Veränderung einer Illustration von John Bauer zu dem Märchen „När Trollmor skötte Kungens Storbyk“ von Elsa Beskow in Bland Tomtar och Troll 1914 entlehnt.
Inhalt
Vorwort des Übersetzers
Aus dem Vorwort von 1881
Die Prinzessin aus Babylonien
Der goldene Turm am Ende der Welt
Die Prinzessin mit dem Wunschring
Die rote Kuh
Der kleine Goldschuh
Aschepatsche, die Königin wurde
Klein Mette
Die Prinzessin im Hügel
Karl Finkelvaters Tochter
Jesper Hasenhirt
Der dritte Sack voll
Die Kennzeichen der Prinzessin
Peter Rothut
Holzschuhe, roter Rock und Spenzer
Jungfer Hellauge
Die kleine Wildente
Die Mädchen im Brunnen
Die Schätze im Heidehaus
Goldschwein, Goldenten und Mundharmonika
Das Pfannkuchenhaus
Die goldene Feder
Hans und der graue Esel
Das springende Wasser und der klingende Baum und der sprechende Vogel
Die Prinzessin in Arabien
Prinz Karl und das weiße Pferd
Der Tippeltopf
Die Mühle auf dem Meeresgrund
Des Teufels Hofjäger
Der Soldat und der Alte Erik
Im Bund mit dem Teufel
Des Teufels Dienstboten
Der Schmied und der Teufel
Saugferkel
Der Knecht des Bergmanns
Mein Dienst beim Bergmann
Der Überwinder des Bergmanns
Die Schwestern im Hügel des Bergmanns
Das Rätsel
Der weiße Seidenjunge
Der grüne Junge und die drei Hexen
Die erlösten Prinzessinnen
Der Stahlmann
Der kleine rote Troll
Reicher Peter Krämer und Armer Paul Schmied
Das Glück zieht um
Die langen Nasen
Der unwillige Bauer
Die drei Raben auf dem Galgen
Ein Kerl für eine Kuh
Das schwatzhafte Mädchen
Vorwort des Übersetzers
Evald Tang Kristensen (1843–1929) war ein dänischer Schullehrer und ein bedeutender Sammler von Volksüberlieferungen. Die Museen in Vejle (Jütland) bezeichnen ihn sogar als der Welt größten Sammler solcher Überlieferungen. Im Gegensatz zu dem bekannteren Svend Grundtvig, der sich zur Hauptsache auf fremde Beiträge stützte, reiste er selbst in seiner Heimat Jütland, dem dänischen Festland, umher, zunächst in seiner Freizeit als Lehrer, später, nachdem man ihn von seinen Unterrichtsverpflichtungen befreit hatte, ausschließlich. Er interviewte 3.3481 Menschen und zeichnete ihre Sagen, Märchen und Lieder auf. Dabei kam ihm mit Sicherheit zugute, dass er mehrere Dialekte seiner jütischen Heimat beherrschte und sich somit mit seinen Informanten in deren Alltagssprache unterhalten konnte. Sein Nachlass umfasst erstaunliche 24.000 handgeschriebene Seiten, darunter etwa 2700 Märchen.
Dankenswerterweise veröffentlichte Evald Tang Kristensen die so gesammelten Märchen nicht im Dialekt, sondern auf Reichsdänisch. Dennoch sind aber viele jütische Regionalismen darin enthalten, von denen eine beträchtliche Anzahl in einer Liste am Anfang des Buches in der Schriftsprache erklärt sind. Aber eben nur erklärt, nicht in Reichsdänisch übersetzt, was die Arbeit für einen Übersetzer nicht einfacher macht, denn die Erklärung führt ja nicht ohne weiteres zur treffenden Übersetzung, wie offensichtlich der Sammler und Herausgeber auch keine hochdänische Entsprechung fand, sonst hätte er ja nicht den Dialektausdruck verwendet. Deshalb war es in der nunmehr vorliegenden deutschen Ausgabe nicht immer möglich, eng am Originaltext zu bleiben.
Ein anderes Phänomen, das eine zu große Nähe zum Original unratsam erscheinen ließ, aber offenbar eine typische Erscheinung in dänischen Volksmärchen ist, stellt die Durchmischung der grammatischen Verbformen dar. Da werden zum Teil Präsens- und Präteritumformen bunt gemischt, und das durchaus auch innerhalb eines und desselben Satzgefüges. Dies entsprechend im Deutschen nachzuvollziehen, würde zu manchmal schon sehr gewöhnungsbedürftigen Konstruktionen führen.
Darum wurde diese Übertragung durchgehend in der Vergangenheit gehalten, wie man es von deutschen Märchensammlungen gewohnt ist.
Eine weitere Schwierigkeit lag darin, dass nicht unbedeutende Teile der Texte aus verkappter indirekter Rede bestehen, das heißt, es wird zwar das Gesagte ausgedrückt, aber es gibt keine Begleitsätze, die deutlich machen, dass überhaupt jemand spricht, und der Text wirkt wie eine „normale“ Erzählung, da das Dänische keinen Konjunktiv kennt. Hier galt es immer wieder zu entscheiden zwischen Erzähltext und indirekter Rede, was hoffentlich weitgehend gelungen ist.
Die hin und wieder verwendeten Fußnoten enthalten ganz überwiegend Anmerkungen des Übersetzers. Wo es sich um Anmerkungen von Evald Tang Kristensen handelt, ist dies durch den Hinweis „Anm. E. T. K.“ kenntlich gemacht.
Auf eine vollständige Wiedergabe des Originalvorworts von 1881 wurde bewusst verzichtet, da die weggelassenen Teile hauptsächlich ein Verzeichnis der Beiträger enthalten sowie einige kurze Bemerkungen zu Tang Kristensens ganzem Projekt, was aus heutiger Sicht entbehrlich erschien.
Handewitt 2023
Klaus-Peter Asmussen
1 Laut Wikipedia sogar 6500.
Aus dem Vorwort von 1881
Das vorliegende Buch ist nicht ausschließlich für Kinder geschrieben, es ist aber doch so viel Rücksicht wie möglich darauf genommen worden, dass auch Kinder Freude daran haben können, darin zu lesen, und wenn doch für jemand sehr Feinfühliges etwas Anstößiges darin enthalten ist, dann liegt dies an dem Wesen des Märchens, dass das Schlichte, zu einem gewissen Grad Platte, auch dazugehört. Man denke an seine Entstehungszeit und seine Mitteiler. … Was den Inhalt der Märchen betrifft, da habe ich nur in einem Einzelfall selbst meine schriftlichen Aufzeichnungen verändert, aber ich habe in einigen Fällen mehrere Aufzeichnungen zu einer verbunden, wenn sie sich nämlich so nahestanden, dass dies ohne Gewaltanwendung geschehen konnte. Wenn mir von einem einzelnen Märchen bis zu zwanzig Aufzeichnungen aus verschiedenen Quellen vorliegen, kann leicht der Fall eintreten, dass der eine Erzähler wichtige Züge vergisst, an die der andere sich erinnert, und dann ist es doch nur natürlich, die beiden Aufzeichnungen einander ergänzen zu lassen. Aber ebenso kann der Fall eintreten, dass die Varianten so weit voneinander entfernt sind, dass sie nicht vereint werden können und doch neben ihrer Eigenart jede für sich ihre Vorzüge haben. In solchen Fällen habe ich im Buch einige der Varianten nebeneinander stehen lassen, während ich andere habe verwerfen müssen, um das Buch nicht zu eintönig werden zu lassen.
Die des Märchens Unkundigen werden gebeten zu beachten, dass die Reihe, wo der Teufel die Hauptperson ist, nicht so schlimm ist, wie es scheint, da er als Märchenbegriff ein einfältiges Wesen ist, mit dem man seine Späße treiben darf. Der Begriff geht unmerklich über in den Troll- und Berggeistbegriff, wofür dieselbe Regel gilt. Der Böse selbst wird in Sagen getreuer dargestellt, obgleich sich natürlich auch Übereinstimmengen zwischen dem bösen Geist der Sage und dem des Märchens finden.
…
11.8.1881
E.T.K.
1. Die Prinzessin aus Babylonien2
(Prinsessen i Babylonien)
Es war einmal ein Bauer auf Seeland, der war Pachtbauer auf einem Gutshof in seiner Nachbarschaft. Nun hatte er mehrmals mit dem Gutsherrn darüber verhandelt, den Hof zu kaufen und Eigentümer zu werden, aber das ließ sich nun nicht machen. Aber dann besaß der Gutsherr noch ein Stück Land, das nicht urbar zu machen ging – Moor und Sumpf und wüster Wald mit Wurzeln und Krimskrams –, das in der Nähe des Besitzes des Bauern lag, und das wollte er gerne haben. Da verhandelte er mit dem Gutsherrn, ob er das nicht verkaufen wolle, denn davon habe er ja keinerlei Nutzen, so wie es daliege mit Hügeln und Löchern und in erbärmlichem Zustand. Doch, das mache keinen Unterschied, das Stückchen hatte der Gutsherr nicht auf der Rechnung, und der Bauer kaufte es ihm für ein halbes Hundert Taler ab. Als er nun Papiere darüber bekam, musste er es in Arbeit nehmen, und er hatte drei erwachsene Söhne, die sollten die Hügel abgraben und die Löcher einebnen und so weiter.
Da verbrachten sie ein ganzes Jahr damit, zu ebnen und trockenzulegen, bis schließlich alles glatt und eben und dienlich war für den Pflug, bis auf ein winziges Loch mitten in dem Stück, das sich nicht trockenlegen ließ. Schließlich erzählten sie ihrem Vater, es nütze nichts, noch weiter darüber nachzudenken, wenn das Loch am Abend aufgefüllt sei, sei es am Morgen wieder offen. „Ja, dann lasst ihr es eben sein“, sagte er, „und nun geht es ans Pflügen.“
Als nun der Boden vorbereitet war, säten sie dort acht Tonnen3 Weizen, und das Korn ging ausgezeichnet auf und stand so herrlich, dass der Mann jeden Tag hinging, um sich daran zu erfreuen – Weizen ist ja das Beste auf Neuland, muss ich sagen. Er stand nun ganz gut bis zur Johannisnacht, aber dann ging das Korn aus bis zum letzten Halm, es blieb nicht das Geringste übrig, und der Mann sah das am Morgen, als er hinging, um das Vieh zu verlegen. Er kam ganz traurig nach Hause und erzählte den Söhnen, was geschehen war. Ja, sie unterhielten sich darüber, was jetzt zu unternehmen sei, und wurden sich einig, den Boden noch ein Jahr zu besäen und dann in der nächsten Johannisnacht beim Korn Wache zu halten.
Da sollte es der älteste Sohn dann als Erster versuchen. Als er am Abend dort ankam, gab es ein solches Donnern und Blitzen, dass es ihm vorkam, als schlüge es rings um ihn ein, und es regnete nun zugleich so furchtbar, dass er sich nicht traute, länger dort zu bleiben, sondern nach Hause lief und sich in sein Bett warf. Am Morgen, als sie hin wollten um nachzusehen, wie es sich mit dem Weizen verhielt, war da kein bisschen mehr vorhanden. Da mussten sie aufs Neue an die Arbeit, denn sie wollten ja zumindest den Einsatz wieder aus dem Boden heraushaben, wenn das möglich wäre. Der zweite Sohn bat darum, wieder Weizen zu säen, denn dann wolle er das nächste Mal dabei wachen, sagte er, und dann solle es nicht so ablaufen. Ja, dann könne er seinen Willen bekommen, sagte der Vater, wenngleich er sich gedacht habe, etwas anderes zu säen, man könne sich dort ja arm säen, sagte er.
Nun sollte der zweitälteste Sohn also hin und aufpassen, und als die Zeit kam, ging er, aber da gab es so einen Donner und Blitz und Regen, dass es entsetzlich war, und er kam auch nicht zu der Stelle, sondern lief im größten Schrecken nach Hause. Als sie dann am nächsten Morgen nachsahen, war der Weizen weg. Nun verzagten sowohl der Vater als auch die Söhne, die beiden besonders. Aber da sagte der jüngste, den nannten sie den verrückten Krischan, und der bewegte sich zwischen Wind und Strom, war aber im Übrigen nicht so dumm, wie man von ihm glaubte: „Sät nun gleich noch einmal, dann will ich aufpassen.“ Da sagte der Vater: „Was hilft das! Nein, können die Klugen nicht aufpassen, dann können die Doofen es noch viel weniger.“ Aber Krischan hörte nicht auf zu quengeln, ob sie nicht doch ein weiteres Jahr säen wollten, und seine Mutter bat für ihn, und da sagten sie schließlich ja zu ihm.
Nun mussten sie also das vierte Jahr den Boden bestellen, und der Weizen entwickelte sich prächtig, genau wie vorher. Am Abend vor dem Sankt-Johannis-Tag, als Krischan seine Abendarbeit erledigt und sein Abendbrot gegessen hatte, musste er ja los, aber da rief ihn die Mutter: „Komm mal her, lieber Krischan, ich will mit dir reden! Sieh mal, hier hast du ein paar Butterbrote in einem Tuch, die sollst du als Verpflegung mithaben, und dann pass auf, dass du nicht zu früh nach Hause rennst, hörst du, lieber Krischan!“ Ja, er werde sich schon tapfer halten, und dann stiefelte er los hin in den Weizen.
Da gab es so ein furchtbares Donnern und Blitzen und Regen, dass es ganz entsetzlich war; aber er dachte bei sich: „Ja, jetzt regnet’s, es wird wohl nachher wieder trocken“, und ging weiter. Da fiel ihm das Loch ein, das sie nie einebnen konnten, und darum herum war immer so langes Gras, das wusste er, weshalb er sich dorthin begab, aber finster und Regen war es und Sauwetter. Als er sich nun ein bisschen in das lange Gras gelegt hatte, wurde es plötzlich herrlich helles und sternenklares Wetter, und da wollte er das Tuch aufmachen, das seine Mutter ihm mitgegeben hatte, um einen Bissen zu nehmen; aber da hörte er auf einmal ein Geräusch wie von Schwänen. „Was ist das für eine seltsame Sache, zu dieser Zeit Schwäne zu hören“, dachte er, und gleich darauf kamen drei Schwäne angeflogen und landeten an dem Loch dicht bei ihm. Krischan drückte sich ja ins Gras, damit sie ihn nicht sehen sollten. Dann legten sie ihre Federkleider ab, und nun konnte er sehen, es waren drei Prinzessinnen. Sie begaben sich alle in das Loch und wuschen sich.
Da schob Krischan sich im Gras hin und bekam Kleider und Federkleid der einen zu fassen. Endlich kamen sie wieder heraus, und zwei fanden ihre Sachen und flogen davon, aber die dritte konnte ja ihr Federkleid nicht finden. Als sie nun ganz verängstigt dastand und sich umsah, erblickte sie Krischan. Sie bat ihn ganz inständig, ihr doch ihr Zeug zu geben, damit sie den Schwestern folgen könne. „Nein“, sagte er, „deine Kleider bekommst du nie und nimmer, es sei denn, du versprichst mir, meine Braut zu werden.“ Dieses Versprechen musste sie ihm geben, und dann bekam sie ihre Kleider, aber das Federkleid bekam sie nicht, bevor sie ihm ganz bestimmt versichert hatte, dass sie ihn heiraten wolle. Nun war diese Verlobung in Kraft. Dann sagte sie, dass sie heute in einem Jahr ganz bestimmt am Sankt-Johannis-Abend schon auf den Hof seines Vaters kommen und mit ihm Hochzeit feiern werde, das sei sicher, und sie zog einen Goldring von ihrem Finger und steckte ihn an Krischans Finger als Verlobungsgeschenk. „Den darfst du niemals verkaufen“, sagte sie, „es sei denn, dir würden zehntausend Taler dafür geboten, dann kannst du ihn gehen lassen.“ Dann wollte Krischan ja wissen, woher sie sei. Ja, sie sei die Tochter des Königs von Babylonien, und damit sagte sie ihm Lebewohl.
Dann wurde es auch schon bald Tag, und Krischan trottete durch den Weizen nach Hause; da war so viel, dass er nur schwer hindurchwaten konnte. Vorher war das Korn von dem Wasser verdorben worden, das sie von ihren Flügeln geschüttelt hatten, wenn sie abflogen, aber nun hatte die Prinzessin ihm versprochen, dass es in Zukunft so reichlich wachsen werde, dass das, was sie verdorben hätten, dadurch erstattet werden könne.
Krischan ging nach Hause und legte sich hin, und als die Mutter heraufkam und in die Kammer ging, um nach ihm zu sehen, lag er und schlief; aber seine eine Hand, an der der Goldring steckte, lag oben auf der Bettdecke. Da sprach sie mit dem Vater, und sie weckten ihn.
„Wo bist du heute Nacht gewesen?“, sagte er.
„Ich bin im Weizen gewesen.“
„Was ist das denn für ein Goldring? Hast du den gestohlen, du dummer Bengel?“
„Nein, den hat meine Braut mir gegeben.“
„Deine Braut! Na, wer ist das denn?“
„Das ist die Tochter des Königs von Babylonien.“
„Ja, es stimmt schon, dass du verrückt bist“, sagte der Vater, und dann gingen sie hinaus, um nach dem Weizen zu sehen.
Der stand hinreichend gut, und es war so viel, dass das Feld davon strotzte. Nun wussten sie nicht recht, was sie glauben sollten.
Dann ging es auf den Herbst, und sie mussten den Weizen dreschen. Da sollte Krischan mit der ersten Fuhre nach Kopenhagen hineinfahren. Dort begegnete er einem Juden, der ihm das Korn für acht Taler die Tonne abkaufte. Aber dann fiel dem Juden der Goldring auf, der an seinem Finger steckte, und er wollte ihn für achttausend kaufen. Nein. Sie verhandelten etwas darum, und es kam ein zweiter Jude dazu, der bot neuntausend. „Ja, dann lass mich noch tausend zulegen.“ Das Geld erhielt er in einzelnen Scheinen, und das war ein ordentlicher Haufen Geld. Aber Krischan tat, als sei nichts, und band ein paar alte Zeitungen und Strohseile um die Scheine, und dann legte er sie unter sein Sitzpolster; das Geld für den Weizen aber warf er hinten in den Wagen.
Als der Vater kam und ihm beim Ausspannen half, sagte er: „Was sind das für Bündel?“
„Das ist Geld; dies hier ist für den Weizen, und das ist für den Goldring, den ich verkauft habe; aber nun will ich eine Abmachung mit Euch treffen. Wenn Ihr meine Hochzeit ausrichten wollt, dann will ich Euch vierhundert Taler geben, und das Geld sollt Ihr bekommen, ob ich nun verheiratet werde oder nicht.“
„Ja, es spricht nichts dagegen, dass ich das will, aber wen willst du heiraten?“
„Die Tochter des Königs von Babylonien“, sagte Krischan, „und die Hochzeit soll drei Tage dauern. Der Pfarrer, der Küster und der Gutsherr sollen mit, und es sollen im Ganzen einundzwanzig Personen sein.“
Damit zählte er die vierhundert Taler ab und reichte sie dem Vater hin.
Dann wurden die Gäste eingeladen, und das Fest sollte gerade an einem Sonntag stattfinden. Aber nein, Krischan wurde nicht verheiratet. Der Montag verging auch, und er schlenderte draußen herum und war nicht viel bei der Gesellschaft. Wenn sie mit ihm über die Braut redeten, sagte er: „Ja, sie wird schon kommen.“ Dann ging es auf den Nachmittag des dritten Tages, und da verschwand Krischan, und da glaubten sie, er sei weggelaufen, aber hin zum Abend kam er und war so herausgeputzt und geschmückt, dass es eine Pracht war. Als es zwölf Uhr wurde, ging er hinaus, und da standen zwei Kutschen vor der Tür. Nun kam die Prinzessin herein, aber da sagte der Gutsherr: „Die kriegst du nicht, bevor du mir die Bäume gefällt hast, die rund um meinen Hof stehen, und das musst du in weniger als einer Stunde schaffen.“ Der Hof lag aber in einem ganzen Wald.
„Das hat keine Gefahr“, sagte die Prinzessin, und sie ging hinaus zu ihrer Kutsche und holte eine kleine Axt, die darin hing. „Nimm jetzt diese Axt“, sagte sie zu Krischan, „und geh hin zu einem Baum, den du mühelos heben kannst. Beim ersten Hieb mit der Axt musst du sagen: ‚Fallt um!‘, dann fallen alle Bäume, die es im Wald gibt.“
Da ging er und kam zu einer kleinen Tanne, die dicht an der Feldscheide stand. Dann tat er, was die Prinzessin gesagt hatte, und bei dem einen Hieb fielen alle Bäume im Wald um, worauf er nach Hause ging und sagte: „Jetzt ist das erledigt.“
„Ja“, sagte der Gutsherr, „das ist gut und schön, aber als Nächstes musst du sie Stamm für Stamm wieder aufrichten, wie sie vorher waren, sonst gebe ich nicht mein Einverständnis, dass du mit dem fremden Frauenzimmer fortreist.“
„Ja, das ist leicht getan“, sagte sie, „wenn du nur den Baum, den du zuerst umgehauen hast, finden und ihn bestimmt auf seinen Platz setzen kannst mit den Worten: ‚Steht auf!‘, denn dann müssen alle anderen auch wieder aufstehen.“
Er ging in den Wald und tat, was sie gesagt hatte. „Jetzt ist es erledigt“, sagte er zum Gutsherrn, „daran dürfte nichts auszusetzen sein.“
„Noch kriegst du sie nicht“, erwiderte er, „vor drei Jahren waren da drei Teufel, die haben mir eine Kiste voll Geld gestohlen, und die steht ganz unten in der Hölle, wenn du mir die holen kannst, dann kannst du sie kriegen.“
Sie erwiderte: „Das soll bald geschehen“, und dann ging sie wieder zur Tür und befahl dem Kutscher, die linke Stute von der Kutsche abzuschirren. Die wurde nun gesattelt, und dann nahm sie selbst eine Schraube, und damit schraubte sie dem Pferd beide Ohren zusammen, damit die Teufel sich nicht dort zwischen die Ohren setzen konnten. Als das getan war, hoben sie Krischan in den Sattel, so dass er nun ritt, und schließlich bat sie ihn, dass er sich nicht umsehen solle und nichts nehme oder danach greife von dem, was ihm begegne.
Da musste er ans Reiten, und das ging ganz lustig, aber plötzlich gab es so ein hässliches Klirren am Hinterhuf seiner Reitstute, und da sah er sich ganz schnell um. „Sitz still!“, sagte das Pferd. Die Sache war die, dass es nicht hoch genug war und sein einer Hinterhuf einen Kirchturm berührte. Na, er ritt ja weiter, und schließlich kamen die drei Teufel mit der Truhe voller Geld angeschleppt, geradewegs auf ihn zu; aber er hörte ja trotzdem nicht auf zu reiten. Dann kamen sie wieder auf ihn zu und machten Anstalten mit der Truhe, als wollten sie die dem Pferd auf den Rücken schleudern, und als es ihm so schien, als sei sie ganz dicht bei ihm, griff er danach. Schwupp! lag Krischan auf dem Boden und hatte nun weder Pferd noch Geld. Die Stute lief denselben Weg zurück und kam wieder zur Prinzessin, so dass sie nun wusste, wie es abgelaufen war, und da setzte sie sich in die Kutsche und reiste wieder zurück nach Babylonien. Es gab fürs Erste also keine Hochzeit.
Der arme, bedauernswerte Krischan irrte nun dort unten umher. Er kam durch eine Heide, und als die aufhörte, kam er in einen Wald. Da traf er auf zwei Riesen, die schlugen sich um einen Stiefel. Er ging auf sie zu, traute sich aber nicht ganz hin, weshalb sie ihn ansprachen und sagten, er solle näherkommen, was er dann auch tat. Da sagte der eine: „Bist du nicht ein Christ?“ Doch, das sei er. „Ja, dann komm, wir wollen mit dir reden. Hier stehen wir nun seit fünf Jahren und schlagen uns um den Stiefel, und wir sind noch nicht so weit gekommen, dass wir entschieden haben, wer ihn haben soll, deshalb musst ihn uns am liebsten abnehmen.“
Da sagte er: „Was ist denn für eine Besonderheit an dem Stiefel?“
„Das ist die, dass du, sobald du ihn anziehst, so viele Meilen schreiten kannst, wie du willst, und sei es bis ans Ende der Welt, denn so viele Meilen, wie du jeweils sagst, so viele Meilen kannst du in einem Schritt zurücklegen.“
Er wollte den Stiefel sofort ausprobieren, zog ihn an und sagte: „Fünf Meilen vorwärts!“, da war er sogleich da. Ja, das stimmte mit dem Stiefel.
Dann traf er wieder auf einen Wald, und dort wollte er gerne hinein, denn ihm war, als hörte er hin und wieder dumpfe und harte Schläge, und jeder ist ja gerne ein bisschen neugierig. Als er nun ein wenig hineinkam, standen da zwei Riesen und schlugen mit zwei großen Bäumen aufeinander ein. Bald erblickten sie Krischan, der auf sie zu geschlendert kam. „Bist du nicht ein Christ?“, sagten sie. Doch, das sei er. „Hier stehen wir seit zehn Jahren und schlagen uns um einen Zapfhahn, und keiner von uns hat den anderen überwältigen können, darum wollen wir ihn ebenso gerne weggeben, wenn du ihn vielleicht annehmen willst.“
„Ja, mit dem größten Vergnügen“, sagte er, und da brauchten sie sich nicht mehr zu schlagen.
Nun wollte er ja wissen, welchen Nutzen er davon haben könne. „Ja, wenn du ihn in Holz oder Mauerwerk oder Eisen setzt, kannst du jedes Getränk zapfen, das du dir wünschst.“
Nun wollte Krischan ja rasch weiter, und er sagte: „Zehn Meilen voran!“ Dort traf er auf noch einen Wald, das war jetzt der dritte, und drinnen hörte er wieder ein schweres Schlagen und Klopfen. Ja, da musste er sich umsehen und streifte ein wenig umher, worauf er noch zwei Riesen fand, die sich schlugen. Als sie ihn entdeckt hatten, sagten sie: „Bist du nicht ein Christ?“ Ja, das sei er. „Hier stehen wir seit fünfzehn Jahren und schlagen uns um ein Tischtuch, du kannst uns das wohl nicht abnehmen?“
Doch, das könne er gut, aber was denn Gutes daran sei?
„Ja“, sagten sie, „sobald du es ausbreitest, kannst du dir jedes Essen wünschen, das du willst.“ Er nahm das Tuch, bedankte sich und reiste seines Weges.
Aber dann wäre es fast schiefgegangen, denn er meinte ja, er müsse noch weit, und da sagte er: „Zwanzig Meilen voran!“, aber hatte dann das Pech, in einem Morast steckenzubleiben, und hätte beinahe sein Leben zugesetzt. Schließlich wühlte er sich heraus und gelangte auf trockenes Land, aber da war es lauter Heide, in die er geriet, und nichts als Heide sah er vor sich. Da streifte er eine Zeitlang in dieser Heide umher, und es war schwierig genug, dort voranzukommen, denn das Heidekraut war so lang, dass er nur schlecht gehen konnte. Endlich wurde er eine ganz kleine Hütte gewahr – so schien es ihm zumindest – aber das war nicht mehr, als dass der Dachfirst über das Heidekraut hinausragte. Na, als er näherkam und eintrat, saß da ein altes Weib, so ein Troll. Da sagte sie: Wo diese Person her sei? Ja, er sei aus dem Ausland, wisse aber im Übrigen nicht, wo er jetzt sei. Ob sie ihm nicht sagen könne, wo es ein Königreich gebe, das Babylonien heiße?
Nein, das könne sie wahrhaftig nicht, denn es sei seit vierhundert Jahren kein Christ auf diesem Land gewesen. Aber sie herrsche über alle Menschen, die auf dieser Insel seien und werde ihm doch gerne den Dienst erweisen, sie zu befragen, denn vielleicht kenne ja der eine oder andere von ihnen das Land.
Ja, das war ja sehr gut, sie ging hinaus und flötete auf einer Signalpfeife, und da kamen da so viele Menschen angewimmelt wie Sand in einem Sandsturm, so dass er fast Angst bekam vor all diesen Menschen; aber die sechs Riesen, die sich geschlagen hatten, die kamen nicht, denn die standen nicht mehr unter ihrem Kommando. Dann rief die Alte ihnen zu, sie sollten sagen, wo Babylonien sei. Nein, davon hätten sie nie etwas gehört, noch viel weniger kennten sie es. Ja, dann konnten sie wieder gehen.
Aber die Alte hatte eine Schwester, die herrschte über alle Kriechtiere, die es in diesem Teil der Welt gab, und vielleicht konnte die Auskunft geben. Ja, Krischan hätte sie auch gerne befragt, und da pfiff die Alte nach der Schwester und sprach sie auch an, als sie kam. Ja, selbst wisse sie nichts, aber dann müsse sie alle Kriechtiere zusammenrufen.
Da kamen so viele verschiedene Tiere, dass es entsetzlich war, und diese Alte flog über sie hin, gerade als sei sie eine Krähe, und befragte sie. Aber nein, es war niemand darunter, der dies Land kannte oder davon gehört hätte. Ja, dann müssten sie die zweite Schwester der Alten zu fassen haben, die herrsche über alle Vögel, die es auf dieser Insel gebe, denn es waren insgesamt drei Schwestern, und sie flötete nach ihr.
Ja, sie hatten noch nichts erreicht, und die dritte Schwester musste ihre Pfeife hervorholen und all ihre Vögel versammeln. Dann kamen sie. Nein, sie könnten keine Erklärung abgeben, sie, die schon gekommen seien; aber die Krähe fehle noch, und endlich kam sie auch und sagte: „Wa’, wa’, wa’?“ Ja, es gehe ja darum, ob sie etwas von Babylonien wisse. Ja, das tue sie, denn von dort komme sie gerade. Sie halte sich nämlich in dem Land auf, denn dort gebe es immer genug für sie, davon zu leben, geschlachtete Menschen und Tiere lägen dort herum, so weit das Land reiche. Dort sei nämlich ein Troll, der Stavi heiße, und der habe alles verhext und zerstört aus dem Grunde, dass er nicht die Tochter des Königs bekommen könne, die mit einem Christen verlobt sei. Es seien jetzt nur noch ganz wenige Personen in der Stadt am Leben, so habe er gemordet und getobt. Da erklärte Krischan, wer er war und wonach er reiste.
„Ja, dann können wir zusammen reisen,“ sagte die Krähe, „aber wir müssen über das Rote Meer, und das Beste ist, du setzt dich auf meinen Rücken, dann werde ich dich schon tragen, denn sonst kommst du wohl niemals hin.“
Nein, das sei nicht nötig, sagte Krischan, denn er könne gut den Weg entlanggehen, und es könne sogar geschehen, dass er vor ihr ankomme, wenn sie ihm nur den Kurs zeigen wolle, den er steuern müsse, und ihm dann sagen, wie viele Meilen es seien bis zum Roten Meer.
Ja, es seien viertausend Meilen, sagte sie.
Nun ja, dann wollten sie abreisen, und er sagte: „Viertausend Meilen!“ Sogleich kam er in die Nähe des Meeres und konnte mit einfachem Gang hingehen.
Als er an den Strand kam und noch reichlich Zeit war, wollte er etwas zu essen haben, breitete das Tuch aus und wünschte sich ein Stück Weißbrot mit Zukost. Das war sogleich da. Nun wollte er etwas zu trinken haben und setzte den Zapfhahn an einen Stein, da konnte er zapfen, was er wollte. Schließlich kam die Krähe, und da breitete er das Tuch auch für sie aus und wünschte ihr etwas Aas und bat sie zu Tisch, was sehr willkommen war, da sie erschöpft und hungrig war.
„Ja, wir müssen vor Tag über das Rote Meer“, sagte sie, „und nun kannst du dich dann auf meinen Rücken setzen, denn wir können wegen des Feindes auf keine andere Weise in die Stadt gelangen, als dass ich dich auf dem Schornstein absetzen muss, und dann musst du selbst zusehen, wie du hineinkommst.“
Dann flogen sie, und er hielt sich an einer Feder in ihrem Schwanz fest, bis sie über die Stadt kamen, und da wurde er auf dem königlichen Schloss abgesetzt.
Nun musste er ja durch den Schornstein hinunterklettern und versuchen, die Prinzessin zu finden. Aber es waren keine Menschen zu bemerken, denn die waren ja verhungert und ausgemergelt. Endlich hörte er etwas sprechen, und da waren es in der Tat die Prinzessin und ihre Kammerzofe, die waren so verhungert, dass sie kaum sprechen konnten, aber er breitete ja das Tuch aus und erquickte sie ein wenig mit feinen Zwiebacken und einer Flasche Wein. Dann pflegte er sie drei, vier Tage, bis sie sich wieder erholt hatten, und in der Zwischenzeit konnte er oben auf dem Schloss umhergehen und all die toten Menschen sehen, die durch dieses Teufelswerk umgekommen waren, und zugleich all die Feinde, die umherschwirrten wie Sand im Sandsturm. Eines Tages, es war so herrliches Wetter, sagte er zur Prinzessin, er habe Lust in den Garten hinunterzugehen und sich eine schöne Laube dort unten anzusehen. Sie sagte: „Nein, das darfst du nicht, denn dann wirst du sofort vom Feind gefangengenommen.“ Doch, er wollte dort nach draußen, und er nahm Zapfhahn und Tischtuch mit.
Dann bereitete er eine kleine Tafel für sich als einzige Peron dort unten. Aber wie er dort saß, kam als Bereiter oder so ein Kerl zu ihm. Krischan lud ihn ein, sich zu setzen und mitzuessen. Ja, vielen Dank, denn es sei heutzutage nicht so leicht, etwas zu essen zu bekommen. Ja, er habe immer genug, und damit jagte er den Zapfhahn in einen Pfeiler und zapfte eine Flasche guten Wein.
Ob er ihm diese Dinge nicht abkaufen könne?
Nein, die wolle er nicht loswerden.
Ja, er wolle einen Tausch mit ihm machen; hier sei eine Patronentasche, die er eintauschen wolle, „und sobald du darauf klopfst, kannst du so viele Soldaten bekommen, wie du dir wünschst.“
„Ach, meinetwegen denn!“, sagte Krischan, denn er fand das gar nicht so verkehrt. Aber der Bursche, mir dem er verhandelte, war nun gerade der Halunke, der den ganzen Feind anführte und das Land verwüstet hatte. Als die Person mit Tuch und Zapfhahn gegangen war, machte Krischan die Tasche auf, klopfte darauf und wünschte sich vier bewaffnete Dragoner, die ihm diese Person einfangen sollten. Sie machten sich sofort auf den Weg, erschlugen ihn und kamen mit den Sachen wieder. Nun hatte er seine Sachen und ging wieder hinein zur Prinzessin.
„Ja, nun muss ich wohl hinaus und ein bisschen unter dem Feind aufräumen“, sagte er.
Nein, das dürfe er auf keinen Fall, und sie bat ihn inständig, das sein zu lassen. Ja, dann sollten sie ihm ein paar alte Frauenkleider hersuchen, die er anziehen könne. Sie fanden auch einige Lumpen und Fetzen und machten ihn zurecht, dass er aussah wie eine alte Bettlerin oder Pilgerin, und mit Sack und Stock in der Hand kam er glücklich auf die Windseite der Stadt. Dort klopfte er auf die Patronentasche und wünschte sich zwei Regimenter Infanterie und zwei Regimenter Kavallerie, die sollten ohne Unterschied alles niedermähen und ausrotten, denn der ganze Dreck müsse ausgerottet werden. Aber bevor sie etwas unternahmen, bewirtete er sie mit dem Tuch und dem Zapfhahn. Als sie nun alle fertig bewirtet worden waren, machten sie kurzen Prozess und mähten alles nieder; aber da sie an dem Tag kaum fertig aufgeräumt bekamen, mussten sie am nächsten Tag wieder daran. Ja, sie fuhren fort, bis man auf der Straße kaum noch gehen konnte vor Blut und Menschen, und dann mussten die Straßen gesäubert werden, und die toten Körper wurden ins Meer geworfen, um sie möglichst schnell loszuwerden. Dann wollte er ja nachsehen, ob noch welche von den Stadtleuten am Leben seien, und fand dann auch einige, die nicht verhungert waren; draußen auf dem Land aber waren noch viel mehr. Als sie hörten, dass das Trollgesindel ausgerottet sei, freuten sie sich und wollten Krischan zum König haben, und da heiratete er die Prinzessin, und sie leben glücklich dort in Babylonien bis zum heutigen Tag.
––––––––––
2 Von diesem Märchen (wie auch vom folgenden) werden drei Varianten mitgeteilt, die sich nicht wenig unterscheiden, um den Lesern Gelegenheit zu geben, Vergleiche auch mit anderen Formen des Märchens im Land anzustellen. Diese drei Varianten sind nicht unvermischt, insgesamt ist dieses Märchen sehr beliebt gewesen, und da sind von den Erzählern nicht selten Züge hineingebracht worden, die woanders hingehören. Die letzte davon ist am echtesten am Ende, wohingegen die beiden ersten den Sieg am Anfang davontragen. (Anm. E. T. K.)
3 Tonne: Getreidehohlmaß; 1 Tonne entsprach 139,2 Litern.
2. Der goldene Turm am Ende der Welt
(Det forgyldte Taarn ved Verdens Ende)
Es war einmal ein sehr reicher Hofbesitzer, und der hatte einen großen Besitz. Aber da war ein Acker auf seinen Ländereien, auf dem er nie etwas anbauen konnte, denn jede Johannisnacht wurde er so zertrampelt, dass alles Getreide, das er darauf säte, ganz und gar verdorben wurde und nicht ein einziges Korn darin blieb. Darum nannte er das Stück Land den „Schein-Acker“.
Aber was es war, das die Saat niedertrat, das wusste niemand.
Dann hatte er auch drei Söhne, die hießen Peter und Paul4 und Hans. Hans saß immer drinnen am Kachelofen und unternahm nie etwas, und selten sagte er etwas; in den beiden anderen dagegen war genügend Leben, darum wurde der Jüngste immer als ein großer Trottel angesehen. Da geschah es eines Frühlings, so zur Aussaatzeit, dass Peter zum Vater sagte: „Darf ich nicht dieses Jahr etwas auf dem Schein-Acker säen, dann will ich zur Johannisnacht auf ihn aufpassen und versuchen herauszubekommen, was es ist, das das Getreide niedertritt.“ Der Vater hatte es nun satt, dort noch öfter Getreide zu säen, aber dann sagte er doch: „Ja, es macht ja weiter nichts, aber du bekommst mit Sicherheit nichts heraus.“ Es wurde dann rechtzeitig Getreide auf dem Acker gesät, und es gedieh recht gut und stand sehr üppig.
Am Johannisabend selbst zog Peter los und wollte hin und Wache halten. Er saß dort bis gegen Mitternacht, da kam da etwas durch die Luft gesaust, er konnte nicht begreifen, was es war, denn es tobte entsetzlich, und da bekam er Angst und rannte nach Hause, als hätte er Feuer in den Hacken. Aber am Morgen war das Korn wie gewöhnlich verdorben und niedergetreten. Sein Bruder verspottete ihn ein wenig und gab zu verstehen, er wäre nicht so ein Feigling gewesen.
Im Jahr darauf wollte Paul auch auf dem Acker säen, um die Möglichkeit zu bekommen, das Korn zu bewachen und zu sehen, was es so übel behandelte. Der Vater sagte wie letztes Mal, es mache ja weiter nichts, aber er denke im Übrigen nicht, dass es ihm besser ergehen werde als seinem Bruder. Doch, sagte Paul, er werde schon die Ohren steifhalten und er habe richtiggehend Lust, sich mit dem Teufelszeug da draußen anzulegen. Aber als es auf Mitternacht ging und er die Unruhe und das Sausen in der Luft hörte, sank ihm auch sein Herz in die Hose, und da gab er Fersengeld und beruhigte sich erst, als er unter der Bettdecke lag. Am nächsten Morgen lag das Korn wie gewöhnlich platt, und sein Vater wurde ein bisschen zornig, dass er, der so groß angegeben hatte, nicht besser davongekommen war.
Als die Aussaatzeit das dritte Jahr kam, sagte Hans, ob er nun nicht dieses Jahr den Acker besäen dürfe, denn dann wolle er auch versuchen, ihn zu bewachen. Ja, was das angehe, könnten sie genauso gut den Schafbock dort draußen anbinden, sagte der Vater, sie könnten den ja hinstellen, „aber wenn ich auch diesmal das Saatkorn für dich vergeude, macht das ja nichts, ich gebe ja nicht dauernd Geld für dich aus wie für die anderen.“ Da bekam er seinen Willen, und am Johannisabend zog er los, und da lag ein großer Stein auf dem Acker, in dessen Schutz hatte er vor zu sitzen, und ein paar gute Butterbrote hatte er auch in der Tasche, die hatte seine Mutter ihm aufgenötigt.
Dann wohnte da eine Kleinbäuerin in der Nähe des Ackers, zu der ging er hinein und sagte, ob sie nicht die paar Butterbrote haben wolle. Doch, sie dankte ihm vielmals, aber sie wolle ihm gerne etwas wiedergeben, und da sie für den täglichen Gebrauch Tabak schnupfte, da sagte sie: „Ich habe richtig guten Schnupftabak, den will ich dir geben, und falls du schläfrig werden solltest, dann könntest du doch eine Prise nehmen.“
Na, er kam hin zum Roggen und setzte sich hinter den großen Stein am Ende des Ackers. Dann wurde die Uhr halb zwölf, und er wurde schläfrig, denn Angst hatte er gar nicht. Er nahm eine Prise, und die Uhr wurde volle zwölf. Da kamen drei große Vögel angeflogen, und es wetterte und brauste, dass es ganz entsetzlich war. Sie flogen und schwebten über das ganze Stück, und als sie ein bisschen umhergeflattert waren, wurde es gutes Wetter, und sie setzten sich mitten ins Getreide auf der anderen Seite des Steins. Nun kroch Hans um den Stein herum und sah, dass es drei Jungfrauen waren, von denen jede ein Federkleid trug, das zogen sie aus und begannen ringsumher auf dem Acker zu tanzen. Danach stellten sie den Stein hochkant, und da kamen da unterirdische Räumlichkeiten zum Vorschein, in die sie hinunterstiegen. Dort unten hatten sie schrecklich viele Sachen, Silber und Gold und anderen Kram. Hans watete in den Roggen und sah ihnen ein wenig zu, aber als er wegging, nahm er den Umhang der Jüngsten mit.
Als sie nun losmussten nach Hause, war der Umhang weg, und sie war übel dran. Sie kam hin zu Hans, und da sie sah, er hatte ihn unter sich, bat sie ihn inständig, ihn wiederzubekommen, aber das wollte er nicht, außer sie würde versprechen, seine Frau zu werden. Das wollte sie ja schon, und dann würde sie eines Tages zu ihm kommen, dass sie Hochzeit feiern könnten.
„In zwei Monaten von heute an“, sagte sie, „werde ich kommen, und zwar genau um zwölf Uhr; du musst für Tische und Bänke sorgen und alles vorbereiten, und dann dürft ihr alle zum Fest einladen, die ihr wollt, bis auf den Sohn des Königs, den dürft ihr nicht einladen. Aber zu Hause im Garten deines Vaters steht ein kleiner, schmaler, gerader Baum, den musst du abhauen und hier unter den Stein stecken, dann kommt der von selbst hoch, und darunter liegen vierzehn Wagenladungen Silbergeld; wenn ihr die bekommt, dann habt ihr genug, um eine gute Hochzeit zu bezahlen, und habt noch eine Menge Geld übrig.”
Schließlich zog sie einen Goldring von ihrem Finger und gab ihm den als Pfand für ihre Verlobung, und dann bekam sie ihr Federkleid und flog damit davon.
Hans ging nun nach Hause in sein Bett und schlief am Morgen etwas lange. Unterdessen hatten die Brüder es eilig, hinauszukommen und zu sehen, wie es auf dem Acker stand. Ja, der war niedergetrampelt wie gewöhnlich. Da ließen sie ihn ja hören, er sei kein Körnchen besser als sie. Nein, das sei wohl wahr, aber nun sei da eine Sache, dabei brauche er heute Vormittag ihre Hilfe, und das sei, den Stein umzudrehen und etwas Geld nach Hause zu fahren. Er hätte vierzehn Wagen mit dorthin haben wollen, aber es hielt schwer genug, einen zu bekommen, und den Baum aus dem Garten seines Vaters erhielt er dann auch. Dann fuhr er mit den Brüdern hinaus zum Stein. Die versprachen sich davon einen großen Spaß, aber sie machten große Augen, als er den Baum unter den Stein geschoben und diesen hochkant gewuchtet hatte, denn nun gingen sie so eifrig an die Bergung, dass der Wagen bald voll war. So fuhren sie vierzehn Ladungen weg, und nun erzählte er, wozu das Geld gebraucht werden solle. Er wolle ja in Kürze Hochzeit machen.
Sie erschraken ja ein wenig darüber, aber er bekam seinen Willen, und sie brauten und buken und trafen große Vorbereitungen. Den Sohn des Königs luden sie in der Tat nicht mit ein, aber seinen Kammerdiener, und da kam der Königssohn ungebeten.
Der Tag kam, und alle Leute waren versammelt, nur die Braut fehlte, aber als sie ein bisschen gewartet hatten, hörten sie ein Brausen in der Luft, und da kam da eine goldene Kutsche mit vier Pferden davor geradewegs zu ihnen herunter auf den Hof. Aus der stieg eine wunderschöne Prinzessin, aber als der Königssohn die sah, sagte er, das sei nichts für einen Bauernburschen, die wolle er selbst haben. Hans wehrte sich ja wohl dagegen, aber das half nicht, der Königssohn sagte, darüber gebe es nichts mehr zu reden, und dann ging er hin und wollte sie in seine eigene Kutsche haben. Aber sie sagte, zur Kirche wolle sie in ihrem eigenen Fahrzeug fahren.
Dann flüsterte sie Hans zu: „Nun können wir heute keine Hochzeit machen; aber komm zu mir dorthin, wo ich wohne, nämlich zum goldenen Turm am Ende der Welt, und damit du einigermaßen vorankommst mit der Reise, will ich dir hier drei Tücher geben. Wenn du das eine ausbreitest und dir zu essen und zu trinken wünschst, dann kannst du bekommen, was immer du magst. Wenn du das zweite Tuch ausbreitest, dann wird da ein Schloss für dich stehen mit so vielen schönen Zimmern und gemachten Betten, dass du es niemals nötig haben wirst, nachts draußen zu liegen, und wenn es Tag wird, brauchst du nur das Tuch zusammenzurollen, dann ist das Schloss weg. Das dritte Tuch ist so beschaffen, wenn du jemals in Seenot geraten solltest und dann das Ende davon ins Wasser fallen lässt, dann hast du grünen Erdboden mit Wald und wilden Tieren vor dir.“
Dann sollten sie ja zur Kirche und getraut werden, aber als sie abgefahren waren, stieg ihre Kutsche wieder in die Luft, und niemand wusste, wo sie geblieben war. Nun war es aus mit dem Fest, und jeder ging zu sich nach Hause. Hans aber begab sich anderntags fort auf die Reise, um seine Braut aufzusuchen.
Wie er so ging, geriet er in einen schrecklich großen Wald, und dort verirrte er sich und konnte um alles in der Welt nicht wieder herausfinden. Aber dann traf er auf eine winzig kleine Hütte, in der sich ein altes Frauenzimmer befand. Sie sagte zu ihm: „Du elender Bengel! Wie bist du in diesen Wald gekommen? Aus dem kommst du nie wieder heraus.“ Aber sie war im Übrigen so gut zu ihm, wie sie konnte; sie hatte nichts anderes zum Leben als ein paar Beeren, die sie im Wald pflückte, und dann ein bisschen frische Baumrinde, die sie in Wasser kochte, das war ihre ganze Nahrung, und sie gab ihm von dem, was sie hatte.
Da sagte er: „Ach, Mütterchen, das ist wahrhaftig ein elendes Abendessen für Euch. Habt Ihr nie etwas Besseres?“ Das verneinte sie. Da holte er sein Tuch hervor, rollte es auf ihrem Tisch aus und wünschte schönes Essen darauf.
Darüber freute die Alte sich sehr. Er erzählte ihr, mit welchem Ziel er reiste, aber sie könne ihm wohl keinen Bescheid darüber sagen? Nein, sie wisse nichts von diesem Schloss, sagte sie. aber ihr Mann habe einen Verwandten, der sei ein Bergmann5 und wohne in einem Berg, der hundert Meilen entfernt sei, vielleicht wisse der etwas davon. Das sei ja ein weiter Weg, aber hier seien ein Paar alte Stiefel, die ihr verstorbener Mann immer gebraucht habe, wenn er irgendwohin gewollt habe, und die wolle sie ihm geben, weil er so gut zu ihr gewesen sei, und dann sei hier ein Schwert, vor dem alles zerspringe, wenn er darauf haue, und sei es ein Felsen. Er solle nur die Stiefel anziehen und geradeaus gehen, dann werde er schon aus dem Wald herauskommen und zum Bergmann kommen. Dann solle er mit dem Schwert an die Tür ticken und sagen, dass er bei der alten Frau übernachtet habe und sie ihm den Weg hierher gezeigt habe.
Na, er zog die Stiefel an, nahm Abschied von der Alten und schritt los immer der Nase nach.
Das ging nun ganz gut. Zu Orten kam er nicht, weil er entweder darum herumschritt oder sie nicht erreichte, aber aus dem Wald kam er, und lange vor dem Abend kam er vor einen großen Berg. Dort ging er ja ohne weiteres hinein, aber der Bergmann wurde wütend, und da musste er ganz schnell erzählen, wer ihn geschickt hatte. Da wurde er wieder friedlich und hieß Hans willkommen. Der fragte ja nach dem Schloss, aber darüber konnte der Bergmann ihm keine Auskunft geben. Indes versprach er, anderntags mit ihm hinauszugehen und alle Kriechtiere zusammenzurufen, denn über die herrsche er als König.
Dann hatte der Bergmann eine Pfeife, in die er hineinblies, und nun kamen alle Kriechtiere. Da fragte er sie, ob sie wüssten, wo der goldene Turm am Ende der Welt sei. Nein, sie sagten nein, davon wüssten sie nichts.
Da ging der Bergmann mit ihm hinein und frühstückte, und als sie fertig waren, sagte er: „Ich habe einen Bruder, der wohnt zweihundert Meilen von hier, wenn du weiter geradeaus gehst, dann triffst du ihn bestimmt, und er weiß wohl Bescheid; aber das wird ja viele Jahre dauern, bis du dahinkommst.“
Ja, das mache Hans nichts aus, er sei schon weiter gereist, als das sein könne, und da gab der Bergmann ihm einen Brief mit an den Bruder, in dem stand, das sei ein guter Freund von ihm, und er solle ihm Obdach für die Nacht geben und ihm nichts tun.
Er kam auch zu diesem Berg, und den Schreitstiefeln hatte er es zu verdanken, dass es nur einen halben Tag dauerte. Der Bergmann wurde rasend und wollte ihn sofort zerreißen, aber er riss ja den Brief auf und reichte ihm den hin. Da wurde er anderen Sinns und war ganz freundlich. Als sie sich ein bisschen unterhalten hatten, erzählte der Bursche ja, mit welchem Ziel er reiste, doch davon wusste der Bergmann keinen Bescheid. Aber anderntags werde er mit ihm hinausgehen und alle laufenden Tiere zusammenrufen, die es auf der Erde gebe, über die herrsche er als König, und werde sie fragen, ob niemand von ihnen von dem Schloss wisse.
Er kam dann hinaus mit seiner Pfeife, und die Tiere kamen, aber bei ihnen war nichts zu holen.
Ja, dann könne er ihm nicht weiterhelfen, aber er habe einen Bruder, der wohne vierhundert Meilen von hier, und wenn der es nicht wisse, sei da wohl nichts zu machen. Nun wolle er einen Brief schreiben und ihm mitgeben, damit er ihm nichts tue, und das könne wohl nötig werden, denn dieser Bergmann habe drei Köpfe.
Hans reiste nun wieder ab, und das gute Tuch, das Brücken schaffen konnte, das war ihm eine gute Hilfe, ob er nun an Flüsse, Seen, oder was es sein mochte kam. So kam er zu dem Berg gerade zur Mittagszeit, und der Bergmann wurde nun noch wütender als die anderen, als Hans anklopfte, aber Hans reichte ihm den Brief, und als er sah, dass das ein guter Bekannter seines Bruders war, ließ er ihn in Frieden. Nun saß Hans da und erzählte ihm seine ganze Geschichte, und dass seine Braut in dem goldenen Turm sitze; den gelte es nun zu finden. Aber von dem Turm wusste der Bergmann nichts. Er sei allerdings König über alle fliegenden Tiere unter dem Himmel, und die wolle er am nächsten Morgen zusammenrufen. Wenn unter denen keins sei, das es ihm sagen könne, dann helfe es nicht, dass er noch weiter reise.
Am Morgen ging er mit ihm hinaus und pfiff auf seiner Pfeife. Da kamen alle Vögel, die einen Namen haben, aber da war einer, der etwas länger ausblieb. Der Bergmann schimpfte und sagte: „Warum bleibst du so lange aus?“ Ja, er habe nicht eher kommen können, denn er habe seinen Platz beim goldenen Turm am Ende der Welt. Das war der große Weltdrache, dieser Vogel.
„Na, dann weißt du also, wo der ist“, sagte der Bergmann, und darüber freute Hans sich ja, aber wie sollte er nun dorthin kommen? Denn das war eine Reise, mit der nicht zu spaßen war. „Kannst du diesen Mann auf deinen Rücken nehmen und zum goldenen Turm bringen?“, sagte der Bergmann. Ja, er wolle es versuchen, aber er glaube es beinahe nicht, denn sie müssten über das große Weltmeer, und er sei beinahe ganz erschöpft gewesen, als er hergekommen sei. „Ja, du musst tun, was du kannst“, sagte der Bergmann, und damit war er einverstanden, und dann nahm er Hans auf den Rücken und flog los.
Als sie mitten auf das große Weltmeer hinauskamen, begann der Drache zu sinken, und er sank so stark, dass seine Flügel aufs Wasser zu schlagen begannen.
„Was wird das jetzt?“, sagte Hans.
„Ja, jetzt ertrinken wir alle beide.“
„Kannst du dich denn nicht noch einmal erheben?“
Doch, das könne er wohl, und er erhob sich, und Hans ließ sein Brückentuch mit dem einen Ende ins Wasser fallen. Da hatten sie grünen Erdboden mit Wald und allen wilden Tieren und Schlangen darauf. Da übernachteten sie dort, Hans wohnte in seinem Schloss, und der Drache versorgte sich tüchtig im Wald.
Am nächsten Morgen flog der Drache wieder los mit Hans, und da nahm er ja sein Brückentuch an sich. Schließlich kamen sie heil und glücklich an Land, und da setzte er ihn ab und sagte: „Nun hast du noch dreihundert Meilen nach, die kannst du wohl gehen, denn ich kann es nicht mehr aushalten, mit dir zu fliegen.“ Ja, er bedankte sich vielmals für die Reise und zog seine Schreitstiefel an, dann konnte er ja bald die dreihundert Meilen gehen.
Als er nun zu dem goldenen Schloss am Ende der Welt kam, da ging er in die Küche und setzte sich. Da er müde war von der Reise, fiel er bald in Schlummer, schlief aber doch nicht fester, als dass er eine schöne Zofe bemerkte, die an ihm vorbei in einen Erdkeller lief mit einem Becher in der Hand. Nun wurde er hellwach und dachte bei sich: „Ob sie nicht wiederkommen sollte?“ Dann zog er den Ring von seinem Finger, den seine Braut ihm gegeben hatte, und saß so mit dem zwischen den Fingern, als die Zofe zurückkam mit einem Becher Wein. Da sagte Hans, ob er nicht einen Tropfen zu trinken bekommen könne, er sei so durstig. Sie hieß ihn dann auch trinken, und da ließ er den Ring in den Becher fallen.
Es war nun für die drei Schwestern, dass die Zofe den Wein geholt hatte, und sie begannen zu trinken, aber da merkten sie, dass da etwas auf dem Boden des Bechers klapperte, weshalb sie den Rest auf einen Teller gossen, und da kam der Ring zutage.
Die jüngste Schwester erkannte ihn sofort, und sie sagte: „Mein lieber Hans muss hier draußen sein, er soll hereingerufen werden.“
Die Zofe ging hinaus und holte ihn, und nun hatten sie rechte Freude aneinander, und er musste erzählen, wie seine ganze Reise vor sich gegangen war.
Dann sagte sie: „Nun müssen wir ja Hochzeit feiern, aber vorher müssen wir noch etwas anderes überstehen, denn es ist ja bald Johannistag, und in der Nacht können wir nicht hier sein, denn dann herrschen alle Teufel, die es gibt, hier im Schloss. Wenn wir hierblieben, müssten wir unser Leben verlieren, und deshalb müssen wir hin und auf dem Acker deines Vaters tanzen, wie du ja weißt, aber du musst mit, und dann wollen wir ein Federkleid für dich nähen, denn nun will ich nie wieder ohne dich sein.“
Er sagte, er wolle deswegen keine so fürchterlich lange Reise machen, und er werde sich schon zur Wehr setzen und empfangen, was für Gäste auch immer kämen, und sei es der Teufel selber. Seiner Braut fiel es schwer, ihm zu glauben, aber wenn er bleiben wolle, dann wolle sie das auch, und als die beiden anderen Prinzessinnen das hörten, wollten sie auch bleiben, und auf diese Weise blieben sie alle vier dort. Aber die Prinzessinnen hatten schon große Angst, und aus Furcht gingen sie alle drei in ein Bett, während er sich zu ihnen auf die Bettkante setzte.
Kurz vor Mitternacht sprangen alle Türen im Schloss auf und es gab einen fürchterlichen Lärm. Da war es ein Drache, der durch alle Zimmer tobte, von einem zum anderen, bis er auch in das Zimmer kam, in dem sie sich aufhielten. Aber da war Hans bereit, ihn in Empfang zu nehmen, er hieb nach ihm mit seinem Schwert, vor dem alles bersten musste, und hieb ihn mitten durch. Da war es aus mit dem Drachen, und von der Zeit an hatten sie Ruhe auf dem Schloss vor Drachenbesuch und all solchem Mist.
Nun machten Hans und die Prinzessin Hochzeit. Als sie dann einige schöne Tage miteinander verbracht hatten, sagte er zu seiner Frau, nun habe er Lust, mit ihr nach Hause zu seinen Eltern zu kommen und zu sehen, wie es dort stehe. Dagegen hatte sie nichts, und da fuhren sie zunächst per Schiff über das große Weltmeer, und danach fuhren sie mit Pferd und Wagen.
Es war ja eine furchtbar lange Reise, aber schließlich gelangten sie doch in den Wald, wo die alte Frau wohnte, die ihm die Schreitstiefel und das Schwert gegeben hatte.
Da sagte er: „Wie geht es Euch, Mütterchen?“
„Ja, mir geht es eigentlich ganz gut“, sagte sie, „solange es im Wald genug Beeren gibt und grüne Rinde an den Bäumen und Wasser in der Quelle, da werde ich schon bestehen.“
„Nein, Mütterchen“, sagte er da, „jetzt müsst Ihr mit mir kommen, dann werde ich schon für Euch sorgen, und Ihr sollt es so gut haben, wie Ihr es Euch nur wünschen könnt.“
Aber sie sagte nein danke, sie wolle lieber an ihrem einsamen Ort bleiben. Aber da sagte seine Frau: „Ja, dann ist es doch schrecklich, wie ärmlich es ihr geht; dann gib ihr doch das Essenstuch und das Schlosstuch, dass sie wohnen kann wie andere Menschen.“ Da gab er ihr die beiden Tücher, und sie freute sich sehr darüber und bedankte sich und wünschte den netten Menschen viel Glück auf der Reise und für ihre Zukunft.
Als sie dann nach Hause kamen, bekamen Vater und Brüder etwas zum Grübeln. Sie gafften, und sie glotzten, aber Hans sagte zu seinen Brüdern: „Ich weiß wohl, ihr streitet euch jeden Tag, wer von euch den Hof haben soll, aber keiner von euch soll überhaupt etwas davon bekommen. Ihr habt euch gefreut, mich loszuwerden, und ihr habt mich immer hören lassen, ich sei ein Trottel und ein Dummkopf; aber die Dummköpfe wart eher ihr, denn ihr seid davongelaufen, als es galt und ihr auf den Roggen aufpassen solltet. Eigentlich war ich wohl der Kluge, denn ich passte so gut auf, dass es für ebenso viele Jahre doppelte Ähren an den Halmen gab, wie der Roggen vorher Schaden genommen hatte. Jetzt könnt ihr in die Welt hinauswandern, wohin ihr wollt, und hier habt ihr Geld, euch jeder einen großen Hof zu kaufen, wo ihr Lust habt.“
Als er ihnen diesen Bescheid gegeben hatte, zogen sie mit etwas hängenden Ohren ab, aber die Höfe, die sie sich kauften, die bezahlte Hans, und dann bestimmte er, dass seine alten Eltern auf dem Hof mit dem Schein-Acker wohnen bleiben sollten. Selbst aber reiste er hin und kaufte sich eine Grafschaft, und dort lebte er herrlich und in Freuden mit seiner Frau, bis sie starben, sofern sie nicht noch am Leben sind.
––––––––––
4 Im Original „Per“ und „Povl“.
5 Der Begriff „Bergmann“ (bjergmand) bezeichnet im Dänischen hauptsächlich einen der Berggeister, die z. B. im Niederdeutschen „Ünnereerdsche“ (Unterirdische), im Oberdeutschen u. a. „Bergmännchen“ genannt werden, kleine, menschenähnliche Wesen mit ungeheurer Kraft, die man sich als in den bronzezeitlichen Grabhügeln wohnend vorstellte. Solche Grabhügel (dänisch „høj“) sind auch meistens gemeint, wenn in den jütischen Märchen von „Hügeln“ die Rede ist. Bergleute im Sinne des Deutschen als Minenarbeiter gibt es ja in Dänemark aus Mangel an Bergwerken nicht.
3. Die Prinzessin mit dem Wunschring
(Prinsessen med Ønskeringen)
Es war einmal ein armer Mann, den nannten sie Piet auf’m Berg6, und er ernährte sich von Fischerei. Er wohnte auf dem Besitz eines Fürsten unter der Bedingung, dass er jeden Tag frischen Fisch für die Tafel des Fürsten beschaffte, und dann bezahlte er sonst nichts für sein Dortsein. Nun achtete er wohl darauf, wenn er guten Fang gemacht hatte, dass er sich nicht allzu weit ausverkaufte, aber er konnte ja auch keinen allzu großen Vorrat behalten, und als es sich dann einmal so ergab, dass der Fang über einige Tage misslang, ging der Fisch zu Ende, und er konnte seine Verpflichtungen gegenüber dem Fürsten nicht erfüllen.
Da fuhr er eines Abends spät wieder hinaus und wollte versuchen, ob er nicht so viel fangen könnte, dass er am nächsten Tag die Tafel des Fürsten beliefern könnte, er fürchtete ja, sonst fortgejagt zu werden. Piet gab sich ja alle Mühe, aber vergebens. Als er dann wieder nach Hause wollte, stieg ein schwarzes Männchen aus dem Meer herauf und packte sein Fischerboot, als wollte er es unter Wasser ziehen. Er bat ihn ja loszulassen, aber das Männchen erwiderte, er tue das nur unter der Bedingung, dass er das Erste, das in seinem Hause geboren werde, in achtzehn Jahren bekomme, und gehe er darauf ein, solle er in Zukunft Glück haben bei seiner Fischerei. Piet und seine Frau waren schon ältere Leute, und darum dachte er, es könne vielleicht ein Kätzchen oder ein Welpe sein, und so eins könne er ihm ja gerne geben. Könne er zugleich so eine Gegenleistung erhalten und aus der Klemme mit dem Fürsten herauskommen, dann sei es das schon wert, diesen Handel zu vollziehen, fand er, und damit war es abgemacht. Das Erste, das geboren würde, sollte in einem Boot hier draußen auf dem Meer übergeben werden, und indem das Männchen verschwand, sagte es, nun könne Piet wieder versuchen, das Netz auszuwerfen. Das geschah, und da zog er einen großen Fisch nach dem anderen heraus und hatte das Boot voll mit nach Hause. So ging es ihm, kurz gesagt, jeden Tag, und ehe furchtbar viel Zeit vergangen war, war er ein reicher Mann geworden.
Nun saß er da und hatte genug von allem, aber von nichts auf seinem Hof konnte er Nachwuchs erhalten, weder von Kühen noch von Schafen. Schließlich merkte seine Frau, dass sie schwanger war, und sie gebar einen Knaben, den sie Karsten7 nannten; das sei kein Glück, fand Piet. Fast nie konnte er den Jungen sehen ohne zu weinen, weswegen seine Frau ihn oft fragte, was das bedeuten solle. Er behielt es eine Zeitlang für sich, aber zuletzt musste er es ihr offenbaren. Er hatte einen Schrank, der in seinem Bett hing, und innen auf diese Schranktür hatte er geschrieben, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit er den Jungen abliefern sollte, denn das musste ja pünktlich geschehen. Als sie es hörte, bekam sie keine bessere Laune, sondern noch schlechtere, und als der Junge heranwuchs und so groß wurde, dass er merken konnte, dass da etwas war, das seine Eltern belastete, wenn sie ihn sahen, fing er an zu fragen und zu forschen und zu ergründen, welchen Grund das hatte. Als seine Mutter dann eines Tages das Bett gemacht hatte und dabei auch am Schrank gewesen war, vergaß sie, ihn wieder abzuschließen, und da konnte der Junge lesen, was auf der Tür stand. Als nun der Vater ihm nicht sagen wollte, worüber er so traurig war, da sagte Karsten: Ja, er verstehe jetzt, was es sei und welches Versprechen er gegeben habe, aber darüber sollten sie nicht traurig sein, sie sollten ihn nur abliefern, wenn die Zeit komme.





























