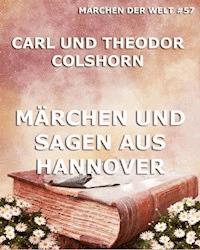
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Erleben Sie die Märchen und Sagen aus aller Welt in dieser Serie "Märchen der Welt". Von den Ländern Europas über die Kontinente bis zu vergangenen Kulturen und noch heute existierenden Völkern: "Märchen der Welt" bietet Ihnen stundenlange Abwechslung. Ein Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis dieses Buches: Prolog 1. Der Goldschmiedsgesell. 2. Vom blutrothen Meßer und steinharten Brod. 3. Von dem Breikeßel. 4. Großmütterchen Immergrün. 5. Peter Bär. 6. Vom gollenen Beineken. 7. Osten, Westen, Norden und Süden. 8. Die weiße Katze. 9. Die schwarze Katze. 10. Buer Slukedal. 11. Die weiße Jungfrau. 12. Die Schlangenjungfrau. 13. Vom Gefangenen. 14. Die gläserne Kugel. 15. Grindköpfchen. 16. Der Werwolf. 17. Die drei Wünsche. 18. Von den rostigen Knöpfen. 19. Wurst wider Wurst. 20. Vom klinkesklanken Lowesblatt. 21. Der weiße Hirsch. 22. Vom Helljäger. 23. Die Zwerge im Gübichenstein. 24. Die Ochsensaat. 25. Die kleine Mühle. 26. Die kluge Dirne. 27. Zwerg Lehnort. 28. Vier Geistergeschichten. 29. Zwerg Holzrührlein Bonneführlein. 30. Buer Griepetau. 31. Waldminchen. 32. Die kleine schwarze Frau. 33. Die Zwerge im Erbsenfelde. 34. Der weiße Ziegenbock. 35. Der Welthund. 36. Die Zwerge im Schalks- und im Wohldenberge. 37. Hans Winter. 38. Die Räuberbraut. 39. Borgemester Wittkopp. 40. Das graue Männchen. 41. Die Riesensteine. 42. Der verwunschene Frosch. 43. Die Querpfeife. 44. Aschenpöling. 45. Der alte Schimmel. 46. Die zwölf ungerechten Richter. 47. Der brennende Hirsch. 48. Der Zwerg mit der grünen Peitsche. 49. Vom großen Ziegenbock. 50. Die hartherzige Haushälterin. 51. Zwei Augen zu viel. 52. St. Peter langweilt sich. 53. Die Zwerge im Perlberge. 54. Die wilde Johanne. 55. Vom schönen Schäfermädchen. 56. Irret euch nicht! Gott läßt sich nicht spotten! 57.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Märchen und Sagen aus Hannover
Carl und Theodor Colshorn
Inhalt:
Bibliographie der Sage
Märchen und Sagen aus Hannover
Prolog
1. Der Goldschmiedsgesell.
2. Vom blutrothen Meßer und steinharten Brod.
3. Von dem Breikeßel.
4. Großmütterchen Immergrün.
5. Peter Bär.
6. Vom gollenen Beineken.
7. Osten, Westen, Norden und Süden.
8. Die weiße Katze.
9. Die schwarze Katze.
10. Buer Slukedal.
11. Die weiße Jungfrau.
12. Die Schlangenjungfrau.
13. Vom Gefangenen.
14. Die gläserne Kugel.
15. Grindköpfchen.
16. Der Werwolf.
17. Die drei Wünsche.
18. Von den rostigen Knöpfen.
19. Wurst wider Wurst.
20. Vom klinkesklanken Lowesblatt.
21. Der weiße Hirsch.
22. Vom Helljäger.
23. Die Zwerge im Gübichenstein.
24. Die Ochsensaat.
25. Die kleine Mühle.
26. Die kluge Dirne.
27. Zwerg Lehnort.
28. Vier Geistergeschichten.
29. Zwerg Holzrührlein Bonneführlein.
30. Buer Griepetau.
31. Waldminchen.
32. Die kleine schwarze Frau.
33. Die Zwerge im Erbsenfelde.
34. Der weiße Ziegenbock.
35. Der Welthund.
36. Die Zwerge im Schalks- und im Wohldenberge.
37. Hans Winter.
38. Die Räuberbraut.
39. Borgemester Wittkopp.
40. Das graue Männchen.
41. Die Riesensteine.
42. Der verwunschene Frosch.
43. Die Querpfeife.
44. Aschenpöling.
45. Der alte Schimmel.
46. Die zwölf ungerechten Richter.
47. Der brennende Hirsch.
48. Der Zwerg mit der grünen Peitsche.
49. Vom großen Ziegenbock.
50. Die hartherzige Haushälterin.
51. Zwei Augen zu viel.
52. St. Peter langweilt sich.
53. Die Zwerge im Perlberge.
54. Die wilde Johanne.
55. Vom schönen Schäfermädchen.
56. Irret euch nicht! Gott läßt sich nicht spotten!
57. Vom dicken fetten Pfannekuchen.
58. Schlangenkönigin.
59. Von den drei Heilebarts.
60. Vom Branntewein.
61. Warum das Meerwaßer salzig ist.
62. Der Müller und die Frösche.
63. Hackelnberg.
64. Güggel und Hüendli.
65. Die Mainacht.
66. Der im Walde schlafende Bauer.
67. Dei Unnereerschka.
68. Von des Todes Boten.
69. Die Hexenkunst.
70. Der wilde Jäger.
71. Das Todtebeindli.
72. Hans Clauert's Lügenmärchen
73. Drei lustige Historien von Hans Clauert.
74. Die Sage vom Vicho, einem See zwischen Uchtenhagen und Schönbeck unweit Marienfließ.
75. Fru Gauden oder Goden.
76. Vom Wolfe, Fuchs und Esel.
77. Thedel von Walmoden.
78. Einochs.
79. Das Mümmelchen.
80. Probe des Adels.
81. Van einem groten Kukuk.
82. Nothfeuer.
83. Von den vier Tagedieben.
84. Van einem grobben narrischen Burensöne, de junge Göse utbröden wolde.
85. Schimmel und Bär.
86. De Drakensteen.
87. Die Zwerge bei Dünnenfehr.
88. Die Hexen in Rodenberg.
89. Der Schmied und der Teufel.
90. Holtmul.
Erklärung einiger Ausdrücke.
Nachwort.
Märchen und Sagen aus Hannover
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849602918
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Bibliographie der Sage
Eine Sage istim allgemeinen alles, was gesagt und von Mund zu Mund weiter erzählt wird, also soviel wie Gerücht; im engeren Sinn eine im Volke mündlich fortgepflanzte Erzählung von irgendeiner Begebenheit. Knüpft sich die S. an geschichtliche Personen und Handlungen, indem sie die im Volke fortlebenden Erinnerungen an geschichtliche Zustände, Persönlichkeiten, dunkel gewordene Taten zu vollständigen Erzählungen ausbildet, so entsteht die geschichtliche S. und, sofern sie sich auf die alten Helden des Volkes erstreckt, die Heldensage; sind aber die Götter mit ihren Zuständen, Handlungen und Erlebnissen Gegenstand der S., so entsteht die Göttersage oder der Mythus (s. Mythologie) und auf dem Gebiet monotheistischer dogmatischer Religion die Legende (s. d.). Hastet die Erzählung an bestimmten Örtlichkeiten, so spricht man von örtlichen Sagen. Noch eine Sagengattung bildet endlich die Tiersage, die von dem Leben und Treiben der Tiere, und zwar fast ausschließlich der ungezähmten, berichtet, die man sich mit Sprache und Denkkraft ausgerüstet vorstellt. Ost hat sich um eine besonders bevorzugte Persönlichkeit, wie z. B. König Artus, Dietrich von Bern, Attila, Karl d. Gr. etc., und deren Umgebung eine ganze Menge von Sagen gelagert, die nach Ursprung und Inhalt sehr verschieden sein können, aber doch unter sich in Zusammenhang stehen, und es bilden sich dadurch Sagenkreise, wie deren im Mittelalter in germanischen wie romanischen Ländern mehrere bestanden und zahlreiche Epen hervorgerufen haben (vgl. Heldensage). Die echte S. erscheint somit als aus dem Drang des dichterischen Volksgeistes entsprungen. Wie alle Volkspoesie blüht sie am prächtigsten in der ältern Zeit, aber auch bei höherer Kultur verstummt sie nicht ganz; vielmehr ist der Volksgeist noch heute tätig, bedeutende Vorgänge und Persönlichkeiten mit dem Schmuck der S. zu umkleiden. Die Anknüpfung an ein gewisses Wirkliches ist hauptsächlich das Merkmal, das die S. vom Märchen (s. d.) unterscheidet. Wie das Märchen, liebt sie das Wunderbare und Übernatürliche, obwohl es ihr nicht unentbehrlich ist. Am häufigsten heftet sie sich an Burg- und Klosterruinen, an Quellen, Seen, an Klüfte, an Kreuzwege etc., und zwar findet sich ein und dieselbe S. nicht selten an mehreren Orten wieder. Um die Erhaltung der deutschen S. haben sich zuerst die Brüder Grimm verdient gemacht durch ihre reiche Sammlung: »Deutsche Sagen« (Berl. 1816–18, 2 Bde.; 3. Aufl. 1891). Nächst diesen sind die Sammlungen von A. Kuhn und Schwartz (»Norddeutsche Sagen«, Leipz. 1848), J. W. Wolf (»Deutsche Märchen und Sagen«, das. 1845), Panzer (»Bayrische Sagen«, Münch. 1848, 2 Bde.), Grässe (»Sagenbuch des preußischen Staats«, Glogau 1871) und Klee (Gütersloh 1885) als besonders reichhaltige Quellen zu nennen. Als Sammler von Sagen einzelner Länder, Gegenden und Örtlichkeiten waren außerdem zahlreiche Forscher tätig, so für Mecklenburg: Studemund (1851), Niederhöffer (1857) und Bartsch (1879); für Pommern und Rügen: U. Jahn (2. Aufl. 1890), Haas (Rügen 1899, Usedom u. Wollin 1903); für Schleswig-Holst ein: Müllenhoff (1845); für Niedersachsen: Harrys (1840), Schambach und Müller (1855); für Hamburg: Beneke (1854); für Lübeck: Deecke (1852); für Oldenburg: Strackerjan (1868); für den Harz: Pröhle (2. Aufl. 1886); für Mansfeld: Giebel hausen (1850); für Westfalen: Kuhn (1859) und Krüger (1845), Weddigen und Hartmann (1884); für die Altmark: Temme (1839); für Brandenburg: Kuhn (1843) und W. Schwartz (4. Aufl. 1903); für Sachsen: Grässe (1874) und A. Meiche (1903); für das Vogtland: Köhler (1867) und Eifel (1871); für das Erzgebirge: J. A. Köhler (1886); für die Lausitz: Haupt (1862) und Gander (1894); für Thüringen: Bechstein (1835, 1898), Börner (Orlagau, 1838), Sommer (1846), Wucke (Werragegend, 1864), Witzschel (1866), Richter (1877); für Schlesien. Kern (1867), Philo vom Walde (1333); für Ostpreußen etc.: Tettau (183f) und Reusch (Samland, 1863); für Posen: Knoop (1894); für den Rhein: Simrock (9. Aufl. 1883), Geib (3. Aufl. 1858), Kiefer (4. Aufl. 1876), Kurs (1881), Schell (Bergische S., 1897), Hessel (1904); für Luxemburg: Steffen (1853) und Warker (1894); für die Eifel: P. Stolz (1888); für Franken etc.: Bechstein (1842), Janssen (1852), Heerlein (Spessart, 2. Aufl. 1885), Enslin (Frankfurt 1856), Kaufmann (Mainz 1853); für Hessen: Kant (1846), Wolf (1853), Lynker (1854), Bindewald (1873), Hessler (1889); für Bayern: Maßmann (1831), Schöppner (1851–1853), v. Leoprechting (Lechrain, 1855), Schönwerth (Oberpfalz, 1858), Sepp (1876), Haushofer (1890); für Schwaben: Meier (1852) und Birlinger (1861–1862), Reiser (Algäu, 1895); für Baden: Baader (1851), Schönhut (1861–65), Waibel und Flamm (1899); für das Elsaß: August St ob er (1852, 1895), Lawert (1861), Hertz (1872); für die Niederlande: Wolf (1843), Welters (1875–76); für Rumänien: Schuller (1857); für die Schweiz: Rochholz (1856), Lütolf (1862), Herzog (1871, 1882); für Tirol. [417] Meyer (2. Aufl. 1884), Zingerle (1859), Schneller (1867), Gleirscher (1878), Heyl (1897); für Vorarlberg: Vonbun (1847 u. 1890); für Österreich: Bechstein (1846), Gebhart (1862), Dreisauff (1879), Leed (Niederösterreich, 1892); für Mähren: Schüller (1888); für Kärnten: Rappold (1887); für Steiermark: Krainz (1880), Schlossar (1881); für Böhmen: Grohmann (1863), Gradl (Egerland, 1893); für die Alpen: Vernaleken (1858), Alpenburg (1861) und Zillner (Untersberg, 1861); für Siebenbürgen: Müller (2. Aufl. 1885), Haltrich (1885). Die Sagen Islands sammelten Maurer (1860) und Poestion (1884), der Norweger: Asbjörnson (deutsch 1881), der Südslawen: Krauß (1884), der Litauer: Langkusch (1879) und Veckenstedt (1883), der Esten: Jannsen (1888), der Lappländer: Poestion (1885), der Russen: Goldschmidt (1882), der Armenier: Chalatianz (1887), die der Indianer Amerikas: Amara George (1856), Knortz (1871), Boas (1895); indische Sagen Beyer (1871), japanische Brauns (1884), altfranzösische A. v. Keller (2. Aufl. 1876); deutsche Pflanzensagen Perger (1864), die deutschen Kaisersagen Falkenstein (1847), Nebelsagen Laistner (1879) etc. Die Sagen bilden mit den im Volk umlaufenden Märchen, Legenden, Sprichwörtern etc. den Inhalt der Volkskunde (s. d.), die seit neuerer Zeit Gegenstand reger wissenschaftlicher Forschung ist. Vgl. L. Bechstein, Mythe, S., Märe und Fabel im Leben und Bewußtsein des deutschen Volkes (Leipz. 1854, 3 Tle.); J. Braun, Die Naturgeschichte der S. (Münch. 1864–65, 2 Bde.); Uhland, Schriften zur Geschichte und S., Bd. 1 u. 7 (Stuttg. 1865–68); Henne am Rhyn, Die deutsche Volkssage im Verhältnis zu den Mythen aller Völker (2. Aufl., Wien 1879); v. Bayder, Die deutsche Philologie im Grundriß (Paderb. 1883); Paul, Grundriß der germanischen Philologie, Bd. 2, 1. Abt. (2. Aufl., Straßb. 1901) und die Bibliographie in der »Zeitschrift des Vereins für Volkskunde«; Grünbaum, Gesammelte Aufsätze zur Sprach- und Sagenkunde (Berl. 1901).
Geschichte des Märchens
Ein Märchenist diejenige Art der erzählenden Dichtung, in der sich die Überlebnisse des mythologischen Denkens in einer der Bewußtseinsstufe des Kindes angepaßten Form erhalten haben. Wenn die primitiven Vorstellungen des Dämonenglaubens und des Naturmythus einer gereiftern Anschauung haben weichen müssen, kann sich doch das menschliche Gemüt noch nicht ganz von ihnen trennen; der alte Glaube ist erloschen, aber er übt doch noch eine starke ästhetische Gefühlswirkung aus. Sie wird ausgekostet von dem erwachsenen Erzähler, der sich mit Bewußtsein in das Dunkel phantastischer Vorstellungen zurückversetzt und sich, vielfach anknüpfend an altüberlieferte Mythen, an launenhafter Übertreibung des Wunderbaren ergötzt. So ist das Volksmärchen (und dieses ist das echte und eigentliche M.) das Produkt einer bestimmten Bewußtseinsstufe, das sich anlehnt an den Mythus und von Erwachsenen für das Kindergemüt mit übertreibender Betonung des Wunderbaren gepflegt und fortgebildet wird. Es ist dabei, wie in seinem Ursprung, so in seiner Weiterbildung durchaus ein Erzeugnis des Gesamtbewußtseins und ist nicht auf einzelne Schöpfer zurückzuführen: das M. gehört dem großen Kreis einer Volksgemeinschaft an, pflanzt sich von Mund zu Munde fort, wandert auch von Volk zu Volk und erfährt dabei mannigfache Veränderungen; aber es entspringt niemals der individuellen Erfindungskraft eines Einzelnen. Dies ist dagegen der Fall bei dem Kunstmärchen, das sich aber auch zumeist eben wegen dieses Ursprungs sowohl in den konkreten Zügen der Darstellung als auch durch allerlei abstrakte Nebengedanken nicht vorteilhaft von dem Volksmärchen unterscheidet. Das Wort M. stammt von dem altdeutschen maere, das zuerst die gewöhnlichste Benennung für erzählende Poesien überhaupt war, während der Begriff unsers Märchens im Mittelalter gewöhnlich mit dem Ausdruck spel bezeichnet wurde. Als die Heimat der M. kann man den Orient ansehen; Volkscharakter und Lebensweise der Völker im Osten bringen es mit sich, daß das M. bei ihnen noch heute besonders gepflegt wird. Irrtümlich hat man lange gemeint, ins Abendland sei das M. erst durch die Kreuzzüge gelangt; vielmehr treffen wir Spuren von ihm im Okzident in weit früherer Zeit. Das klassische Altertum besaß, was sich bei dem mythologischen Ursprung des Märchens von selbst versteht, Anklänge an das M. in Hülle und Fülle, aber noch nicht das M. selbst als Kunstgattung. Dagegen taucht in der Zeit des Neuplatonismus, der als ein Übergang des antiken Bewußtseins zur Romantik bezeichnet werden kann, eine Dichtung des Altertums auf, die technisch ein M. genannt werden kann, die reizvolle Episode von »Amor und Psyche« in Apulejus' »Goldenem Esel«. Gleicherweise hat sich auch an die deutsche Heldensage frühzeitig das M. angeschlossen. Gesammelt begegnen uns M. am frühesten in den »Tredeci piacevoli notti« des Straparola (Vened. 1550), im »Pentamerone« des Giambattista Basile (gest. um 1637 in Neapel), in den »Gesta Romanorum« (Mitte des 14. Jahrh.) etc. In Frankreich beginnen die eigentlichen Märchensammlungen erst zu Ende des 17. Jahrh.; Perrault eröffnete sie mit den als echte Volksmärchen zu betrachtenden »Contes de ma mère l'Oye«; 1704 folgte Gallands gute Übersetzung von »Tausendundeiner Nacht« (s. d.), jener berühmten, in der Mitte des 16. Jahrh. im Orient zusammengestellten Sammlung arabischer M. Besondern Märchenreichtum haben England, Schottland und Irland aufzuweisen, vorzüglich die dortigen Nachkommen der keltischen Urbewohner. Die M. der skandinavischen Reiche zeigen nahe Verwandtschaft mit den deutschen. Reiche Fülle von M. findet sich bei den Slawen. In Deutschland treten Sammlungen von M. seit der Mitte des 18. Jahrh. auf. Die »Volksmärchen« von Musäus (1782) und Benedikte Naubert sind allerdings nur novellistisch und romantisch verarbeitete Volkssagen. Die erste wahrhaft bedeutende, in Darstellung und Fassung vollkommen echte Sammlung deutscher M. sind die »Kinder- und Hausmärchen« der Brüder Grimm (zuerst 1812–13, 2 Bde.; ein 3. Band, 1822, enthält literarische Nachweise bezüglich der M.). Unter den sonstigen deutschen Sammlungen steht der Grimmschen am nächsten die von L. Bechstein (zuerst 1845); außerdem sind als die bessern zu nennen: die von E. M. Arndt (1818), Löhr (1818), J. W. Wolf (1845 u. 1851), Zingerle (1852–54), E. Meier (1852), H. Pröhle (1853) u. a. Mit M. des Auslandes machten uns durch Übertragungen bekannt: die Brüder Grimm (Irland, 1826), Graf Mailath (Ungarn, 1825), Vogl (Slawonien, 1837), Schott (Walachei, 1845), Asbjörnson (Norwegen), Bade (Bretagne, 1847), Iken (Persien, 1847), Gaal (Ungarn, 1858), Schleicher (Litauen, 1857), Waldau (Böhmen, 1860), Hahn (Griechenland u. Albanien, 1863), Schneller (Welschtirol, 1867), Kreutzwald (Esthland, 1869), Wenzig (Westslawen, 1869), Knortz (Indianermärchen, 1870, 1879, 1887), Gonzenbach (Sizilien, 1870), Österley (Orient, 1873), Carmen Sylva (Rumänien, 1882), Leskien und Brugman (Litauen, 1882), Goldschmidt (Rußland, 1882), Veckenstedt (Litauen, 1883), Krauß (Südslawen, 1883–84), Brauns (Japan, 1884), Poestion (Island, 1884; Lappland, 1885), Schreck (Finnland, 1887), Chalatanz (Armenien, 1887), Jannsen (Esthen, 1888), Mitsotakis (Griechenland, 1889), Kallas (Esthen, 1900) u. a. Unter den Kunstpoeten haben sich im M. mit dem meisten Glück versucht: Goethe, L. Tieck, Chamisso, E. T. A. Hoffmann, Fouqué, Kl. Brentano, der Däne Andersen, R. Leander (Volkmann) u. a. Vgl. Maaß, Das deutsche M. (Hamb. 1887); Pauls »Grundriß der germanischen Philologie«, 2. Bd., 1. Abt. (2. Aufl., Straßb. 1901); Benfey, Kleinere Schriften zu Märchen-forschung (Berl. 1890); Reinh. Köhler, Aufsätze über M. und Volkslieder (das. 1894) und Kleine Schriften, Bd. 1: Zur Märchenforschung (hrsg. von Bolte, das. 1898); R. Petsch, Formelhafte Schlüsse im Volksmärchen (das. 1900).
Märchen und Sagen aus Hannover
Prolog
Die kleine Auguste war ein gar herziges Mägdlein von sieben oder acht Jahren; sie blühte wie eine Lilie, war rein wie eine Taube und mild wie eine Traube. Deshalb war sie die Freude und Wonne ihrer Eltern, und alle, die sie kannten, liebten sie.
»Komm, Kleine,« sagte eines Tags der Papa zu ihr, »setz dein Hütchen auf, binde dein rothes Tuch um und zieh deine Handschuhe an; wir wollen ein wenig ins Freie.« Da klatschte Auguste vor Freuden in ihre Händchen, und im Nu stand sie da, wie aus der Beilade genommen. Nun küssten und drückten sie die Mama und wanderten fort.
Als sie eine Weile gegangen waren und sich ergötzt hatten an den zwitschernden Vöglein, den flatternden Schmetterlingen und den hüpfenden Lämmlein, kamen sie auf eine Wiese, auf welcher tausend und abertausend lustige Blumen wuchsen. »Darf ich die pflücken?« fragte Auguste, und der Papa nickte mit dem Kopfe und winkte mit den Augen. Da war die Freude erst recht groß!
Während aber die Kleine wie ein Schmetterling von Blume zu Blume eilte, nahm der Papa etwas Weißes aus der Tasche und legte es ins Gras, das er ein wenig zur Seite bog. Und als Auguste ein schmuckes Sträußchen gepflückt hatte, kam sie heran gehüpft und sagte: »Papa, darf ich nun Hasennester suchen?« Da nickte der Papa wieder mit dem Kopfe und winkte wieder mit den Augen; und sie suchte und suchte.
»Ei, was ist das!« rief sie plötzlich aus, »was wird darin sein?« Rasch nahm sie das Papier hinweg und jubelte und jauchzte hoch auf. »O, Papa, was hat mir Häschen heute gebracht! Grimm's Märchen, in blauen Sammt gebunden, mit goldnem Schnitt und goldnem Titel!«
Und sie nahm das Buch mit nach Haus, ergötzte sich an seinen köstlichen Märchen und hielt es lieb und werth.
Jetzt ist Auguste groß geworden und selber eine Mama; aber das Buch ist ihr lieb und werth wie damals und wird ihr lieb und werth sein bis zu ihrem Tode.
1. Der Goldschmiedsgesell.
Mündlich in Eldagsen.
Es war einmal ein König, der wollte mit seiner Gemahlin zum Jahrmarkt und fragte deshalb seine drei Töchter, was er ihnen mitbringen solle. »Ein goldenes Spinnrad« sagte die eine, »einen goldenen Haspel« die andere, »eine goldene Garnwinde« die dritte. »Das sollt ihr haben«, sagte der König, »und noch mehr«, setzte die Königin hinzu; »dafür«, meinte der König, »müßt ihr nun aber auch versprechen, daß ihr nicht in den Garten gehen und keine Blumen von dem Rosenbusch abpflücken wollt, der dicht am Wege steht; denn wenn ihr das thätet und darauf röchet, so wär' es ein großes Herzeleid.« Sie sagten: »Wir wollen es nicht thun, ganz gewis nicht«, und getrost reisten die Eltern ab. Als die Töchter zu Mittag gegeßen hatten, sagte die eine, ich weiß nicht mehr welche, zu den beiden anderen: »Die Sonne scheint so schön, und die Vögel singen so lustig, laßt uns ein wenig hinunter in den Garten gehen; die übrigen Blumen dürfen wir ja besehen und abpflücken, und um die Rosen brauchen wir uns ja nicht zu kümmern.« Die anderen waren's gern zufrieden, und so hüpften und sprangen sie die marmorne Treppe hinab und flatterten von Blume zu Blume wie die Schmetterlinge. Als sie sich an den anderen Blumen müde gesehen hatten, sprach die eine: »Besehen dürfen wir die Rosen wohl, das kann ja nicht schaden, und Rosen sehen doch am allerbesten aus!« »Das thun sie auch«, sagte die andere, »aber abpflücken dürfen wir keine.« »Ja nicht«, sagte die dritte, »der Vater hat's verboten.« Und sie giengen hin; ihr Herz klopfte zwar etwas heftig, sie giengen aber doch hin. Und sie konnten sich gar nicht satt sehen an dem wunderschönen Rosenbusch; drei Rosen aber waren die allerschönsten, und die saßen zusammen an einem Zweige und standen wie ein Kleeblatt dicht neben einander, und es war ihnen fast, als wären's Augen gewesen und sähen sie an. Endlich giengen sie langsam weg, kehrten aber bald rasch zurück; zum zweitenmal gieng's noch langsamer fort und noch rascher zurück, und zum drittenmal – ja, da giengen sie eigentlich gar nicht weg, sondern kehrten sich nur um und wieder um, und jede brach eine von den drei Rosen, und hat man erst eine Rose in der Hand, da laße einer das Dranriechen! Die drei Königstöchter wenigstens konnten's nicht laßen; sie rochen daran, und im Nu waren sie von der Erde verschwunden und im Schloße des unterirdischen Königs. Da jammerte alles Gesinde und am meisten, wenn sie daran dachten, wie der König und die Königin jammern würden. Und es war auch kläglich anzusehen, wie diese des Abends vergnügt heimkehrten und die Geschenke selber die Marmortreppe hinauf trugen, und nun niemand war, der sich darüber freute; denn wenn den Kindern die Eltern genommen werden, so ist das schon ein Herzeleid, wenn aber den Eltern so auf einmal alle Kinder fortgegangen sind, so ist noch viel größer Herzeleid.
Als sie sich ein bißchen wieder gefaßt hatten, wenigstens der König, die Königin grämte sich zu Tode, schickte jener Läufer durch alle Lande und ließ bekannt machen: »Meine Töchter sind abhanden gekommen; wer sie wiederfindet, soll die älteste zur Gemahlin haben und nach mir König werden.« Söhne nämlich waren nicht da. So gern nun jeder König geworden wäre, so meldete sich doch niemand; denn nirgends im Lande waren die drei Königstöchter zu hören und zu sehen, und du weißt recht gut, warum nicht. So rief denn eines Tags der König seinen Kutscher und seinen Bedienten herein und sagte zu ihnen: »Nehmt mein eigen Gespann, ich gehe derweil zu Fuß, und laßt euch so viel Gold geben, als ihr wollt, und suchet meine Töchter überall; vielleicht, daß ihr sie findet.« »Wir wollen's versuchen«, erwiderten sie, thaten, wie ihnen geboten worden, und fuhren ab. Als sie etwa zwei Pfeifen Tabak gefahren waren, sahen sie im Graben einen Handwerksburschen sitzen und fragten ihn nach seinem Gewerbe, und wohin er wolle. »Ich bin ein Goldschmied«, sagte er, »und suche die drei Prinzessinnen.« »Das thun auch wir«, versetzten jene; »so können wir ja zusammen reisen.« Der Goldschmied war's zufrieden; »doch«, sagte er, »so geht's nicht! Da vor uns liegt ein großer Wald; drum haltet euch ja an Lebensmittel.« Als jene hierauf mit ihren Goldstücken klimperten, fuhr er fort: »An Gold könnt ihr doch nicht anbeißen, und zu kaufen giebt's dort nichts.« »Ei«, meinten jene, »wir haben noch schöne Sachen aus der Königsküche, und die Pferde ziehen schon was weg in einem Tage«; so fuhren sie sorglos weiter, kamen aber mit dem Handwerksburschen überein, sie wollten im Schatten eines Baumes so lange warten, bis er nachkomme. Während sie da nun sich lagerten und das feine Backwerk und das süße Getränk verzehrten, was ihnen die todkranke Königin eigentlich für die Töchter mitgegeben hatte, die Pferde graseten munter umher; gieng der Goldschmied in ein nahes Dorf, klopfte an alle Thüren, füllte sein Felleisen mit Brod und gesellte sich bald wieder zu ihnen. Da schirrten sie die Thiere an und fuhren weiter. Sie fuhren aber immer zu, die ganze Nacht und den ganzen Tag, und der Wald ward noch immer dichter, und nimmer zeigte sich ein Ende; sie wurden müde und machten Halt, sie wurden hungerig und sättigten sich, und fuhren ebenso die zweite Nacht und den zweiten Tag und ruhten aus. Mit dem Satteßen war's aber für Kutscher und Bedienten aus; denn ihre leckere Speise war verzehrt, und als der Goldschmied ihnen von seinem Vorrath anbot, antworteten sie: »So hoch hat Gott uns noch nicht gestraft, daß wir Bettelbrod eßen sollten!« Jener machte sich nichts daraus, aß sein Bettelbrod, trank klares Waßer dazu und sang und pfiff, daß es eine Lust war, wenigstens für ihn, wenn auch nicht für die beiden anderen; denn die gönnten ihm nicht, daß er satt und fröhlich war. Am dritten Tage bot er ihnen wieder von seinem Bettelbrod an, und nun mußten sie sich schon bequemen; doch sträubten sie sich wieder noch ein wenig und sagten: »Für umsonst nehmen wir nichts; wenn du uns aber davon verkaufen willst, so mag es gehen.« »Da sei Gott für!« versetzte jener; »umsonst hab' ich's empfangen, umsonst geb' ich's wieder weg, oder gar nicht.« So langten sie denn zu, und das Bettelbrod schmeckte ihnen wunderschön.
Gegen Abend kamen sie endlich aus dem Walde heraus und trafen auf ein kleines Haus. »Da endlich wird's was Beßeres geben, als Bettelbrod!« sagten Kutscher und Bedienter; »nun wollen wir dich einmal frei halten!« Sie fuhren hinzu, aber keine Mutterseele ließ sich sehen; sie giengen hinein, suchten alle Zimmer durch, fanden jedoch kein lebendes Wesen drin. So ward denn wieder zum Bettelbrod gegriffen, und alle schliefen ein. Am andern Morgen, als sie abermals das Haus durchsuchten, fanden sie allerlei ungekochtes Gemüse, auch brannte ein Feuer auf dem Herde; da wurden sie eins unter einander, Kutscher und Goldschmied sollten auf die Jagd gehen, der Bediente hingegen, der sich nicht gern rühren mochte, solle zu Hause bleiben und ein Mittagsmahl zubereiten; und sie thaten also. Zuerst besah sich der Bediente alle Zimmerchen, und damit gieng der Morgen fast hin; als er endlich in die Küche gieng und von dem blank geputzten Geschirr nahm, Gemüse hinein that und aufs Feuer setzen wollte, bekam er, die Sonne stand gerade mitten am Himmel, bekam er plötzlich solche Ohrfeigen, rechts und links, rechts und links, daß ihm Hören und Sehen vergieng, und er von der einen Seite zur andern flog. Voll Entsetzen flüchtete er sich in die Stube, und siehe! vor ihm stand der Zwergkönig, sah ihn grimmig an und brummte: »Was thust du in meinem Hause? Was thust du in meinem Hause?« »Bist du's gewesen, der mich geschlagen?« kreischte der Bediente; »dich Klabautermännchen will ich schon über Bord kriegen!« und nun fielen sie über einander her, hast du nicht, so kannst du nicht, und rupften sich und balgten sich; bald aber gieng dem Bedienten der Athem aus, und der Zwergkönig stieß ihn von einer Ecke in die andere und ließ ihn für todt liegen. Als die beiden anderen nach Hause kamen, sie hatten nichts geschoßen, fanden sie den Bedienten noch im Winkel liegen, ganz lahm und zerstoßen. »Mensch, was fehlt dir?« fragten sie. »Ich bin krank geworden,« log jener. »Nun,« meinte der Goldschmied, »dem Menschen kann bald was zustoßen.« Hierauf brachten sie ihn zu Bett, aßen vom Bettelbrod, das schon schimmelig wurde und ihnen doch schmeckte, auch dem Kutscher, und legten sich danach aufs Ohr.
Am andern Morgen, als die Sonne aufstand, weckte der Handwerksbursch die beiden anderen und sagte: »Heute laßt uns aber ernstlich an Speise denken; denn mit meinem Brod ist's bald aus und vorbei.« Der Kutscher stieg, der Bediente kletterte aus dem Bett, und nun wurden sie eins, der Kutscher soll zu Haus bleiben, die beiden anderen sollen ihr Heil auf der Jagd probieren. Gern wäre der Bediente daheim geblieben; doch die Knüffe und Püffe – nein, lieber mitgehumpelt! Er war aber ein böser, böser Mensch; deshalb sagte er von seinem Unglücke kein Sterbenswörtchen, auch dem Kutscher nicht, lachte vielmehr ins Fäustchen und dachte: »Was dem einen recht ist, ist dem andern billig.« Während die Jäger draußen umherirrten, wollten sie eben zuschießen, husch! war das Wild fort, wollten sie Beeren pflücken, hui! war's eine häßliche Spinne; schnoperte der Kutscher das Haus durch, Zimmerchen um Zimmerchen, und als er endlich, die Sonne stand wieder gerade mitten am Himmel, in die Küche gieng, von dem blank geputzten Geschirr nahm, Gemüse hinein that und aufs Feuer setzen wollte, bekam er plötzlich solche Ohrfeigen, rechts und links, rechts und links, daß ihm Hören und Sehen vergieng, und er von der einen Seite zur andern flog. Voll Entsetzen flüchtete er sich in die Stube, und siehe! vor ihm stand der Zwergkönig, sah ihn grimmig an und brummte: »Was thust du in meinem Hause? Was thust du in meinem Hause?« »Bist du's gewesen, der mich geschlagen?« schrie der Kutscher; »dich Knirps soll der Kukuk!« und nun fielen sie über einander her, und nun gieng's dem Kutscher ebenso schlimm wie dem Bedienten: zerstoßen, zerkratzt, windelweich geschlagen, fiel er wie gerädert in eine Ecke. Als die beiden anderen nach Hause kamen, sie hatten nichts geschoßen, fanden sie den Kutscher für todt im Winkel liegen. »Mensch, was fehlt dir?« fragten sie. »Ich bin krank geworden«, log jener. Der Bediente lachte und freute sich erst recht auf morgen; der Goldschmied aber sagte: »Nun, dem Menschen kann bald was zustoßen!« Sie brachten ihn zu Bette, aßen das letzte Bettelbrod auf, in dem schon Maden saßen, das ihnen aber doch schmeckte, auch dem Bedienten, und legten sich danach aufs Ohr.
Am andern Morgen, als die Sonne aufstand, weckte der Handwerksbursch die beiden anderen und sagte: »Mein Brod ist verzehrt bis auf die letzte Rinde; also laßt uns auf anderes Eßen denken. Und da euch beiden was zugestoßen ist, denk' ich, bleib' ich heute zu Haus, und ihr geht auf die Jagd.« Des waren sie froh und humpelten fort. Erst giengen sie stumm neben einander; endlich sagte der Bediente: »Nun kommt die Reihe an ihn!« »Ja, nun kommt die Reihe an ihn!« versetzte der Kutscher; und als sie merkten, daß es ihnen beiden ganz gleich ergangen sei, klagten sie sich ihre Noth und freuten sich nur, daß sie's schon überstanden hätten, während der Handwerksbursch erst noch hindurch müße. Auch wurden sie eins, sie wollten sich hinlegen und schlafen, denn es hülfe alles Jagen doch nicht; in nächster Nacht aber wollten sie den lahmen Goldschmied zurücklaßen und sich mit dem Gespann aus dem Staube machen. Und sie legten sich ins Gras und schliefen ein. Unser Goldschmied derweil besuchte alle Zimmerchen, fand auch einen Weinkeller, der offen stand und voll besten Weines war, und den die anderen nicht gefunden hatten; dann gieng er in die Küche, und siehe! hier kochte und schmorte es schon, daß es eine Art hatte, die Aale wälzten sich in der Pfanne, die Suppe schäumte, die Erbsen platzten, der Bratspieß drehte sich von selbst, kurz, es rumorte darauf los, als sollte Hochzeit sein. An Ohrfeigen war auch nicht zu denken; als aber die Sonne gerade mitten am Himmel stand, kniff es den Goldschmied ins Bein. Erschreckt sah er sich um, und vor ihm stand der Zwergkönig, ernst, doch nicht grimmig, und sprach: »Schöne Geschichte das! zwei hab' ich schon abgeprügelt, und nun kommt noch der dritte!« »Liebes Gevatterchen«, sagte der Handwerksbursch, »um Prügel ist mir's weniger zu thun, als um Eßen, das kannst du glauben! Die letzte Rinde ist verzehrt; und wolltest du uns nur das laßen, was hier kocht und schmort, so würdest du uns einen großen Gefallen erweisen; denn der Hunger thut gar zu weh!« Zwergkönig antwortete: »Dir hab' ich's gleich angesehen, daß du beßer bist; du bittest doch noch vernünftig, wenn du was haben willst. Behalte es denn; aber die beiden verwegenen Bunken sollen nichts abhaben!« »Liebes Gevatterchen«, erwiderte der Handwerksbursch, »es ist ja nur ihre Dummheit; vergieb es ihnen also.« Der Zwerg murmelte was in den langen Bart und zeigte hierauf dem Goldschmied alle Zimmer und alle Schätze und erlaubte ihm, hier zu bleiben, so lange er wolle, und zu sieden und zu kochen, so viel ihm beliebe. »Das ist recht dankenswerth«, meinte der Handwerksbursch, »wo sollen wir aber Holz hernehmen?« Der König wies auf den Hof, wo Baum an Baum lag. »Liebes Gevatterchen«, sagte der Goldschmied, »das ist aber nicht gespalten!« »Hier ist ein Beil«, entgegnete der Zwerg und zog ein funkelnagelneues aus der Tasche, »spalte!« Der Handwerksbursch versetzte: »Vier Hände können mehr als zwei, und die Bäume sind dick; wolltest du mir nicht ein wenig helfen?« »Auch das noch?« brummte der Zwerg; »nun, meinetwegen ans Werk!« und langte ein zweites Beil aus der Tasche. Hierauf spalteten sie einen Baum und noch einen und giengen an den dritten. Eben hatte der Zwerg einen dicken Keil hineingetrieben und lehnte sich über den Baum, um die Axt aufzunehmen; da gerieth sein langer Bart in die Spalte, der Handwerksbursch zog flugs den Keil heraus, und fest saß der Zwerg und heulte und stöhnte. »So wärst du also gefangen!« sagte der Goldschmied, »nun bekenne, wo hast du die drei Königstöchter! Meine Base, die dir wohl noch bekannt sein wird, hat mir gesagt, du habest sie geraubt; sie wieder zu holen, bin ich hier. Wo sind sie? Bekenne, oder du bist auf ewig gefangen.« Der Zwerg wand und krümmte sich, bat um Befreiung, versprach alles, kam jedoch nicht eher los, als bis er bekannte: »Die drei Prinzessinnen sind in meinem Schloß. Hier hast du einen Zauberstab; geh damit in die Mitte des Waldes, dahin, wo er sich mit der Spitze zur Erde neigt. Da brich ihn dreimal durch; dann öffnet sich die Erde, und du wirst weiter sehen. Und hier hast du einen Bindfaden, zweimal sechsundachtzig Klafter lang; so tief geh, aber tiefer nicht.« Der Goldschmied dankte, trieb aufs neue den Keil hinein, und verschwunden war der Zwerg. Kaum war jener im Hause, die Sonne wollte schon untergehen, als der Bediente und der Kutscher heulend hereinstürzten: »Es hat uns jemand schrecklich am Barte gezupft, die Ohren gerieben wie nichts Guts, und ist doch niemand dagewesen; es muß der Zwergkönig gewesen sein!« Er war es auch gewesen. Wie aber staunten sie, als sie den Goldschmied frisch und munter fanden, die Tafel gedeckt, die Schüßeln dampfen, die Tische von Speisen und süßem Wein knacken! Sie fragten und fragten, aber der Goldschmied sagte nichts; so aßen und tranken sie, bis sie müde wurden und ins Bett taumelten.
Nun blieben sie hier eine Woche und noch eine und noch eine, zwei schlenderten umher, einer kochte und besorgte den Tisch, und so alle Tage umschicht, und lebten in Saus und Braus; der Kutscher und der Bediente dachten weder an den Vater, der auf seine Kinder hoffte, die Mutter war todt, noch an die Töchter, die vielleicht auch nicht lauter Freude hatten; der Goldschmied aber dachte an alles, so wohl es ihm hier gefiel. Endlich sprach er: »Ich schlage vor, wir bekümmern uns nun einmal um die drei Prinzessinnen!« Die anderen wollten erst nicht; als sie aber sahen, daß es jenem Ernst damit war, und er allein fort wollte, sagten sie: »Nun, so wollen wir sie suchen; finden wir sie aber nicht, kommen wir hieher zurück, denn hier ist's wohl sein!« Der Handwerksbursch schlug vor: »Wir ziehen jeder unsere Straße«; dagegen sträubten sich die anderen, und so fuhren sie zusammen in den Wald. Als sie die Mitte desselben erreicht hatten, kehrte sich das Stäbchen mit dem einen Ende zur Erde; der Handwerksbursch wollte es gerade halten, es gieng nicht; die anderen faßten es mit an, es neigte sich. Nun nahm es der Goldschmied und brach es dreimal durch; beim erstenmal krachte es in der Erde, beim zweitenmal barst sie ein wenig auf, beim drittenmal that sie sich aus einander und zeigte eine lange Wendeltreppe von weißem Marmor. »Wer will hinein?« fragte der Goldschmied; keiner meldete sich. So hieß er jene den Bindfaden fest halten, und sie thaten's auch; er selber stieg hinab, bis der Faden zu Ende war. Da fand er unten ein wunderschönes Schloß mit hohen Thürmen und hellen Fenstern, und als er anklopfte, sprang das Thor auf, und er gelangte über einen großen Hof, wo alles still und öde war. Vor der Hausthür standen Posten, langbärtige Zwerge, die waren fest eingeschlafen; er zupfte sie am Bart, er rief und schüttelte sie, sie schliefen weiter. Er klopfte an die Thür, sie drehte sich knarrend in den Angeln, und er kam in ein schönes Zimmer, in welchem es hell war von den Waffen an der Wand, so leuchteten sie; Zwerge waren auch genug da, sie schliefen aber und antworteten nichts. So war's auch im zweiten Zimmer, und als er die Küchenthür öffnete, er gieng aber nicht hinein, sah er, wie selbst die Flamme schlief, und er dachte bei sich: »Komische Wirthschaft das!« Am andern Ende des zweiten Zimmers war aber eine große, große gläserne Thür, die führte in einen großen, großen Saal; hier blieb er stehen, blickte hindurch und sah dann die drei Königstöchter an einem Tische sitzen, und sie waren erschrecklich blaß und weinten, und die älteste hatte den Zwergkönig auf dem Schoß, und auch dieser schlief und schnarchte. Der Goldschmied klopfte leise an; da kam die zweite herbei geschlichen und erkundigte sich, wer er sei, und was er wolle. Er antwortete: »Wir suchen euch. Eure Mutter ist gestorben vor Gram; euer Vater lebt noch und hofft auf eure Wiederkehr.« Da sagte es die zweite den beiden anderen, und alle weinten; die älteste aber sprach: »Es geht nicht! der Zwergkönig läßt uns nicht weg, es wäre denn, daß du ihn tödtetest.« Als der Goldschmied dazu bereit war, holte die jüngste ihm ein blankes Schwert von der Wand, die beiden anderen ließen den Kopf des Königs sacht auf einen Stuhl gleiten, und – »hau ihn ja zum erstenmal ab!« – flüsterte noch die älteste, da rollte schon der Kopf im Saal umher, der Rumpf zuckte am Boden, und das Blut spritzte bis an die Decke; und als der König starb, hörten sie draußen ein Gepolter und Geseufze, und als sie zusahen, waren alle Zwerge todt niedergefallen, das Feuer war aus, und alles war still wie im Grab. – Die drei Schwestern freuten sich, bedankten sich und sagten: »Du hast uns erlöst; aber drei Tage müßen wir hier noch bleiben, sonst müßten wir auch sterben. So komm denn über die Zeit wieder und hole uns!« Und zum Zeichen gab ihm die älteste eine goldene Sonne, die zweite einen goldenen Mond und die dritte einen goldenen Stern; an allen aber stand der Name des Königs. Der Handwerksbursch versprach es, entfernte sich, stieg die Wendeltreppe hinauf, und die Erde schloß sich nicht wieder.
Oben angelangt, erzählte er den beiden Gefährten alles, wie sich's zugetragen hatte; nur von den drei Zeichen sagte er ihnen nichts. Da wurden sie lustig über die Maßen, sprangen in den Wagen und ließen den Goldschmied zu Fuße nachkommen; dieser aber dachte: »Fahrt nur zu!« Unterwegs verbrachten jene alles Geld, das ihnen der König mitgegeben hatte, und fuhren jubelnd vors Schloß, wo sie mit ihrem Bericht alles heiterer stimmten, besonders den König. Am andern Tage kam auch der Handwerksbursch; er hatte sich wieder Brod gebettelt und die Nacht unter freiem Himmel zugebracht. Als er dem König alles haarklein erzählte, und wie die Töchter so blaß und traurig wären, da meinte schon der König: »Er ist der Rechte«; als er nun aber noch die drei Zeichen vorwies, da sagte der König: »Du bist der Rechte; du sollst die älteste Tochter zur Gemahlin haben und König werden.« »So erlaubt mir, Herr König,« versetzte der Goldschmied, »daß ich zuvor meine alten Eltern wiedersehe und mir deren Segen hole.« Des war der König zufrieden; »komm aber ja zur rechten Zeit wieder«, fügte er hinzu. »Wenn ich kann!« meinte jener und zog seine Straße. Er konnte aber nicht; denn seine Mutter war krank, und sie wollte er erst genesen sehen, worüber Woche auf Woche vergieng.
Am dritten Tage, als der Goldschmied nicht wiedergekommen war, sandte der König den Kutscher und den Bedienten los mit vielen Soldaten, die drei Töchter zu holen. Sie fanden auch die Stelle wieder, stiegen hinab zu den Königstöchtern und bedroheten sie: »Wenn ihr nicht sagt, daß wir euch erlöst haben, so müßt ihr alle sterben.« Die Prinzessinnen erschraken und besannen sich; die beiden Schurken schnitten aber so grimmige Geberden, daß sie's versprachen. So fuhren sie denn zusammen ins Schloß, und da war lauter Freude und Wonne; auch kamen viele Fürsten, um dem Könige und den Prinzessinnen Glück zu wünschen. Nach mehreren Wochen, als der Goldschmied immer nicht wiederkam, und die beiden anderen immer stärker auf den König eindrangen, er solle sein Versprechen erfüllen, sie selber wollten um die älteste Tochter loosen, bestellte jener eine große Versammlung, beschied auch den Kutscher und den Bedienten dahin sammt den drei Töchtern und fragte, wer diese erlöset habe. »Der Kutscher und der Bediente«, sagte die älteste, und die beiden andern bejaheten es. Der König merkte die Schurkerei; was wollte er aber machen? er setzte die Hochzeit fest. Da jammerte die älteste Tochter und bat, noch ein wenig zu warten; eben sei ja erst die Mutter gestorben, und da könnten sie noch nicht tanzen. Der König willigte ein. Nach vier Wochen, als der Kutscher und der Bediente immer lauter wurden und auf ihr Recht pochten, berief der König wieder eine Versammlung und bestimmte nun die Hochzeit auf den siebten Tag; »länger«, sagte er, »warten wir aber nicht« und dachte, »vielleicht ist der Goldschmied ein Schelm, denn er kommt ja nicht wieder, und da hat einer der anderen die Krone verdient.« Die älteste Prinzessin weinte und rang die Hände, denn sie hatte den Goldschmied sehr lieb, und immer wollte er noch nicht kommen. Sie sah auch Tag und Nacht vom hohen Schloß herab, sie sah sich fast die hellen Augen blind; aber immer wollte der Goldschmied nicht kommen. Am Morgen des siebten Tags, der Bediente, denn ihn hatte das Loos getroffen, war schon stattlich herausgeputzt, die unglückliche Braut aber schlummerte noch, am Morgen des siebten Tags ward's laut vor dem Thor; die Braut fuhr aus wirren Träumen auf und sah hinunter; und siehe! der Goldschmied, schmuck angezogen und wunderschön von Gestalt, stritt mit den Posten, die ihn nicht einlaßen wollten. Da konnte sie sich nicht mehr halten; »das ist der Rechte!« rief sie aus dem Fenster; »der Rechte ist da!« rief sie ihrem Vater in die Kammer. Der Goldschmied kam herein, und alle bewunderten den schmucken, schlanken Jüngling. Nun gieng's ans Erzählen, und der Goldschmied sagte: »Ich wollte nicht ohne meine Eltern Hochzeit halten; dort kommen sie nachgefahren.« Der König freute sich und sagte: »Ist das der Rechte?« »Ja, das ist der Rechte!« riefen die Prinzessinnen, »das ist unser lieber Erlöser!« »Nun«, sagte der König zur ältesten, »so heirate du diesen.« Hierauf mußte der Goldschmied abtreten, und der Kutscher mit dem Bedienten hereinkommen; und der König fragte sie: »Was verdient der, der seinen Herrn und König betrügen will?« Sie wußten nicht, daß der Goldschmied da sei, und meinten, der König denke an diesen, und so antworteten sie: »Daß er von vier Pferden aus einander gerißen werde!« »Ihr habt euch selbst das Urtheil gesprochen; führt sie zum Tode, Soldaten!« Der Goldschmied hatte es nebenan gehört und stürzte hervor und bat für sie; der König jedoch, so gern er ihm sonst einen Gefallen gethan hätte, mußte es ihm abschlagen, da die beiden zu ruchlos gewesen waren, und so wurden sie von vier Pferden aus einander gerißen. Der Goldschmied aber heiratete die älteste Prinzessin, erhielt nach des alten Königs Tode die Krone, und sie haben lange glücklich mit einander gelebt.
2. Vom blutrothen Meßer und steinharten Brod.
Mündlich auf der List.
Es war einmal eine arme Wittwe, die hatte sechs unmündige Kinder, und als einst im Frühling ein böses Fieber kam und erst die Kinder und danach auch die Mutter niederwarf, da war es, als sollten sie verhungern. In dieser schrecklichen Noth raffte die Mutter sich auf, schleppte sich nach einer reichen Frau, die gerade gegenüber wohnte, und bat um ein wenig Brod. Diese aber wies sie schnöde ab und entgegnete: »Ich gäbe dir wohl was; doch mein Meßer ist so roth wie Blut, und mein Brod so hart wie Stein.« Die unglückliche Mutter entsetzte sich, wankte traurig aus der Thür und fiel wie todt auf der Schwelle nieder. Bald aber erholte sie sich; denn ein altes Mütterchen kam an einer Krücke herbeigehinkt, flößte ihr einige Tropfen Wein ein, tunkte etwas Brod in Wein, reichte es der Wittwe und brachte sie also ins Leben zurück. Hierauf fragte das alte Mütterchen: »Was fehlt dir? was weinest du?« Jene erzählte ihr die Geschichte, und nun hob das Mütterchen den krummen Zeigefinger gegen die reiche Frau auf und murmelte: »Dein Meßer so roth wie Blut! dein Brod so hart wie Stein!« Als nun aber die Wittwe ihrer armen Würmlein gedachte, da weinte sie von neuem; das alte Mütterchen jedoch tröstete sie und sagte: »Was todt ist, das ist wohl versorgt; was noch lebt, das soll nicht sterben.« Und sie giengen zusammen in die Höhle des Jammers, und fünf Kinder wurden wieder lebendig, als das Mütterchen ihnen Wein einflößte, und das sechste lag da und lächelte, denn dieß sechste – ja, das war beim lieben Gott. – Um die Frühstückszeit gieng die reiche Frau in die Speisekammer, um sich Brod zu schneiden; aber das Meßer war so roth wie Blut, und das Brod so hart wie Stein. Sie nahm ein anderes Meßer und ein anderes Brod; aber das Meßer war so roth wie Blut, und das Brod so hart wie Stein. In höchster Angst rief sie einen Diener herbei, und in dessen Hand war das Meßer so blank wie Eis, und das Brod so weich wie Brod; doch als die Frau das Butterbrod eßen wollte, da war es in ihrem Munde so hart wie Stein. Und alle Speise, die sie von der Zeit an über die Lippen brachte, es mochte Brod oder Fleisch oder Gemüse sein, war in ihrem Munde so hart wie Stein; und als sie elendiglich verhungert war, da lächelte sie nicht auf dem Todtenbette, denn sie war nicht bei Gott, sondern mußte alle Nacht umgehen; und sie hatte nicht eher Ruhe im Grabe, als bis der eine von ihren Erben der armen Wittwe so viel von der Erbschaft gab, daß sie mit ihren Kindern zu leben hatte bis an ihren Tod.
3. Von dem Breikeßel.
Mündlich in Springe.
Sieben Meilen hinter Eulenpfingsten lebten vor alter Zeit ein Mann und eine Frau, aßen und tranken und waren allezeit guter Dinge. Der Mann aber war ein Müller; nun rathe, was die Frau war. Und sie hatten eine einzige Tochter, wenn die im Sommer am Bache saß und ihre Füßchen spülte, kamen alle Fische herbei und sprangen vor Freuden aus dem Waßer, so schön war sie. Einst wurde eine theure Zeit, und es kam nur wenig Korn zur Mühle; deshalb hatten sie nichts mehr zu eßen. Da gieng die Frau eines Tages hin, schüttelte alle Kisten und Kasten und klopfte alle Säcke aus, that das letzte Salz daran, kochte einen Roggenbrei und sagte: »Dieß wird die letzte Mahlzeit sein; wir können uns dann hinlegen und sterben.« Als der Brei bald fertig war, kam der Mann in die Küche, nahm den hölzernen Löffel und wollte einmal schmecken. Die Frau verwehrte es ihm, und als er Gewalt brauchen wollte, nahm sie den Keßel auf den Kopf und lief davon, daß ihr die Haare um den Nacken flogen; der Mann mit dem Löffel in der Hand setzte hinter ihr her, und als die Tochter das sah, nahm sie ihre Schuhe in die Hand und lief hinter dem Vater her. Und sie kamen in einen Wald, da verlor das Mädchen den einen Schuh, und während sie den suchte, ohne ihn finden zu können, verschwanden Vater und Mutter hinter den Bäumen; da setzte sie sich hinter einen Busch und konnte nicht mehr, so müde war sie, und weinte und wimmerte, und als sie daran dachte, daß sie ihren einen Schuh verloren hatte, weinte sie noch viel mehr. Den Schuh aber hatte der Zaunkönig gefunden, und die Frau Zaunkönigin wiegte ihre Jungen darin. Als sie nun da so saß und klagte, daß es einen Stein hätte erbarmen sollen, stand auf einmal eine steinalte Frau vor ihr, die sagte: »Was fehlt dir, mein Kind?« Das Mädchen antwortete: »Ja, die Mutter nahm das letzte Mehl und kochte einen Brei davon, da wollte der Vater schmecken, die Mutter wollte es nicht haben; nun ist sie davon gelaufen mit dem Keßel auf dem Kopf, und der Vater läuft hinter ihr her mit dem Löffel in der Hand; und als ich ihnen nachlief, verlor ich den einen Schuh, und während ich den suchte, verschwanden Vater und Mutter hinter den Bäumen. Was soll ich nun anfangen? Hätte ich nur den Schuh wieder!« »Hier hast du einen andern«, sagte die Frau, griff in die Tasche, holte einen funkelnagelneuen heraus und setzte hinzu: »Sei ruhig und thu, was ich dir sage, so wird alles gut! Geh noch ein wenig tiefer in den Wald, da kommst du an ein großes Haus, das ist ein Königsschloß, da geh hinein; und wenn sie dir dann viele Kleider vorlegen, seidene, baumwollene und leinene, und dir sagen, du sollst dir davon eins wählen, so such dir das schönste seidene aus, und wenn sie dich fragen, warum du dir das wählst, so antworte: ›Ich bin in Seide erzogen.‹« Das Mädchen bedankte sich und gieng und kam bald an das schöne Schloß, und als sie hinein kam, und ihr die vielen Kleider vorgelegt wurden, seidene, baumwollene und leinene, suchte sie sich das schönste seidene aus. Da fragte sie der König: »Warum wählst du dir denn gleich ein seidenes?« Sie antwortete: »Ich bin in Seide erzogen«; eigentlich war sie aber in Linnen erzogen. Nun hatte der König einen Prinzen, der war zwölf Jahr alt und sollte heiraten, und als die Müllerstochter in dem seidenen Kleide herein kam, lief es ihm heiß durchs Herz, und er sagte: »Lieber Vater, wenn ich doch nun einmal mit Gewalt heiraten soll, so gebt mir die; eine andere nehme ich nun und nimmermehr!« Des waren alle froh, und die Hochzeit wurde angesetzt. Eines Tages stand die Braut oben im Saale am Fenster und besah sich die Gegend, und als sie eben noch hinuntersah, siehe, da lief da ihre Mutter vorbei mit dem Keßel auf dem Kopf, daß ihr die Haare um den Nacken flogen, und hinter ihr her lief der Vater mit dem großen hölzernen Löffel in der Hand; da konnte sie es nicht laßen, sie mußte laut auflachen. Das hörte der Prinz im Nebenzimmer und kam herein und sagte: »Schätzchen, was lachst du?« Sie wollte die Geschichte von ihren Eltern nicht gern erzählen und antwortete: »Ich lache darüber, daß wir in diesem kleinen Schloße Hochzeit halten sollen; denn wo wollen hier die vielen Gäste unterkommen?« Da versetzte der Prinz: »Hast du denn ein größeres?« Sie antwortete: »Ja, viel größer«; sie hatte aber eigentlich gar kein Schloß. »Ei,« sagte der Prinz, »so laß uns die Hochzeit noch acht Tage aufschieben! Wir bestellen dann alle auf dein Schloß, fahren gleichfalls dahin und feiern dort die Hochzeit.« Damit gieng er weg, um es dem Vater zu sagen; sie aber stieg in den Hof hinab und war traurig, denn wo sollte das große Schloß herkommen? Und als sie da saß und weinte, war auf einmal die alte Frau vor ihr und sagte: »Was fehlt dir?« Sie antwortete: »Ich stand gerade oben im Saale am Fenster und besah mir die Gegend, und siehe, da liefen meine Eltern unten vorbei, und da mußte ich laut auflachen. Das hörte mein Bräutigam im Nebenzimmer, und als er kam und sich erkundigte, warum ich gelacht habe, wandte ich vor, es sei wegen dieses kleinen Schloßes geschehen; ich hätte ein viel größeres. Nun soll dort die Hochzeit gefeiert werden, und ich habe doch gar kein Schloß.« »Das hast du doch!« erwiderte die Alte; »sei nur ruhig und fahre getrost mit hin, und wenn ihr ein bißchen gefahren seid, springt ein weißer Pudel aus dem Gebüsch, den du allein sehen kannst; wo der hinläuft, laß hinfahren.« Damit verschwand die alte Frau, und das Mädchen gieng wieder in den Saal. Als die acht Tage umwaren, und die Gäste zur Hochzeit kamen, fuhren sie über die Brücke in den Wald, und bald sprang ein weißer Pudel aus dem Gebüsch, den das Mädchen allein sehen konnte, und wohin der lief, ließ sie ihren Wagen fahren, und die anderen Wagen kamen alle hinterdrein. Als sie eine Zeit lang unterweges waren, und den Gästen die Zeit lange zu dauern anfieng, fragten sie: »Sind wir noch nicht bald hin?« Sie antwortete: »Sogleich«, und in demselben Augenblick stand der Pudel still und verschwand im Gebüsch, und wo er verschwunden war, stand plötzlich ein großes Schloß mit hohen Thürmen und hellen Fenstern, und lustig drängte sich der Rauch aus allen Schornsteinen. »Das ist mein Schloß«, sagte die Braut, und alle stiegen aus und giengen hinein. Und siehe, die Tische waren gedeckt, die Betten gemacht, und die Bedienten liefen ein und aus. Da hielten sie ein halbes Jahr Hochzeit. Und am letzten Tage, als sie schon eingepackt hatten, um wieder nach dem alten Schloße zu fahren, und eben zum letztenmal bei Tische saßen, da plötzlich rannte etwas gegen die Thür, daß sie krachend aufsprang. »Frau Königin! Frau Königin!« rief eine Frau, die mit einem Keßel auf dem Kopfe hereinstürzte, »Frau Königin schützt mich; mein Mann will mich schlagen!« Und der Mann kam hereingestürmt mit einem hölzernen Löffel und war ganz wüthend und wollte die Frau schlagen; als er aber die hohen Gäste sah, ließ er es bleiben. »Das sind meine lieben Eltern!« sagte die junge Königin, und der junge König freute sich, und der alte auch, denn sie hatten die schöne Frau über die Maße lieb; und als diese ihre ganze Geschichte erzählt hatte, mußten die Bedienten den großen hölzernen Löffel nehmen und jedem der Gäste einen Löffel voll von dem Brei, dem alle ihr Glück verdankten, auf den Teller geben, und alle aßen davon und lobten ihn; der Müller und die Müllerin aber bekamen so viel Wein und Braten, wie sie nur laßen konnten, und das war sehr viel, denn sie hatten sich ungemein hungerig gelaufen.
4. Großmütterchen Immergrün.
Mündlich in Hildesheim.
Es war einmal eine kranke Mutter, die hatte Herzweh nach Erdbeeren und schickte deshalb ihre beiden Kinder ins Holz, daß sie ihr welche suchten. Als das Körbchen voll war, keins aber hatte eine gegeßen, so lieb hatten sie die Mutter; da kam ein altes Mütterchen daher, das war ganz grün angezogen und sprach zu ihnen: »Ich bin hungerig und kann mich nicht mehr bücken, so alt bin ich; schenkt mir ein paar Erdbeeren.« Und sie erbarmten sich der alten Frau und schütteten ihr das Körbchen in den Schoß. Als sie hierauf forteilten, um andere zu pflücken, rief das Mütterchen sie zurück, nahm sie bei der Hand und sagte: »Nehmet die Erdbeeren nur wieder, ich finde doch schon; und weil ihr ein so gutes Herz habt, schenke ich dir eine weiße und dir eine blaue Blume. Nehmet sie wohl in Acht, bringt ihnen alle Morgen frisches Waßer, und zanket nicht mit einander!« Sie dankten und eilten nach Hause. Als die Mutter die erste Erdbeere an die Lippen brachte, da war sie gesund, und das hatte Großmütterchen Immergrün gethan; und als die Kinder die Geschichte erzählten, da dankte sie der holden Frau und freute sich der Kinder, und so oft diese die Blumen ansahen, die immer frisch und lieblich waren, gedachten sie an das Wort: »Zanket nicht mit einander!« Eines Abends jedoch entzweiten sie sich und giengen friedlos zu Bette; und als sie am Morgen die Blumen tränken wollten, siehe! da waren diese kohlrabenschwarz. Da erschraken sie, nahmen sie traurig in die Hand und weinten viele, viele Thränen auf die Blumen; und siehe! die weiße wurde wieder weiß, die blaue wieder blau. Seit dem Tage haben sie immer Frieden mit einander gehalten, und die Mutter hat sie gesegnet im Leben und im Tode, und sind also die Blumen ein großer Schatz für sie geworden, und haben sie Großmütterchen Immergrün lieb gehabt bis an ihren Tod.
5. Peter Bär.
Mündlich in Hannover.





























