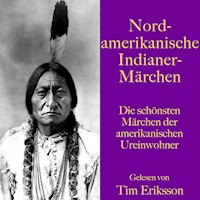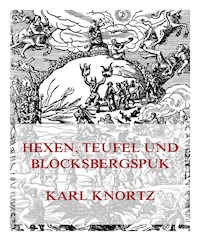3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Geschenkbuch Weisheit
- Sprache: Deutsch
Die Märchen und Sagen der Indianer sprudeln nur so vor Originalität und Fantasie. Himmelhohe Riesen und baumstarke Manitus, Jäger und Stammesgründer, Kosmogonien zahlreicher indianischer Stämme sowie Geister, die in Bächen, Felsen und Bäumen hausen, begegnen uns in dieser großartigen Sammlung. Durch die mythischen und traumhaften Elemente wandeln die Texte immer wieder in magischen Sphären und geben uns einen Einblick in die indianische Weltsicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Karl Knortz
Märchen und Sagen der Indianer Nordamerikas
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Der Text erschien zuerst 1871 bei Costenoble in Jena.
Orthografie und Interpunktion wurden für diese Ausgabe auf neue deutsche Rechtschreibung umgestellt.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
© 2017 Anaconda Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlagmotiv: »Tribal seamless colorful geometric pattern. Ethnic vector texture. Traditional ornament«, © Chernushka / Shutterstock. – »Indianischer Traumfänger, Dekoration, Fotografie, Horizontal, Indigenes Volk«, © worawut17 / iStock Umschlaggestaltung: Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bonn ISBN 978-3-7306-9163-2V002
www.anacondaverlag.de
EINLEITUNG
Ich weiß nicht, ob es gerade ein lohnendes Unternehmen ist, die Märchen, Sagen und Fabeln der wilden Rothäute der nordamerikanischen Urwälder und Prärien zusammenzustellen; äußerst mühevoll ist es sicher, das so weitläufig zerstreute Material aus den vielen englischen und französischen Büchern und mündlichen Berichten der Missionare, Dolmetscher, Reisenden und Indianeragenten zu kollektieren, zu ordnen und umzuschreiben. Doch glaube ich, dass es jedenfalls eine interessante Aufgabe ist, der ich mich hier unterzogen habe, denn statt der Anzahl der bisherigen stereotypen Skalpgeschichten hält uns eine solche Sammlung einen klaren Spiegel indianischen Gemütslebens vor, bestehend in uroriginellen, wild aufgeschossenen, zwischen Blumen, Gras und Wigwamstangen gekeimten Fantasien, mit denen sich der alte Medizinmann schon mehr als tausendundeinmal ein »heiligeres« Ansehen gegeben und der vom rauen Kabibonokko in den Wigwam gebannte Familienvater seinen Kindern schon ebenso oft Hunger wie Langeweile vertrieben hat.
Nur im Winter hat der Indianer zu solcher Unterhaltung Zeit und Muße, denn im Sommer, wenn »die Wildnis blüht wie eine Rose« und ihn die Strahlen der Sonne aus der engen Hütte jagen, verbieten ihm sein Gewissen und seine Sicherheit jene Fantastereien, denn es würden ihm dann zur Strafe, wie die alten Propheten lehren, Kröten und Klapperschlangen die nächtliche Ruhe rauben.
Ruhig sitzt er dann neben seinem glimmenden Baumstamm, raucht gelassen seine Pfeife und lässt sich dabei, wenn er gerade sprechselig und nicht allzu hungrig ist, ob seiner merkwürdig verschlungenen Geschichten bewundern, wie er sie fand:
In des Waldes Vogelnestern,
In dem Hüttenbau des Bibers,
In des Büffelochsen Hufspur,
In dem Felsenhorst des Adlers.
Da erzählt er seine haarsträubenden Sagen von himmelhohen Riesen, deren Mäntel aus Skalpen und deren Trinkgeschirre aus Schädeln ihrer Feinde bestanden; von Mammutbüffeln, die so große Füße hatten, dass sie mit einem allein den größten Wald niedertreten konnten; von baumstarken Manitus, deren Anzahl sich wie die Götter der Hindus nur nach Millionen berechnen lässt, oder von leichtfüßigen Elfen, die wie die Virgilsche Camilla über die Flüsse liefen, ohne sich die Füße zu benetzen, oder über einen Kornacker, ohne eine Ähre zu knicken – und das Echo dieser Erzählungen tönt doch sicherlich viel angenehmer und lieblicher als das jener vielen absichtlich entstellten, von müßigen Köpfen dem Geschmack des ungebildeten Publikums angepassten Gräuelgeschichten, die sich von zahlreichen »zivilisierten« Völkern in noch bedeutend grelleren Farben aufzeichnen ließen, wenn den Lesern nur damit gedient wäre. Aber die arme Rothaut ist einmal vor der öffentlichen Meinung in Ungnade gefallen, und sie ist bereits auch zu alt und zu schwach geworden, um vielleicht noch die Zeit eines günstigen Umschwungs erleben zu können, und es wird auch nicht mehr lange dauern, dass ihre Geschichte, die ja bis jetzt nur von ihrem Untergang handelte, wie ein aus uralten Zeiten überliefertes Märchen klingen wird; denn die Beherrscherin der Welt, die Zivilisation, hat jene traurigen Gestalten längst für überflüssig erklärt und ihnen schon seit geraumer Zeit im Urwald die dickste Eiche umgebogen, die ihnen den Weg zum nahen Grab zeigt.
»Das Geschlecht der Kornsäer ist mächtiger als das der Fleischfresser.«
Die Zivilisation ist eben mit einem wohlgepflegten Garten zu vergleichen, dessen Hüter hauptsächlich darauf angewiesen ist, die wilden Tiere davon fernzuhalten.
So ist’s mit dem Indianer. Als sich herausstellte, dass ihm das Wort »Fortschritt« ein unbekannter Begriff war, der weder in seinem Kopf noch in sein ganzes Leben passte, sahen sich die Blassgesichter gezwungen, ihm seinen besonderen Boden anzuweisen, wo er mit seinem Freund, dem Büffel, in gleicher Kategorie stand und nur noch insofern als höheres Geschöpf betrachtet wurde, als er ständig das willfährige Werkzeug zu den nichtswürdigsten Spekulationen abgab.
Zwar wurden für ihn die mildesten und humansten Gesetze und Bestimmungen erlassen, und sein Land wurde ihm so teuer bezahlt, wie man es einem Weißen hätte bezahlen müssen, aber er erhielt doch so gut wie gar nichts dafür. Seine Annuitäten werden gegen die wertlosesten Sachen umgetauscht. Senator Neshmith von Oregon sagte einst in einer Rede, dass er Augenzeuge gewesen sei, wie einem Stamm anstatt des bestimmten Geldes und der wollenen Decken vierzig Dutzend Paare elastischer Strumpfbänder geschickt wurden, trotzdem keiner jener Indianer je vorher nur einen Strumpf gesehen hatte.
So haben sie also ihre angestammte Heimat verloren und das bisschen Wild, das sich noch auf den für sie reservierten Strecken herumtreibt, wird auch tagtäglich seltener, denn der verwegene Trapper achtet keine Grenze, sondern geht hin, wo es ihm gefällt, bestraft aber jede unglückliche Rothaut, die sich desselben Verbrechens schuldig macht, unbarmherzig mit dem Tod oder mit Grausamkeiten, die die der roten Rasse bei Weitem in den Schatten stellen. Denn jene verwegenen Gesellen, die sich dem unsteten Trapperleben, das tagtäglich von allen erdenklichen Gefahren umgeben ist, widmen, schlagen ihr Leben äußerst gering an und das ihrer roten Brüder natürlich noch viel geringer.
Alle Indianer stimmen darin überein, dass es, seit sie mit den Weißen Umgang gepflogen hätten, bedeutend mehr Diebe, Mörder und sonstige schlechte Kerle unter ihnen gäbe.
Der Prophet Tecumseh sagte einst in einer Rede: »Als der weiße Mann seinen Fuß auf unser Land setzte, war er hungrig und schwach und hatte keinen Platz, wohin er seine Decke legen, und kein Feuer, an dem er sie trocknen konnte. Unsere Väter teilten alles mit ihm; wenn er Hunger hatte, speisten sie ihn, wenn er krank war, brachten sie ihm Medizin, und wenn es kalt war, wärmende Felle. Aber der weiße Mann ist wie die halb erfrorene Schlange, die ihren Wohltäter, der sie in seinem warmen Wigwam aufnahm, heimlich mit ihrem Gift tötete. Der weiße Mann macht jetzt Jagd auf uns und verschont weder unsere Kinder noch unsere Frauen, noch unsere alten, hilflosen Leute. Gott hat ihm ein großes Land hinter dem Wasser gegeben, aber er ist mit nichts zufrieden, und nun sucht er uns aus unserer Heimat zu vertreiben!«
Letzteres ist’s denn, was den roten Mann zur Verzweiflung treibt und was ihn lehrt, sich zuweilen ähnlicher Waffen zur Verteidigung zu bedienen. Ein jeder Weißer aber, der es mit ihm ehrlich, aufrichtig und human meint, ist mit einem Edelmut, einer Liebe und einer Aufopferung belohnt worden, die bei den zivilisierten Völkern zu großer Seltenheit gerechnet werden müssen. Ich erinnere da nur z. B. an William Penn oder an den Franzosen Dubuque, Gründer der gleichnamigen Stadt in Iowa, zu dessen Ehren lange Jahre nach seinem Tod ein heiliges Feuer unterhalten wurde; dann an den Pelzjäger Henry, den zur Zeit des Krieges Pontiacs gegen die Engländer ein Indianer schnell an Bruders statt annahm und dann seinen Häuptling durch reiche Geschenke bewog, ihn als solchen anzuerkennen und ihm das Leben zu schenken. Dann erinnere ich noch an den Missionar Dean, dessen Geschichte ein Pendant zur Pocahontas-Affäre bildet. Es war nämlich beschlossen worden, ihn zur Sühnung eines durch ein Bleichgesicht getöteten Indianers hinzurichten, als plötzlich alle Weiber des ganzen Dorfes herbeisprangen und einstimmig erklärten, dass, wenn nur eine rote Hand den Kopf des weißen Mannes berühre, sie sich augenblicklich ermorden würden. Dabei zog jede ein verborgen gehaltenes Messer hervor.
Auch erinnere ich noch an Washington, den die Irokesen Hänodägänears oder den »Städtezerstörer« nennen. Als die indianische Medizin oder Religion ihren Himmel schuf, dachte sie natürlich nicht an das Bleichgesicht und reservierte ihm daher auch keinen Sitz; sie fand übrigens auch später, dass es keines solchen würdig war. Als aber die wilden Söhne die Gerechtigkeit und die Humanität Washingtons – des Mannes, den sie schon seit der Schlacht von Monongahela von einem mächtigen Manitu beschützt glaubten – kennenlernten, da wurde es ihnen doch bang ums Herz, wenn sie dachten, dass dieser gute Mann wohl die ganze Ewigkeit am großen, mit faulen Fröschen und Eidechsen gefüllten Stinkfluss zubringen müsse, und ihre Medizinmänner sahen daher schnell nach und fanden dicht am Eingang des Paradieses einen wunderschönen Hügel voll schattiger Bäume und duftender Blumen, und darauf bauten sie seiner Seele eine trauliche Heimat, die jeder Indianer beim Eintritt in den Himmel passiert und freundlich begrüßt.
Zur Kälte der Hölle jedoch ist noch kein Weißer ausdrücklich verdammt worden, trotzdem die Gründe dafür wohl tausendfach auf der Hand liegen.
In der eigentlichen Zivilisation der roten Rasse auf praktischem Weg ist in Nordamerika noch so viel wie gar nichts geleistet worden. Die sich aufopfernden Missionare mit ihren unzähligen Bibeln in den Händen und den edelsten Gedanken in den Köpfen, die vor keiner Mühe noch Gefahr, noch vor der sprachlichen Herkulesarbeit zurückschreckten, haben aus vielfachen Gründen auch nicht viel Solides wirken können; denn abgesehen davon, dass mehrere von ihnen äußerst borniert und andere wieder sehr spekulativer Natur waren und mehr Schnapsfässer als heilsame Ideen einführten, so ist das Christentum wie eine jede andere europäische oder asiatische Religionsform das alleruntauglichste Vehikel, eine wilde Menschenrasse zu veredeln, und das hat sich, denke ich, an den Indianern am deutlichsten gezeigt.
Das Christentum hat sich einmal überlebt; der zweitausend Jahre alte Ideengang eines fremden Volkes, der fremden Verhältnissen, Gesetzen, politischen und sozialen Umständen entwurzelt ist, wirkt auf eine unter ganz anderen Ansichten groß gewordene Nation wie die Temperatur der arktischen Zone auf ein Tropengewächs.
So wenig dem Indianer eine fein gebügelte Hose, eine künstlich gestickte Weste oder ein kostbarer Biberhut von Wert sein kann und so wenig feine Möbel, Sofas und Pianos in seinen Wigwam passen, so wenig passen die biblischen Absurditäten in seinen Kopf. Wie er seine eigenen Kleider hat, so hat er auch seine eigene Religion, seine religiösen Feste, seine Gebete, seine Sintflut, seine Manitus und seine Götter, die er sich so leicht nicht nehmen lässt. Eine christliche Gottesanschauung ist ihm noch lächerlicher wie uns die seinige.
Auch ist seine Brust voll des begründeten Erbhasses, der ihn lehrt, alles von den Weißen Kommende mit der größten Vorsicht und Bedachtsamkeit zu erwägen, ehe er sich entschließt, sich etwas davon zu eigen zu machen. »Denn«, sagte einst ein Häuptling, »der weiße Mann ist nicht mit guten Absichten in unser Land gereist, und das Buch, das er mitgebracht hat und von dem er sagt, es enthalte Gottes Wort, ist nicht für die Indianer gemacht. Gott hat uns seine Gebote in den Kopf geschrieben und unseren Vorvätern gesagt, wie wir ihn ehren sollen, damit er uns immer Wild schicke. Wenn wir aber dem weißen Mann und seinem Buch folgen und unsere alten Sitten vergessen, so werden wir, wie die Erfahrung zeigt, elend und arm, und unsere Schutzgeister werden uns weinend den Rücken kehren. Dann werden wir immer tiefer und tiefer sinken und zuletzt wie er mühsam Kühe melken und Korn pflanzen müssen!«
Eine andere Unterhaltung, die uns Conrad Weiser, ehemals Dolmetscher bei den sechs Nationen, mitteilt, liefert uns ebenfalls eine treffende Charakteristik des allgemeinen Argwohns, mit dem der Indianer die christliche Kirche ansieht.
Conrad Weiser hatte einst eine Botschaft nach Onondaga im Staat New York zu bringen und traf dabei unterwegs eine ihm befreundete Rothaut, mit der er sich einige Stunden unterhielt. »Conrad«, sagte der Indianer, »du hast lange unter den Weißen gelebt und kennst auch ihre Sitten. Ich habe, wie du weißt, mich häufig längere Zeit in Albany aufgehalten und dort bemerkt, dass sie sich regelmäßig alle sieben Tage einmal in einem großen Haus versammeln; kannst du mir nicht erklären, was sie darin tun?«
»O ja«, erwiderte Weiser; »sie versammeln sich dort, um gute Dinge zu hören und ihrem Gott zu danken und zu dienen.«
»Ich zweifle nicht daran, Conrad, dass sie dir das gesagt haben, denn sie haben mir dasselbe gesagt; aber ich bezweifle dessen Wahrheit und will dir nun meine Gründe mitteilen. Ich war kürzlich wieder einmal in Albany, um meine Häute zu verkaufen und Messer, Decken usw. dafür einzutauschen. Du kennst doch Hans Hanson dort; zu dem ging ich und fragte ihn, wie viel er für das Pfund Biber geben könne. ›Vier Schilling‹, erwiderte er und fügte hinzu, dass er aber jetzt keine Geschäfte machen könne, da er in die Kirche gehen müsse.
Nun, dachte ich bei mir selbst, wenn du jetzt keine Geschäfte machen kannst, so gehst du einmal mit ihm; und ich tat es denn auch. In der Mitte des Hauses stand ein kohlschwarz angezogener Mann, der schien von sehr wichtigen Dingen zu reden, wobei er stets auf mich blickte. Da ich mir einbildete, er ärgere sich, mich hier zu sehen, so ging ich hinaus und setzte mich vor die Tür und zündete meine Pfeife an. Darauf hörte ich ganz deutlich, wie jener Mann ständig von einem Biber sprach. Als die Kirche aus war und die Leute wieder nach Hause gingen, fragte ich Hans, ob er mir nicht mehr als vier Schilling geben könne.
›Nein‹, antwortete er barsch, ›ich hab’s mir überlegt und kann nur dreieinhalb bezahlen.‹
Alle anderen Kaufleute, die ich darauf fragte, gaben mir dieselbe Antwort, und nun liegt es doch klar auf der Hand, dass sich die Weißen nur deshalb versammelten, um mir schlechte Preise für meine Biber zu zahlen. Denk nur nach, Conrad, und es wird dir einleuchten. Wenn sich die Weißen so oft versammeln, um Gutes zu hören, so sollten sie doch auch etwas Gutes wissen; aber sie wissen rein gar nichts. Wenn ein Weißer in unser Land kommt und hungrig ist, so geben wir ihm Speise und Trank und verlangen nichts dafür; kommt aber eine Rothaut in ihre Häuser, um etwas zu essen, so heißt’s zuerst: ›Wo ist dein Geld?‹ Und hat nun der Arme keins, so wird er vor die Tür geworfen.
Solche gute Sachen lehren sie nicht in jenen Versammlungen. Uns sind sie von unseren Müttern gelehrt worden, als wir noch Kinder waren, und wir haben uns deshalb nicht mehr als Männer zu versammeln brauchen. Aber die Weißen gehen nur aus dem einfachen Grund in jenes große Haus, damit sie sich einigen, wie sie uns am billigsten um unsere Felle beschwindeln!« –
Wir haben vorhin beiläufig erwähnt, dass außer dem allgemeinen psychologischen Grund auch noch die Dummheit verschiedener Missionare eine Teilschuld an ihrer Erfolglosigkeit trägt, und wir führen dazu nur ein Beispiel an, nämlich Stellen aus dem Religionsbuch eines französischen Geistlichen, dessen Manuskript zufällig Dr. Mather in die Hände fiel.
Frage: »Wie ist der Boden im Himmel?«
Antwort: »Sehr eben. Man braucht weder Fleisch noch Kleider dort; man wünscht es sich nur, und man hat es.«
Fr.: »Müssen die Leute im Himmel arbeiten?«
Antw.: »Nein, sie tun nichts. Die Felder bringen ohne besondere Mühe Korn, Bohnen und Kürbisse hervor.«
Fr.: »Wie ist der Boden in der Hölle?«
Antw.: »Sehr uneben und zerrissen; sie ist ein feuriger Pfuhl in der Mitte der Erde.«
Fr.: »Hat man Licht in der Hölle?«
Antw.: »Nein, es ist immer dunkel, und man kann nichts als Teufel sehen.«
Fr.: »Wie sehen die Teufel aus?«
Antw.: »Sehr kränklich. Sie haben Larven vor, mit denen sie die Leute erschrecken.«
Fr.: »Was wird in der Hölle gegessen?«
Antw.: »Die Leute sind immer hungrig. Die Verdammten leben von heißer Asche und von giftigen Schlangen.«
Fr.: »Welches Wasser haben sie zu trinken?«
Antw.: »Schreckliches Wasser. Nichts als geschmolzenes Blei.«
Fr.: »Sterben sie in der Hölle?«
Antw.: »Nein. Einer frisst den anderen auf; aber Gott erweckt jeden Morgen die Gefressenen wieder.«
Mit dieser Probe wird wohl der Leser genug haben. Sehen wir uns nun einmal das religiöse Leben der Indianer etwas näher an, von dem uns nichts einen besseren Begriff liefern kann als eben ihre primitiven Märchen und Legenden.
Wie bei den Griechen, so wimmelt auch bei jenen die ganze Natur von Göttern, und wie Erstere die Stufe zwischen Mensch und Gott durch ihr mächtiges Heroengeschlecht ausfüllten, so haben Letztere dafür zweideutige Manitus erfunden. Bäche, Felsen, Bäume und Sträucher sind von diesen Geistern bewohnt; Regenbogen, Nordlichter und Sternschnuppen sind Geister, und die Milchstraße ist deren Weg.
Der hauptsächlichste religiöse Kultus der Irokesen besteht in der Verehrung der heiligen drei Geschwister; diese sind der Geist des Korns, der Geist der Bohne und der Geist des Kürbisses. Jene Pflanzen sind nämlich die wichtigsten Gaben des Großen Geistes und daher besonderen Schutzengeln anvertraut worden, unter denen man sich drei schöne Frauen vorstellt, die einen großen Wigwam bewohnen und unter dem Namen Deohako bekannt sind.
Die guten Geister offenbaren sich gewöhnlich durch Träume; denn Träume, sagen die Indianer mit Homer, kommen von Gott und haben folglich auch etwas zu bedeuten.
Wie nun der Große Geist seine zahlreichen Unterbeamten und Vasallen hat, so hat auch sein später entstandener Antagonist, der Teufel, eine Masse dienstbarer Trabanten, die Pestilenz, Krankheit und Hungersnot verschulden und allerlei Schwarzkünstler und Hexen unter die Leute schicken. Besonders großartig organisiert sind die irokesischen Teufel; sie halten sogar jährlich ihre regelmäßigen Versammlungen ab, zu denen jedem der Skalp seines besten Freundes als Einlasszettel dient.
Jene Teufel sollen auch dem edlen Korn seine ursprüngliche Nahrhaftigkeit genommen und verursacht haben, dass dessen Pflanzung jetzt mit so viel Mühe verbunden ist und die roten Leute dabei ihre liebe Mutter, die Erde, so sehr quälen müssen. Wenn der Wind durch die Ähren streift, so hört man auch ganz deutlich das Jammern und Wehklagen des Korngeistes ob der Schändung des göttlichen Kleinods, das der Sage nach dem Busen der Mutter des Großen Geistes entsprungen sein soll.
Die zwei obersten geistigen Gewalten haben natürlich bei jedem Stamm ihre besonderen Namen, Beschäftigungen, Attribute und eigentümlichen Charaktere. Bei den Odjibwas heißt der Große Geist Gitschi Manitu, bei den Irokesen Häwenneyu; andere Namen für ihn sind Mingo Minnato, Monätowa, Atahon, Oki, Mitschabu usw. Einer seiner Hauptbeamten war, wie die Irokesen erzählen, Heno, der Gott des Donners, gewöhnlich nur der »Großvater« genannt, der unter dem Niagarafall wohnte, Wolken, Regen und Gewitterstürme schuf und stets rächende Blitze für die Hexen und Gotteslästerer bereithielt. Sein Kopf war mit glänzenden Federn geschmückt, die ihn gegen alle Attacken des Teufels sicherten, und wenn er ausging, hängte er sich gewöhnlich einen großen, mit scharfkantigen Felsen gefüllten Ranzen um, die er gelegentlich miserablen Subjekten auf die Köpfe warf.
Am einfachsten in theologischen Dingen ist wohl der Apache-Indianer in Sonora; er hat nur einen Häuptling des Himmels, Yastasitanne, angestellt, ihm aber weiter keine Eigenschaften – weder gute noch schlechte – beigelegt, weil man seiner großen Entfernung wegen darüber nichts zu sagen wisse. Daher weiß er auch nicht, ob es eine Belohnung und eine Bestrafung seiner Taten gibt, und an ein Fortleben nach dem Tod zu glauben, geht nun ganz und gar über seinen Horizont.
Auch die Chickasaws wissen nichts von einer ewigen Verdammnis.
Der Große Geist hat so viele verschiedene Wohnungen, wie es Rothäute gibt. Nach dem allgemeinen indianischen Sprichwort soll er auf »der Prärie« weilen; die Komantschen sagen, sie wüssten es nicht, aber die Sonne wüsste es sicher, da sie ihn ja täglich besuche, weshalb man sie auch verehren solle. Andere sagen wieder, er wohne in Carver’s Cave, einer mit Hieroglyphen beschriebenen Höhle bei St. Paul in Minnesota, die von den Indianern Wakantipe genannt wird, usw.
Gitschi Manitu tritt in allen möglichen Gestalten auf: als Schildkröte, als rote Sandsteinpfeife, als Bär usw. Er kann sich sehr schnell verwandeln und tut das auch häufig. Den Odjibwas erschien er einst als 64 Fuß (?) großer Riese; bei den Huronen hatte er sich mit Schellen, Korallen und Muscheln behängt, und als ihm Hiawatha seine Tochter opferte, kam er in Gestalt eines Vogels herunter. Früher, als er noch als Mensch unter den Indianern lebte, hatte er sich den Namen Manobozho, Hiawatha oder Tarenyawagon beigelegt, Namen, die ein sehr reichhaltiger poetischer Sagenkreis umgibt. Seine Riesenarbeiten, die er in jener Gestalt verrichtete, erinnern an die eines Herkules, eines Thor oder eines Wischnu.
Der indianische Hiawatha ist der mexikanische Quetzalcoatl; er lehrte wie jener Ackerbau und Religion, zerstörte aber nicht wie der später durch einen an einem Spinnengewebe vom Himmel gekommenen Zaubertrank verrückt gemachte Azteke seine Werke wieder, sondern ließ sie für alle Ewigkeit bestehen.
Hiawatha heiratete auch, aber er machte es nicht wie sein göttlicher Kollege Wischnu, jener flötenblasende Mädchenjäger, der sich 16 000 Weiber anschaffte, oder wie der geile Zeus, der sogar seine Schwester zur Frau nahm, sondern er war genügsam und nahm sich nur eine Frau, um seiner Nation ein würdiges Beispiel zu geben, nach dem sich aber seine »heiligen Nachfolger«, die Herren Medizinmänner, nicht gerne richten, denn sie glauben ebenso gut wie die Chiefs das Privilegium zu haben, Polygamie treiben zu dürfen.
Wie Zeus durch das Rauschen der Eiche zu Dodona seinen Willen kundgab, so macht sich Gitschi Manitu durch das Rauschen der Blätter oder durch die Gestalt hinziehender Wolken oder den Flug der Raubvögel verständlich. Auch geben die Medizinmänner vor, mit ihm in direkter Verbindung zu stehen, aber ihre Mitteilungen darüber sind bereits seit geraumer Zeit so sehr in Misskredit geraten, dass kein Indianer mehr großen Wert darauf legt. Doch sind diese mitunter so origineller und zuweilen auch so poetischer Natur, dass wir uns erlauben, einige Worte darüber mitzuteilen.
Ungefähr im Jahre 1800 kam ein solcher Medizinmann zu den Irokesen, der gab vor, großartige Offenbarungen vom Großen Geist zu haben und auch von ihm mit der Aufgabe beehrt zu sein, seinen Willen zu predigen. Er hieß Gäneodigo oder Schöner See und gehörte zum Schildkrötentotem der Senecas. Seine Jugend hatte er, wie er selbst erzählte, verfaulenzt, verbummelt und verliederlicht und dabei seinen Körper so ruiniert, dass er stündlich seinen Tod erwartete. Stattdessen erschien aber ein Abgesandter des Großen Geistes bei ihm und brachte ihm einen Strauch mit Stachelbeeren, die er essen musste, worauf er wieder genas. Dann erteilte ihm der Bote die priesterliche Weihe und zeigte ihm den Schreckensort der Missetäter und das Paradies der Guten, damit er späterhin genaue Auskunft darüber geben könne. Darauf trat Gäneodigo sein neues Amt an und predigte über dreißig Jahre lang.
Er und Sosehawä, sein Neffe und Nachfolger, wüteten hauptsächlich gegen das Feuerwasser, das kein anderer als der Teufel den Bleichgesichtern in die Hände gegeben habe. Der Weiße gebe es auch nur deshalb den Indianern, um bequem Zank und Streit unter ihnen zu stiften und sie in ihre Zuchthäuser bringen zu können. Keiner, der auch nur Feuerwasser trüge, komme in den Himmel. Wenn die Trinker am großen Scheideweg anlangen, wo Gott und Teufel über sie zu Gericht sitzen und über ihre Zukunft entscheiden, wird sie der Teufel gleich beim Namen nennen und ihnen eine dickleibige Schnapsflasche kredenzen, deren Inhalt ihnen wie ein feuriger Strom aus dem Mund fließen wird, wobei sie vergeblich um Hilfe schreien. Frauen, die den Rothäuten Schnaps verkauft haben, verlieren in der Ewigkeit Fleisch und Blut und müssen als schreckliche Knochengestalten umherlaufen.
Ähnlich wütete auch Tecumseh, der Prophet, der die Sonne unter seine Füße bringen konnte, gegen das Feuerwasser und teilte mit, dass er bei seinen häufigen Reisen in die Wolken jedes Mal zuerst die Wohnung des Teufels erblickte, die von Säufern angefüllt sei, denen ewig brennende Flammen aus den Mäulern leuchteten.
Schlechten Weibern und zanksüchtigen Männern wachsen nach dem Tod die Zungen und die Augen so weit heraus, dass sie weder sprechen noch sehen können; faule Frauen müssen ewig Korn schneiden, das gleich wieder nachwächst. Weiberprügler müssen ständig auf weißglühende Frauen schlagen, dass ihnen die Funken Arme und Beine verbrennen. Die Hexen werden in einen Kessel mit kochendem Wasser geworfen, und ihr teuflischer Freund wird ihnen trotz inbrünstigster Bitten keinen kalten Platz anweisen. Die Landverkäufer müssen große Sandberge abtragen, die aber nächtlich immer wieder nachwachsen, usw.
So wie allmählich das Ansehen der Medizinmänner schwand und der Bogen mit der Flinte vertauscht wurde, so schwanden auch die alten »medizinenen« Sitten und Bräuche und die Heilighaltung und Verehrung der Götter. Sogar der Medizinsack, das Heiligste, was die Rothaut des Nordwestens je besessen hat und das kein Bleichgesicht anrühren durfte, ohne mit dem Leben dafür zu büßen, haben die meisten als nutzloses Anhängsel abgeworfen und, wo es ging, mit der lieben Whiskyflasche vertauscht. Die indianischen Götter müssen sich nun kümmerlich von stinkendem Tabaksrauch nähren, und wenn ihnen zuweilen noch ein Pfeil, ein Stück Fleisch oder wohl gar ein Hund geopfert wird, so sind diese Dinge sicherlich für jeden anderen Gebrauch total wertlos. Höchstens wird vielleicht dann eine Ausnahme gemacht, wenn irgendein großes Unglück über einen Stamm gekommen ist und sich dieser wieder mit seinen Göttern versöhnen will – also aus Gründen der Spekulation.
Der Indianer verehrt wie der Perser, der Araber, der Mexikaner und der Peruaner hauptsächlich die Elemente, bringt diesen aber nicht wie Letzere Menschenopfer dar*, wenigstens geschah dies früher äußerst selten. So erschoss einst ein Dakota, als es furchtbar donnerte und blitzte, seinen Sohn, um den Donnergott zu bewegen aufzuhören. Auch stellten einst die Indianer am Missouri, um sich einer gesegneten Ernte zu vergewissern, eine nackte Jungfrau auf einen brennenden Holzhaufen und rissen ihr, als sie halb verbrannt war, das Fleisch von den Knochen und streuten es über die Kornfelder.
Die Hauptverehrung der Götter geschieht durch Tänze, deren der Indianer beinahe so viele zählt, als er Haare in der Skalplocke hat. Der Tanz bildet einen Teil seiner nationalen Existenz, und viele behaupten, dass, sowie sie ihre Tänze aufgeben, ihre ganze Rasse dem Untergang nahe sei. Da haben sie denn in erster Reihe den religiösen Federtanz und den patriotischen Kriegstanz, bei welch Letzterem die hochzeitlichsten Mokassins, Giseha und Gägetä angezogen werden und Tomahawk und Skalpiermesser so blank geputzt sind, dass sie strahlen wie die Mittagssonne, und bei dem die Mäuler in jenem grauenhaften Kriegsruf noch einmal so weit wie gewöhnlich aufgerissen werden. Dann haben sie den Fischtanz und den Büffeltanz, der jene Tiere herbeilocken soll; dann den Rasseltanz, den Ententaz, den Skalptanz, den Bärentanz, den Schildkrötentanz, den Hundetanz, den Donnertanz, den Totentanz usw.
Außerdem haben auch noch einige Stämme ein jährliches Fest zur Erinnerung an die verheerende Sintflut, mit der sie einst der Große Geist infolge ihrer Schlechtigkeit heimsuchte. Eine solche Sintflut scheint jedoch den Winnebagos unbegreiflich, denn sie sagen, Gitschi Manitu müsse ein großer Narr gewesen sein, wenn er seine mühsam fabrizierte Welt mit allem, was darauf kroch und flog, wieder so leichtsinnig zerstört habe.
Als nach einer mexikanischen Erzählung die Erde durch den Wassergott Tlalok unterging – eine Episode, die das sogenannte »vierte Weltalter« bildet –, entging nur der alte Fischgott Coxox mit seiner besseren oder schlechteren Hälfte den Fluten, und ein Kolibri zeigte ihnen später durch einige mitgebrachte Zweige an, dass sich die Erde wieder reorganisiere. Das bei den Karaiben gerettete Menschenpaar bevölkerte die Erde wieder dadurch, dass es Steine hinter sich warf, die sich augenblicklich in Menschen verwandelten (s. Deukalion und Pyrrha).
Bei den Muyscas, die die Terra firma bewohnen, wurde die Sintflut durch ein böses Weib verschuldet, und wenn ihr dreihäuptiger Mann nicht schnell den Wasserfall von Tequendana geschaffen hätte, sodass das Wasser abfließen konnte, so wären sicherlich alle Menschen ertrunken. Die Komantschen in Texas glauben, sie seien deshalb dem Ertrinken entronnen, weil sie der Große Geist noch zur rechten Zeit in weiße Vögel verwandelt habe.
Bei einigen Indianerstämmen herrscht der Glaube, dass die Welt das nächste Mal durch Feuer untergehen werde, ein Malheur, das die Brasilianer und die Mexikaner bereits glücklich überstanden haben.
Große Aufregung herrscht jedes Mal bei einer Sonnen oder einer Mondfinsternis, denn einige glauben, der betreffende Körper sei krank und wolle sterben. Einige glauben auch wie die Chinesen, ein böser Geist wolle ihn verschlingen, weshalb sie einen fürchterlichen Lärm machen, um diesen zu verscheuchen. Hunde werden losgebunden und geprügelt und alle Donnerbüchsen abgeschossen. Plutarch erzählt, dass auch die Römer bei ähnlichen Gelegenheiten zu demselben Zweck eherne Gefäße gegeneinanderschlugen.
Kurios sind die Ansichten einiger Indianerstämme hinsichtlich ihres Lebens nach dem Tod. Sie stimmen nur in dem Punkt überein, dass die Hauptseele des Guten ein prächtiges, sonniges Land voll des fettesten Wildes erwartet; der Weg dahin führt teils über die Milchstraße, teils über die große »medizinene« Prärie. Wir sagten eben die Hauptseele, und das mit Absicht, denn manche Indianerstämme schreiben sich mehrere Seelen zu. Die Dakotas glauben deren vier zu haben, wovon die erste ins Reich der Geister oder ins Paradies gehe und die zweite die Luft bewohne; die dritte müsse den Kadaver bewachen und die vierte ständig ihr heimatliches Dorf umschweben.
Bei den Stämmen der Algonkin-Familie begnügt sich jeder Indianer mit zwei Seelen: Einer körperlichen und einer geistigen; sie nageln deshalb auch nie ihre Särge zu, sodass die eine immer bequem aus und ein gehen und der anderen Nahrung bringen kann. Dass überhaupt jeder Mensch zwei Seelen habe, suchte ein alter Indianer einst am Träumen zu beweisen; während nämlich die eine Seele durch Feld und Wald streife, bleibe die andere ruhig beim Körper zurück, denn sonst würde der ja während dieser Zeit sterben.
Der meisten Seelen rühmen sich die Karaiben: Jeder Pulsschlag ist nämlich eine. Sie haben Seelen der Augen, der Nase, der Füße, der Hände usw., von denen aber nicht alle selig werden.
In der alten Tragödie »Pontiac«, wahrscheinlich von William Rogers verfasst, gibt es zwei Trapper, von denen der eine dem Indianer gar keine Seele zuspricht:
ORSBOURN:
I fear their ghosts will haunt us in the dark.
HONNYMAN:
It’s no more murder than to crack a louse,
That is, if you ’ve the wit to keep it private.
And as to haunting Indians have no ghosts,
But as they live like beasts, like beasts they die.
I’ve killed a dozen in this selfsame way,
And never yet was troubled with their ghosts.
ORSBOURN:
Then I’m content, my scroupels ae removed.
Für die Seelen sorgen einige Indianer recht ängstlich. Die Dakotas hängen rings um den Leichnam Speise auf und lassen mehrere Tage lang ein Feuer dabei brennen, damit jene weder frieren noch Hunger leiden. Kindern wird ihr Spielzeug beigegeben, und die Verwandten kommen häufig zum Totengerüst, um sich mit der dabei zurückgebliebenen Seele zu unterhalten.
Die Algonkins fangen, wenn einer von ihnen gestorben ist, einen Vogel, der dessen Seele in den Himmel tragen muss.
An die sogenannte »Seelenwanderung« glauben nicht alle Stämme. Die Algonkins behaupten, vor ihrer Geburt Tiere bewohnt zu haben, weshalb sie diese auch für vernünftig und verständig halten. Einige Odjibwas geben vor, einem Hundefell entsprungen zu sein, und die Bucros hoffen nach dem Tod in Affen verwandelt zu werden. Gewisse Stämme in Kalifornien essen nie Fleisch von großen Tieren, da sie befürchten, es enthielte den Geist irgendeines Menschen. Viele essen von Tieren, die sie aus dem genannten Grund in Ehrfurcht halten, nicht von der rechten Seite oder nicht vom Kopf oder nicht die Leber usw.
Zum weiteren Seelenleben der Indianer gehören auch noch die »Ahnungen«. Der Aberglaube eines jeden Volkes und eines jeden Landes denkt überall jedes bedeutende soziale wie politische Ereignis in irgendeiner Weise vorausgesehen zu haben. Hat ein altes Weib einen außergewöhnlichen Traum gehabt; hat ein grimmiger Köter eine ganze Nacht hindurch ohne bekannte Ursache gebellt; ist ein Nordlicht erschienen oder hat sich sonst ein gerade nicht alltägliches physikalisches Phänomen blicken lassen, und das philiströse Stillleben wird plötzlich mit Krieg, Hungersnot oder Pestilenz heimgesucht, so unterliegt es natürlich keinem Zweifel, dass die vorhergegangenen Zufälligkeiten die untrüglichsten Vorboten jener Kalamitäten waren. So haben die Indianer geradeso gut ihre schlimmen Omina vom Untergang ihrer Nation wie zu ihrer Zeit die Etrusker, die Römer und die Türken.
Im Oktober 1762 – also kurz vor Beginn des blutigen Pontiacschen Krieges – will man über Detroit mehrere kohlschwarze Wolken gesehen haben, deren Regen nach Schwefel roch und eine tintenartige Farbe hatte, sodass die Leute damit schreiben konnten. Ehe der sogenannte »König-Philipps-Krieg« (King Philipp’s war) anfing, hörte man in der Plymouth-Kolonie häufig schweres Kanonengerassel in der Luft, hörte Flinten abfeuern und den Lärm der Trommeln, ohne jedoch etwas zu sehen. Bei den Indianern zu Columbus’ Zeiten deuteten alle derartigen Vorzeichen auf die Ankunft der Spanier hin.
Das Sterben soll bei einigen Indianerstämmen wie bei den Griechen durch die Ungehorsamkeit der Weiber eingeführt worden sein, wie denn überhaupt diese als die Quelle allen Elends gelten müssen, das die Rothaut das Leben hindurch verfolgt. Kein Wunder also, dass die Vergrößerung einer Familie durch ein Mädchen quasi als ein Unglück gilt, wenn der Indianer auch nicht so inhuman damit verfährt wie der Hindu, der es auf den Markt trägt und mit der einen Hand feilbietet und in der anderen ein Messer hält, um es für den Fall, dass sich kein Liebhaber dafür findet, gleich erstechen zu können.
Viele Kinder zu besitzen ist der indianischen Squaw unangenehm, und das aus sehr triftigen Gründen: Bei ihrem ständigen Wanderleben ist sie der alleinige Packesel, der sie mühsam mitschleppen muss, da es der Mann ebenso sehr unter seiner Würde hält, Kinder zu tragen wie Mais zu pflanzen. Doch da wissen sich einige Squaws genauso gut zu helfen wie die amerikanischen Ladies seit der Zeit, wo bei ihnen der nationale Grundsatz, unter keinen Umständen mehr als höchstens zwei Kinder zu besitzen, zur allgemein befolgten Regel geworden ist. Aber weder die Faulheit noch die Furcht vor Mutterpflichten treibt sie zu jenem teuflischen Verbrechen; auch nicht die Bequemlichkeit oder die allmächtige Mode mit ihren mannigfachen Ansprüchen; auch nicht gesellschaftliche Rücksichten wie Bälle, Teevisiten usw., die doch unter keinen Umständen vernachlässigt werden dürfen – nein, was die rote Frau dazu treibt, sind die Not, die pure Not, und ihr gesamtes nationales Unglück, das ihr Kind der genügenden Kleidung, Nahrung, Pflege und Ruhe beraubt.
Wer hilflos ist, ist überflüssig in der Welt, und in diese Kategorie gehören bei den Indianern außerdem auch noch die Greise. Einem bejahrten Dakota gaben einst seine Kinder eine Flinte in die Hand, damit er sich gegen sie verteidigen könne, damit sie, wie sie sagten, ihn in ehrenhafter Weise loswürden – dieselbe Methode also, die jetzt die Zivilisation gegen die ganze Rasse anwendet und wobei jene auch ihren sicheren Untergang finden wird. Es wird wahrhaftig kein Jahrhundert mehr dauern, so wird der mächtige amerikanische Adler die Seele der letzten Rothaut zwar nicht in die Höhe zum Großen Geist, wohl aber ins Reich der gänzlichen Vergessenheit getragen haben.
* Montezuma ließ ja bekanntlich deshalb die Unabhängigkeit der Republik Tlascala bestehen, damit er immer einen Feind hatte, der ihm Gefangene zum Opfern lieferte.
DAS WEISSE STEINKANU
Vor vielen, vielen Jahren lebte am Michigansee ein wunderschönes Mädchen, das mit einem tapferen, jagdtüchtigen jungen Mann verlobt war. Der Tag ihrer Hochzeit war auch bereits festgesetzt worden; als aber dieser endlich herankam, starb die hübsche Braut plötzlich. Das raubte denn dem Bräutigam alle Ruhe und alle Lebenslust. Stundenlang saß er unter dem Totengerüst, auf das die alten Frauen ihren Leichnam zur Verwesung hingelegt hatten, und nahm weder Speise noch Trank zu sich. Seine Kameraden kamen häufig zu ihm und sagten, er sollte doch klüger sein und seine Gedanken lieber auf die Jagd oder den Krieg lenken, als seine jungen Tage so mit unnützem Trauern zu vergeuden. Aber sein Herz war tot für solche Beschäftigungen, und unwillig schleuderte er Keule, Pfeil und Bogen von sich, da sie ihm keinen Ersatz für das Verlorene zu gewähren vermochten.
Nun hatte er einst von alten Leuten gehört, dass es einen geheimen Pfad gäbe, der zum Land der Seelen führe. Diesen gedachte er nun zu verfolgen. Er bereitete sich also vor und marschierte südwärts, was der Tradition nach die rechte Richtung war. Für eine Weile begegnete ihm weiter nichts Außergewöhnliches; Berge, Täler und Bäume sahen geradeso aus wie bei ihm und die Tiere und die Vögel ebenfalls.
Als er seinen Wigwam verlassen hatte, lag rundum alles in Schnee und Eis, welch winterliche Zeichen sich jedoch allmählich verloren; der Schnee schmolz durch die Strahlen der erstarkenden Sonne, die Bäume bekamen nach und nach grüne Blätter, und ohne dass er wusste, wie es eigentlich zuging, stand rings um ihn her die ganze Natur in der anmutigsten Frühlingspracht. Die Blumen erglänzten in ungeahntem Farbenschmuck, und die Vögel erfüllten die Luft mit den herrlichsten Liedern. Unser Wanderer war also auf dem rechten Weg.
Bald entdeckte er auch einen geebneten Fußpfad, der ihn durch ein allerliebstes Wäldchen auf eine Anhöhe führte, auf der er eine sorgfältig gebaute Hütte wahrnahm. Ein alter Mann mit schneeweißem Haar und eingesunkenen Augen, aus denen aber doch noch das Feuer der Jugend zu lodern schien, kam ihm freundlich entgegen und hieß ihn willkommen. Um seine Schultern hing ein weiter Mantel aus den feinsten Tierfellen, und in seiner Hand führte er einen silberglänzenden Stab.
Der junge Mann nahte sich dem Alten ehrfurchtsvoll und brachte in ehrerbietigster Weise sein Anliegen vor.
»Oh«, sagte der Greis, »ich kenne deinen Wunsch bereits; ich habe dich schon lange erwartet und war eben ausgegangen, um nach dir zu sehen. Diejenige, die du suchst, hat sich vorgestern bei mir ausgeruht und neue Kräfte zu ihrer Reise ins Land der Seelen gesammelt, und das musst du denn auch tun.«
Darauf setzten sie sich zusammen vor die Tür des Wigwams, und der Alte fuhr fort: »Sieh – dort, wo sich die große blaue Ebene bis ins Unendliche ausdehnt, dort ist das Paradies, ihre Heimat. Hier stehst du an der Grenze; mein Haus bildet die Eingangspforte. Deinen Körper aber kannst du nicht mit hinnehmen, auch deinen Hund und deine Waffen nicht; ich werde dir daher dies alles bis zu deiner Rückkehr treulich aufbewahren.«