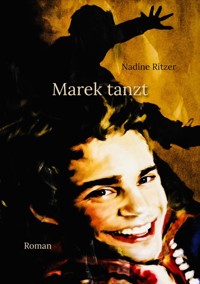
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Marek tanzt" erzählt die Geschichte zweier Leben, zwischen denen die Musik die Brücke schlägt. Die Ich-Erzählerin reist nach Warschau, wo sie ein lange aufgeschobenes Zwiegespräch mit ihrem Großvater führt. Da dieser bereits tot ist, sind es andere, die ihr helfen zu verstehen, was in ihrer Familie lange verschwiegen wurde. Durch den geheimnisvollen Marek, durch Erlebnisse und Erinnerungen wird die Geschichte des aus der heutigen Ukraine nach Deutschland verschleppten polnischen Zwangsarbeiters zutage gefördert: Sein Leben in einem Dorf in Bayern während und nach dem Krieg, das Geheimnis einer verbotenen Liebe zu einer Deutschen und die Tragik des Verrats am gemeinsamen Kind. Auf der Suche nach dem verschütteten Gestern der eigenen Geschichte gerät die Ich-Erzählerin selbst in den Bann von Liebe und Musik und muss am Ende schmerzlich erfahren, dass es in jedem Leben einmal für etwas zu spät ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Nadine Ritzer
Marek tanzt
Roman
© 2023 Nadine Ritzer
Umschlag, Illustration: Francisco Rojas
Lektorat: Anna Stüssi
Korrektorat: Der letzte Schliff
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN
Paperback
978-3-347-75243-6
Hardcover
978-3-347-76031-8
e-Book
978-3-347-75244-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Quellennachweis
Nachwort
Die Autorin
Marek tanzt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Widmung
Prolog
Die Autorin
Marek tanzt
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
In liebevollem Gedenken an meine Oma und für all die anderen starken Frauen in meiner Familie.
„Die menschlichen Wesen, Pflanzen oder der Staub, wir alle tanzen nach einer geheimen Melodie, die ein unsichtbarer Spieler in den Fernen des Weltalls anstimmt.“ Albert Einstein
Prolog
Ich nehme es auf mich, dich zu suchen. Hättest du je geglaubt, dass es so weit kommen würde? Was hättest du gesagt – damals, als wir noch miteinanderredeten? Damals, als du mich beim Namen nanntest, ohne mir deinen zu verraten? Wahrscheinlich hättest du gelächelt und gedacht, deine Welt sei untergegangen, der Weg dorthin vom Eisernen Vorhang versperrt. Du hättest gelächelt und geschwiegen, wie ihr alle immer geschwiegen habt. Sieh her, Metro, ich nehme es auf mich, deine Geschichte unter den Trümmern dieses Schweigens zu suchen. Ich will sie finden, deine Geschichte, die mich mitbestimmt – irgendwie. Ich mache mich auf, uns zu finden.
Weiß hängt vor den kleinen Fenstern, als der Pilot an einem Sonntag im Januar nach einer unsichtbaren Grenze den Sinkflug nach Warschau einleitet. Die Landschaft unter mir bleibt schemenhaft. Ich habe das von nicht mehr ganz jungen Flight Attendants verteilte Sandwich abgelehnt und mich mit einem Glas Wasser begnügt. Vielleicht wäre Wein besser gewesen. Oder Wodka. Die Landung verläuft wunschgemäß, kein meterweises Absacken in luftleeren Gefilden, das einen an Achterbahnfahrten in Kindertagen erinnert. Lediglich ein leises Sinken, dann eine nahezu zärtliche Kontaktaufnahme mit der Piste. Das heftige Abbremsen drückt mich kurz in den Sitz, dann rollt das Flugzeug aus, ich hole tief Atem. Erst, als das Sitzgurtsymbol über meinem Kopf aufgehört hat zu leuchten, erhebe ich mich, und im Gänsemarsch mit den anderen Fluggästen steige ich aus. Ich durchquere lange, karge Gänge. Nur zwei Schalter der Passkontrolle sind geöffnet. Nach endlosen Minuten bin ich an der Reihe. Ich reiche der Zollbeamtin den Pass, weißes Kreuz auf rotem Grund. Ein freundliches Lächeln, eine lasergesteuerte Kopie meiner Daten ins Netz der Bürokratie geschleust, ein Kopfnicken, und ich betrete polnischen Boden. Eigentlich sollte ich niederknien und diese Erde küssen, die meine Heimat hätte sein können, wäre die Geschichte anders verlaufen.
Als ich endlich das Ausgabeband erreicht habe, dreht mein Koffer bereits langsame Kreise. Nach der nächsten Tür erwartet mich ein Schild, auf dem mein Name steht, dahinter eine kleine, zierliche Frau. Ich winke und grüße sie mit einem mir noch nicht geläufigen „dzień dobry“.
Ein kurzer Händedruck, dann führt mich Ewa zu ihrem Wagen. „Ich habe früher in der Goethe-Schule Deutsch unterrichtet“, erzählt sie mir in einem ersten Redeschwall. In der DDR habe sie zahlreiche Kurse besucht. Sie liebe die Sprache von Goethe und Schiller und ja, auch von Brecht. Seit dem EU-Beitritt arbeite sie in einer kleinen Firma, die Übersetzungsdienste für die Werbebranche anbiete, vor allem für Online-Werbung. Sie hoffe, der Boom halte an. „Seit dem EU-Beitritt kann ich viel mehr deutsche Texte übersetzen als zuvor. Früher waren es vor allem russische. Das mach‘ ich heute nur noch, wenn ich unbedingt Geld brauche“, erklärt Ewa mit einem schelmischen Lächeln.
Nach einer 20-minütigen Autofahrt biegen wir in eine von Schneehaufen übersäte, von grauen Wohnblocks gesäumte Straße ein und halten auf einem unsichtbaren Parkfeld. Ich ziehe meinen Koffer durch den Schneematsch zur eisernen Eingangstür, die Ewa mit einem Code öffnet. Ein klappriger Lift bringt uns in den fünften Stock.
Das mir zugewiesene Zimmer ist winzig, mit einem hellbraunen, ausgetretenen Teppich und blumengemusterten Stofftapeten ausgestattet. Die Vorhänge sind rot und schwer und zugezogen, obwohl der Nachmittag noch etwas Licht gespendet hätte. Stattdessen leuchtet eine nackte Glühbirne von der Decke. An der Wand über dem Kopfende des Bettes hängt Maria. Blond, rundes Gesicht, den zärtlichen Blick auf die Erde zu ihren Füssen gerichtet.
„Nimm dir Zeit, dich einzurichten. Die Dusche ist frei, und danach gibt’s etwas zu essen. Du bist sicher hungrig“, sagt Ewa.
Bin ich nicht. Mir ist noch immer flau im Magen. Vom Fliegen, vielleicht aber auch von den zahlreichen Erwartungen, die mir die Sinne vernebeln. Ewa lässt mich allein. Ich setze mich auf das fremde Bett, atme den fremden Geruch ein und denke darüber nach, wie ich dazu gekommen bin, hier zu landen. Ein Inserat in der Schweizerischen Lehrerzeitung, leicht zu übersehen. Unerwartet bot sich mir meine Vergangenheit auf vier mal fünf Zentimetern dar. Ich musste nur eine Nummer wählen – und schon gab es kein Zurück mehr.
Gemächlich packe ich aus: meine Kleider, Bücher, einen Ordner voller Papier, Toilettenartikel. Alles reihe ich säuberlich im winzigen Schrank auf, auch die Lehrmittel verstaue ich, obwohl mein Einsatz schon am nächsten Tag beginnen wird. Auf die Dusche verzichte ich. Ich verlasse das Zimmer und klopfe verhalten an die Tür nebenan. Nach Ewas „Proszę!“ trete ich ins Zimmer mit eingebauter Küche, das sowohl als Esszimmer als auch als Stube dient. Ein fremder Duft liegt in der Luft, süßlich, rauchig zugleich, durchzogen von einer schmalen Spur Gas. Ich setze mich auf einen Stuhl am kleinen Esstisch. Ewa rührt eifrig in den Töpfen. Ihre feinen, blonden Haare sind kurz geschnitten. Auf der Stupsnase sitzt eine große altmodische Brille mit dünnem Goldrand. Sie trägt enge dunkelblaue Jeans und einen dicken braunen Wollpullover, der ihr über die Hüften reicht und sämtliche Kurven verdeckt. Vermutlich ist sie ein wenig älter als ich. Vielleicht vierzig.
Obwohl die Pierogi ausgezeichnet schmecken, kaue ich lange auf ihnen herum. Das Wasser riecht nach Chlor. Zwischen Kauen und Schlucken versuche ich, auf die zahlreichen Fragen Ewas zufriedenstellende Antworten zu geben. Ich bin hier, um an einem Gymnasium Deutsch zu unterrichten, mit dem Ziel, ein wenig didaktische Expertise in das veraltete, von Frontalunterricht geprägte polnische Schulsystem zu bringen, wie mir an der Infoveranstaltung in Bern mitgeteilt wurde. Darauf habe ich mich vorbereitet, einwandfrei aufbereitetes Unterrichtsmaterial aus der Schweiz hierhergeschleppt, von meiner pädagogischen Mission erfüllt. Aber nicht nur. Der Unterricht ist nur ein Vorwand, doch das verschweige ich Ewa. Ich bin auf der Suche nach mir selbst, nach all dem, was mir entgangen ist, durch den Zwang der Zeit, zu vergessen.
Ewa beharrt darauf, den Abwasch allein zu machen. „Ruh dich doch etwas aus. Meine Schwester kommt mit ihrer Familie noch kurz vorbei. Sie will dich unbedingt kennenlernen.“
Ich ziehe mich zurück, brauche Zeit, um richtig anzukommen.
Ich bin da angekommen, wo du herkommst. Die wackelige Brücke der Sprache betrete ich, ganz vorsichtig, um den verloren gegangenen Teil meines Ichs zurückzugewinnen. Die Ungewissheit nehme ich auf mich und mit ihr deine Geschichte. Ich bin angekommen. Das heißt, ich bin daran, anzukommen. Noch ist mir alles fremd, dein Land, die Menschen, ihre Art zu sprechen. Du warst mir fremd, Metro, die ganze Zeit über, als ich auf deinemSchoß gesessen bin. Ich habe dich kaum verstanden, wenn du etwas gesagt hast. Nicht wegen der Sprache, die hast du damals schon ganz gut beherrscht, aber du warst stets leise, kaum hörbar für meine Kinderohren, und erst recht nicht für die Ohren der anderen. Du warst schweigsam wie er, der dich einst zum Schweigen gebracht hat und trotzdem neben dir saß in jenen Tagen. Zwei Schweiger. Jetzt bin ich hier, durchbreche euer Schweigen. Ich bin dir auf der Spur. Ich habe bereits Kontakt aufgenommen zu den Deinen. Sonderbar komme ich mir vor, wenn ich deine Sprache spreche, um mit ihnen zu reden. Aber ich gebe mir Mühe. Es kostet mich große Anstrengung, ein neues Wort zu lernen – so fremd sind die Laute, schwierig die vielen Konsonanten. Skrzyżowanie. Die Kreuzung. An welcher Weggabelung stehe ich? Eigentlich hätte Polnisch meine Muttersprache werden können. Meine Großvatersprache. Doch das haben wir verpasst.
Du hast dir Mühe gegeben, Deutsch zu lernen, damals, als du musstest, um zu überleben. Du hast es ausgezeichnet gelernt – keine Frage. Ich habe nicht gemerkt, dass du nicht zu ihnen gehörtest. Ich habe es nicht gemerkt, und keiner hat es mir gesagt, obwohl sie es alle wussten. Jeder, der mit uns am Tisch saß, damals in der gut geheizten Stube der Tante Anna Maria. Nein, ich merkte nichts, und als man es mir erklärte, war es für uns zu spät. So gerne hätte ich mit dir über deine Geschichtegesprochen, die eigentlich auch meine ist. Jetzt habe ich mich auf die Suche gemacht, um Nichtgesagtes zu vernehmen. Ich werde zuhören, und ich werde dich finden in all jenen, die mir hier begegnen.
Die Klingel lässt mich zusammenfahren, und schon ruft mich Ewa. Zwei Jungen, vielleicht 4 und 7 Jahre alt, rennen kreischend durch den winzigen Flur und, als sie mich erblicken, verstummt zurück zu einer Frau, hinter deren Beinen sie sich verstecken. Ewa stellt mir ihre Schwester Małgorzata und deren Mann Piotr vor. Sie wohnen in Łajski, einem Dorf etwa 20 Kilometer von Warschau entfernt.
„Piotr ist Landwirt, Małgorzata verdient in einem kleinen Laden etwas dazu, wenn die Kinder in der Schule sind“, klärt mich Ewa auf.
Ich stelle mich mit dem mühsam erlernten Schulbuchpolnisch vor, die Kinder reichen mir zögernd die Hand, murmeln etwas Unverständliches. Piotr spricht kein Deutsch, Małgorzata ein wenig. Ewa erzählt mir, dass ihre Großeltern mütterlicherseits aus Schlesien stammten. Man habe in der Familie Wert daraufgelegt, den eigenen Kindern diese Sprache mit auf den Lebensweg zu geben, bevor sie die Sprache des Feindes wurde. Ihre Mutter hatte sie einst verdrängt, doch als die Kinder zur Welt kamen, habe sie ihnen deutsche Kinderlieder vorgesungen und Grimms Märchen vorgelesen.
„Und sie hat immer auf Deutsch geflucht. Sie fand, auf Polnisch zu fluchen, sei sehr unanständig“, lacht Ewa.
Ich werde sanft genötigt, ein Gläschen Kirschlikör zu trinken, den Ewa „Großmutterwässerchen“ nennt, Nalewka Babuni. Es schmeckt süß – so süß, dass ich das zweite und dritte Gläschen nicht ablehne. Piotr trinkt ein Żywiec direkt aus der Flasche. Dazu serviert Ewa Käsekuchen. Die Kinder spielen auf dem Boden mit einem Feuerwehrauto, während die Erwachsenen über das Leben diskutieren. Ich kann den Wortwechseln nicht richtig folgen. Ewa übersetzt, wenn sie es für wichtig hält. Irgendwann erreicht das Gespräch die EU, Polen und die Schweiz.
„Die Bauern haben es doch ganz gut in der Schweiz, viel besser als die Bauern hier, oder?“, will Piotr wissen.
Ich versuche mich darin, Piotr eine zufriedenstellende Antwort zu geben, aber mir fehlen die polnischen Worte für Milchwirtschaft, Käseexport und Subventionen. Mit Ewas Hilfe erkläre ich einem sichtlich verdutzten Piotr, dass es in der Schweiz nicht mehr viele Bauern gebe, auch wenn es manchmal auf den Werbeplakaten der Tourismusindustrie so aussehe, als seien die Schweizer ein einzig Volk von Bauern und Hirten.
Piotr lässt sich nicht aus dem Konzept bringen und sagt trotzig: „Aber leben kann man als Bauer in der Schweiz. Doch nicht in diesem Land!“ Er könne nicht leben. Wenn seine Frau nicht arbeiten und sein kranker Vater nicht etwas von seiner Invalidenrente an den Haushalt bezahlen würde, hätte die Familie zu wenig. Viel zu wenig zum Leben. Die Vorschriften seien zu streng, die EU wolle sie ausbeuten, sie, die Kleinen. Man dürfe nicht mal mehr den Käse räuchern, wie man es seit Jahrhunderten gewohnt sei, Schnaps zu brennen sei verboten, und Polen kaufe sogar Getreide von der EU, statt umgekehrt, das müsse man sich mal vorstellen.
„Einmal waren wir Polen als die besten Bauern Europas bekannt. Viele sind früher ins Ausland gegangen, um gutes Geld zurückzubringen“, erklärt Ewa, worauf Piotr etwas lauter als nötig ergänzt, die Deutschen hätten dann mit ihrem verdammten Krieg alles vermasselt. Jetzt wolle sie niemand mehr, die polnischen Bauern, höchstens als billige Handlanger für die Spargelernte. Es sei ein großer Betrug und er sei gegen die Brüsseler Bürokratie. Gegen die Diktatur der EU, die auch nicht besser sei als jene aus Moskau.
Während Piotr einen großen Schluck Bier nimmt, wechselt Ewa geschickt das Thema. Ich nutze den Augenblick, um mich zu entschuldigen und in mein Zimmer zurückzuziehen.
Ich öffne die schweren Vorhänge und blicke in die Dunkelheit. Viel ist nicht zu erkennen. Eine schwach erleuchtete Straße neben dem Haus, ein Fußballfeld dahinter, in der Ferne dunkelgrauschwarze Häuserfassaden, hier und dort ein matt erleuchtetes Fenster. Ich lasse die Gedanken von Piotr und den polnischen Bauern forttreiben, zurück zu den Bauern einer vergangenen Zeit, zu den Bauern in Tadani, die ihre Familien für den Dienst im Deutschen Reich verlassen mussten, um nie mehr zurückzukehren.
1942, hat man mir gesagt, haben sie dich geholt. Auf dem Feld in Tadani. Im Oblast Lwów. Lwiw. Lemberg. Während der Erntezeit sind sie plötzlich aufgetaucht in ihren Lastwagen und haben euch zusammengerufen. Deutschland brauche Arbeiter. Junge, starke Arme, die anzupacken verstünden. Versprechungen lockten. Drei Monate Landdienst im Reich. Ganz Europa arbeite für Deutschland! Ein kurzer Arbeitseinsatz auf einem fremden Bauerngut, auf dem man dazulernen konnte, um Wissen in die Heimat zurückzutragen, und gutes Geld dazu. Tausenden vor euch hätten sie bereits bewiesen, dass sie es ernst meinten, die Deutschen, und dass sie die Polen gut behandelten.
Mit entblößten – von der Arbeit unter der polnischen Sonne gebräunten – Oberkörpern habt ihr den fremden Männern in Uniformen zugehört, doch ihr habt ihren Worten nicht getraut, den Verlockungen nicht, den Versprechungen nicht. Ihr hattet längst gehört, dass die neue Herrenrasse im Westen die Menschen im Osten als Untermenschen betrachtete. Keiner von euch hat sich freiwillig gemeldet. Keiner. Auch wenn ihr die Sowjets nicht gemocht habt, die vorher euer Land besetzt hatten, so wolltet ihr doch den Nazis nicht helfen, die sich als Befreier inszenierten. Keiner meldete sich freiwillig, und so trieb man euch in eine Scheune und schloss das Tor, damit ihr es euch nochmals überlegen konntet.
Als du in der Nacht den Schuppen verlassen konntest, wollte deine Mutter glauben, du würdest bleiben. Doch am nächsten Morgen standen sie vor der Tür. Uniformen. Abzeichen. Waffen. Fritz Sauckel besaß die Führervollmacht. Deutschland warb nicht mehr – Deutschland befahl. Es galt, das geforderte Kontingent an Arbeitern zu liefern. Ihr hattet der öffentlichen Arbeitspflicht nachzukommen, die die Verordnung des Reichsministeriums vorschrieb. Nach „Maßgabe eurer Arbeitsfähigkeit“. Ihr wart fähig zu arbeiten, darum wählte man euch aus. Zwei Stunden hattet ihr Zeit, um euch zu verabschieden. Zwei Stunden, um einen Koffer zu packen. Dann habt ihr der Heimat einen Gruß zugeworfen, ohne wissen zu können, dass es der letzte war. Siebzehn junge Männerschleuderten ihr „do widzenia“ in tränennasse Gesichter von Müttern, die vorausahnten, dass das „Auf Wiedersehen“ eine Lüge war. Hättet ihr euch zur Wehr gesetzt, so hätte die SS die Höfe eurer Familien niedergebrannt, wie es in eurem Nachbardorf geschehen war – und euch dann trotzdem mitgenommen.
Die Deutschen packten euch in Viehwaggons und fuhren euch nach Westen. Zwei Mal hielt der Zug an, damit ihr euch waschen und verpflegen konntet – schließlich brauchte man euch als Arbeitskraft, nicht wie andere, die zur gleichen Zeit nach Osten transportiert wurden, und die weder Nahrung noch Wasser erhielten.
Am frühen Morgen erwartet mich eine Überraschung im Bad: Das Wasser, das in leicht bräunlicher Färbung aus der Duschbrause tröpfelt, ist kalt. Ich fluche leise, wasche mich notdürftig und steige schlotternd so schnell wie möglich in die Kleidung. Am Esstisch würge ich ein Brot mit Wurstaufstrich hinunter. Den eigenartigen Quarkkäse, den mir Ewa anbietet, lehne ich dankend ab.
„Do widzenia!“, ruft Ewa in meinem Rücken, während ich eilig aufbreche, um zur Bushaltestelle zu hasten.
Etwa zehnmal hat Ewa mir den Weg zur Schule beschrieben, mir erklärt, wie ich eine Fahrkarte zu lösen und bei welcher Station ich umzusteigen habe. Świętokrzyska. Ich wechsle vom Bus in die Metro, um nach wenigen Minuten schon wieder auszusteigen, mit einigen Dutzend Jungen und Mädchen. Etwas verloren scheine ich zu wirken, als ich endlich beim Schulgebäude ankomme, denn im Vorhof fragt mich ein Mann, was ich suche. In seiner Begleitung betrete ich wenig später ein Klassenzimmer. Auf engem Raum sitzen rund zwanzig Schülerinnen und Schüler hinter viel zu kleinen Pulten, die nicht viel mehr sind als dünne Holzplatten auf Metallgestellen. Die Wände sind grau und düster, der Verputz löst sich von der Decke. Es ist mucksmäuschenstill.
Ein Lehrer sitzt lässig auf dem Tisch vor einer verschmierten Wandtafel, spricht ein paar Worte auf Polnisch, steht auf, nickt mir zu und überlässt mir dann mit einer Handbewegung und den Worten „Ihre Deutschklasse! Viel Spaß!“ das Feld.
Ich blicke in verdutzte Gesichter. Um mein eigenes Erstaunen zu überspielen, stelle ich mich in gemächlichem Sprechtempo vor. Dann bitte ich die Schülerinnen und Schüler, ihre Namen auf Kärtchen zu schreiben, was ein Problem verursacht, da sie keine losen Blätter besitzen und ihre Hefte erst ausdünnen müssen, bevor sie meinem Wunsch nachkommen können. Dann stehen sie vor mir, die mir fremden Namen. Małgorzata und Sławek müssen sich zusammenreißen, um nicht zu lachen, als ich sie aufrufe und sie bitte, mir etwas über sich zu erzählen.
Schnell vergehen die ersten Lektionen in drei verschiedenen mir zugeteilten Gymnasialklassen, ohne dass auch nur eine polnische Lehrperson mir bei meinen didaktisch durchstrukturierten Lektionen zugeschaut hätte, um vom pädagogischen Austausch zu profitieren oder mit mir über linguistische oder didaktische Fragen zu diskutieren.
Am Ende des Nachmittags sitze ich mit meinem Betreuer Michał im Computerzimmer, einem modern ausgestatteten Raum, den ich im baufälligen Schulgebäude nicht erwartet hätte. Mein polnischer Lehrerkollege, ein Hüne mit blonden Haaren und stahlblauen Augen hinter dicken Brillengläsern, führt mir vor, wie das Goethe-Gymnasium den Anschluss an die EU gemeistert hat. Mithilfe von 25 hochmodernen PCs kann die globalisierte Welt ins Zimmer geholt werden. Und mit ihr der Traum und das Versprechen auf eine bessere Zukunft. Mit Michał bespreche ich die Ziele meines Aufenthalts. Von professionellen didaktischen Standards und pädagogischer Entwicklungshilfe will er nichts wissen.
„Die Präsenz der polnischen Lehrpersonen während deiner Lektionen ist nicht zwingend“, eröffnet mir Michał. Sie hätten hier alle mindestens einen Nebenjob, ohne diesen könnten sie ihre Familien unmöglich ernähren, ich müsse verstehen.
Ich beharre darauf, dass es in der Ausschreibung und beim Briefing in Bern anders geklungen habe. Doch Michał lacht nur.
„Ja, ja. Die Administration ist das eine, die Realität das andere. Wir sind eine Schule mit deutschem Profil. Das heißt, die Schüler sollen von dir Deutsch lernen. Sie sollen vor allem viel sprechen und auch einiges über die Schweiz erfahren. Vielleicht über die Geschichte von Wilhelm Tell oder über eure Demokratie. Die polnischen Lehrer nutzen die Zeit anders.“
Ich schlucke, akzeptiere die polnische Realität.
„Aber ich rede über die alltägliche, die wahre Schweiz, Michał, nicht über Mythen. Davon haben wir schon genug bei uns zu Hause. Die müssen wir nicht auch noch exportieren!“
„Du kannst sprechen, worüber du möchtest. Hauptsache auf Deutsch“, lacht Michał. „Du weißt ja, die Schweiz ist die unscheinbare Dritte im Bund der deutschsprachigen Traumdestinationen unserer auswanderungswilligen Jugend!“
Deine Auswanderung war unfreiwillig, dein Fortgang aus dem besetzten Polen ein Albtraum. Die Fahrtüber Lemberg, das früher euch gehörte, und Wien bis nach Donauwörth habt ihr heil überstanden. Du warst erst achtzehn, als du zum ersten Mal deutschen Boden betreten hast, jenen Boden, auf dem du dich zu bewähren hattest. Den Güterwaggons entstiegen, wurdet ihr in die Donauhalle geführt, wo ihr die Nacht verbringen musstet. Am nächsten Morgen führte man euch den Ortsbauernführern vor. Diese wählten, wie auf dem Viehmarkt, aus eurem Bestand. Gemästet. Stark. Gesund. Dann wurdet ihr weggeführt – in verschiedene Richtungen. Das „Auf Wiedersehen“ blieb dieses Mal aus. Keine Lügen mehr. Dein Bestimmungsort war O. Die Registrierung hielt fein säuberlich fest: D. Dmytro, Beruf: Landarbeiter. Dein Glück. Du bist der Rüstungsindustrie entkommen. Landarbeiter. Zugeteilt dem Bauern K. Auch das ein Glück. Einen Strohsack hast du zum Schlafen bekommen, in einem richtigen Zimmer. Kein Hundehaus als Nachtlager wie einige der Deinen. Die „Pflichten der Zivilarbeiter und -arbeiterinnen polnischen Volkstums“ sahen vor, dass ihr im Stall zu schlafen hattet. Rassentrennung.
Doch K. verhielt sich gesetzeswidrig. Er errichtete auch keinen Zaun rund um euch, sodass ihr den Arbeitsort verlassen konntet. Trotzdem keine Flucht. Auch dann nicht, als du begriffen hast, dass der Lohn nicht überlebensfähig macht. Auch nicht, als du nach drei Monaten trotz anderslautender Versprechen keine Fahrkarte nachHause bekamst, obwohl dir die Reise, um die du ersucht hattest, anfänglich bewilligt worden war. Das Reich brauche dich. Das Arbeitsamt Donauwörth sprach das letzte Wort. Aus dem Zivilarbeiter wurde ein Zwangsarbeiter. Du hattest zu bleiben. Wie alle anderen. Im Pflichtenheft stand: „Jeder polnische Arbeiter und jede polnische Arbeiterin hat sich stets vor Augen zu halten, dass sie freiwillig zur Arbeit nach Deutschland gekommen sind.“ Nein, Metro, freiwillig bist du nicht nach Deutschland gekommen, aber freiwillig bist du geblieben – später dann, als der Krieg vorbei war. Du warst einer von 1.105.719 polnischen Zwangsarbeitern in der deutschen Landwirtschaft. Trotz Zwang kein Fluchtversuch. Aussichtslos.
Drecksarbeit, nicht viel anders als zu Hause, hast du wohl gedacht, dort auf den deutschen Feldern und im deutschen Stall. Doch dieses Mal für fremde Mäuler. Immerhin warst du nicht ganz allein. Ihr habt euch gesehen, ab und zu, ihr Polen. Zum Beispiel in der Kirche, so hat man mir erzählt. Du hast jeden Sonntag die Messe besucht, erst nach den Deutschen, versteht sich. Ihr alle habt die Messe besucht, die keine war. Der Priester durfte nicht für euch predigen, und er durfte, wie ihr, kein Wort Polnisch sprechen. Ihr habt es doch getan. Hinter der Friedhofsmauer, die heute noch steht, und vor der du liegst. Du hast dich in diesem Dorf mit seinen tausend Seelen frei bewegen können. Nur einmal hat dich eineraus der Gaststube geworfen. Es war kein Einheimischer, sondern einer, der die Regeln des Reichs kannte, aber nicht jene in O., in diesem kleinen Dorf am Lech, in dem die Menschen eigenen Gesetzen folgten. In O. wurden die Vorschriften, die für jene galten, die ein P auf ihrer Kleidung zu tragen hatten, nicht eingehalten. Wenigstens nicht konsequent.
„Raus mit dir, Polake!“, befahl dir ein Fremder mit einem Parteiabzeichen, das ihn zum Richter über dich machte.
Ihr habt euch getroffen, ohne aufzufallen. Aufzufallen war verboten. Auch den Deutschen. Trotzdem gab es sie, die Kontakte zwischen euch und ihnen. Auch du hattest sie, auch während der Arbeit. Ein Glück für dich, dass du für K. ein Mensch warst. Und doch fehlte dir anfänglich, was den Menschen zum Menschen macht: die Sprache. So habt ihr gelernt, auf dem Feld, im Stall, im Keller, durch den jungen Sohn des Bauern M., Mitglied in der Hitlerjugend. Trotzdem lehrte er dich die Sprache. Und dann durch die Kinder des Schreiners, der vor dem Krieg gestorben war, und dessen Platz damals schon der andere eingenommen hatte: durch die beiden Mädchen, die fast schon Frauen waren, und durch den Jüngsten, der noch zu jung war für den Krieg. Jede Begegnung ein Tausch, ein polnisches Wort gegen ein deutsches, ein „dzękuję“ gegen ein „danke“, ein „kocham cię“ gegen ein „ich liebe dich“ – doch das war später.
Meinen ersten freien Nachmittag nutze ich für einen Spaziergang durch den innersten Kern Warschaus. Mit der U-Bahn lande ich nach einigen Kilometern beim Ratusz, der Metrostation nahe der Altstadt. „Stare Miasto“, provisorische Endstation. Die Zukunft ist auf den Metroplänen bereits vorgezeichnet und reicht zwei Stationen weiter. Das Erste, was mir nach dem Betreten der autofreien Gasse ins Auge sticht, ist ein alter, in einen speckigen Filzmantel gehüllter Mann, der schlotternd vor der roten Stadtmauer steht, vor sich ausgebreitet einige getrocknete Gebinde aus blauen Kornblumen, die jemand gepflückt hat, als die Sonne noch wärmte. Für fünf Zloty, so sagt es ein mit ungelenker Schrift kreiertes Kartonschildchen, sind sie zu haben. Ich mustere den Verkäufer. Ein freundliches Lächeln liegt auf seinem furchenreichen Gesicht. Der schwarze Hut bedeckt die langen grauen Haarsträhnen nicht vollständig. Sein Blick lässt mich stehen bleiben – er hat sie nicht, diese leeren, ausdruckslosen, vom Alkohol und verkauften Hoffnungen erloschenen Augen, wie ich sie in den letzten Tagen bei so vielen Männern an Haltestellen oder in Metrostationen gesehen habe. Im Gegenteil. Seine tiefgrünen Augen leuchten. Er hebt ein Bouquet hoch und streckt es mir entgegen. Es gelingt mir nicht, sein Alter zu schätzen. Vielleicht 70. Aber hier sehen viele älter aus, als sie sind.
Meine Finger zittern fast so stark wie seine, als ich ihm das Geld reiche. Während ich die Blumen sorgfältig in meiner Tasche verstaue, lächelt der Alte verschmitzt und blickt mir lange in die Augen. Ich merke, wie ich erröte. Etwas abrupt wende ich mich schließlich ab, und ohne ein Wort zu sagen, gehe ich erst hastig, dann langsamer durch die Gassen bis zum innersten Viereck der Stadt. Das Weiß des Schnees spielt mit den farbenfrohen Fassaden der Häuser. Ein paar Männer sind dabei, in schwindelerregender Höhe Eiszapfen von Dachvorsprüngen zu schlagen.
Vor der Statue der Meerjungfrau bleibe ich einen Augenblick stehen. Das über den zierlichen Kopf zum Kampf erhobene Schwert zieht die Blicke auf sich, wodurch jegliche erotischen Gefühle von vornherein verhindert werden, welche die vollen, entblößten Brüste möglicherweise auszulösen vermocht hätten. Die Kälte kriecht unter meine Kleidung, ich ziehe meine Mütze tiefer ins Gesicht, meinen Schal bis über die Nase und gehe weiter in Richtung Nowy Świat, der Einkaufsmeile Warschaus. Obwohl es nicht schneit, ist das Kopfsteinpflaster von der Mischung aus Salz und geschmolzenem Schnee rutschig, sodass ich öfter auf den Boden als in die Schaufenster blicke.
Am Abend lädt mich Ewa ins Theater ein. Ich bin eigentlich todmüde und würde am liebsten ins Bett fallen, doch Ewa besteht drauf.
Unter den Augen des hell erleuchteten Kulturpalasts finden wir einen Parkplatz. Auf dem Weg zum Eingang bekomme ich von Ewa einen kulturellen Vortrag zu hören: „Der Kulturpalast ist 230 Meter hoch. Er ist ein Geschenk Stalins und das umstrittenste Gebäude Warschaus. Entweder man liebt den Palast – oder man hasst ihn!“
„Und zu welchen gehörst du?“, frage ich Ewa.
„Tadeusz Konwicki hat den Kulturpalast einmal als Denkmal der Arroganz bezeichnet, als Statue der Unfreiheit und als Torte aus Stein zur Warnung an die polnische Nation“, lacht Ewa. „Das ist auch etwa meine Meinung.“





























