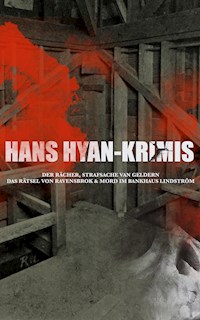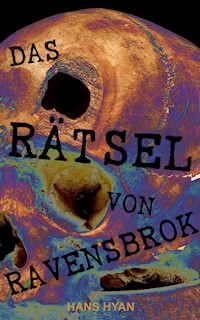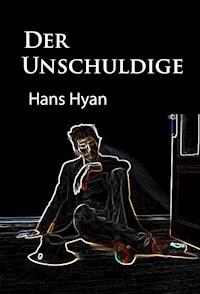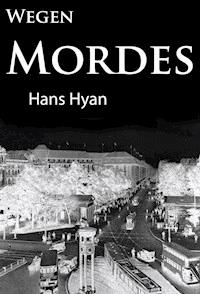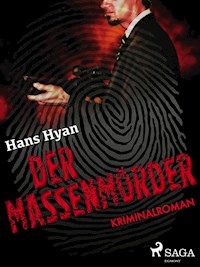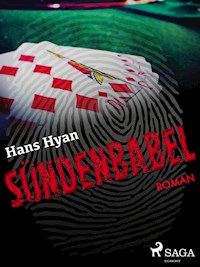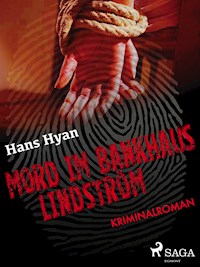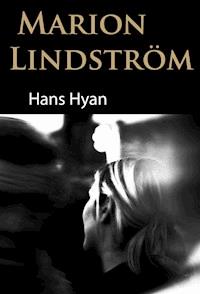
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Das ist es ja nicht, das ist es ja nicht, Papa! Mein Gefühl für Stefan bleibt sich immer gleich. Ich liebe ihn so, wie eine Frau einen Mann lieben muß, wenn sie ihm angehören soll. Ich habe Verlangen nach seiner Nähe und nach seiner Person, und ich weiß ganz genau, daß ich glücklich sein werde, wenn ich ihn heirate ...« Die schönen blauen Augen blickten unbeirrt auf ihren Vater: »Nein, das ist es wirklich nicht, es ist etwas ...« Mit einem tiefen Atemzug, als nähme sie einen Anlauf, um ein unüberwindliches Hindernis zu nehmen: »Es ist etwas in meinem Leben, das ich ihm nicht sagen kann ... nein, auch dir nicht, Papa ... worüber ich nicht sprechen kann ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Hyan
Marion Lindström
Kriminalroman
idb
ISBN 9783961507313
Coverph. Hans van den Berg
1
Der alte Martin brachte den Tee in das Arbeitszimmer des Konsuls.
»Das gnädige Fräulein möchte Herrn Konsul sprechen, ehe der gnädige Herr ins Büro geht.«
Die hohe, breitschultrige Figur des Konsuls reckte sich, er sah den Diener forschend an.
»Was sagte denn meine Tochter, weshalb sie ...?«
»Das gnädige Fräulein meinte nur, sie müßte Herrn Konsul auf jeden Fall vorher sprechen.«
Indem kamen leichte Schritte durch das Nebenzimmer, und zwischen den dunklen Samtportieren erschien die blonde Marion, des Konsuls einzige Tochter.
Sie blieb einen Augenblick stehen und sah mit ihren schönen Augen aufmerksam zu ihrem Vater hin. Da spürte er, daß sie ihm wirklich Wichtiges mitzuteilen hatte.
Der alte Martin war geräuschlos gegangen; der Konsul breitete seine Arme aus ...
Dieses Mädchen da war der Mittelpunkt seines Daseins. Er selbst, schon in den Fünfzigern, hatte das Leben genossen; er war reich, besaß Macht und Einfluß, er hätte nicht gewußt, was er sich noch wünschen sollte. Aber diese Tochter, seine Marion, mit ihren einundzwanzig Jahren, war für ihn Einsatz und Gewinn seines Lebens zugleich. Er liebte sie, nicht nur wie Väter ja meistens ihre Töchter lieben – sie war ihm Weib und Kind zugleich. Den Gedanken, sie zu verlieren, dachte er überhaupt nicht aus.
Sie war verlobt mit einem Künstler, einem berühmten und wertvollen Menschen, und sie hing gewiß mit Liebe und Leidenschaft an dem erwählten Mann. Aber ihre Verbundenheit mit dem Vater konnte durch nichts übertroffen werden.
Das alles fühlte Rudolf Lindström mit jedem Nerv, und davon war seine Seele erfüllt, als Marion zu ihm trat, ihre Arme um seinen Hals legte, wie sie es schon als ganz kleines Mädchen getan hatte, und sich von ihm auf die Wange küssen ließ.
»Ja, ich muß dich sprechen, Papa«, sie zauderte sekundenlang; dann ging ein Ruck durch ihren schlanken Körper:
»Ich kann mich nicht verloben ... ich kann einfach nicht, Papa.«
Ein Lächeln irrte um seinen bärtigen Mund, als er fragte:
»Seit wann hat meine Marion solche Launen?«
Sie schüttelte ihr blondes Haupt:
»Das sind keine Launen ... das ist ...«, sie fand das Wort nicht, »das ist ...« Sie hob die Schultern: »Das ist wahrscheinlich ... mein Schicksal ...«
Jetzt war das Kopfschütteln an ihm:
»Wie alt bist du, Marion?«
»Einundzwanzig, Papa.«
»Ich weiß es ja, aber ich frage doch ... Ihr jungen Menschen von heute lebt von lauter Entschlüssen; für euch gibt es immer nur ein Entweder-Oder. Jede Schwierigkeit heißt bei euch ›unmöglich‹. So ist doch das Leben nicht! ... Wenn du mir gesagt hättest: du kannst dich heute nicht verloben, das würde ich begreifen. Wenn jemand noch nicht das volle Gefühl der Zusammengehörigkeit mit einem anderen Menschen hat ...«
Aber Marion verneinte:
»Das ist es ja nicht, das ist es ja nicht, Papa! Mein Gefühl für Stefan bleibt sich immer gleich. Ich liebe ihn so, wie eine Frau einen Mann lieben muß, wenn sie ihm angehören soll. Ich habe Verlangen nach seiner Nähe und nach seiner Person, und ich weiß ganz genau, daß ich glücklich sein werde, wenn ich ihn heirate ...«
Die schönen blauen Augen blickten unbeirrt auf ihren Vater:
»Nein, das ist es wirklich nicht, es ist etwas ...«
Mit einem tiefen Atemzug, als nähme sie einen Anlauf, um ein unüberwindliches Hindernis zu nehmen:
»Es ist etwas in meinem Leben, das ich ihm nicht sagen kann ... nein, auch dir nicht, Papa ... worüber ich nicht sprechen kann, wenigstens nicht, ehe ich mir nicht ganz klar geworden bin ... über den eigentlichen Vorgang ...«
»Aber Marion, das ist doch das reine Rätselraten!« Er versuchte absichtlich, einen leichten, scherzenden Ton beizubehalten. »Du sagst, es ist etwas geschehen; aber was geschehen ist, das sagst du nicht; gleich darauf: du weißt selbst nicht, ob etwas passiert ist, was dich hindert, dich mit Stefan zu verloben. Wer soll sich denn da herausfinden!«
Marions Gesicht wurde ernster und trüber:
»Ich weiß es nicht, Papa, ich bin mir ja selbst nicht klar darüber, was ich tun muß, um von dieser furchtbaren Last frei zu werden. Du weißt, ich habe ein heiteres Naturell, mir liegt nichts ferner als Kopfhängen und Grübeln; ich will gar nicht unglücklich sein! Leben will ich! Gesund sein und lachen! ... Aber das weißt du doch auch, Papa, man kann nicht immer, wie man will. Vielleicht ... kann ich nur in der Entfernung von dir das tun, was ich muß.«
Sie wandte sich ab und ging an das Fenster; dort zog sie die üppigen Stores beiseite und blickte hinaus in die neblige Morgenfrühe der Allee, in der die Villa Lindström zwischen anderen Landhäusern reicher Leute inmitten eines großen Gartenlandes lag.
Der Konsul hatte sich in dem Ledersessel zurückgelehnt und sagte zärtlich und eindringlich, wie manchmal in früheren Jahren, wenn Marions Widerspruchsgeist sich regte:
»Du weißt, Liebling, ich kann dir ernstlich nichts abschlagen. Aber weil du meine Schwäche dir gegenüber kennst, hast du auch die Pflicht, mich nicht vor Entscheidungen zu stellen, bei denen ich dir einfach nicht nachgeben kann. Das mußt du doch einsehen, daß du heute, am Morgen deines Verlobungstages, wo alles vorbereitet ist, wo wir hundert Gäste erwarten, nicht plötzlich sagen kannst: ›Ich verlobe mich nicht!‹«
Marion war zu ihm getreten, hatte den Arm um seinen schon etwas ergrauten Kopf gelegt und setzte sich nun, wie sie es als Kind oft getan hatte, auf des Vaters Knie:
»Du hast ja recht, aber ...« Sie schwieg.
»Aber ...?« fragte er.
Sie blickte ihn zweifelnd und unsicher an, endlich sagte sie:
»Ich verspreche dir, nichts zu überstürzen ... Ja, ich werde mich verloben, heute abend ... nicht, weil ich diese Verlobung wünsche, aber ... das sehe ich ein, und darin gebe ich dir recht, ich hätte Stefan meinen Entschluß schon früher mitteilen sollen ... das war ein doppeltes Unrecht ... Ich habe ihm verheimlicht, was er wissen muß, und ich habe ihm nicht einmal gesagt, daß ich nicht die Seine werden kann, wenn dieses Unglück ...«
Sie drückte ihre schmalen Hände an die Augen, als wollte sie aufschluchzen, aber sie weinte nicht. Im Gegenteil, ihre Stimme und ihre Muskeln wurden fester und straffer. Sie beugte den Kopf:
»Ich muß dahinterkommen, Papa, und du kannst dich auf mich verlassen, daß ich das, was mir heute, jetzt so unfaßbar ... so unergründlich erscheint, daß ich das herausbekomme und daß ich mich von allem freimache.«
Sie drückte seinen Kopf fest und leidenschaftlich an ihre Wange, und da er weiter fragen wollte, wehrte sie ab:
»Nein, nein, ich kann dir jetzt nichts sagen, heute nicht und morgen auch nicht ... Du darfst mich auch nicht fragen.«
Der Fernlautsprecher schnarrte. Dann kamen aus dem Apparat die Worte:
»Herr Generaldirektor wollen doch bitte sofort in die Bank kommen, es ist eingebrochen worden!«
Überrascht fragte der Konsul:
»Bei uns ... in der Bank ...?«
Er hatte den Lautsprecher abgestellt und den Hörer ans Ohr genommen:
»Matschunke, Sie sind es ... nun sagen Sie doch..! Nein, ich komme sofort herunter ... den Doppelschlüssel zum Tresor, ja, den bring' ich mit ...!«
Er legte den Hörer fort, wandte sich zu der gespannt aufhorchenden Tochter:
»Was sagst du dazu, Marion ...! Ja, ich ruf dich gleich an, von der Bank aus ...« Der Konsul war jetzt schon ganz in seiner Bank und mit dem Einbruch beschäftigt. »Und im übrigen, Marion, ich komme früh nach Hause heute, da können wir ja alles noch einmal in Ruhe durchsprechen ... und du bist meine vernünftige Tochter ... nicht wahr, du siehst, in diesem Augenblick ... da weiß ich wirklich nicht, wo mir der Kopf steht ...«
Der alte Martin war hereingekommen, hatte seinem Herrn Mantel und Hut gebracht, und der Konsul war aus dem Zimmer, ehe Marion noch viel fragen konnte. Sie war auch so beschäftigt mit ihren eigenen Gedanken, daß ihr dieser Einbruch, der sie sonst gewiß interessiert hätte, im Augenblick recht bedeutungslos erschien.
Es gab ja eine Versicherung und auch die Polizei. Marion war es von ihrem Vater gewöhnt, daß er jede Sache schnell und praktisch erledigte.
Nachdenklich ging sie wieder hinüber in ihr Zimmer.
2
Im Schneenebel eines Wintermorgens, der sich langsam erhellte, ging der frühere Kriminalinspektor und jetzige Privatdetektiv Doktor Splittericht durch die Flinsberger Straße nach seiner am Harlemer Platz gelegenen Wohnung. Zehn Schritt vor ihm, im Morgendämmer verschwimmend, trugen zwei Telefonarbeiter ein schweres Kabel, und der Doktor-Kommissar, der in Gedanken versunken dahinging, erschrak etwas, als der vordere von den beiden Arbeitern aufschreiend mit dem halben Leibe im Straßenpflaster versank. Sein Kollege sprang hinzu und zog den Mann im blauen Kittel aus dem Loch. Im Verein mit dem Detektiv betrachteten beide voll Erstaunen den Einbruch in der Pflasterung. Es hatten sich eigentlich nur die mosaikartig festgeklopften Granitbrocken neben den großen Trottoirsteinen etwa einen halben Meter gesenkt. In dem entstandenen Loch aber sah man zerbrochene Bretter und Hölzer, die den Steinbelag noch stützten. Als sich nun die beiden Arbeiter mit ein paar hinzukommenden Kollegen daran machten, wurde bald ein unterirdischer Gang bloßgelegt, der, wie ein Bergwerksstollen abgesteift, unter der Erde entlangging.
Doktor Splittericht trat mit einem leisen Lächeln an den Bord der breiten Straße. Das Haus, vor dem man sich befand, war ein großes Industriegebäude, das in seinen oberen Etagen Wohnungen enthielt, während in den unteren Stockwerken sich nur Geschäftsräume befanden. Das Erdgeschoß und den ersten Stock bewohnte das Bankhaus Lindström – diese Feststellung zauberte ein mephistophelisches Lächeln auf Doktor Splitterichts Gesicht. Er legitimierte sich den durcheinanderredenden Arbeitern gegenüber und forderte sie auf, hier an der Stelle zu bleiben, bis er von einem Telefongespräch zurückkäme. Dann eilte er nach dem Harlemer Platz, trat in einen Telefonkiosk und ließ sich mit dem Polizeipräsidium verbinden.
»Die Abteilung IV, bitte, Fräulein ...! Kommissar Starkmann ... jawohl, hier Splittericht. Sie müssen schnell mal herunterkommen, Herr Kollege, nach der Flinsberger Straße neun. Mit ein paar von Ihren Leuten, ja ... es handelt sich um ein ganz groß angelegtes Verbrechen ... wie? ... ja, Bankraub ... Bankhaus Lindström in der Flinsberger Straße neun ... das Straßenpflaster ist unterminiert. Die Leute sind offenbar unter dem Straßenniveau durch die Hausmauer in den Tresorkeller gedrungen ... richtig, ja! ... Ich sichere den Tatort bis zu Ihrer Ankunft.«
Der Detektiv hängte ab und nahm gleich die zweite Verbindung zu der Privatwohnung des ihm gut bekannten Oberregierungsrats Henderson, des Leiters der Abteilung IV. Auch den verständigte er von seiner Entdeckung und entschuldigte sich wegen des frühen Anrufs – es war kurz nach sieben Uhr.
»Aber ich bitte Sie, liebster Doktor«, klang es von der anderen Seite, »wir sind Ihnen doch sehr dankbar ... es ist ja so merkwürdig, daß Sie immer schon da waren, wenn wir erst hinkommen ...« – sie lachten beide, – »in einer Viertelstunde bin ich bei Ihnen.«
Als Doktor Splittericht zurückkam, hatten die Telefonarbeiter den Gang schon ein ganzes Ende weiter bloßgelegt. Die Flinsberger und die Straße am Harlemer Platz schnitten sich hier. Den Schnittpunkt bildete das Bankhaus. Der Eingang zur Bank befand sich an der Flinsberger Straße. Doktor Splittericht stieg nun auf die etwa zwei Meter tief liegende Gangsohle hinab. Den Revolver in der rechten, seine Taschenlampe in der linken Hand, drang er zuerst nach links vor und kam etwa drei Meter weiter an das Ende des Stollens und an ein Loch in der Hausmauer, durch das er sich nur schwer hindurchzwängen konnte. Er befand sich jetzt, wie der helle Lichtstrahl seiner Lampe zeigte, in einer Art Schornstein, in dem er sich kaum bewegen konnte. Kein Zweifel, das war ein Luftschacht!
Splittericht kroch vorläufig wieder durch das Mauerloch in den Gang zurück und ging in gebückter Haltung durch ihn hindurch bis zu seinem rechten Ende. Auch hier stieß er auf ein Loch in der Hausmauer, durch das er in den Heizungskeller hineinblickte. Er wollte sich eben weiter orientieren, als er Stimmen in seinem Rücken hörte und, sich umdrehend, den Kommissar Starkmann sah, der ihm neugierig mit der elektrischen Laterne ins Gesicht leuchtete.
»Ah, Sie sind der Kriminalpolizei wieder um eine Nasenlänge voraus, Herr Doktor!«
»Leider«, meinte Splittericht bekümmert, »ich habe wirklich selber genug zu tun. Aber ich kann doch beim besten Willen an so einer Sache nicht vorbeigehen.«
»Waren Sie schon da drin?« Der Kommissar deutete auf das Loch in der Mauer, durch das Splittericht im nächsten Augenblick verschwand. Der Beamte folgte ihm. Das erste, was sie sahen, war ein gewaltiger Berg weißen Sandes – der Rauminhalt des Stollens, den die Einbrecher mit großer Mühe herausgeschafft hatten. Da lag noch der Eimer, den der im Stollen stehende Schränker ein Mal um das andere mit der Erde füllte, um ihn jedesmal dem hinter der Mauer im Heizkeller stehenden Komplizen durch das Loch hindurchzureichen.
»Ein tolles Stück Arbeit«, sagte der Kommissar, »woran die Herrschaften wahrscheinlich tagelang geschuftet haben! Den Sand und die Bruchstelle haben sie immer wieder mit Kohlen bewerfen müssen ... es konnte ja doch jemand hier reinkommen, wenngleich die Stelle im Keller ziemlich abseits liegt ...«
Die beiden leuchteten nun den Keller in allen seinen Gängen ab. Sie besichtigten die Heizung, das recht komplizierte System der elektrischen Schalter für die Beleuchtung des großen Hauses und kamen so durch mehrere Gänge an die Tresorwand.
»Von hier aus ist nichts zu machen gewesen, das haben die beiden Ganoven sofort gesehen. Der Tresor besteht aus einer zollstarken doppelten Stahlwand, der Zwischenraum ist mit einer Mischung von Beton, Kalk und Kieseln, sogenanntem Eisenmörtel, ausgefüllt. Kein Bohrer und kein Schneidebrenner kann dagegen an.« Kommissar Starkmann betrachtete die Wand interessiert, er sah deutlich, wo die Einbrecher das Material des Tresors auf seine Festigkeit geprüft hatten. »Nun bin ich bloß gespannt, ob und wie sie reingekommen sind.«
»Das will ich Ihnen sagen«, nickte Splittericht, »darum sind sie ja durch die Hauswand, unterm Trottoir durchgekommen, dann wieder durch die Hausmauer und an den Tresor, aber von der Schmalseite her ... da liegt nämlich der Luftschacht.«
»Woher wissen Sie denn das?«
Das stille Leuchten, das über das meist unbewegliche Gesicht des Detektivs lief, ärgerte den andern. Er dachte bei sich: Du alter Besserwisser, zaubern kannst du doch auch nicht!
»Woher wissen Sie denn das, Herr Kollege?«
Aber Splittericht antwortete nicht. Er ging zurück, kroch durch die Mauer, wobei ihm der Kommissar auf dem Fuße folgte, glitt den Gang entlang und kam durch die jenseitige Maueröffnung in den Luftschacht hinein. Hier war nur sehr wenig Raum. Herr Starkmann konnte ihm nicht folgen. Er hörte nur, wie Splittericht meinte:
»Es ist so, wie ich dachte: der Luftschacht ist von außen durchbrochen, dann haben die Leute die Anker, die in der Luftklappe den Durchlaß zum Tresor schützen sollen, mit dem Schweißbrenner beseitigt und der Dünnere ist reingekrochen ... Das werden wir beide kaum fertigkriegen, Herr Starkmann ... Wir müssen warten, bis die Leute von der Bank mit den Schlüsseln kommen.«
Auch Starkmann sah sich in dem engen Gemäuer um, dann gingen sie beide zurück, kletterten aus dem Gang auf die Straße und kamen eben recht, um Oberregierungsrat Henderson zu begrüßen, der gerade aus seinem Auto sprang.
Der Hausportier hatte inzwischen den Generaldirektor und Hauptaktionär des Bankhauses Lindström, Konsul Lindström, angeläutet und ihm mitgeteilt, was geschehen war. Auf dessen Geheiß war er im Auto zu dem nahe wohnenden Kassenboten Matschunke gefahren, der den einen Schlüssel zum vorderen Bankeingang in Verwahrung hatte. Den anderen Schlüssel nahm der Lehrling Winter abends mit nach Hause, um sich am nächsten Morgen Punkt acht Uhr mit Matschunke vor dem Bankgebäude zu treffen. Die beiden Leute konnten nur gemeinsam die Eingangstür zur Bank öffnen. Allerdings befanden sich die Duplikatschlüssel zum Eingang im Gewahrsam des Generaldirektors selbst.
Matschunke und Alfred Winter kamen eben. Sie öffneten die Tür und ließen den Oberregierungsrat, den Kommissar Starkmann, zu dem jetzt noch seine Untergebenen, Wachtmeister Vogel und Assistent Nebeltau, gestoßen waren, und den Doktor Splittericht in die Bank eintreten. Dann fuhr der Lehrling Winter nach der Markenstraße zum Hauptkassierer Hermann Reese.
»Wann kommt Herr Reese gewöhnlich ins Geschäft?«
»So um halb neun, Herr ...«
Splittericht sah auf die Armbanduhr: es waren zehn Minuten bis acht.
Das Banklokal lag nur eine Stufe über dem Niveau der Straße, auf der sich jetzt, da es schon heller geworden war und der Verkehr der zur Arbeit eilenden Menschen wuchs, Publikum ansammelte, das voller Neugier herandrängte. Von der nächsten Wache wurden mehrere Sipos herbeibeordert, die die Straße im Umkreis absperrten.
3
Wenn man in den Schalterraum der Bank eintrat, lagen rechts die sich weit hinziehenden Einzelschalter, vor denen sich das Publikum aufhielt. Es standen da Tische zum Schreiben, Sessel und Stühle und an der linken Wand mehrere große Lederbänke. Links vom Eingang führte eine Holztreppe mit geschnitztem Eichenholzgeländer in den Tresor hinab. Der Treppeneingang war offen. Unten kam man in einen kleinen Vorraum und dann an die Tresortür selbst, die, gleich einer mächtigen Stahlwand, den Zugang zu diesem Mammut-Kassenschrank versperrte. Das Buchstaben- Stellschloß war nach besonderer Konstruktion gearbeitet. Niemand außer dem Konsul Lindström und dem Hauptkassierer Reese kannte die Zahlenfolge des Stellschlosses, die obendrein alle Woche einmal geändert wurde.
»Es ist ganz unmöglich«, meinte Herr Henderson, »in diesen Tresor einzudringen. Denn selbst wenn man die Schlüssel hat, so muß man doch immer noch die Stellziffern wissen.«
Doktor Splittericht nickte, und wieder irrte jenes seltsame Lächeln um seine Lippen.
»Man hätte nur an den Luftschacht denken müssen, der doch eigentlich, wenn man so will, recht überflüssig ist.«
In diesem Augenblick trat der Generaldirektor des Bankhauses Lindström, Konsul Lindström, in den Vorraum des Tresors und begrüßte, mit besorgtem Blick die Tresortür musternd, die Herren von der Behörde. Mit Herrn Henderson war er seit langem befreundet. Er schüttelte den Kopf:
»Ich kann es mir doch gar nicht denken, lieber Herr Oberregierungsrat ... unter der Straße lang und durch die Hausmauer ...? Ist denn so etwas möglich?«
»Ja ...« Der Oberregierungsrat strich den kurzen grauen Schnurrbart. »Es muß wohl sein, Herr Konsul. Eben sagte Doktor Splittericht noch ... übrigens, darf ich vorstellen: Herr Doktor Splittericht – Herr Konsul Lindström ... ach, die Herren kennen sich?«
Der Bankier reichte dem Detektiv die Hand:
»Ich habe viel von Ihnen gehört, Herr Doktor! Und gerade in diesen Tagen hatte ich vor, Sie in einer Sache um Ihren Rat zu bitten ...«
Der Detektiv verbeugte sich:
»Ich stehe immer zu Diensten, Herr Konsul!«
Der Oberregierungsrat lächelte verbindlich:
»Ja, aber der Doktor hat recht: an den Luftschacht im Tresor hätte man denken sollen ... der ist ja total überflüssig ... Wenn einer, der hier was zu suchen hat, hineingeht, so bleibt die Tresortür offen und er kriegt Luft von außen. Und wenn einer eindringt, der nichts darin zu suchen hat, dann hat man eigentlich nicht notwendig, für Luftzuführung zu sorgen ...«
Konsul Lindström stellte jetzt die Scheiben-Kombination des Stellschlosses an der Tresortür auf die nur ihm und dem Hauptkassierer bekannte Stellziffer ein und drehte das Handrad einmal. Dadurch wurde eine kleine Nische in der Außenpanzerung frei, und der Bankier erklärte dem Leiter der Kriminalpolizei: das sei die sogenannte Lafette. Dahinein täte man diesen Schlüssel, er holte aus einem kleinen Lederetui ein unwahrscheinlich kleines, flach-sichelartiges Instrument hervor, das er nun in die Vertiefung einpaßte.
»Sie sehen, lieber Herr Oberregierungsrat, ein Schloß gibt es hier eigentlich überhaupt nicht, wenigstens nicht an der Oberfläche der Tür. Das Schloß ist eingelagert in die hintere Panzerung. Erst die zweite Umdrehung des Handrades«, er legte seine Hand auf das Rad, »führt den Schlüssel mit der Lafette in das versteckte und so doppelt geschützte Patentschloß ... wenn ich jetzt das Rad noch eine halbe Drehung machen lasse, dann ist das Schloß offen, und gleichzeitig schiebt sich die hundert Zentner schwere Doppeltür selbsttätig auseinander.«
Er ließ seinen Worten die Tat folgen und trat dann mit dem Kassenboten Matschunke, der neben ihm stand, in den Tresor. Aber die beiden Männer prallten zurück, der Kassenbote schrie laut und Konsul Lindström griff nach dem blanken Stahl der Gittertür. Hinter den beiden reckten die Kriminalbeamten voller Neugier die Köpfe.
Was zuerst ins Auge fiel in diesem von automatisch aufflammenden Lampen erhellten Raum, waren nicht die aufgebrochenen Safes, auch nicht der Extraschrank, an den Konsul Lindström besonders gedacht hatte, weil gestern abend noch anderthalb Millionen in barem Gelde darin lagen – was so kraß ins Auge fiel und die Beschauer mit Entsetzen erfüllte, war der Mensch, der mitten im Raum tot auf dem Teppich lag.
Ein junger, großer und schlanker Mann in eleganter Kleidung. Der lag, die Arme verkrümmt und die Hände zu Fäusten gekrampft, lang ausgestreckt, das Gesicht nach unten, auf dem hellen Fußbodenbelag. Neben ihm lag die ausgebrannte Diebslaterne.
Kommissar Starkmann trat heran. Seine beiden Untergebenen folgten ihm.
»Drehen Sie mal den Mann um, Vogel!«
»Jawohl, Herr Kommissar!« Und der Oberwachtmeister Vogel, ein wahrer Goliath, gegen den sich ein Verhafteter nur selten wehrte, nahm den doch schweren Menschen wie eine Puppe vom Boden auf und legte ihn auf den Rücken:
»Er ist schon ganz steif, Herr Kommissar.«
»Ja«, sagte der und sah bald den Wachtmeister, bald den Verbrecher an, »wie ist mir denn, Vogel? Das ist doch der ehemalige Leutnant, unser alter Freund Zalewski?«
Der Wachtmeister Vogel war im Kriminaldienst ergraut, er kannte die meisten der gewerbsmäßigen Einbrecher. Und nickte einsilbig:
»Ja ... Zalewski.«
»Na, na, reden Sie mal 'n bißchen, lieber Vogel, wenn's auch schwer fällt! ... Seit wann ist denn der wieder draußen, der Zalewski?«
»Sechs Wochen.« Und Wachtmeister Vogel schwieg abermals.
Lächelnd sagte der Kommissar, zu dem Generaldirektor und seinem Chef gewendet:
»Der Wachtmeister Vogel weiß mehr als wir alle, aber er sagt es nicht ... 's muß hart kommen, wenn er mal vier Worte hintereinander sprechen soll. Was, lieber Vogel?«
Aber der Wachtmeister beantwortete auch diese Frage nicht. Er hatte sich niedergebeugt, hatte den toten Einbrecher durchsucht und die Brieftasche aus dem modern geschnittenen dunklen Tuchjackett genommen. Dann zog er aus der hinteren Hosentasche links eine Pistole und aus der rechts eine zweite, beides Brownings, heraus. In den Seitentaschen steckten ein an der Kette hängendes Schlüsselbund, ein Taschentuch und eine Handvoll zerknittertes Papiergeld.
»Das ist alles, was der Tote bei sich hat?« fragte Starkmann.
Der Wachtmeister bückte sich noch einmal, nahm eine fein ziselierte Uhr aus der Westentasche des Toten, steckte sie ebenfalls zu sich. Dann hob er den Toten wieder hoch, als hätte er gar kein Gewicht, und legte ihn genau so nieder, wie er ihn gefunden hatte.
Inzwischen war der Polizeifotograf gekommen und die übrigen Herren der Mordkommission. Jetzt traten alle zurück, um Platz für den Fotografen zu schaffen. Eine große Lichtlampe wurde angeschlossen. In der weißblendenden Helle sah das Gesicht des toten Einbrechers wie Marmor aus.
Ein Reporter, der erste, der, Gott weiß woher, schon von dem Bankdiebstahl gehört hatte, stellte sich vor und übersah freundlich die kühlen Blicke, die ihn kaum willkommen hießen. Er ließ es sich auch nicht anfechten, als Herr Lindström deutlich sagte:
»Wir sind genug hier unten ... Sagen Sie mir bloß, lieber Oberregierungsrat, was bedeutet das?«
Der hob die Achseln, zeigte mit dem Finger auf den Geldschrank:
»War viel Geld darin?«
»Anderthalb Millionen Mark ... und was da drüben in den Einzelsafes«, er zeigte nach dem Metallschrank, der eine Kombination vieler, jetzt brutal aufgerissener Safefächer war, »was da drin gelegen hat, das wissen nur unsere Tresorkunden ... da kann es noch ganz nette Zivilprozesse geben ...«
Konsul Lindström schwieg. Er ging an den kleinen, aber ganz modernen Kassenschrank, dessen beide Schlösser mit dem Fernholzbrenner wie mit einer Schere aus der Stahlplatte herausgeschnitten waren ... Dicht neben dem Schrank lag die Brennlampe, ein Erzeugnis modernster Konstruktion, und daneben eines jener schweren Lederetuis, in denen die kleinen Staubsaugermodelle transportiert werden. Hier hatte dieser glänzende Beutel zum Transport zweier Eisenflaschen gedient, und Herr Henderson verbreitete sich eben über ihren Zweck: sie seien mit dem modernen Disu-Gas gefüllt gewesen, mit dem der Fernholzbrenner gespeist würde. Eine ganz neue Erfindung, die das Mitschleppen der großen Sauerstoffballons überflüssig mache.
In einer Art Trance sah der Bankier die Menschen und die Gegenstände in dem hell erleuchteten Tresorraum an sich vorüberhuschen. Der Verlust der anderthalb Millionen, die Sonnabend von der Reichsbank hereingeholt waren, um heute, am Letzten des Monats, den Ultimobedarf einer Kleinbahn, der Hauptkundin der Bank, zu decken, war gewiß schmerzlich. Doch die Diebstahlsversicherungen seiner Bank waren so ausreichend, so durchaus unanfechtbar, daß für die Firma auf keinen Fall ein allzu großer Verlust entstehen konnte. Nein, was den Konsul so schwer bedrückte, was in ihm diese widerwärtige Empfindung hervorrief, als schmecke er Blut, das war der tote Mensch dort vor ihm auf der Erde. Und in dieses grausige Bild mischte sich ein anderes. Er hörte die Stimme seiner Tochter, die ihn bat: »Du darfst mich jetzt nicht fragen, Papa, ich kann heute nichts sagen!« – Was verbarg sich hinter dieser Weigerung ...? Die Furcht vor einem Menschen ...? Aber wer durfte seinem Kinde etwas anhaben ...? Hatte sie selbst etwas Unrechtes begangen? – Nein, er kannte Marions stolze, freie Seele! Hatte sie etwas getan, was unrecht war, so hätte sie auch den Mut gefunden, es einzugestehen.
»Was ist nun eigentlich hier vorgegangen, meine Herren?« wiederholte der Konsul seine Frage.
In diesem Augenblick kam noch jemand die kurze Treppe herab und drängte sich zwischen den Beamten durch. Herr Henderson ging ihm entgegen und sagte vorstellend:
»Sanitätsrat Rangower, unser Polizeiarzt.«
Ein kleiner, nicht sehr adrett gekleideter Herr von fünfzig Jahren mit buschigem Schnauzbart, der einen schwarzumrandeten Kneifer vor die Augen drückte, sofort die grüne Decke wegzog und, neben dem Toten in die Knie gehend, den Körper und das Gesicht musterte.
Er fühlte flüchtig den Puls, behorchte die Herzgegend und sagte mit heftiger Stimme:
»Herzschlag ... gar kein Zweifel«, er lauschte nochmals an der Brust, »sogenannter Betriebsunfall ...! Is mausetot, der Mann!«
Herr Henderson schüttelte ungläubig den Kopf.
»Aber wieso ...? Wie soll er denn – hier 'n Herzschlag gekriegt haben?!« Doktor Rangower sprühte ordentlich vor Sarkasmus: »Das is ganz einfach Arbeiterrisiko bei der Nachtschicht, Herr Oberregierungsrat!«
Henderson schien ärgerlich, aber er überwand seine Verstimmung und meinte nun seinerseits ironisch:
»Natürlich! Wer so befreundet ist mit dem Herrn Tod wie Sie, Doktor, der muß ja alle Scheu vor ihm verlieren!«
Der Sanitätsrat Rangower stand auf und drehte sich um:
»Danke bestens! Übrigens kann ich hier weiter nichts tun ... kommt ja später zur Obduktion, der Knabe, habe heute auch noch zu viel anderes vor!«
Und er ging, ohne sich um irgend jemand zu kümmern, durch den Kreis der Herren und verschwand auf der Tresortreppe.
Der Oberregierungsrat lächelte und wollte den Sanitätsrat, der im übrigen ein ganz vorzüglicher Arzt wäre, entschuldigen. Doch Konsul Lindström sah mit zerstreutem Blick an den Anwesenden vorbei:
»Mich entschuldigen Sie wohl auch für eine Weile, lieber Henderson ... ich muß mich erst wieder ein bißchen zusammenfinden. Außerdem warten meine Herren oben auf mich mit der Post ...«
Und er ging langsam die Treppe hinauf nach den Bankräumen.
Dort stand er noch und sprach ein paar Worte mit dem Vorsteher der Wechselkasse, als die Eingangstür förmlich aufgerissen wurde und ein großer, gebückt gehender Herr unsicheren Schrittes schnell hereinkam. Der Mann war leichenblaß, und als er eben den Hut abnahm, sah man das dichte weiße Haar, das unordentlich um den Kopf hing. Sein Winterpaletot stand offen, in der Eile und Aufregung hatte er sogar vergessen, die Krawatte zu binden, deren beide Enden herabhingen.
Konsul Lindström trat ihm entgegen:
»Aber lieber Herr Reese! Um Gottes willen, was ist denn mit Ihnen?!«
Der Hauptkassierer konnte nicht sprechen. Der Konsul nahm ihn unter den Arm und begleitete ihn die breite Treppe hinauf, die in die obere Etage der Bank führte.
»Ich kann es ja verstehen, lieber Freund, daß Sie sich darüber aufregen, aber schließlich trifft Sie doch keine Schuld. Es ist natürlich ein Unglück für die Bank und für jeden von uns ... das obendrein noch ein Menschenleben gekostet hat ...«
Nichts weiter als ein trockenes Schluchzen kam aus der Kehle des Hauptkassierers.
»So beruhigen Sie sich doch nur ...! Wollen Sie vielleicht wieder nach Hause fahren, lieber Reese? Wir kommen auch so aus ... außerdem habe ich schon an Ostermann telegrafiert, der seinen Urlaub natürlich unterbrechen muß ... Ich erwarte ihn heute noch.«
Der Hauptkassierer sah seinen Chef aus verstörten Augen an:
»Anderthalb Millionen Mark ... anderthalb Millionen ... und die Schlüssel ... die Schlüssel ...«
Er machte sich vom Arm des Generaldirektors los und lief fahrig mit seiner langen mageren Gestalt den Korridor hinab, der nur gedämpftes Licht aus den Deckenlampen erhielt.
Der Konsul war stehen geblieben und wartete auf den Lehrling Winter, der beflissen näher trat:
»Herr Reese hat sich furchtbar aufgeregt, als er es hörte. Ich dachte schon, er würde ohnmächtig werden Fräulein Gertrud kommt auch gleich.«
Der Konsul nickte:
»Es ist gut, Winter, gehen Sie man an Ihre Arbeit.«
Der junge Mensch verneigte sich in dem Gefühl seiner Wichtigkeit. Nachher, während der Frühstückspause, da würde er den Kollegen, die sonst immer auf ihn herabsahen, als wenn er gar nichts wäre, mal was erzählen!
Indem kam Gertrud Reese. Sie war ein Mensch, auf den man sich verlassen konnte. Hermann Reeses Tochter war schon ein paar Jahre in der Bank tätig und jetzt Privatsekretärin des Generaldirektors. Der Konsul kannte sie von Kind auf, er nannte sie heute noch »du« und »Trudchen«, so daß sie von jedem in der Bank »Fräulein Gertrud« gerufen wurde.
»Papa ist schon oben?« fragte sie. »Ach, Herr Konsul, er hat sich entsetzlich aufgeregt, als der Winter kam. Und war schon so fruchtbar niedergedrückt ... Willis wegen ...«
Der Konsul sah sie fragend an, sagte aber nichts. Sie gingen nebeneinander den breiten Korridor hinauf. Der Plüschläufer dämpfte das Geräusch ihrer Schritte, und dem Konsul war, als ob dieser matt erhellte Gang sich in schattenhafte Angst und Unsicherheit verlor.
Rudolf Lindström konnte nicht weitergehen. Ganz unmöglich, daß er jetzt mit diesem zerbrochenen Menschen, dem Reese, über das Verbrechen sprach. In dieser Stunde war er nicht wie sonst imstande, Mitgefühl für andere aufzubringen. Er suchte selbst nach einer Seele, die ihm helfen und ihn stützen konnte, Er sah Gertrud mit einem langen Blick an und wandte sich rückwärts:
»Ich muß noch einmal nach unten ... geh du zu deinem Papa und sieh, daß du ihn ein bißchen beruhigst.«
Das Mädchen bewegte die vollen Lippen, als wollte sie etwas erwidern, aber dann nickte sie nur und ging weiter den Gang entlang.
4
Kommissar Starkmann war mit Wachtmeister Vogel und Assistent Nebeltau um die Ecke nach dem Harlemer Platz gegangen. Sie wollten durch den zweiten Eingang des Hauses über den Hof in den Heizkeller. So blieben Herr Henderson und Doktor Splittericht allein im Tresorraum.
Sie hatten auf zwei Hockern Platz genommen, und der Chef der Kriminalpolizei steckte sich noch eine von den schweren Zigarren an, die er entgegen dem Rat seines Arztes vornehmlich dann gern rauchte, wenn eine besonders schwierige Aufgabe seinen Geist beschäftigte.
Doktor Splittericht war der Vertraute des ungemein rechtlichen und tüchtigen Henderson gewesen, solange er im Kriminaldienst stand. Als es ihm mit den Jahren immer schwerer wurde, sich in den Beamten-Rangstaat einzuordnen, litt es ihn nicht länger bei der Behörde. Sein Ruf war auch in Privatkreisen so groß, daß er als Detektiv das Zehnfache seines Beamtengehaltes verdiente. Dabei zog ihn die Kriminalpolizei noch jetzt bei besonderen Gelegenheiten gern zu Rate.
Die Herren saßen eine Weile schweigend beieinander. Zarte blaue Wolken zogen von der großen Zigarre des Oberregierungsrates durch den Raum, bis Splittericht auf einmal sagte:
»Wenn ich nur wüßte, wieso der Zalewski 'n Herzschlag gekriegt hat ...«
»Wird 'n Herzfehler gehabt haben, lieber Doktor!«
Splittericht nickte: