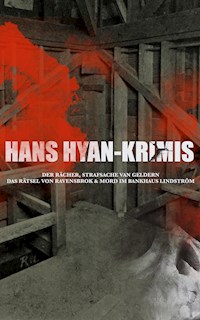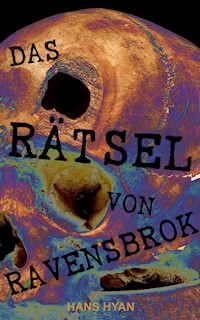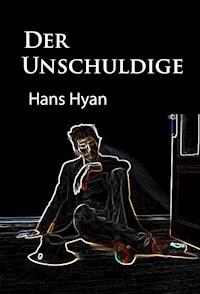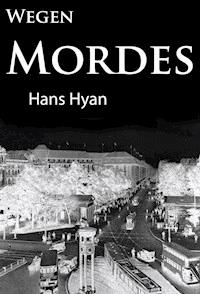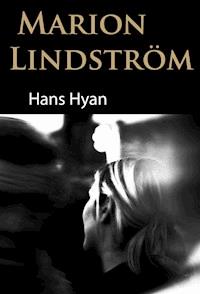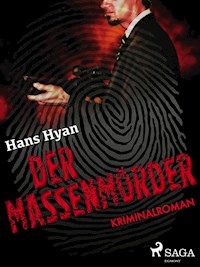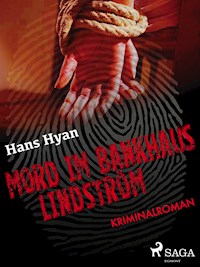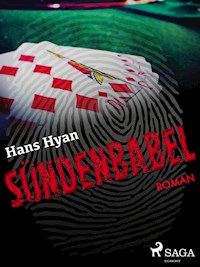
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein buntschillerndes Panorama der Großstadt Berlin: habgierige Geldverleiher treffen auf spielsüchtige Grafen, betrügerische Gräfinnen gehen Scheinehen ein, Kupplerinnen ziehen unschuldige Mädchen ins Verderben, illegale Spielklubs adliger Nichtstuer kommen ins Visier der Polizei, Kredithaie treiben ihr Unwesen – schließlich geschieht ein Mord. Findet in dieser durch und durch verdorbenen Welt trotzdem der junge Offizier Hans von Ballenstedt sein Glück und kann der hochverschuldete, auf Abwege geratene Graf Berghorst die brave Käthe Wunderlich zum Altar führen? Zum Autor: Hans Hyan (1868–1944) war ein deutscher Kabarettist, Gerichtsreporter und Schriftsteller. Er verfasste vor allem Kriminalromane, aber auch Drehbücher. Hyan besuchte das Gymnasium in Prenzlau, Brandenburg. 1901 hob er in Berlin das Kabarett "Zur Silbernen Punschterrine" aus der Taufe, das bis 1904 bestand. Hyan war liberal und sozialkritisch eingestellt. Diese Haltung schlug sich auch in seinen zahlreichen Kriminalromanen nieder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Hyan
Sündenbabel
Roman
Saga
I. Eine vornehme Hochzeit.
In dem grossen Saal, durch dessen weitgeöffnete, mit feinen Stores verhangene Fenster der Märzabend seinen milden Atem hereinblies, wurde ein glänzendes Fest gefeiert.
Kam man von der Tür herein, so sah man zuerst nichts als ein Gewoge und Geflimmer von blendenden Lichteffekten und buntglänzenden Farben.
Die reichen und verwöhnten Menschen, die sich hier zu einem opulenten Mahl versammelt hatten, liebten es nicht, sich von den eindringlich hellen Flammen des mächtigen Kronleuchters überschütten zu lassen, der an der Decke hing. Nur hohe Ständerlampen warfen ihr von gelben Seidenschleiern gedämpftes Licht über die Tafel. Und dazwischen, ebenso wie an den Wänden, duftende Wachskerzen, die in silbernen Armleuchtern brannten und deren Flammen durch rote Schirmchen geschützt waren.
So lag der in matter Farbe tapezierte Raum in einem goldigen Dämmerlicht, und mit dem Duft der Blumen, die in feinen Glaskelchen vor jedem Gaste standen, mischten sich die teuren Parfüms, die gleich unsichtbaren Wölkchen über den reichen Toiletten der Frauen schwebten.
In allen Altersstufen waren sie vertreten unter den vielleicht fünfzig Personen, die sich lachend und mit von der Glut des Weines belebten Wangen unterhielten.
Aber die Jugend herrschte doch vor, und die Schönheit der einzelnen erschien doppelt reizvoll, weil die kostbarsten Toiletten diese herrlichen Gestalten umschmiegten, weil Samt und Seide hier mit dem Schmelz der weissen Schultern wetteiferten und weil man nicht wusste, ob man das Feuer all der seltenen Edelsteine, die diese Damen schmückten, oder den Glanz und die Glut so vieler schöner Augenpaare mehr bewundern sollte.
In diesem Moment erhob sich ein Herr, der als einziger unter all den schwarzgekleideten Männern einen Frack aus feinem roten Tuch mit goldenen Knöpfen trug.
Es war ein beliebter Humorist und Schriftsteller, ein Bekannter des Hauses, der wohl zu den Intimen gehörte und es daher selbst heute wagen durfte, in einem so aussergewöhnlichen Kostüm zu erscheinen.
Und wie Herr Bruno Siegwart, der Schriftsteller, nun, dar Sektglas erhebend, seine mit witzigen Pointen reich gewürzte Rede begann, wie er, sich ein wenig vorbeugend, zu der ihm gegenübersitzenden Dame, der das heutige Fest galt, sprach, da verstummte das Gläserklingen, das Geräusch der lachenden und flüsternden Lippen allmählich, denn alles hörte gespannt zu, und die schöne Frau selbst stützte den klassisch geformten Arm auf die Lehne ihres Fauteuils und lauschte behaglich auf die Worte des geistvollen Schmeichlers dort drüben.
Seit zwei Stunden hiess sie Maria Anna Gräfin von Berghorst. Ihre kaum mehr als mittelgrosse Gestalt, die den vollen Zauber des reifen Weibes atmete, umschloss ein Kleid aus schwarzer Seiden-Panne, jenem dünnen, geplätteten Samtstoff, dessen Lüstre ohnegleichen ist, dessen weichschimmernder Glanz sich wie Schlangenhaut um blühende Formen spannt. Die Taillenärmel fielen an den Ellenbogen in weisse Crêpe de Chine-Puffen aus, und aus dem, der feierlichen Gelegenheit angepassten sehr diskreten Halsausschnitt erhob sich sinnverwirrend ein Nacken, den grosse, an einer kaum sichtbaren Goldkette aufgereihte Brillanten umstrahlten.
Und jetzt, wie sie ihre grossen, südländisch dunklen Augen zu dem Sprecher aufschlug, da sprühte aus diesem stolzen und doch wieder lieblichen Gesicht eine solche Fülle von Lebensdrang und Genusssucht, dass der feine Spott auf den Lippen des Rotbefrackten erstarb, dass nichts mehr als aufrichtige Bewunderung in seinem Auge lag, als sein und der Gräfin Glas aneinanderklangen.
Alsdann erhoben sich, wie es bei solchen Gelegenheiten üblich, die Gäste aus den weichen Polstern der himbeerfarbenen Fauteuils und kamen herbei, um mit der jungen Gattin und ihrem Gemahl, einem von oben herabblickenden Aristokraten, der ein auffallend grosses Monokel in seinem jungen, blasierten Gesicht trug, anzustossen.
Vor der Gräfin selbst stand in diesem Augenblick ein junger Mann in der Offiziersuniform des Potsdamer Garderegiments von auffallend grosser, kräftiger Figur, der den Worten der Dame mit höflich geneigtem Kopf lauschte.
In den Augen der Frau lag, während sie rein gesellschaftliche Phrasen mit dem jungen Manne wechselte, ein undenklich schmachtender Ausdruck. Und wäre jemand dabei gewesen, der wohl sehen, aber nicht hören konnte, er hätte gewiss nicht anders geglaubt, als dass diese soeben in den heiligen Stand der Ehe getretene Dame ihr Herz und vielleicht noch etwas mehr diesem stattlichen jungen Manne entgegenbrachte, den die Uniform so brillant kleidete.
„Wir werden nach einer kurzen Pariser Reise längere Zeit hier verweilen,“ sagte die Gräfin, in deren Stimme so viel verhaltene Glut und Innigkeit bebte, dass der Leutnant innerlich, wie vor etwas Brennendem, zurückschrak.
Mit Sekundenschnelle trat wieder der Salon vor sein geistiges Auge, der kleine, ganz in Tiefgrün dekorierte Salon, in dem er die junge Frau zum ersten Male gesehen hatte. Graf Berghorst selbst hatte ihn eingeführt, war dann aber, um, wie er sagte, einer wichtigen Verabredung zu folgen, bald fortgegangen und hatte den jungen, im Verkehr mit Frauen stets sehr schüchternen Offizier mit seiner Braut allein gelassen.
Die Gesellschafterin, eine ihrer Herrin augenscheinlich sehr ergebene Person, hatte selbst den Tee serviert, und sich dann wieder zurückgezogen.
Und während von Ballenstedts Blick über die grossen, schlanken Blumenmuster glitt, die sich in zartfarbigen Linien von dem tiefen Oliveton der mit englischem Samt bezogenen Möbel abhoben, war er anfänglich nur schwer imstande gewesen, seine Befangenheit zu verbergen. Das Licht quoll so träumerisch sanft unter den Seidenfransen des merkwürdig geformten Lüstres hervor, ein kleines Seidenäffchen hockte in der grünlichen Dämmerung des Kamins auf seiner Stange und knabberte mit den scharfen Zähnen an einer Nuss.
Wie einmal eine längere Gesprächspause eintrat, glaubte der Leutnant die junge Frau heftiger als sonst atmen zu hören.
Es war still, so still in dem grossen Gemach, an dem allerorten die reichen Stoffe in schweren Falten zu Boden fielen, und ein Duft, ein ganz absonderliches, geradezu berauschendes Parfüm ging von der schönen Braut des Grafen Berghorst aus. Hans von Ballenstedt, der seine sonst laute Stimme diesem diskreten Raum angepasst, hatte plötzlich wieder lauter zu sprechen angefangen.
Er wollte sich mit diesen lauten Worten wehren gegen die Heimlichkeit dieses Beisammenseins und gegen die süsse, sanfte Betäubung, welche aus den Kleidern und den Händen der schönen Frau auf ihn einzuströmen schien.
Gerade wie jetzt hatte er auch damals nicht gewagt, sein Gegenüber lange anzusehen. In den nachtleuchtenden Augen lag etwas, worüber sein naives Gemüt sich nicht klar zu werden getraute. Er fand sie schön und entzückend, aber der Gedanke, dass da ein Liebesbaum sich über ihm wölbte, dessen reife Frucht er nur zu pflücken brauchte — der Gedanke war ihm nicht gekommen ...
„Ich hoffe, dass Sie mir dann Gelegenheit geben werden, unsere zwar noch neue, aber doch so reizend begonnene Bekanntschaft fortzusetzen ... ich lade Sie heute schon ein, uns recht oft zu besuchen! ... Nicht wahr, Herr Leutnant, Sie werden meiner Aufforderung Folge geben?“
Hans von Ballenstedt verneigte sich tief.
Aber wenn er hätte wiederholen sollen, was die Gräfin Berghorst soeben zu ihm gesprochen hatte, so wäre er in Verlegenheit geraten.
Jenes eigentümlich helle, glockenhelle Lachen, das ihm am heutigen Tage schon so oft ins Ohr geklungen, war in diesem Moment wieder laut geworden und, ob er wollte oder nicht, Hans von Ballenstedt musste hinübersehen zu der kleinen Elfe, die so kindlich lachte, deren Augen so rein und unschuldig blickten und die ihrer Tante, der Gräfin Maria Anna von Berghorst, trotzdem so ähnlich sah.
Und sie hatte eine Art, zu sprechen und sich zu geben, wegen deren man sie allein schon lieben musste. So ohne einen Schatten von Falschheit und Arg war jede ihrer Mienen, das ganze Gesicht strahlte bei einer scherzhaften Bemerkung ihres Tischnachbars, und in der unbewussten Koketterie, mit der sie dann ihr Köpfchen wie im leisen Zweifel seitwärts neigte, lag ein Charme, eine Anmut, — selbst ein Zyniker hätte sich dieser lieblichen, unschuldigen Jugend beugen müssen.
Sicherlich war Luzie Petersen ihrem Empfinden nach noch ein Kind. Aber mochte es in der Rasse liegen, oder war der Reichtum und die immer gleich gute Pflege daran schuld, diese Kindesseele steckte in einem Körper, der wie eine kräftig entwickelte Blumenknospe all seine zarten Reize soeben zu enthüllen begann.
Ihr kleiner Erdbeermund stand nicht still, und das Gefühl eines stillen Neides beschlich den Leutnant darüber, dass er nicht an der Stelle des geschniegelten Referendars sass, der die kleine, in seegrüne Seide mit gesticktem Tüllüberwurf gekleidete Schönheit während des Diners unterhalten durfte.
Aber Hans von Ballenstedts Blicke hatten zu lange an dem zarten Profil Luzies, dessen antikes Ebenmass der hochblonde griechische Knoten vervollständigte, gehangen, als dass nicht die vor ihm sitzende Gräfin darauf aufmerksam geworden wäre.
Und indem sie sich über die Richtung seines Blickes klar wurde, ging eine merkwürdige Veränderung in ihrem brünetten Antlitz vor; die Falte zwischen den starkgezeichneten Augenbrauen verstärkte sich, die vollen, purpurroten Lippen pressten sich fest aufeinander und die dunklen Augen flogen wie Wetterstrahlen zu der Blonden hinüber, welche in nichtsahnender Fröhlichkeit mit ihrem Kavalier scherzte.
Alles das ging mit Sekundenschnelle vor sich. Als Hans von Ballenstedt sich wieder auf sich selbst und diejenige, der er gegenüberstand, besonnen hatte, als er ihr mit lächelndem Munde — unter seinem dichten, braunen Schnurrbart blitzten dabei die grossen, weissen Zähne — sagte, wie sehr er sich freue, und wie er die Zeit herbeisehne, wo er sich ihr das nächstemal vorstellen dürfe, da war auch die Gräfin Anna Maria wieder ganz die huldvolle, gütig lächelnde Weltdame, deren Mienen im Glücke der vollsten Zufriedenheit leuchteten.
Dann kamen andere, die ihren Champagnerkelch an den der neu kreierten Gräfin klingen lassen wollten.
Leutnant von Ballenstedt wurde fortgeschoben, aber ehe er wieder auf seinen Platz ging, blieb er einen Augenblick vor dem von rotgoldenen Lichtreflexen überhauchten Wandspiegel stehen, und das trotz seiner Jugend schon so ernste und männliche Gesicht bekam einen tiefzärtlichen Schein, als er im Spiegel das süsse Antlitz derjenigen lachen sah, die er heute hier zum erstenmal erblickt, und die doch sogleich sein Herz in leidenschaftliche Begeisterung hatte hoch auflodern lassen.
Vergeblich sann er, wie er bei diesem Diner, dem ein Tanz oder sonstige Festlichkeit nicht folgte, die Bekanntschaft der jungen Dame machen könnte.
Er war ihr wohl vorgestellt worden, aber bei der langen Reihe von Namen und Personen, die heute an dem jungen Mädchen vorübergezogen waren, hatte Luzie Petersen ihn wohl kaum bemerkt ... Hans von Ballenstedt lächelte über sich selbst; Tor, der er war, zu glauben, dieses schöne, reiche und vielumworbene Mädchen würde, sobald er sich nur etwas eingehender mit ihr beschäftigte, seine Neigung erwidern!
Und er wollte, wütend auf sich selbst, sich eben wieder nach der Tafel umdrehen, als eine Hand leise seine Schulter berührte und jemand flüsternd sagte:
„Ich wollte mich nur von Ihnen verabschieden, Herr Leutnant, ich gehe jetzt ...“
Es war ein Berichterstatter der „Unpolitischen Nachrichten“, ein Dr. jur., der sich der journalistischen Karriere zugewandt und den der Leutnant kannte, da er als Einjähriger bei seinem Regiment gedient hatte während der Zeit, als der jetzige Leutnant noch Fähnrich war.
Hans von Ballenstedt war konservativ erzogen und hatte bisher nicht viel von der Presse und ihren Vertretern gehalten, aber diese Bekanntschaft mit Dr. Otto Pfeiffer, in dem er einen ungewöhnlich intelligenten und gebildeten Menschen kennen lernte, hatte ihn ein wenig von seiner Ansicht abgebracht.
„Wollen Sie mich mitnehmen, lieber Doktor? ... Ich habe auch genug.“
Und indem sie scheinbar auf ihre Plätze zurückgingen, entfernten sich die beiden Herren, ohne dass ihr Weggehen in dem Hin und Her der Gäste viel bemerkt worden wäre.
Wie sie aus dem Portal des Hotels hinaustraten und in dem Dämmer des Frühlingsabends, durch das die Flammen der Laternen so hilflos blinkten, die Linden hinabgingen, schwiegen sie anfangs alle beide.
Dann räusperte sich der Offizier und sagte, wie um eine unangenehme Empfindung loszuwerden:
„Ich weiss nicht, wie ich mir das selbst erklären soll, aber für mich hat die Geschichte trotz aller Vornehmheit der Namen und Toiletten doch etwas Protzenhaftes ... oder nein, das ist nicht der richtige Ausdruck! ... und den finde ich vielleicht auch nicht ... aber ich habe das Gefühl, als sei nicht alles so, wie es sein sollte! ...“
Der Journalist wiegte seinen Kopf, dem der schwarze Henriquatre einen etwas französischen Anstrich lieh, und blies leise die Luft durch die gespitzten Lippen aus.
Der Offizier sah ihn forschend an.
„Seien Sie mal offen zu mir, Doktor, und sagen Sie, was Sie von den Leuten halten ... Ich bin seinerzeit mit dem Grafen bekannt geworden, draussen beim Rennen in Hoppegarten. Ich weiss auch, dass er viel mit Offizieren verkehrt ... und habe eigentlich nie was Ungünstiges über ihn gehört ... er soll spielen, aber das tun die Kameraden ja fast alle ... sagen Sie mal, Herr Doktor, wissen Sie was Genaueres?“
„Darf ich fragen, wie Sie mit der Gräfin bekannt geworden sind?“ fragte der Journalist statt einer Erwiderung.
„Ganz einfach, der Graf hat mich seiner Braut vorgestellt ... vor vierzehn Tagen etwa. Ich bin auf mehrfache Aufforderung zweimal dagewesen und kann nichts anderes sagen, als dass ich mich brillant unterhalten habe ...“
Hans von Ballenstedt stockte und wollte augenscheinlich noch etwas hinzusetzen, ohne dass er sich recht dazu entschliessen konnte.
Otto Pfeiffer überlegte unterdessen mit der ihm eigenen Schnelligkeit im Denken die Situation: gewiss, er wusste so manches über das neuvermählte gräfliche Paar! Aber was doch nur gerüchtweise an sein Ohr gedrungen war, hatte er ein Recht, das weiter zu erzählen? ... Wenn die Fama sich nun irrte und der in der Tat wenig schöne Handel, von dem man ihm berichtet hatte, eine Verleumdung war?
Nein, er wollte vorläufig wenigstens Stillschweigen bewahren! Erfuhr er später Näheres über die Geschichte und bewahrheitete sich das Gehörte, so war es noch immer früh genug, auch dem ihm befreundeten Leutnant, für den er ein entschiedenes Interesse hegte, davon Mitteilung zu machen und ihn vor einem Verkehr zu warnen, der seine Stellung als Offizier gefährden konnte.
Hans von Ballenstedt, der sich ebenfalls mit seinen Gedanken beschäftigte, sagte jetzt mehr von innen heraus, als in der Absicht es auszusprechen:
„Nein, das kann ich mir doch nicht denken, sie macht einen so guten, kindlich reinen Eindruck ... so sehr kann man sich nicht täuschen! ...“
„Wen meinen Sie?“ fragte der Journalist, „die Gräfin Berghorst?“
Hans von Ballenstedt schüttelte energisch den Kopf.
„Nein, nein, ihre Nichte ... das blonde junge Mädchen im grünen Tüllkleide, das links von Ihnen neben dem Referendar Lessen sass.“
Der Journalist war zart genug, den jungen Offizier, der sich in einiger Verlegenheit befand, in diesem Moment nicht anzusehen.
Sie wechselten dann noch einige allgemeine Redensarten; plötzlich aber blieb der Gardeleutnant stehen, drückte seinem Begleiter freundschaftlich die Hand und empfahl sich.
Mit einem feinen Lächeln ging der Journalist nach der entgegengesetzten Richtung zu. Um ein paar nette Bildchen für sein heutiges Feuilleton war ihm nicht bange.
II. Vampyre.
Nicht lange, nachdem Hans von Ballenstedt die Tafel verlassen hatte, empfahlen sich auch Braut und Bräutigam.
Die heut Vermählten hatten sich jede Begleitung zum Bahnhof ausdrücklich verbeten, und als das von zwei raschen Pferden gezogene Kupee davonfuhr, hatten die jungen Eheleute vollkommen Musse, sich ihre Herzen gegenseitig auszuschütten.
Die Gräfin, die im Hotel Zeit gefunden hatte, ihre Toilette zu wechseln, trug jetzt einen seidenen Staubmantel, unter dem ihr Kleid, das aus lichtgrauem Tuch mit dunklen Applikationen gefertigt war, kokett hervorsah.
Dazu an Hals und Armen einen diskreten, altertümlich getriebenen Silberschmuck, zu dessen Inkrustierung man Saphire und Rubinen verwandt hatte, grosse durchsichtige, blau und rot leuchtende Steine von erlesener Schönheit.
Um die vollen Lippen der jungen Frau — denn jung war sie, trotzdem die Spuren raffinierter Toilettenkünste an ihr dem Eingeweihten nicht verborgen blieben —, um den brennendroten Mund schwebte ein Lächeln der Geringschätzung, das sie nicht einmal zu verbergen bestrebt war, als sie jetzt zu ihrem Manne sagte:
„Nachdem Sie Ihre Mission zu meiner vollen Zufriedenheit erfüllt haben, mein Herr, gebe ich Ihnen hiermit gern Ihre Freiheit wieder. Sie werden so gut sein und mich zum Bahnhof begleiten ... Und dann werden Sie, sobald als möglich, in einer anderen Richtung, deren Wahl Ihnen selbstverständlich vollkommen freisteht, Berlin ebenfalls verlassen ... So war es ausgemacht, und, nicht wahr, dabei soll es auch bleiben?“
Graf Berghorst, der während dieser Rede etwas nervös die Schnur seines Monokels zwischen den Fingerspitzen wirbelte, nickte zustimmend.
Dann warf er das Glas ins Auge — ein Auge, in dem, wie häufig bei Nachtschwärmern und Spielern, ein unstetes, scheues Glitzern war, und sah die junge Frau an, als wolle er sie etwas fragen.
Aber die Gräfin kam ihm zuvor.
„Was die Erfüllung unserer sonstigen Bedingungen anlangt, mein lieber Graf, so hatte ich anfänglich die Absicht, die Angelegenheit aus leichtbegreiflichen Gründen durch meinen Anwalt ordnen zu lassen. Da ich jedoch bei näherer Überlegung jedes Hineinziehen einer dritten Person tunlichst zu vermeiden wünschte und mir ausserdem denken kann, dass eine Verzögerung gerade dieses Teiles unserer Abmachungen Sie peinlich berühren würde —“
Die Gräfin hatte währenddem eine kleine Tasche aus rotem Corduan geöffnet und ihr ein Kuvert entnommen.
„So bin ich so frei, Ihnen dies persönlich zu übermitteln ...“
Sie reichte dabei dem Grafen das Kuvert, das dieser mit einer leichten Verbeugung entgegennahm.
„Sie werden finden, lieber Graf, dass ich, ebenso wie Sie, mich meiner Verpflichtungen genau erinnere.“
Der Graf erhob seine grosse, gelbbehandschuhte Hand.
„Aber, ich bitte, meine Allergnädigste ... äh ... ich bin nur traurig, dass ich damit nicht auch wirklich von dieser reizenden Hand Besitz ergreifen darf!“
Sie zog schnell ihre Hand, die in einem silbergrauen Handschuh aus Sämisch-Leder steckte, zurück — so schnell, dass es fast den Anschein hatte, als wolle sie die Rechte des Grafen nicht gern unnötigerweise berühren.
Er übersah das absichtlich, aber seine Stimme hatte einen spitzigen Ton, als er hinzusetzte:
„Nun, Sie werden doch nicht leugnen können, meine Verehrte, dass eine Situation, wie die unsere, jedenfalls sehr ... äh ... hm ... wie soll ich mich denn da ausdrücken? ... na, jedenfalls sehr eigenartig für beide Teile ist!“
Sie fasste ihn darauf abermals scharf ins Auge und ihre schweren, schwarzen Brauen rückten wie in innerlicher Entrüstung dicht zusammen. Aber sie liess seine Bemerkung unerwidert.
Er selbst schwieg auch, und man sah es dem bleichen Gesicht mit der grossen Hakennase deutlich an, wie sein Besitzer sich ärgerte. Dann nahm er den Claque ab uno fuhr sich mit dem weissen Seidentuch über die bedenklich verlängerte Stirn, um schliesslich doch mit der Bemerkung herauszuplatzen:
„Wenn ich mich nun jetzt plötzlich in Sie verliebte, meine Gnädige, und mich zu dem zweiten Teil unserer Abmachungen, wie Sie das so überaus zutreffend ... Äh ... zu nennen belieben — wenn ich mich nun damit jetzt nicht mehr einverständen erklärte, was dann?“
Die Gräfin hatte ihn ruhig ausreden lassen. In die braunen Ripspolster des Kupees lässig zurückgelehnt, betrachtete sie ihn mit ihren dunklen Augen, die hart und voller Verachtung auf seinem von Ärger leicht geröteten Gesicht ruhten.
„Ich habe Sie bis jetzt für einen Mann gehalten, dem sein Kavalierswort heilig ist, mein Herr.“
Sie betonte jedes Wort deutlich und lächelte dabei, ein kaum bemerkbares, aber desto vernichtenderes Lächeln.
„... und ich werde damit fortfahren, bis Sie selbst mir die Beweise vom Gegenteil liefern ... ausserdem aber ...
Sie betrachtete jetzt ihre wohlgeformten, für eine Frau aber auffallend kräftigen Hände.
„... ausserdem bin ich auch ein wenig orientiert über die glänzende Gewandtheit, mit der Sie, Herr Graf, das Geld unter die Leute zu bringen verstehen ... ich glaube, ich kann den Zeitpunkt in aller Ruhe abwarten, wo Sie selbst auf Scheidung unseres heut geschlossenen Ehebündnisses dringen werden, um die zweiten hunderttausend Mark zu bekommen.“
Und sie lachte so herzlich, dass ihre klugen, energischen Züge einen Anflug von entzückender Munterkeit bekamen.
Er sah ein, dass es für ihn nichts Vernünftigeres geben könne, als in dieses Lachen einzustimmen, und da der Wagen inzwischen den Anhalter Bahnhof erreicht hatte, so fragte er galant, ob er ihr noch irgendwie bei der Unterbringung des Gepäcks behilflich sein könne.
Sie verneinte.
Ihre Gesellschafterin sei am Bahnhof. Die Koffer, welche sie in Paris zuerst brauchte, seien der Sicherheit halber schon vor mehreren Tagen vorausgeschickt worden. Das übrige besorge ihr Intendant, dem sie, wie immer, die Regelung ihrer Angelegenheiten in ihrer Abwesenheit anvertraut habe.
Mit einem Seufzer verglich der Graf sein eigenes unstetes Leben und seine nur dem äusseren Schein nach geordneten Verhältnisse mit dem wirklich vornehm arrangierten Haushalt dieser Millionärin.
Aber viel zu wohlerzogen, um sich seinen Neid und Ärger äusserlich auch nur im geringsten anmerken zu lassen, öffnete er den Schlag des jetzt eben am Bahnhofsportal haltenden Wagens und half seiner Gemahlin beim Aussteigen.
Die Nacht war inzwischen hereingebrochen. Der Askanische Platz lag im Flimmer der Laternen, unter denen die dunklen Schatten der Passanten sich bewegten. Auf den Bänken der Anlagen sassen ausruhende Arbeiter und Pärchen; auch die Armen, die weder Geld noch Arbeit haben, lungerten dort in Menge umher. Und manches Auge sah neidisch herüber, wo im hellen Schein der Bahnhofslaternen die reichen Leute dem eleganten Gefährt entstiegen.
In der Wartehalle wurde Gräfin Berghorst von der Gesellschafterin, ihrer langjährigen Vertrauten, empfangen, einer älteren, sehr gemessenen Person von gediegen bürgerlichem Aussehen, die sich ihrer Herrin sofort anschloss, nachdem sie sich auch vor dem Grafen höflich verbeugt hatte.
„Meinen Gatten halten noch einige wichtige Besorgungen hier zurück,“ sagte die Gräfin, die dadurch zu erkennen gab, dass sie den Schein einer wirklichen Ehe in jedem Falle aufrecht zu erhalten strebte.
„Er hofft jedoch, dass er uns bald folgen kann! ... Nicht wahr, mein Freund?“
Etwas, von dem er selbst nicht wusste, was es heissen sollte, in seinen breiten, blonden Schnurrbart hineinmurmelnd, beugte sich der Graf und hauchte einen flüchtigen Kuss auf die Stelle des Handgelenks, die der etwas zurückgeschlagene Handschuh der Dame freiliess.
Dann empfahl er sich, als vollendeter Weltmann, den Zylinder in eleganter Pose etwas seitwärts haltend.
Aber während die Gesellschafterin bereits vorausschritt, beugte sich, schon im Gehen, die Gräfin noch einmal leicht zurück und sagte, nur für ihren Gatten hörbar:
„Wenn ich Ihnen noch einen Rat geben darf, mein Lieber, hüten Sie sich vor den Karten!“
Graf Berghorst schnitt eine Grimasse, als habe jemand sein vornehmstes Hühnerauge mit dem Stiefelabsatz in Berührung gebracht; dann drehte er sich, die rechte Gesichtshälfte zusammenkneifend und so das grosse Monokel ins linke Auge bringend, kurz um und schritt dem Ausgange zu.
Als die Gräfin neben ihrer Gesellschafterin über den Vorplatz schritt, um auf den Bahnsteig des Pariser Zuges zu gelangen, blieb sie einen Augenblick stehen.
Ihre Augen richteten sich auf einen Menschen, der ihr entgegenkam und vor dem sie, da auch sein Blick sie stark fixierte, mit einer instinktiven Gebärde den Schleier ihres Reisehütchens herunterliess.
Die grosse, in schlechter, abgerissener Kleidung steckende Gestalt dieses Mannes hatte wenig Vertrauenerweckendes.
Der finstere, schwarzbärtige Kopf, in dem die Augen so unruhig hin und her flogen, war auffällig klein und trug auf dem dunklen, kurzgeschorenen Haar eine sogenannte Wolkenschiebermütze.
Der Mann hatte eine Reisetasche aus schwarzem, abgerissenen Wachstuch in der Hand und schien auf dem anderen Bahnsteig, auf dem ebenfalls ein Zug hielt, fortfahren zu wollen.
Auch er hatte beim Anblick der Gräfin Berghorst, wie elektrisiert, den Schritt verhalten; als aber Maria Anna, einem leichten Ruck von der Hand der Gesellschafterin nachgebend, schnell weiterging, bewegte sich auch jener Mensch, wenn auch zögernd, vorwärts, und obgleich er sich mehrfach nach ihnen umsah, so hatten doch die beiden Frauen in wenigen Sekunden den Bahnsteig betreten und waren hinter dem dessen rechte Seite flankierenden Zuge verschwunden.
Als die Damen in einem Kupee erster Klasse sassen, das der Schaffner zum Dank für ein gutes Trinkgeld, solange wie es irgend anginge, für sie zu reservieren versprochen hatte, da fragte die Gesellschafterin, in deren erblassten Zügen noch immer ein ungläubiges Staunen und Erschrecken lag:
„War er’s denn wirklich, Marie?“
Die Gräfin nickte.
„Ja, da ist kein Zweifel, das war Fred Hunter!“
„Und glaubst du, dass er uns erkannt hat?“
„Sicherlich.“
Danach versank die Gräfin wieder in das Brüten, das sie in ernsten Lebensmomenten stets überfiel.
Und indem an ihrem umfassenden Geiste die Bilder ihres Lebens schnell vorüberzogen, mass sie die Entfernung zwischen ihnen ab, die Möglichkeiten, die das Einst und Jetzt miteinander zusammenstossen lassen konnten ....
Aber soviel sie sich mühte, die Erinnerungen, die so drohend sich herandrängten, zurückzustossen — sie bannte sie nicht, die schweren, schwarzen Wolken, die aus der Vergangenheit heraufzogen, und die ihre dunklen Schatten über den goldenen Strom warfen, an dem jetzt ihr Dasein blühte.
„Na, Herr Graf, wie ist es denn nun mit dem Provisiönchen?“
Graf Berghorst drehte sich um und sah bei dem ungewissen Licht der Laternen in das finnige und von einer rötlichen Bartfrese umrahmte Gesicht des Herrn Kretschmar, jenes Agenten, der ihm in Gemeinschaft mit noch zwei anderen Personen die Heirat mit Maria Anna Petersen vermittelt hatte.
Und gleichzeitig tauchten hinter diesem Herrn noch zwei andere Personen auf.
Eine etwas korpulente Frau im mit Pelz besetzten Seidenplüschmantel und mit einem schwarzen Federhut auf dem Kopf, dessen herabgelassener, dichter, weisser Schleier ihr Gesicht verdeckte. Und ein Mann im schwarzen Hohenzollernmantel, eine grosse deutsche Reckengestalt, mit langem, blondem Vollbart und den blauen Augen der alten Germanen, die allerdings ein wenig unsicher und vom Trinken gerötet schienen.
Graf Berghorst war förmlich zurückgeprallt bei dem plötzlichen Erscheinen dieser drei Leute, die ihm hier offenbar ebenso unerwartet als unerwünscht kamen.
Aber sofort erwachte in dem Aristokraten der hochmütige Stolz, der seiner Rasse stets zu Gebote steht, wo es sich um einen Konflikt mit niederstehenden Personen handelt.
Er trat einen Schritt zurück und fragte mit eisiger Stimme:
„Weshalb, wenn ich fragen darf, lauern Sie mir hier auf, halten Sie mich am Ende für Ihresgleichen?“
„Wie meinen Sie das, liebster Graf?“ meinte der Rotbärtige, dessen schmallippigen Mund ein höhnisches Lächeln umspielte.
„Wenn es Sie danach verlangt, will ich Ihnen die Erklärung nicht vorenthalten, Herrrr!“
Graf Berghorst erregte sich sichtlich, indem er mit diesem schon seinem Äusseren nach perfiden Menschen sprach.
„Bitte, bitte, genieren Sie sich gar nicht, Verehrter!“ höhnte letzterer weiter.
Aber nun legte sich der grosse, blonde Herr im schwarzen Kragenmantel ins Mittel und sagte:
„Lassen Sie doch Ihre spitzen Redensarten, Kretschmar, der Herr Graf wird es uns gewiss nicht übelnehmen, dass wir ihn hier erwartet haben ... mein Gott, jeder will doch sein Heu so bald wie möglich einbringen ... nicht wahr, Herr Graf?“
Er wandte sich mit einer chevaleresken Verbeugung an den Aristokraten.
„Sie verdenken es uns nicht, dass wir Sie bitten wollten, uns heute noch die Heiratsprovision auszuzahlen?“
„Jawohl,“ fiel jetzt die Dame ein.
„Darum wollten wir alle drei den Herrn Grafen ganz ergebenst gebeten haben. Denn erstens sind da die Vorschüsse, die wir dem Herrn Grafen verschafft haben und für die wir doch auch wieder haften müssen ... und dann hat uns die Zusammenbringung dieser Partie auch wirklich viel Mühe und noch mehr Unkosten gemacht ... schliesslich, nicht wahr, jeder Arbeiter ist doch seines Lohnes wert!“
Dem Grafen stieg der Ekel bis in die Kehle hinauf ... Das waren die Aasgeier, die auf seiner toten Ehre sassen und sich an ihr mästeten ... Er sah den Kretschmar an, der sich jetzt still verhielt, dessen bleiches, argwöhnisches Gesicht aber gespannt an jeder seiner Bewegungen hing, und er sah ein, dass er nichts Besseres tun könne, als so rasch wie möglich die Forderung dieser Leute zu befriedigen und sich ihrer Gesellschaft zu entziehen.
Wenn ihm jetzt einer seiner Bekannten begegnete! ... Welch eine Unvorsichtigkeit war es, sich mit diesen anrüchigen Leuten, die gewiss auch noch anderen ausser ihm bekannt waren, auf offener Strasse in lange Auseinandersetzungen einzulassen! Er suchte und fand eine Kaleschendroschke, die Raum für vier Personen bot.
Und die Herrschaften liessen sich denn auch nicht lange nötigen und stiegen ein.
Er selbst nahm unter dem hochgeschlagenen Rückverdeck Platz, so dass ihm jemand aus seinen Kreisen, der etwa vorüberging, nicht sehen konnte. Dem Kutscher hatte er zugerufen:
„Nach der Ackerstrasse 216!“
„Wieso nach der Ackerstrasse?“ fragte der misstrauische Agent.
„Ich habe dort etwas zu tun,“ erwiderte der Graf kurz.
„Na, aber ...“
Der Rotbärtige hatte etwas entgegnen wollen, überlegte es sich jedoch und fragte:
„Haben Sie denn das Geld, Herr Graf?“
„Ja, in einem Scheck.“
„Ach ’n Scheck! ...“ sagte die dicke Frau, die Leonore Tuto hiess und sich offiziell mit Heiratsvermittelungen befasste, während über ihre inoffiziellen Geschäfte niemand so recht orientiert war.
„Ein Scheck! ... Da sind wir ja noch so klug wie vorher ... heute ist doch keine Bank mehr offen!“
„Lassen Sie das nur,“ meinte der grosse Blonde — sein Name war Traugott Casparius, und er hatte sich als verkrachter Rittergutsbesitzer auf sogenannte Agenturgeschäfte gelegt, das heisst, er machte Hypotheken und Versicherungen, akquirierte auch Inserate und war, wie es hiess, wenig wählerisch in der Art der Unternehmungen, denen er seine Kräfte widmete.
„Lassen Sie nur, Frau Tuto, Herr Kretschmar und ich, wir kennen jemand, der uns auch heute abend noch den Scheck honoriert ... denn, nicht wahr, Herr Graf, Ihnen liegt doch auch daran, heute noch Geld zu sehen ... und auf einhundert Märkchen wird’s Ihnen dafür gewiss nicht ankommen?“
Graf Berghorst neigte zustimmend sein zweiunddreissigjähriges Haupt, dessen Haare von so manchem Sturm bereits stark gelichtet waren.
Und während er einige Worte an den früheren Gutsbesitzer richtete, der ihm aus jener Periode her vom Spieltisch bekannt war, wo Herr Casparius, wie er selbst sagte, den schönsten Teil seines Lebens zugebracht und den grössten Teil seines Rittergutes gelassen hatte — meinte der rothaarige Agent, dessen Stimme allein schon den Grafen in nervöse Unruhe versetzte, so leise, als spräche er zu sich selbst:
„Wenn ich nur wüsste, was der Herr Graf in der Ackerstrasse will!“
Der Graf überhörte das absichtlich.
Doch der Agent fuhr, in der offenbaren Absicht, von Berghorst zu einer Antwort zu reizen, fort:
„Wir haben doch wahrhaftig mehr zu tun, als dem Herrn Grafen bei seinen privaten Angelegenheiten Gesellschaft zu leisten!“
Kretschmar wandte sich dabei an die Tuto, und obwohl diese abwehrende Handbewegungen machte, setzte er hinzu:
„Ich schlage vor, wir fahren sofort nach der Fennstrasse ’raus zu Ephraim und sehen zu, dass die Geldsache sobald wie möglich in Ordnung kommt!“
Jetzt hielt der Graf nicht länger an sich, er wurde wütend.
„Nein!“ schrie er, „zum Donnerwetter, nein! Hören Sie denn nicht, was ich sage! Wir fahren nach der Ackerstrasse, und wenn Ihnen das nicht passt, so steigen Sie gefälligst aus! ... Ihre Gegenwart ist mir sowieso im höchsten Grade chokant!“
Mit dem Blick eines bösen, tückischen Tieres, aber ohne mehr als die blutlosen Lippen zu bewegen, starrte der Agent den Aristokraten an. Dieser Mensch war schlau, sehr schlau! Er wusste wohl, dass er nicht die geringste Handhabe hatte, den Grafen zu zwingen, dass dieser heute noch die Mitgiftsumme auskehrte. Deshalb schwieg er, aber in seinem Herzen schwur er dem Grafen heisse Rache und er war überzeugt, dass er früher oder später schon Gelegenheit finden würde, diesem alles mit Zinsen heimzuzahlen!
Der übrige Teil der Fahrt durch die hellen, menschenbelebten Strassen des Ostens ging fast ohne Unterhaltung vonstatten ... Diese vier Menschen hatten Wichtigeres zu tun, als zu plaudern.
Sie rechneten, wie viel für jeden von den Hunderttausend abfallen würde, und jeder, mit Ausnahme des Grafen vielleicht, hoffte den andern bei der Auszahlung übers Ohr zu hauen.
Als die Droschke in der Ackerstrasse hielt, sprang der Graf sofort leichtfüssig hinaus. Es war, als beflügele eine neue unsichtbare Gewalt seine Schritte. Aber er war kaum in dem matt erleuchteten Torweg des Hauses verschwunden, als auch schon der Agent die Droschke verliess mit den Worten:
„Vor allen Dingen werd’ ich mal untersuchen, ob das Haus auch nicht etwa einen zweiten Ausgang hat!“
III. Ein Kind des Volkes.
Atemlos, ein Rot der Hast und der inneren Erregung auf den sonst so aristokratisch farblosen Wangen, langte Graf Berghorst im vierten Stocke an.
Noch zitterten die Wogen des Unmuts über das Benehmen dieses Menschen da unten in der Droschke in ihm nach, den er viel zu sehr verachtete, um ihn zu fürchten.
Aber der Graf hatte nur nötig, an eine Tür zu klopfen und, als ihm geöffnet wurde, über eine Schwelle zu treten, um alles, alles zu vergessen, was ihn störte und bedrückte.
Mehr als dreissig Jahre waren vergangen, ohne dass es der Liebe gelungen wäre, dieses stolze Männerherz zu bezwingen!
Graf Berghorst wusste wohl, dass Frauenschönheit und Frauengunst dem Manne süss sei: durch braune, blonde und schwarze Locken war seine schmalfingrige Hand geglitten und in mancherlei Mundarten hatten rote Lippen ihm zugeflüstert:
„Ich liebe dich!“
Aber nie hatten solche Geständnisse und Liebkosungen sein Herz mehr als einen flüchtigen Augenblick schneller schlagen lassen.
Vielleicht hatte er das nicht gefunden, was die Leidenschaft in seinem Herzen ausgelöst hätte. Es war auch wohl möglich, dass das Spiel all seine Empfindungen und Gedanken so sehr in Anspruch nahm, dass nicht viel für Amors sanfte Triebe übrigblieb.
Und ihm, der den Luxus so selbstverständlich fand, dem ein Leben, das nicht mit allem Komfort des Reichtums umgeben war, ungeniessbar erschienen wäre — diesem Manne, der die seltensten Treibhauspflanzen kaum beachtete, war es vorbehalten, von einer Heckenrose so gefesselt zu werden, dass es ihn festhielt mit tausend Klammern, dass er niedersank vor ihr und mit scheuem Flehen um einen Blick ihrer sanften Augen, um einen Druck ihrer kleinen, arbeitharten Hände warb.
Was besass denn Käthe Wunderlich, dass sie diesen stolzen, hoffärtigen Charakter, den die eigene Mutter nie hatte bändigen können, mit einem einzigen Blick ihrer blauen Augen zur tiefsten Demut zwang?
Schön war sie doch eigentlich nicht.
Ihre blonden Flechten, die sie wie eine Krone ums Haupt gewunden trug, waren sicherlich das Allerschönste an ihr.
Ihr längliches Gesicht hatte, trotzdem ihre Arbeit sie täglich im engen Zimmer festhielt, eine frische, gesunde Farbe, und der hohe Wuchs ihres kräftigen, wohlgeformten Körpers gefiel jedem.
Aber das erklärte den tiefen Eindruck noch nicht, den sie auf den Mann ausübte, dessen Standesideale sicherlich in einer ganz anderen, viel komplizierteren Frauengattung ihre Erfüllung fanden.
Man musste mit Käthe Wunderlich sprechen, den bestrickenden Klang ihrer tiefen Altstimme hören, und man musste das seelenvolle Aufleuchten ihrer klarblauen Augen, ihres ganzen frommen Angesichts sehen, wenn sie sich an dem Gegenstand, von dem gesprochen wurde, erwärmte!
Sicherlich, ein Hauch von jenen Höhen, denen all unser Bestes immerdar zustrebt, war auch in diese einfache Menschenseele geflossen — ein Hauch, der denen entgegenwehte, die mit Käthe Wunderlich umgingen, der selbst den Verständnislosen Achtung und Bewunderung abnötigte.
Sie hatte an ihrem Arbeitstisch gesessen, als Graf Berghorst klopfte, und dorthin ging sie zurück, als sie ihm geöffnet hatte.
Auf der Platte des Tisches, über den eine einfache Schirmlampe ihr volles, gelbes Licht ergoss, lagen Seidenstreifen, schwarze und bunte von verschiedenem Muster. Daneben in einem Karton kleine blitzende, seltsam geformte Metallstückchen. Dann Schnallen, die einen blinkenden Hügel auf dem braunen Holze bildeten, und, etwas abseits in regelmässige Reihen gelegt, Herrenkrawatten zu Dutzenden.
Käthe erwarb ihr Brot mit Krawattennähen. Sie verfertigte die kleinen bunten, schwarzen und weissen Schleifen, „Diplomates“ genannt, welche die Herrenwelt unter dem Stehkragen über ihren weissen, gestärkten Chemisettes trägt.
Und da das Mädchen geschickte Hände und viel Geschmack besass, so wurde es ihr nicht schwer, sich auf eine anständige Weise zu ernähren.
Der Graf, der ihr bei seinem Kommen nur, wie einer Dame der grossen Welt, die Hand geküsst hatte, sass ihr jetzt gegenüber und sah zu, wie Käthes flinke Finger die bereits fertiggenähten Seidenstreifen zu verschieden geformten Schleifen banden, um sie alsdann mit raschen Nadelstichen zu befestigen.
Während sie dabei harmlos mit ihm plauderte, fühlte der Graf heimlich voll ängstlicher Bedrücktheit nach seinem Trauring, den er in die Westentasche gesteckt hatte.
Hier in der Nähe des angebeteten Mädchens lastete seine Verfehlung doppelt schwer auf ihm.
Dazu kam, dass er ihr heute zum ersten Male gegenüberstand als ein Mann, der seine Freiheit um schnödes Geld verkauft hatte, der im Augenblick wenigstens nicht mehr das Recht hatte, über seine Hand zu verfügen.
Er meinte auch, sie müsse ihm das ansehen.
Ihre heiteren unschuldigen Augen, die er auf sich gerichtet fühlte, brannten in seiner Seele, und nichts hätte er mehr gewünscht, als sich jetzt der Geliebten zu Füssen werfen zu dürfen, um ihr alles, alles einzugestehen.
Aber er wusste genau, sie würde sich dann erheben mit ihrer hohen aufrechten Gestalt, und ihm ruhig und ernst die Tür weisen — für immer!
Und das fürchtete er mehr als alles andere!
Deshalb sagte er nichts von dem, was sein Gemüt mit solch dumpfem Schmerz erfüllte; ja er log sogar, als sie ihn teilnehmend fragte, ob er Kummer habe, und verneinte die Frage lächelnd.
Dabei aber sah er sie immerfort an und verging vor Durst nach ihrem roten Munde ... einmal, einmal ja nur wollte er sie küssen ...
Oh, wer ihm das gesagt hätte, dass er so elend werden würde vor Sehnsucht nach diesen Lippen, damals an jenem Abend, als er sie zum erstenmal gesehen!...
Wie greifbar deutlich das alles plötzlich wieder vor seinem geistigen Auge stand!
Im Dezember war’s gewesen, als er wie gewöhnlich abends nach dem Klub zum Spielen fahren wollte.
Und seine Droschke hätte beinah — das erfuhr er erst später — ein Kind überfahren. Ja, der Kleine wäre sicher unter die Räder gekommen, wenn nicht im letzten Augenblick ein Mädchen zugesprungen wäre und das Kind zurückgerissen hätte.
Das Kind kam mit blossem Schrecken davon, die mutige Retterin aber war von einem Wagenrade erfasst und zu Boden gerissen worden.
Sie sah übel aus, die arme Käthe, aber es war ihr gottlob nichts Ernstliches geschehen, und sie hätte ihren Weg gewiss am liebsten still und unbemerkt fortgesetzt, wenn nicht die schnell zusammengeströmte Menge ihr allzu aufdringlich ihre Huldigungen dargebracht hätte, während sich natürlich gegen den Droschkenkutscher und den im Wagen sitzenden Grafen der ganze Unwille der Menge kehrte.
Dem letzteren hatte der Graf Berghorst allerdings schnell gesteuert, dadurch, dass er der herbeigeeilten und schimpfenden Mutter des Kindes — die Frau hätte eher Schelte verdient! — einen „blauen Lappen“ einhändigte ...
Er war gerade bei Kasse ... und, du lieber Gott! was kam’s ihm schon auf einen Hundertmarkschein mehr oder weniger an ... Als Spieler wird man es gewöhnt, das Geld so schnell kommen und gehen zu sehen, dass die Banknote selbst gar keinen Reiz mehr besitzt ...
Aber auf die armen Leute, die sich um ihn drängten, machte diese Freigebigkeit einen enormen Effekt! Dafür trat sogar das opfermutige Wagnis des jungen Mädchens in den Hintergrund, das, wie jemand unter den Zuschauern ganz offen sagte, „ja nicht mal was abbekommen hätte.“
Käthe Wunderlich verlangte auch gar keine Anerkennung für ihr Tun. Sie wäre still und zufrieden im Bewusstsein ihrer voll erfüllten Menschenpflicht nach Hause gegangen, wenn nicht der Graf selbst ihr seine höchste Anerkennung ausgedrückt und sie gebeten hätte, seinen Wagen zu benutzen, um nach Hause zu gelangen.
Mit einem Blick auf ihre über und über beschmutzte Kleidung hatte Käthe sein Anerbieten akzeptiert, und als der Graf dann ebenfalls einstieg und der Kutscher davonfuhr, waren die beiden Insassen der Droschke peinlich berührt worden durch ein paar recht unschöne Spässe, die sich der allzeit ulklustige Mob selbst bei dieser ernsten Gelegenheit nicht verkneifen konnte.
Vielleicht hatte der Graf auch wirklich, wie die Bemerkungen der Zurückgebliebenen andeuten wollten, im Anfang daran gedacht, er könne hier zu einer leichten Eroberung kommen.
Aber jedenfalls hatte er noch nicht viele Worte mit Käthe Wunderlich gewechselt, als von Berghorst wohl erkannte, er täte gut daran, jede derartige Absicht im Keime zu ersticken.
Der ernste Sinn des Mädchens liess für solche Liebelei gar keinen Raum. Und ehe sich der Graf noch von seinem Staunen über dieses seltsame Menschenkind erholt hatte, das seinen Mitschwestern so gar nicht ähnlich sah, mit dem man wie mit einem Manne reden konnte und das bei all seiner Vernunft doch wieder von einer kaum glaublichen Naivität war — noch ehe sich Graf Berghorst über dieses liebliche Naturwunder so recht klar geworden war, hatte ihn schon eine tiefe Neigung für dieses Mädchen erfasst, eine Neigung, die sich mit jedem Zusammensein steigerte und die zu immer höher aufflammender Leidenschaft wurde, je weniger Käthe sie erwiderte.
Denn in der Tat deutete nichts im Benehmen der Krawattenarbeiterin darauf hin, dass Graf Berghorst ihrem Herzen näher stand als andere Männer.
Sie war lieb und freundlich zu ihm. Wenn er kam, stand eine Tasse Tee für ihn bereit, und sie erkundigte sich teilnehmend nach seinen Arbeiten — er hatte ihr vorgeredet, er sei Ingenieur und arbeite an einem fachwissenschaftlichen Werke, weil tatsächlich die Technik ihn früher interessiert und beschäftigt hatte.
Aber weiter ging ihre Vertraulichkeit bisher nicht. Und der Graf sah gar keinen Weg, auf dem er diesem unberührten keuschen Herzen sich hätte nähern können.
So hatte denn auch zu seinem heutigen Besuch bei Käthe keine andere Veranlassung vorgelegen, als die rastlose Sehnsucht, der glühende Wunsch, sie zu sehen, in ihrer Gegenwart zu atmen und — vielleicht den ersten Kuss auf diesen reinen Mund drücken zu dürfen! ...
Deshalb liess Graf Berghorst seine „Geschäftsfreunde“ unten in der Droschke so lange warten; deshalb blieb er, obwohl ihn dieses Warten der drei in Gedanken peinigte, immer noch länger hier bei Käthe Wunderlich.
Die Uhr ziehend, sah er, dass es bald halb zehn war. Also mehr als eine halbe Stunde hatte er die unten schon warten lassen.
Wenn sie nun ungeduldig würden, ihn suchten und durch irgend wen erfuhren, dass er hier sei, bei seinem geliebten Mädchen.
Dem Kretschmar war die Frechheit zuzutrauen, dass er einfach heraufkam und nach dem Grafen von Berghorst sich erkundigte ..., dass er Berghorst hiess, wusste Käthe, aber von dem Adel und gar von dem „Grafen“ hatte sie keine Ahnung.
Nein, wahrhaftig, er musste gehen!
Unverzüglich! Sofort!!
Aber gerade dieser Zwang, der ihn wider seinen Willen von dannen trieb, liess das Meer seiner Leidenschaft immer höhere Wellen schlagen.
Er stand auf.
Seine Hände zitterten und seine Stimme bebte, als er jetzt sagte:
„Ich habe heut wenig Zeit ... Ich muss gehen.“
Käthe sah auf von ihrer Arbeit.
In ihren Augen blinkte es, wie eine Träne.
Und da — da siegte der Wunsch, sie sein zu nennen, über seine Schüchternheit.
Trunken vor Liebe und Zärtlichkeit, mit den unsicheren Bewegungen einer seiner Sinne nur halb Mächtigen, kam er ihr näher.
Sie hatte sich erhoben.
Und als er jetzt seine Arme um sie schlang, da widerstrebte sie nur schwach.
Ihr armes, einsames Herz, überwältigt von der Grösse dieser Liebe, deren wilder Pulsschlag zu ihr herüberdrang und sie schwach werden liess, gab sich ihm zu eigen.
Sie küssten sich minutenlang. Mit einer Kraft und Innigkeit, als sollte der Tod sie in der nächsten Minute voneinander reissen.
Und dann, als ihre Lippen sich, nach Atem ringend, voneinander lösten, da drängte sie selbst ihn nach der Tür, mit einem Flüstern, das wie ein Hauch durch den stillen Raum klang.
„Morgen! ... komm morgen wieder!“
IV. Ein nächtlicher Besuch.
Als Graf Berghorst wieder zu seinen Begleitern in die Droschke sprang, hatte er auf die spitzen Bemerkungen, mit denen ihn der Agent Kretschmar wegen seines langen Fortbleibens empfing, nur ein Lachen.
Auch fragte er sich jetzt nicht mehr, ob durch das Beisammensein mit diesen drei Personen seine Reputation Schaden nähme, er sprach mit ihnen, scherzte sogar mit Frau Tuto, die er eine brave, rechtschaffene Frau nannte, und schliesslich hatte er nicht übel Lust, dem rotbärtigen Agenten die Hand zur Versöhnung zu reichen.
v. Berghorst befand sich eben in jenem Rauschzustande absoluter Glückseligkeit, in dem der Mensch alles in einem verklärenden Lichte erblickt, wo sein eigner Frieden so schön und ungemessen ist, dass er mit niemand mehr in Feindschaft leben möchte.
Da, mitten im Gespräch, warf Casparius, der Grosse mit dem blonden Vollbart, auf einmal die Frage auf:
„Ja, wie kommen nur denn aber nu’ ins Haus, bei Ephraim? ... es ist doch zehne vorbei, wenn wir da sind!“
Er wie auch die andern mussten mit erhobener Stimme reden, da das Rasseln der Droschke, die jetzt dem Süden Berlins zufuhr, auf dem schlechteren Pflaster der Vorstadtstrassen ihre Worte übertönte.
Aber Kretschmar, der Fuchs — er hatte in der Tat viel Ähnlichkeit mit einem solchen — der überall ein Loch wusste, wo man durchschlüpfen konnte, war auch hier nicht um Rat verlegen.
Es sei da solche Kellerkneipe im Haus, durch die könne man den Hof erreichen, der Pfandleiher wohne nämlich auf dem Hofe.
„So ...“ sagte die Tuto, „was ist denn der Ephraim für einer? Den kenn’ ich doch gar nicht?“
Eine Weile überliessen sich der frühere Rittergutsbesitzer und Kretschmar gegenseitig das Antworten.
Und dann wie Casparius eben etwas erwidern wollte, sagte Graf Berghorst plötzlich mit einem kurzen Auflachen:
„Aber ich kenn’ ihn, Frau Tuto ... wenn Sie mal Ihren Familienschmuck versetzen wollen ... Der alte Ephraim beleiht nur wirkliche Pretiosen .... ausserdem ist er der gerissenste Halsabschneider, der mir jemals vorgekommen ist ... übrigens ist es gut, dass es heute Sonnabend und nicht Freitag ist. Von Freitagabend bis Sonnabend um dieselbe Zeit ist er nicht zu sprechen ... da können Sie ihm ’n Tausendmarkschein auf ’n Tisch legen, er rührt ihn nicht an. Und gern macht er auch am Sonnabend abend keine Geschäfte, seine alten Kunden wissen das schon und kommen dann erst gar nicht zu ihm. Aber vielleicht macht er mit uns eine Ausnahme.“
Der Sprechende nickte zu Casparius und Kretschmar hinüber.
„Jedenfalls können wir’s ja versuchen!“
„Mit mir macht er jedenfalls eine Ausnahme!“ erwiderte der Rotbärtige, wobei sich ein unheimliches Lächeln um seine schmalen Lippen stahl.
Die übrigen sahen dies Lächeln und hatten alle drei das nämliche peinliche Gefühl dabei, dem Casparius Ausdruck gab, indem er gezwungen lachend sagte:
„Sie sind ein Satanskerl, Kretschmar! Ich glaube, mit Ihnen würde der Deubel selbst nicht fertig werden!“
Der Agent erwiderte darauf nichts. Er blickte aus der schwerfällig dahinrollenden Droschke hinaus auf die Strasse, deren linke Seite mit elenden Mietkasernen bebaut war, während rechts hinter weit sich hinstreckenden Bretterzäunen das von den schwarzen Tüchern der Nacht überhangene Feld sich dehnte.
Die Laternen schienen hier in weiteren Zwischenräumen als sonst zu stehen und vermochten mit ihren rötlichen Flammen, die in der nebligen Luft erzitterten, die Finsternis nur auf kurze Strecken zu durchdringen.
„Wie unheimlich es hier ist!“ dachte der Graf, „es riecht förmlich nach Elend und Verbrechen!“
Aber er sagte nichts davon zu den anderen, und so erreichte man in schweigsamer Fahrt das Haus, in dem der alte Ephraim wohnte.
Die Kellerbudike hatte richtig noch Licht.
Einer nach dem andern kletterten die vier sechs aus rotem Backstein gemauerte Stufen hinab.
Kretschmar öffnete die mit einer roten Kattungardine verhangene Glastür, und ein fürchterlicher Brodem, aus Bierdunst, Tabaksrauch, Speisengestank und widerlicher Menschenausdünstung gemischt, schlug den Eintretenden entgegen.
Nie erinnerte sich Graf Berghorst einen derartigen Raum betreten zu haben.