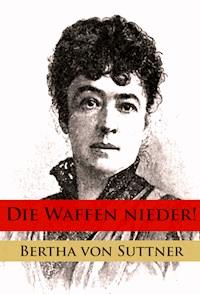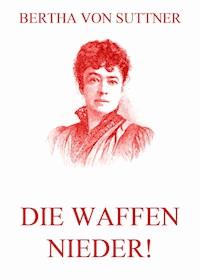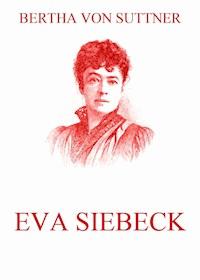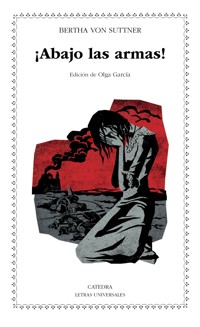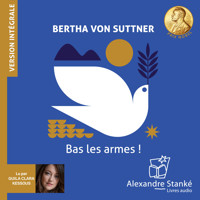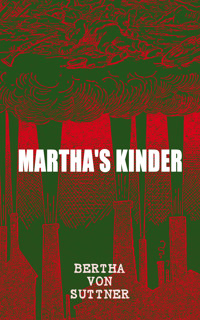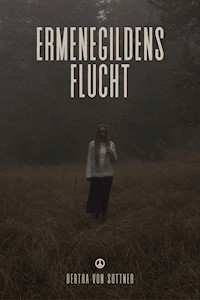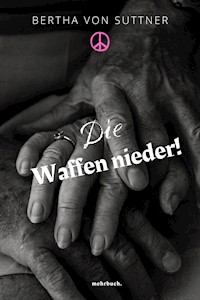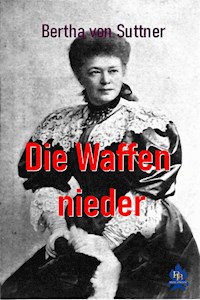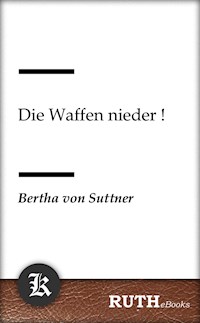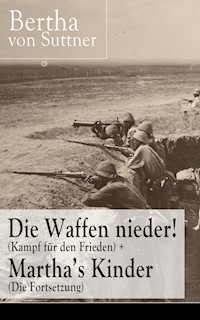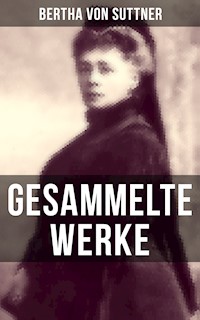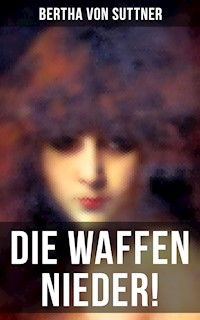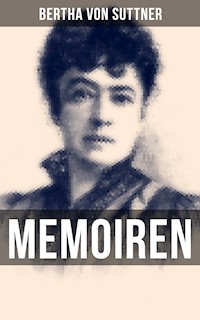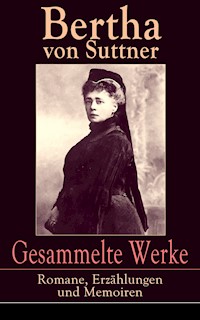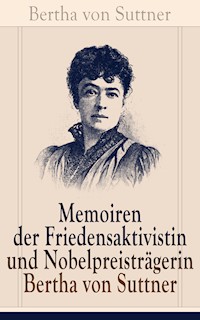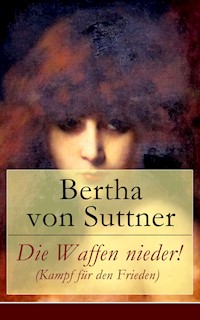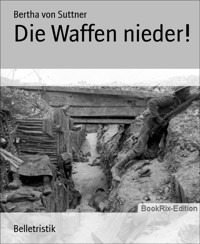Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Bertha von Suttner's Antikriegsroman 'Martha's Kinder' dreht sich die Handlung um die Hauptfigur Martha, eine engagierte Pazifistin, die sich leidenschaftlich für den Frieden und die Vermeidung von Krieg einsetzt. Der Roman wurde erstmals 1889 veröffentlicht und ist sowohl für seinen starken sozialkritischen Inhalt als auch für seinen klaren und prägnanten Schreibstil bekannt. Von Suttner schafft es, die Grausamkeiten des Krieges eindringlich darzustellen und gleichzeitig eine ergreifende Geschichte über Menschlichkeit und Hoffnung zu erzählen. Ihr Werk gilt als wegweisend für die Friedensbewegung des späten 19. Jahrhunderts und hat bis heute große Bedeutung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martha's Kinder: Antikriegsroman
I.
»Es lebe die Zukunft!«
Mit diesen Worten schloß Graf Rudolf Dotzky seine Tafelrede. »Und aus diesem Glase,« fügte er hinzu, indem er den Champagnerkelch an die Wand warf, daß er klirrend zerschellte, »darf kein anderer Trunk mehr gemacht werden, und heute, zu meines Erstgeborenen Tauffest, soll auch kein anderer Toast mehr gesprochen werden als dieser: Es lebe die Zukunft! Nicht unserer Vätersväter – wie die alte Phrase lautet – wollen wir trachten, uns würdig zu zeigen, sondern unserer Enkelsöhne … Mutter« unterbrach er sich – »was ist Dir? … Du weinst? … Was siehst Du dort?«
Baronin Martha Tilling hatte ihre großen schwarzen Augen, die so seltsam von dem weißen Haare abstachen, und aus welchen ihr jetzt zwei große Tränen über die Wangen rannen, starr nach dem Garten gerichtet, der vor der offenen Terrassentür lag.
Was sie dort sah, war ein Halluzinationsbild, das oft in ihren Träumen auftauchte: ein alter Mann – ihr Mann, der im Abendsonnenschein mit einer Gartenschere Rosenbäumchen stutzt.
Sie hatten einst, die glücklichen jungen Eheleute, von ihrer fernen Zukunft gesprochen: »Weißt Du, Martha, wenn ich einmal über die Siebzig bin und für das Weltgetriebe nicht mehr tauge, da werde ich mich meiner Liebe zu den Blumen hingeben und Gärtnerei betreiben.« – »O, ich sehe Dich vor mir, ein Hauskäppchen – nicht etwa von mir gehäkelt, derlei grauenvolle Arbeiten mache ich nie – ein Hauskäppchen auf den Silberlocken, in der Hand eine Gartenschere, mit der Du die welken Blüten von den Rosenstämmen trennst.« – »Ja – und Du sitzest auf der Gartenbank – ein duftiges Spitzentuch auf Deinem ebenfalls schon gebleichten Haar geschmackvoll gesteckt – denn kokett wirst Du immer bleiben –; in der Hand – also keine Häkelei, sondern das noch geschlossene Buch, aus dem Du mir später vorlesen wirst, und lächelnd siehst Du meiner Arbeit zu … Wir werden ein glückliches altes Paar sein, Martha!«
Diese Vorstellung hatte sich ihr so eingeprägt, daß sie sich in ihren Träumen wie ein Erlebnis zu wiederholen pflegte. Achtzehn Jahre schon war sie verwitwet und immer noch, wenn sie von ihrem verlorenen Friedrich träumte, sah sie ihn lebend vor sich; meist so, wie er in der Brautzeit gewesen, und manchmal auch in jener Gestalt, die nur in beider Phantasie entstanden war.
An diesem Tage, beim Tauffest ihres Enkelkindes, als Rudolf in seinem Trinkspruch gesagt: »Ja, Mutter, dieses Glas bringe ich dem Andenken Deines ewig Geliebten und ewig Betrauerten, dem auch ich alles verdanke, was ich denke und was ich bin« – da war ihr furchtbar weh ums Herz geworden. Sie saß der offenen Fenstertür gegenüber. Die Strahlen der untergehenden Sonne umwoben einen Rosenstrauch mit zittergoldigem Dunst und davon sich abhebend – ihr Traumbild: sie sieht die Gartenschere flimmern, das weiße Haupthaar glänzen … »Nicht wahr,« lächelte er zu ihr herüber, »wir sind ein glückliches altes Paar?«
Durch Rudolfs Frage aufgeschreckt, trocknete sie rasch ihre Augen und erhob sich.
Sie nahm den Arm ihres Nachbarn zur Rechten – Ritter von Wegemann, Minister a. D., im Hause unter dem Spitznamen »Minister Allerdings« – oder eines neuerlich angenommenen Gewohnheitswortes wegen – »Minister Andrerseits« bekannt.
Man begab sich in den anstoßenden Salon. Es war nur eine kleine Tischgesellschaft gewesen: Außer den schon Genannten Rudolfs Halbschwester Sylvia – der Mutter lebendes Jugendbild; Gräfin Lori Griesbach, Rudolfs Schwiegermutter; Doktor Bresser, der langjährige Freund des Hauses und sein Sohn Hugo Bresser; Graf Anton Delnitzky, der junge Pate des Täuflings; Oberst Baron Schrauffer, ein alter Anbeter Gräfin Loris und der Ortspfarrer, Pater Protus.
Sylvia schenkte den schwarzen Kaffee in die Schalen und reichte diese den Gästen.
Jede Bewegung der schlanken, geschmeidigen Gestalt atmete Anmut; auf dem rosigen Gesichtchen lag ein Schein von gehobener Glücksstimmung.
Martha und Lori nahmen auf einem kleinen Eckdivan Platz, während die Herren in der Nähe Sylvias blieben.
»Also wirklich,« sagte Gräfin Griesbach, »der Toni Delnitzky hat sich erklärt? Da gratuliere ich … Und darf man schon laut – –?«
»Nein, nein, ich bitte Dich! … Sylvia hat mir die Sache auf dem Wege von der Kirche mitgeteilt – erst morgen wird er bei mir um ihre Hand anhalten. Erst dann, bis ich ja gesagt habe, kann die Verlobung verkündet werden –wennich ja sage …«
»Du wirst doch nichts einzuwenden haben? Einer der größten Epouseure Österreichs! Daß er ein leichter Vogel war – je nun, das sind sie mehr oder weniger alle – solche junge Leute wie Rudolf findet man nicht wieder.«
»Und wenn ich auch einzuwenden hätte … ich glaube wirklich, daß der beiden Charaktere nicht zueinander passen … aber Sylvia ist kein Kind mehr …«
»Du kommst mir sehr unschlüssig vor: zuerst »wennich ja sage« und dann »wenn ich auch Einwendungen machen wollte, so nützt es nichts«.«
»In der Tat – es nützt nichts. Schau nur, wie glückstrahlend sie aussieht und mit welchem Eifer Delnitzky jetzt in sie hineinredet …«
Lori seufzte. »Es ist doch eine schöne Sache um die Jugend! …«
»Du kommst mir eigentlich auch noch jung vor, Lori …«
»Vorgestern war mein achtundvierzigster Geburtstag …«
»Du hast Dich körperlich nicht viel und seelisch gar nicht verändert seit den letzten zwanzig Jahren. – Du bist noch immer so schlank, so blond, so lebhaft, (so leicht, setzte sie im Geist hinzu) und so – verzeih – so gefallsüchtig wie immer … Diese prachtvolle granatrote Toilette – dazu die Blicke, die Du unserem Minister Andrerseits zugeworfen hast – was wird Schrauffer dazu sagen?«
»Und Du in Deinem ewigen Schwarz und ewigen Ernst – Du gibst Dir ein viel älteresair, als Dir zukommt.«
»Ach, mein Schatz, wenn man solchen Schmerz erfahren hat wie ich – so unsägliches Unglück nach so unsäglichem Glück, dann dürfte man schon ganz gebrochen sein … Ich bin es nicht, weil ich meine Kinder habe …«
Der Minister näherte sich den Damen und ließ sich in einem Fauteuil an der Seite Loris nieder.
»Ich habe eben mit dem Grafen Rudolf disputiert, meine Damen, und rufe Sie zu Richterinnen an. Der Ton, den er in seinem Trinkspruch angeschlagen, wollte mir nicht gefallen … ein Ausfall gegen die Väter und Vätersväter! Allerdings, wenn man gerade ein Wickelkind feiert, so liegt der Gedanke an Enkelssöhne näher – andrerseits soll man nicht vergessen, daß es nureinenBoden gibt für ersprießliches Gedeihen, (namentlich für Unsereins) – den Boden der Tradition. Was sagenSie, Gräfin?«
Lori war weit davon entfernt, über diese Frage irgend eine Meinung zu hegen, aber da sie doch etwas antworten mußte, so sagte sie:
»Sie haben ganz recht, ganz recht.« Das ist eine Meinungsäußerung, welche denjenigen, dem sie gilt, gewöhnlich als sehr vernünftig berührt.
»Ich muß meinem Sohne recht geben,« widersprach Martha. »Es ist besser, denen zu Dank zu handeln, die nach uns kommen, als jenen, die vor uns waren. Straßen pflegen ist ganz schön – Bahn brechen ist schöner.«
Die Neuverlobten konnten jetzt einige unbelauschte Worte tauschen:
»Morgen werde ich also mit Ihrer Mutter sprechen, Sylvia … ich fürchte mich ein wenig …«
»Sie glauben doch nicht, daß Mama –«
»Nein, abweisen wird sie mich nicht – das fürchte ich nicht, sondern die Feierlichkeit davon – die Ungewohnheit …«
Sylvia lachte: »Hoffentlichist’s ungewohnt! Wer soll denn Übung darin erlangen, um Hände anzuhalten? Übrigens, auch mir ist entsetzlich »ungewohnt« zu Mute … ich begreife gar nicht, daß ich mit einem kurzen »ja« mein ganzes Leben verpfändet habe … war ich nicht voreilig? Ich kenne Sie eigentlich so wenig und Sie – – kennen mich vielleicht gar nicht …«
»Und ob ich Sie kenne: das natürlichste, heiterste, anmutigste Geschöpf …«
»Kurz, das Muster eines wohlerzogenen Komtessels, wie? Ein anderes Bild hatte ich ja auch nicht Gelegenheit, hervorzukehren in den fünf oder sechs Kotillons, die wir miteinander getanzt haben. Es steckt aber wirklich doch noch manches andere in mir, von dem Sie vermutlich nichts ahnen.«
»Zum Beispiel?«
»Ungeheure Ansprüche an das Leben und an die Menschen – und besonders an den Menschen, der mein Leben ausfüllen soll –«
»Muß er ein halber Gott sein?«
»Nein, aber ein ganzer Mensch. So wie dieser da,« fügte sie hinzu, auf den Bruder deutend. Rudolf trat heran. »Warum wird hier mit Fingern auf mich gezeigt?«
»Als Muster der Vollkommenheit wirst Du gepriesen,« antwortete Delnitzky. »Du entsprichst dem Ideal, das sich Deine Schwester von einem – wie sagte sie doch? – ganzen Menschen macht.«
Seufzend schüttelte Rudolf den Kopf:
»Da muß ich das Leitmotiv meines Toasts wiederholen – es lebe die Zukunft – die wird ganze Menschen haben… heute findet man nur viertel, achtel, hundertstel –«
»Nicht einmal halbe gibst Du zu?«
»O, Halbheit in anderem Sinne, auf die stößt man nur zu oft. Ernstlich, Du hast eine zu gute Meinung von mir, Sylvia. Du weißt doch, daß ich eine Aufgabe habe, und weißt, wie wenig ich noch die Kraft fand, sie zu erfüllen, Du weißt –«
»Nicht die Kraft,« unterbrach Sylvia, »die Möglichkeit hat Dir gefehlt.«
»Auch die. Hoffentlich wird es größere, weitere Möglichkeiten geben, wenn mein Friedrich erwachsen ist. Sein Feld wird das zwanzigste Jahrhundert sein, und von dem erwarte ich die Erfüllung großer Dinge.«
»Du bist heute ganz Zukunft, Rudi,« sagte Delnitzky; »da folge ich Dir nicht, denn die Gegenwart ist nur viel zu schön.«
Sylvia warf ihm einen Blick Zu, mit dem sie ihm das Weiterreden verwehrte. Offenbar war es ihr unerwünscht, daß Rudolf in diesem Augenblick erfahre, was Delnitzkys Gegenwart so sehr verschönte.
In einer anderen Ecke standen der Oberst von Schrauffer, Doktor Bresser und der Pfarrer im Gespräch.
»Ein hübscher Junge, Ihr Sohn, Herr Doktor,« sagte der Pfarrer, »dem wäre die Uniform gutgestanden – warum haben Sie ihn nicht zum Militär gegeben?«
Pater Protus war eine Zeitlang Feldkaplan gewesen und hatte sich eine große Vorliebe für die Angehörigen des Militärs bewahrt. Die Erinnerung an die in Gesellschaft fröhlicher Offiziere zugebrachten Stunden gehörte zu seinen liebsten Erinnerungen. Zweiunddreißig Jahre alt, aufgeweckten Geistes, lern-und lebenslustig, war er von jeglichem Sektengeist, von jeglicher muckerischer Strenge weit entfernt. Als Gesellschafter war er allgemein beliebt. Er wußte ebensowohl auf Scherze einzugehen, als an wissenschaftlichen Diskussionen teilzunehmen. Natürlich hatten seine Freunde den Takt, dem Priester gegenüber bei Scherzen keinen zu frivolen, bei Diskussionen keinen glaubensverletzenden Ton anzuschlagen. Ebenso zurückhaltend war Pater Protus: im gesellschaftlichen Verkehr schlug er niemals einen lehrhaften, bekehrenden Ton an. Ob er nicht auch selber in seinem Innern mit manchen Dogmen gebrochen, das konnte aus seinen Äußerungen niemals hervorgehen, doch lag in seiner Art, mit notorisch freidenkenden Menschen umzugehen, ein Zug stillschweigender Achtung.
»Ein hübscher Junge, Ihr Sohn,« sagte er zu Doktor Bresser, »dem wäre die Uniform schön gestanden, warum haben Sie ihn nicht zum Militär gegeben?«
»Gegeben? Ich? Er hat sich seinen Beruf selber gewählt. Er ist Schriftsteller.«
»So – o?« machte der Oberst. »Ist denn das überhaupt ein Beruf?«
»Ich sollte meinen, einer der allerschönsten,« bemerkte Pater Protus. »Und ich denke, Schriftstellerei kann man doch nur so nebenbei betreiben; es ist ja doch keine Karriere – mit regelmäßigem Vorrücken, mit gesichertem Erwerb«
»Das freilich nicht. Aber da mein Sohn von seiner Mutter ein genügendes, selbständiges Vermögen geerbt hat –«
»Ich verstehe,« unterbrach der Oberst, »so privatisiert er.«
»Im Gegenteil – er hat sich die breiteste Öffentlichkeit als Lebensweg gewählt: er ist Schriftsteller und Journalist.«
»Journalist? – Also der Beruf der Leute – ich glaube Bismarck hat ihn so genannt – die ihren Beruf verfehlt haben?«
»Ich finde den Journalismus einen sehr schönen Beruf,« fiel der Pfarrer lebhaft ein. »Ein lieber, sehr geschätzter Freund von mir schreibt die Kunst-und Musikreferate für die Neue freie Presse –«
»Es nimmt mich Wunder, daß ein geistlicher Herr das bekannte Judenblatt –«
»O, ich stehe nicht auf dem antisemitischen Standpunkt, Herr Oberst. Und für welche Zeitung arbeitet Ihr Sohn, Doktor Bresser?«
»Für zehn verschiedene. Doch vom künftigen Oktober ab wird er eine Stelle als ständiger Redakteur eines neugegründeten politischen Blattes antreten.«
»Hoffentlich ein gutgesinntes … Einerlei: als Leutnant… jetzt könnte er auch schon Oberleutnant sein – wäre mir Ihr Sohn doch lieber, wie als – verzeihen Sie – als Federfuchser. Hätten Sie ihn rechtzeitig in eine Militärakademie gesteckt … Aber Sie sind ja ein alter Freund der Baronin Tilling – folglich ein geschworener Militärfeind –«
»Militarismusfeind«, verbesserte Bresser.
»Das bleibt sich gleich. Wenn einer eine Sache nicht mag, so fügt er ihrem Namen ein gehässiges »ismus« an. Nicht wahr, Herr Pfarrer, die Feinde der Kirche sagen auch beileibe nicht, daß sie etwas gegen die Religion oder gegen die Kleriker haben – nur dem Klerikalismus sind sie feind –«
»Ich fühle da doch den Unterschied,« erwiderte Pater Protus. Dann an Doktor Bresser gewendet:
»Ihr Sohn kommt mir heute sehr schweigsam und melancholisch vor. Ist er oft so?«
»Er ist gewöhnlich ernst; doch ist mir es auch aufgefallen, daß er heute etwas verstimmt scheint.«
Der junge Mann, von dem die Rede war, saß an einem Tisch und blätterte in illustrierten Zeitschriften. Aber sein Blick haftete nur zerstreut auf den Bildern, immer wieder irrte er in die Richtung, wo Sylvia und Denitzky nebeneinander standen.
Seit Jahren schon trug Hugo Bresser eine schwärmerische Neigung für Silvia im Herzen. In bewußter Hoffnungslosigkeit zwar, denn er maßte sich nicht an, der gefeierten, reichen Aristokratin als Freier sich zu nahen. Was ihm aber heute in Gebaren und Mienenspiel an dem Paare aufgefallen, hatte seine Eifersucht entfacht.
Selber auf ein Glück verzichten, ist schon schwer genug – aber einen anderen in dessen Besitz zu sehen, ist unerträglich … Wenn ich recht erraten, sagte er sich – so werde ich dieses Haus meiden – ich könnte da nicht zusehen. Und dabei: er ist ihrer nicht wert … Nur dem Besten, Gescheitesten, Edelsten wäre sie zu gönnen … aber dieser Dutzendmensch! … Ist es nicht schon bedauerlich genug, daß der herrliche Rudolf sich ein Dutzend-Komteßchen nahm…
Indessen waren die beiden Großmütter in das Schlafzimmer der jungen Frau gegangen, ihr einen Besuch abzustatten.
Beatrix Dotzky, in schleifen-und spitzengeschmücktes Nachtgewand gehüllt, lag in ihrem Bette und hielt den kleinen Fritz im Arm. Kammerfrau und Wärterin standen daneben.
Gräfin Lori eilte auf ihre Tochter zu:
»Also Trixi – wie geht’s? Gib mir das Wurm ein bissel her … So ein lieber Schneck. Die ganze Mama – und Du siehst mir ähnlich, folglich die ganze Großmama – ich kann zwar nicht behaupten, daß mich dieser Titel entzückt…«
»Er will Dir auch gar nicht passen, liebste Mama …«
»Aber mir paßt er doch, Beatrix, nicht wahr?« sagte Martha. »Gib mir den Kleinen, Lori.«
Gräfin Griesbach ließ sich nicht bitten und legte das Kind auf Marthas Arme.
»Und jetzt laß Dir erzählen…« Sie setzten sich an das Fußende des Bettes und in übersprudelndem Redefluß berichtete sie, wie die Taufe in der Kirche vor sich gegangen, was der Pfarrer gesprochen, und wie der Kleine geschrien und was für Toaste bei Tische ausgebracht wurden: Oberst von Schrauffen hatte so herrlich von den künftigen Großtaten gesprochen, die der kleine Fritz bestimmt war, im Dienste des Vaterlandes auszuführen, wenn er wie sein Großvater und wie sein Urgroßvater Althaus des Kaisers Rock trüge. Von da sprang Loris Rede ohne Übergang auf die Genesis ihres granatroten Damastkleides »bei der Spitzer, weißt Du – die arbeitet doch am chiksten …« – auf verschiedene Sorten von »Milchkasch«, mit denen man am besten kleine Kinder aufpäppelt, auf die Misere, die man später mit den Bonnen hat und auf Verhaltungsmaßregeln für die junge Mutter. »In sechs Wochen,« so schloß sie, »mußt Du, ja mußt Du nach Mariazell, um der Muttergottes für die Geburt des Knaben zu danken (ich bin so froh, daß es ein, Bub ist – wegen dem Majorat). Ich bin schon vor Deiner Geburt nach Mariazell – nein Mariataferl war’s – gewallfahrtet und wie Du siehst, hat es Dir Glück gebracht – –«
Martha saß schweigend am andern Bettrand und blickte nachdenklich auf das Kind, das sie im Schoße hielt. Gedanken, Gefühle, Bilder durchwogten ihre Seele – nicht klar, nicht abgesondert, sondern ineinander fließend, in ihrer Vermengung eine Wehmutsstimmung ergebend.
Der Sohn ihres Sohnes … vielleicht würde auch der wieder Söhne zeugen… und so geht das Leben, um alles Sterben unbekümmert, aus entlegenster Vergangenheit in entlegenste Zukunft hinüber – dazwischen immer wieder Leid, Kampf, Alter, Tod – und was am Ziele? Was am Wege? Wohl auch mitunter Freude, Liebe, Begeisterungsschwung: das ist ja an sich schon erfüllter Zweck. Das Ziel kann doch nur sein: mehr Freude, mehr Liebe, höherer Schwung … O« du kleines, hllfloses Geschöpfchen, was wird aus Dir werden – wenn Du überhaupt erhalten bleibst? Wie viel Schmerz wirst Du erdulden, wie viel Schmerz bereiten?Sicherist Dir nur Eines, früher oder später: das Todsein – die ewige Abwesenheit … O mein Verlorener! …
Und wieder entstand das Bild Tillings vor ihrem inneren Auge. Aber nicht in jener im Traum entstandenen, altersmüden Gestalt, sondern wie er in seiner Vollkraft gewesen an dem Tage, da er unter den Kugeln des Exekutions-Pelotons zusammenfiel.
II.
Rudolf Graf Dotzky, geboren 1859, wenige Monate vor Ausbruch des italienisch-österreichischen Krieges, in dem sein Vater den Tod fand, zählte jetzt dreißig Jahre. Besitzer des ausgedehnten Dotzkyschen Majorats, hatte er keinen andern praktischen Beruf als die Bewirtschaftung seiner Güter. Daneben hatte er sich aber noch einen idealen Beruf erwählt, dem sein Lernen, Denken und Streben galt: nämlich die Aufgabe zu erfüllen, welche Friedrich Tillings Vermächtnis war: die Bekämpfung der Kriegsinstitution. Die eigentliche Erbin dieses Vermächtnisses war freilich Tillings Witwe, doch freiwillig hatte sich Rudolf zum Mitarbeiter seiner Mutter herangebildet. Das zu Friedrichs Lebzeiten angelegte »Protokoll« – ein Einschreibebuch, in das die Fortschritte der Friedensidee und -Bewegung eingetragen waren, wurde zuerst von Martha, dann von Rudolf weitergeführt. Die von dem Elternpaar zusammengetragene Bücherei natur-und sozialwissenschaftlicher Werke fand in ihm einen eifrigen Studenten und Mehrer.
Allerdings mußte daneben das obligate Studium der offiziellen Schulgegenstände absolviert werden; auch das Freiwilligenjahr hatte er ausdienen müssen. Dann kam die Erbschaft des Dotzkyschen Majorats, wodurch dem jungen Mann die Notwendigkeit erwuchs – wollte er anders den Pflichten des Großgrundbesitzes gerecht werden – ernstliche Landwirtschaftsstudien zu betreiben – all das ergab eine bedeutende Ablenkung von jenem idealen Beruf.
Auch kam eine Zeit, da er durch den Umgang mit seinen Alters-und Standesgenossen in einen Wirbel von weltlichen und sportlichen Vergnügungen gerissen wurde, wobei die Beschäftigung mit seiner Lebensaufgabe stark zur Seite geschoben ward. Sogar die Gesinnungen, die dieser Aufgabe als Grundlage dienten, waren durch den Einfluß der ganz entgegengesetzten feudalen, chauvinistischen und reaktionären Ansichten, die in seiner Umgebung herrschten, momentan ins Schwanken geraten und hatten Gefahr gelaufen ganz unterzugehen, wären sie nicht schon so tief in seiner Seele geankert gewesen, und wenn der niemals ganz aufgegebene innige Verkehr mit der Mutter ihm nicht immer wieder die Ideale aufgefrischt hätte, für die er wirken wollte – später, später, bis er zur Ruhe käme.
Und er kam bald zu Ruhe. Das schale Leben der »goldenen Jugend«, mit den ewigen Trinkgelagen und ewigen »kleinen Jeux«, mit den abwechslungslosen Jagd-, Rennstall-und Koulissengesprächen ekelte ihn bald an. Es zog ihn zurück zu seinen Büchern und zu seinen gutsherrlichen Pflichten. Schon im Alter von vierundzwanzig Jahren hatte er sich von dem Treiben seiner Genossen losgerissen. Er zog sich auf Brunnhof – die größte und schönste seiner Domänen – zurück und lud seine Mutter und Schwester ein, bei ihm zu wohnen.
Hier widmete er sich wieder mit verdoppeltem Eifer seinen beiden Berufen – dem einen mit ausübender, dem anderen mit vorbereitender Arbeit. Er unterbrach dieses einsame Landleben nur durch einige Reisen nach Paris, London und Italien. Denn er sah wohl ein, daß man ein Stück Welt gesehen haben müsse, wenn man einst öffentlich wirken wollte.
Das Gebiet seiner Aufgabe hatte sich ihm unversehens stark erweitert. Ursprünglich war es nur die eine – von Tilling überkommene Idee – Bekämpfung der Kriegsinstitution – die ihm als Ziel vorgeschwebt, aber allmählich kam er zur Überzeugung, daß jeder Zustand, jede Einrichtung mit allen anderen Zuständen und Einrichtungen in vielfacher Wurzelverschlingung verbunden ist, und da begann er, sich in andere Probleme zu vertiefen und andere Bewegungen zu verfolgen; überall lauschte er hin, wo ein neuer Geist die alten Formen sprengen wollte. Je weiter er vorwärts drang, desto zahlreicher eröffneten sich ihm immer wieder neue Forschungsfelder. Die Fülle der auf ihn einstürmenden Gedanken und erwachenden Erkenntnisse hinderte ihn daran, sich auf irgend eine bestimmte Aktion zu konzentrieren. Erst mußte er lernen und noch lernen, erst mußte sein gärender Geist Klärung gewinnen, ehe er daran gehen konnte, tätig in das Räderwerk des öffentlichen Lebens einzugreifen. »Später, später!« rief er sich zu und hatte vorläufig darauf verzichtet, sich politisch oder publizistisch zu betätigen. Er bewarb sich nicht um den Reichsratssitz, zu dem ihn sein Großgrundbesitz berechtigt hätte, er schloß sich keinem Vereine an und veröffentlichte keine Aufsätze; er begnügte sich mit Studieren und Denken, mit Schauen und Beobachten. Daß er öffentlich werde wirken müssen, um die in Tillings Vermächtnis enthaltene Aufgabe zu erfüllen, das war ihm klar – aber: später, später.
Als er achtundzwanzig Jahre alt war, entschloß er sich, zu heiraten. Der Besitzer des Majorats und zugleich letzter männlicher Sproß des Hauses Dotzky war einfach verpflichtet, für Vermögens-und Namenserhaltung zu sorgen und sich eine ebenbürtige Gattin zu wählen.
Von Kindheit auf hatte er – halb im Scherz, halb im Ernst – um sich wiederholen gehört, daß die einzige Tochter der Gräfin Griesbach, die kleine Beatrix, seine Frau werden solle. Die Mütter waren Jugendfreundinnen, die Kinder Spielgenossen, und der Gedanke, daß sie einst ein Paar werden sollten, wuchs sowohl bei Rudolf wie bei Beatrix als etwas selbstverständliches, einfaches, garnicht tiefbewegendes noch hochbeglückendes, aber immerhin als etwas ganz erfreuliches heran.
Ohne langes Hofmachen seinerseits, ohne langes überlegen ihrerseits, ohne Überraschung für die Familien und Freunde wurde Rudolfs Werbung vorgebracht und angenommen und sechs Wochen später die Trauung vollzogen. Beatrix war eine anmutige und elegante Erscheinung; in geistiger Beziehung war sie nicht viel über das Niveau ihrer Mutter herausgewachsen, aber Rudolf hatte gar nicht den Versuch gemacht, sie zur Teilnahme an seinen geistigen Interessen heranzuziehen – hierin war und blieb seine Vertraute die Mutter. Bei seiner kleinen Frau wollte er nicht Anregung zu seinen Arbeiten, sondern Erholung finden. Ausruhen wollte er bei ihr und sich aufheitern lassen. Sie besaß ein fröhliches Temperament und fühlte sich durch die glänzende Lebensstellung, die ihr der liebenswürdige und hübsche Gatte bot, vollständig glücklich – da konnte sie wohl durch sonnige Laune und ungeheuchelte Zärtlichkeit die gewünschte Aufheiterung leisten. Für das geistige Ausruhen bürgte ihr gänzliches Unverständnis: mit ihr gab es kein weiteres Ausspinnen der Gedanken, kein Erwägen der Pläne – mit einem Wort: keinerlei weiteres Kopfzerbrechen, in ihrer Gesellschaft mußte man die geistige Arbeit ruhen lassen.
Martha hatte sich dieser Eheschließung nicht widersetzt. Sie hatte die Empfindung, daß Rudolfs Lebensaufgabe und Lebensinhalt außerhalb der häuslichen Verhältnisse lag, etwa wie bei einem von seiner Berufspflicht ganz erfüllten Priester. Rudolfs Schicksal hing nicht an der Gemeinschaft mit einem geliebten Weibe – es hatte ein weiteres Feld. Auf diesem Felde war die Mutter seine Vertraute und Beraterin; vielleicht wäre es dieser sogar schmerzlich gewesen, eine solche Rolle einer anderen überlassen zu sollen. Der große Liebreiz der jungen Gräfin Dotzky, verbunden mit ihrem kindlichen Frohsinn, ließ über ihren Mangel an Geist, über die Seichtigkeit ihres Charakters hinwegsehen. Viele nannten sie entzückend und Rudolf hatte sie von Herzen lieb.
So fühlte sich Martha über ihres Sohnes Eheleben ganz beruhigt und zufriedengestellt. Anders urteilte sie über die bevorstehende Heirat der Tochter. Da war ihr unsäglich bang. Für Sylvia hatte sie stets den Traum genährt, daß ihr in einer harmonischen Ehe ein Glück beschieden sein möge, wie sie selber es an der Seite Tillings gefunden. Und dafür bot ihr das Wesen des jungen Delnitzky keine Bürgschaft.
Es war am Abend des Tauffestes. Sylvia saß beim Fenster in ihrem Zimmer. Die Dunkelheit war schon hereingebrochen. Das Fenster stand offen Und die laue Sommernachtluft, düftebeladen, strömte herein. Hinter den Baumwipfeln stieg eine glutrote, unnatürlich groß scheinende Mondscheibe empor. Von ferneher leiser Unkengesang und aus nahem Gebüsch die Triller einer Nachtigall.
Sylvias Kopf war an die Fauteuillehne zurückgeworfen und ihre beiden Hände hingen über die Armlehnen hinab. Ihr Atem ging hörbar und kurz durch die halbgeöffneten Lippen; sie selber fühlte das Schlagen ihres Herzens.
Verliebt… Die Wonne dieses Bewußtseins war nicht nur eine seelisch, sondern zugleich physisch empfundene Wonne. Eine süße Wärme, eine seligkeitsahnende Beklemmung in der Brust, eine wogende Betäubung im Kopf.
Beim Abschied – sie standen von den anderen ungesehen in einer Nische der finsteren Ausgangshalle – hatte Delnitzky sie auf den Mund geküßt. Der erste Liebeskuß in ihrem Leben. Jetzt saß sie da und suchte sich dieses Erlebnis, dieses Ereignis wieder zu vergegenwärtigen. Sie war erschüttert, bereichert – verändert mit einem Wort, nicht mehr dieselbe Sylvia, die sie vor einigen Stunden gewesen.
Die Tür ging auf.
»Im Finstern, mein Kind?« Und Martha drückte an den elektrisches Knopf. Ein mattes rosa Licht fiel nun durch die gläserne Deckenampel in den Raum und zeigte die weiß lackierten Möbel, die blumengemusterten Stoffe und Tapeten des frischen, einfachen Mädchenzimmers.
Sylvia sprang auf.
»Habe ich Dich erschreckt?«
»O nein, Mama … Gut, daß Du kommst … ich, wäre ohnehin später zu Dir hinüber … Bitte, setz Dich hierher auf das Sofa … und laß mich … so, auf diesem Schemel…« Und Sylvia ließ sich zu ihrer Mutter Füßen nieder und legte den Kopf auf deren Schoß.
Martha strich liebkosend über des jungen Mädchens Scheitel:
»Das ist ja unsere Märchenerzähl-Stellung,« sagte sie lächelnd, »nur sind die Rollen getauscht: jetzt mußt Du mir erzählen. Wie ist das gekommen? … Morgen will Delnitzky um Deine Hand bei mir anhalten … Werde ich – werden wir ja sagen? Bist Du mit Dir im Reinen?«
»Glücklich bin ich, glücklich …«
»Die Frage ist, ob Du glücklich wirst … Auf die Dauer, meine ich … für ein Leben … Paßt Ihr auch für einander? … Kennst Du ihn als einen Mann, zu dem Du vertrauensvoll aufblicken kannst, von dessen Verstand, dessen Güte, dessen Übereinstimmung mit Deinem Wesen Du überzeugt bist? …«
»Das sagte ich ihm vor ein paar Stunden selber: »Wir kennen uns nicht.« So wie Du, Mama, empfand auch ich halbe Zweifel … aber jetzt ist das verscheucht … Liebe kann nicht so täuschen – und ist Liebe nicht schon an und für sich Gewähr für Glück? Ob fürs ganze Leben … wer wird gleich so viel verlangen? Ist es nicht schon Erfüllung genug, daß man diese goldene Frucht – das Glück – überhaupt pflücken und die Seele damit laben darf? … Erinnerst Du Dich, Mama – Du hast mir nicht nur Märchen, Du hast mir auch Geschichten aus Deinem Leben erzählt – erinnerst Du Dich, wie Du Deine Ehe mit Rudolfs Vater eingegangen? Ein Kotillon auf einem Kasinoball – und sein und Dein Schicksal war besiegelt. Warst Du nicht glücklich mit ihm? … Freilich auch nicht fürs Leben – denn nach einem kurzen Jahr ist er Dir, entrissen worden … aber war dieses Jahr nicht schön?«
»Mein Kind, das ist etwas anderes… ich war damals so jung, so unausgewachsen an Vernunft und Charakter – während Du, Sylvia –«
»Ich bin doch auch jung –«
»Doch schon zweiundzwanzig … Ich war damals siebzehn Jahre alt. Aber nicht die Jahre machen es – Du bist ein ernstes Mädchen, ein selbständig denkendes Weib – Du stellst große Ansprüche an die Menschen –«
»Ja, dasselbe habe ich heute meinem Bräutigam gesagt … dieselben Zweifel ausgedrückt …«
»Siehst Du?«
»Ausgedrückt habe ich sie, aber ich empfinde sie nicht – wenigstens jetzt nicht. Das Glück, das mich erfüllt, ist stärker als alles – alles andere – ich begreife es ja nicht…«
»Du hast schon so viele Körbe gegeben und unter Deinen abgewiesenen Freiern waren solche, die ich höher einschätze als Delnitzky, Du aber konntest nicht genug zu erwägen, zu tadeln finden. Der war nicht genug universell gebildet, der nicht hochherzig genug – dem mangelte es an funkelndem Geist, dem an edler Milde – kurz, man hätte glauben sollen, Du wolltest Deine Zukunft nur einem Ideal von Vollkommenheit anvertrauen, und jetzt –«
»Und jetzt habe ich das Gefühl, daß es auf der ganzen Welt keinen anderen Menschen gibt, dem ich angehören könnte, als Delnitzky. Märchen sollte ich Dir erzählen, Mama? Da hast Du eins? Ein lichtes Wunder, ganz losgelöst von allem vernünftigen »Warum?« und »Wozu«. Es hat keine Erklärung und braucht keine. Ich bin so glücklich und mir ist, als wäre alles verzaubert, und ich selber bin eine andere, als die ich war. Was ich früher gedacht, überlegt, erwogen – das ist alles zerflattert, zerstoben, etwas Neues umgibt, durchdringt mich, hebt mich empor –«
»Kind, Kind – Du sprichst wie im Rausch –«
»Ja, Mama. Aber nicht der Champagner ist mir zu Kopf gestiegen – ich weiß jetzt, was das Wort Glücksrausch bedeutet.«
»Du bist mir aber noch die Erzählung schuldig. Wie ist es gekommen?«
»Auf dem Wege von der Kirche hat er sich erklärt.«
»Nein – ich frage, wie ist es gekommen, daß er Dein Herz erobert? Allmählich? Plötzlich? – Welche besondere Eigenschaft hast Du an ihm entdeckt?«
»Eine besondere Eigenschaft? Irgend eine wahrgenommene Tugend, die mich zu dem überlegten Entschluß veranlaßt hätte: »Dieser Mensch ist liebenswert – ich will ihn lieben«? So etwas ist nicht geschehen. Zwar hatte ich das stets so erwartet. Da bisher alle meine Bekannten und alle meine eifrigsten Courmacher mich kalt gelassen, sagte ich mir: es hat eben noch keiner so liebenswerte Eigenschaften gezeigt, wie ich sie von meinem künftigen Gatten fordere; wenn sich einer so offenbaren wird, wie mein Ideal beschaffen ist, dann werde ich ihm meine Liebe schenken. Als ob ein solches Geschenk ein willkürlicher Akt wäre! … Jetzt habe ich erfahren, daß Liebe von jeglicher Willenslenkung unabhängig ist – ebenso gut könnte man aus freiem Entschluß ein Nervenfieber bekommen, wie –«
»Wie ein Liebesfieber? Als eine Krankheit betrachtet meine Sylvia ihr schicksalsentscheidendes Gefühl?«
»Als eine süße, betäubende, gefährliche Krankheit –«
»Warum gefährlich?«
»Weil ich sterben müßte, wenn etwa jetzt ein Hindernis –«
»O, man stirbt nicht so leicht an Schicksalsschlägen und an Seelenschmerz – davon bin ich ein Beispiel. Doch jetzt will ich Dich allein lassen, mein geliebtes Kind … geh zur Ruh – ein tüchtiger, langer, fester Jugendschlaf wird Dich erfrischen und beruhigen – Du bist jetzt so erregt … ich will Dich garnicht mit weiteren Ausforschungen plagen. Morgen früh wirst Du mir besser erzählen können, was ich noch wissen will. Gute Nacht, mein. Kind.«
Martha beugte sich über ihre Tochter und strich ihr mit der einen Hand zärtlich über das Haar, während Sylvia die andere an ihre Lippen zog:
»Gute Nacht, Mutter, Freundin – einzige, gute, liebste Mama, ich bin so glücklich …« Nachdem sie allein geblieben, ging Sylvia wieder zum offenen Fenster und, an die Fensterwand gelehnt, den Kopf auf den zurückgelegten Arm gestützt, schaute sie zum Nachthimmel auf. Jetzt stand der Mond schon hoch am Firmament und goß ein sanftes, blauweißes Licht auf die Büsche und auf die Kieswege des Gartens. Die leise bewegte Luft war von Rosen und Jasmindüften durchweht.
Diese Nachtluft und diese Düfte: wie oft hatte Sylvia deren Zauber empfunden; doch während solcher Zauber sonst eine Verheißung war – heute war er Erfüllung. Ja, das Leben ist schön … ja, der Lenz mit seinen Blütenschätzen, mit dem geheimnisvollen Glanz seiner Mondnächte, ist Verkünder und ist Spender liebeatmender Entzückung …
»Wie es gekommen?« Das zog jetzt an Sylvias Geist vorüber.
Vor vierzehn Tagen im Prater – damals blühte noch der Flieder und es war auch so eine laue, helle Frühlingsnacht gewesen – da war im Sacher-Saale ein »Junge-Herren-Ball« veranstaltet worden. Von allen jungen Herren der Gesellschaft galt Delnitzky als der hübscheste und eleganteste. Wenigstens zehn Komtessen schwärmten für ihn und fast alle Mütter wünschten im stillen, daß ihre Töchter ihn erobern mögen – denn er war eine der ersten »Partien« des Landes.
Auf den drei oder vier vorhergehenden Bällen, die Sylvia mitgemacht, hatte der junge Mann besonders auffallend ihr gehuldigt, wodurch sie sich – nicht ohne eine gewisse Genugtuung – als der Gegenstand vielseitigen Neides fühlte. Dann aber, in einer Soiree bei der französischen Gesandtschaft – am Vorabend jenes Praterballes – hatte er sich von Sylvia ganz fern gehalten und in ziemlich ostentativer Weise der jungen Gattin eines alten Diplomaten den Hof gemacht. Eine gemischte Empfindung von Kränkung und Ärger klärte Sylvia darüber auf, daß ihr Delnitzky nicht gleichgültig war.
Am liebsten hätte sie auf den »Junge-Herren-Ball« – den letzten der Saison – verzichtet. Delnitzky unter solchen Umständen wiederzusehen, würde ihr nur Qual bereiten. Es kam aber anders. Gleich bei ihrem Eintritt in den Saal eilte der junge Mann auf sie zu und bat um den Kotillon.
Einen Augenblick war sie versucht, zu erwidern, daß sie vergeben sei, aber ehe sie noch darüber entschied, hatte sie schon unwillkürlich ja gesagt.
Jene junge Frau war auch anwesend, doch wechselte Delnitzky diesmal keine zehn Worte mit ihr. Während einer Tanzpause kam eine ihrer Freundinnen auf Sylvia zu und hängte sich in sie ein:
»Komm, laß uns ein wenig auf und ab gehen – ich habe Dir etwas zu erzählen –«
»Das wäre?«
»Ich bin vorhin von einem Verliebten zur Vertrauten erkoren worden. Zwar kein gar lustiges Amt – man ist in solchen Angelegenheiten lieber der Gegenstand … aber, da es sich um Dich handelt – von der man weiß, daß Du meine liebste Freundin bist… kurz, ich bin nicht neidisch. Hast Du gesehen, mit wem ich die letzte Quadrille getanzt? …«
»Ja, mit Delnitzky … und ich sah ihn eifrig mit Dir sprechen –«
»Was er mir so eifrig sagte, war, daß er sterblich in Dich verliebt ist; daß er Dich aber für kalt und ablehnend hält. Gestern habe er – in seiner Verzweiflung – versucht, einer anderen den Hof zu machen … er hatte sich vorgenommen, Dich zu meiden – doch heute war dieses Vorhaben wieder umgestoßen; er hielte es nicht aus … Und er bat mich, Dich auszuforschen – klug und unmerklich auszuforschen, ob er hoffen dürfte. Ich entledige mich dieses Auftrags … freilich nicht gar klug und unmerklich – wozu auch? Du wirst auf jeden Fall aufrichtig mit mir sein? Nun?«
Sylvia zögerte mit der Antwort. Da fiel das Orchester mit einer rauschenden Walzermelodie ein und mehrere junge Leute traten mit auffordernder Verbeugung vor beide Mädchen hin.
»Freut euch des Lebens«, hieß der Walzer – und wahrlich: diesem von Meister Strauß in Dreivierteltakt erlassenen Gebot gehorchte Sylvia aus vollem Herzen, als sie sich nun von ihrem Tänzer durch den Saal wirbeln ließ.
Der Kotillon, die Krönung der schönen Ballnacht, brachte zwar keine förmliche Erklärung, aber ein durch Blick und Tonfall sich unzähligemal wiederholendes Bewerben und Gewähren. Auf einen Heiratsantrag hätte Sylvia sich Bedenkzeit erbeten, denn sie war durchaus nicht entschlossen, Delnitzkys Frau zu werden – dazu mußte sie ihn doch erst besser kennen lernen –, aber auf die stummen, lieberglühten Blicke gaben ihre Augen, ohne daß sie es hindern konnte, zärtliche Antwort, und seine leidenschaftszitternde Stimme, auch indem er die gleichgültigsten Dinge redete, weckte ein Echo in ihrer befangenen Gegenrede.
Nach dem Kotillon das Souper an seiner Seite – und dann der Aufbruch in den dämmernden Frühlingsmorgen hinaus; er war es, der sie in ihren Mantel hüllte, der ihr das Spitzentuch um den Kopf wand, der sie zum Wagen führte und ihr einsteigen half – mit langem, bebendem Händedruck.
An all das dachte Sylvia zurück. Jetzt war alles besiegelt, er hatte ihre Hand begehrt und sie hatte ja gesagt; er hatte sie geküßt und sie hatte seinen Kuß erwidert …
Und so war es denn Sylvia ergangen, wie dem ersten besten »Komtessel«, dessen ganzer geistiger Horizont von den Begriffen: Ball, Courmacher, »Passion«, »glänzende Partie« umgrenzt ist. Und doch wie ganz anders war sie geartet. »Ihre Interessen umfaßten eine ganze Welt von Ideen, Kenntnissen und Zeitfragen; an den Bestrebungen und Plänen ihrer Mutter und ihres Bruders hatte sie stets ernsten Anteil genommen. Obwohl von diesen beiden nicht zur tätigen Mitarbeit herangezogen, war ihr doch Einblick in deren Denken und Fühlen gegeben, und auch sie war ein ernstes, von hohen Idealen erfülltes Menschenkind geworden. Und wenn sie von ihrer Zukunft träumte, so pflegte sie sich an der Seite irgend eines bedeutenden Mannes – Gelehrter oder Staatsmann – zu sehen, der seiner Zeit seinen Stempel aufdrücken würde, und der befähigt wäre, diesen Stempel so zu formen, daß den Zeitgenossen wieder um eine Stufe herauf geholfen würde, auf der Skala der Veredlung und Beglückung.
Und jetzt? Jetzt war sie bereit und entschlossen, ihr Leben mit einem Mann zu teilen, von dessen Charakter sie eigentlich nichts, garnichts wußte; von dem ihr keinerlei Bürgschaft geboten war, daß er ihre Träume erfüllen, daß ihm jemals eine hervorragende und einflußübende Rolle zufallen würde, daß er überhaupt ein – Edelmensch sei. Dieses von Tilling geprägte Wort war im Hause geläufig geblieben. Und an ihrem Bruder besaß Sylvia das Urbild aller Eigenschaften, die zu jenem Titel berechtigen; von Toni Delnitzkys Eigenschaften kannte sie eigentlich nur die, daß er ihr Herz in seliger Unruhe pochen gemacht, daß er rasend verliebt schien, und daß er der eine Mann, der einzige auf Erden war, nach dessen Kuß ihre Lippen sich sehnten. Sie war aber nicht verblendet, sie dichtete ihm nicht alle Tugenden an, wie das naiv Verliebten sonst Brauch ist. Sie gab sich Rechenschaft darüber, daß sie dem Bann einer Leidenschaft verfallen war. Es war aber ein so starker und so süßer Bann, daß sie garnicht versuchen wollte, dagegen anzukämpfen. Wozu auch? Es band sie keine andere Pflicht, sie brach niemandem die Treue; – sie setzte nur eines aufs Spiel: ihr eigenes Glück. Das Glück späterer Jahre. Nun, diesen Einsatz konnte sie wagen; war ihr das Glück der gegenwärtigen Stunde und der nächsten Zukunft sicher und fühlte sie doch, daß sie höchstes Glück gewährte, daß sie dem geliebten Freier mit ihrem »Ja« eine beseligende Gabe gereicht, während ihr »Nein« ihm schier unerträgliches Leid zugefügt hätte. Sie empfand, daß sie durch diese Verlobung aus der Alltäglichkeit in ein ungeahntes Fest – in eine Lebens-Sonntagsstimmung gehoben war, aus der sie nicht willkürlich sich herausreißen konnte, ehe die Festnummern absolviert waren, die auf dem rosa Programm prangten …
Lange noch stand Sylvia am offenen Fenster und sog die balsamische Nachtluft ein. Jeder Atemzug Freude, jeder Pulsschlag Lebensgenuß.
III.
Martha hatte ihren Sohn bitten lassen, auf ihr Zimmer zu kommen, sie habe mit ihm zu sprechen.
Rudolf folgte dem abgesandten Diener auf dem Fuße:
»Was steht zu Befehl, Mutter?«
Baronin Tilling saß in einem an ihr Schreibzimmer anstoßenden runden Erker. Der kleine Raum enthielt nur ein Miniatursofa an der linken Wand und einen niedern Schrank an der rechten. In der Mitte, dem Eingang gegenüber, Marthas Fauteuil, davor ein drehbarer Lesetisch, und rechts daneben ein zweites Tischchen. Auf diesem die Tageszeitungen, ein Arbeitskorb, Fächer, Flacon, Blumenvase und ein Photographierahmen mit Tillings verblaßtem Bild. An den Wänden hingen noch mehrere Bilder des verlorenen Gatten in verschiedenen Aufnahmen und Größen. Darunter auch ein gemaltes lebensgroßes Kniestück, von der Hand eines berühmten französischen Künstlers. Dieses Porträt war aber unvollendet. Begonnen im Sommer 1870, einige Wochen vor Ausbruch des Krieges, konnte es nicht ausgeführt werden, weil sich der Maler zu den Fahnen stellen mußte. Dennoch, so wie es war, zeigte es schon die sprechendste Ähnlichkeit.
Der niedere Schrank, kunstvoll aus Ebenholz geschnitzt und mit Elfenbein eingelegt, war mit Andenken an Tilling bedeckt und angefüllt. Da standen zwei Kassetten aus oxydiertem Silber mit den gravierten Jahreszahlen 1864 und 1866. Es waren die Briefe, welche Tilling von den dänischen und den böhmischen Schlachtfeldern an seine Frau geschrieben, und in einem kleinen goldenen Kästchen lag der erste Brief, den sie überhaupt von ihm bekommen – geschrieben am Sterbelager seiner Mutter. In dem Schranke waren auch die blauen Hefte aufbewahrt, das sogenannte »Protokoll«, worin die Gatten im Verein die Chronik der Friedensidee eingetragen hatten.
In diesem Winkelchen hielt sich Martha täglich mehrere Stunden auf; hier las sie ihre Bücher und Zeitungen, oder zog die Fäden einer Stickerei, dabei an den Verlorenen denkend.
Mit den Worten: »Was steht zu Befehl?« küßte Rudolf seiner Mutter die Hand. Dann setzte er sich auf das kleine Sofa.
Wohlgefällig blickte Martha auf ihren Sohn – ein Bild männlicher Jugendfrische und Vornehmheit. Er trug einen lichten, sommerlichen Morgenanzug, der seine sonngebräunte Hautfarbe noch dunkler erscheinen ließ. Tiefschwarz das kurzgeschorene, in drei Zacken in die Stirn gepflanzte Haar; schwarz der schmale Schnurrbart, der den schöngezeichneten Mund frei läßt, schwarz auch und leicht gekräuselt der spanisch zugestutzte Kinnbart. Nur die dicht bewimperten Augen unter den dunklen Brauen sind blau. Edelgeformt das Profil; die Gestalt geschmeidig und schlank und beinahe sechs Fuß hoch, aristokratische Hände und Füße. – Mit Recht galt Rudolf Dotzky als einer der hübschesten Männer des an schönen Männererscheinungen nicht armen österreichischen Hochadels. So ungefähr hatte auch der junge Husar ausgesehen, der das Herz der siebzehnjährigen Martha Althaus im Fluge erobert hatte. Die Züge waren jedenfalls ähnlich, jedoch viel durchgeistigter. Und in Sprache und Tonfall hatte Rudolf vieles von seinem Stiefvater angenommen, so waren ihm manche seiner Bewegungen, seine Art zu lachen und ein paar norddeutsch anklingende Redewendungen hängen geblieben.
»Ich wollte mit Dir über zwei wichtige Dinge sprechen, Rudolf.«
»Auch ich will Dir eine Mitteilung machen. Doch nachher … Zuerst Du…«
»Also, erstens: Delnitzky hat um Sylvias Hand angehalten.«
»Habe mir’s gedacht.«
»Sie liebt ihn und ist entschlossen, ihn zu nehmen. Zwar habe ich mir meinen künftigen Schwiegersohn anders geträumt – was ist Deine Ansicht?«
»Mein Gott, ich kenne den Toni nur wenig … Ich könnte nichts Übles von ihm sagen, habe auch nie Übles über ihn gehört … Und wenn sie ihn gern hat –«
»Ich halte ihn für oberflächlich, für unfähig, auf die Ideen und Gesinnungen einzugehen, die meine Kinder hegen.«
»Vielleicht wird Sylvia ihn beeinflussen –«
»Das dacht’ ich im ersten Augenblick auch … Daß sie für einander schwärmten, bemerkte ich schon lang – besonders seit jenem »Jungen-Herren-Ball« … Und Delnitzky ist ja ein lieber, guter Mensch, ein Gentleman … … Aber seit die Entscheidung gefallen, steigen mir die Zweifel auf… Meines unvergleichlichen Friedrich Kind … das gönne ich keinem, der nicht so ist wie er gewesen… Aber gibt es einen solchen? … Und verlieren werden wir sie…«
»Ich glaube nicht, daß unsere Sylvia sich uns entfremden wird. Wir drei sind mit zu vielen Herzens-und Geistesfasern miteinander verwachsen, als daß uns etwas auseinander reißen könnte. Auch die Ehe nicht … Sieh mich, zum Beispiel…«
»Ja Du, mein Rudolf! … Reden wir jetzt von Dir. Das ist der zweite Gegenstand, den ich auf dem Herzen hatte. Du hast gestern, beim Tauffest, Worte gesprochen, die tiefen Eindruck auf mich gemacht haben – die klangen wie eine geliebte, längstverstummte Stimme –«
»Und darum brachst Du in Tränen aus? … Was sagte ich? Ich erinnere mich nicht –«
»Desto genauer erinnere ich mich – jedes Wort hat sich mir eingeprägt … »So lange wir uns an die Vergangenheit klammern, werden wir Wilde bleiben« – sagtest Du – »Aber schon stehen wir an der Pforte einer neuen Zeit – die Blicke sind nach vorwärts gerichtet, alles drängt mächtig zu anderer, zu höherer Gestaltung – schon dämmert die Erkenntnis, daß dieGerechtigkeitals Grundlage alles sozialen Lebens dienen soll und aus dieser Erkenntnis wird die Menschlichkeit erblühen – die Edelmenschlichkeit …« Aber, Rudolf, die Zukunft wird nur eine andere, wenn die Gegenwart zu vorbereitender Handlung ausgenützt wird. Willst Du nicht handeln?«
»Ja, ich will. Das war es eben, was ich Dir mitzuteilen hatte. Was ich vor mir sehe, ist dies: ein Sitz im Abgeordnetenhause. Die Schaffung – vielleicht die Führerschaft einer neuen Partei. Daneben publizistische Tätigkeit … In Bressers Blatt wird mir allwöchentlich eine Spalte offen stehen –«
»Und da wirst Du die Friedens-und Abrüstungsidee vertreten? Wie mich das beglückt! Du weißt ja, daß sich eine interparlamentarische Union gebildet hat – da könntest Du im österreichischen Parlament auch eine Gruppe zu bilden trachten –«
»Ich habe ein umfassenderes Programm im Sinn. Damiteinegroße Wandlung angebahnt werden könne, müssen zehn andere große Wandlungen gleichzeitig angestrebt werden.«
Martha schüttelte den Kopf.
»Gewiß,« sagte sie, »jede Wandlung ist von anderen bedingt, und zieht andere mit sich – ob aber ein Mensch zugleich nach allen verzweigten Richtungen streben soll? Wo bleibt da die Arbeitsteilung?«
»Es gibt Dinge, die sich nicht teilen lassen, die ein großes Ganzes sind – z. B. eine Weltanschauung. Je mehr ich mich umsehe im ganzen öffentlichen Leben, je deutlicher erkenne ich, daß das, was not tut, eben dies ist: eine neue Weltanschauung – eine neue Orientierung. Nicht Schrauben und Masten sind an dem Schiffe zu ändern, auf daß es besser segele – der Kurs muß ein anderer werden. Denn in seiner jetzigen Richtung gleitet es nach einem Maelstrom, der es in die Tiefe ziehen wird –«
»Und Du allein, mein Sohn, willst der Lotse sein, der solche Kurswendung erreicht? Dein Ehrgeiz ist hoch.«
»Ehrgeiz?« – Rudolf machte eine wegwerfende Handbewegung – »Nein, den hab’ ich nicht. Ich weiß ganz gut, daß das, was man unter Ehren und Würden versteht, nicht auf Pfaden zu holen ist, die man erst aushauen muß –«
»Und aus welchem Anlaß hast Du Dich gerade jetzt zum Handeln entschlossen?«
»Mein dreißigstes Jahr ist vollendet – die Lehrlingszeit ist vorüber – und dann, vielleicht auch die gestrige Feier … Als ich es aussprach, daß wir uns der Söhne und Enkel würdig zeigen müssen, da mahnte mich das Gewissen, daß ich selber noch nichts dazu getan. Wie soll ich hoffen, daß mein Sohn einst meine Arbeit fortsetzt, wenn ich die Aufgabe nicht erfüllt hätte, die ich von meinem Vater übernommen –«
»Von Deinem Vater? –«
»Ach, verzeih – meinen wirklichen Vater habe ich ja nicht gekannt und in meinem Heizen habe ich stets diesen« – er zeigte auf das Bild an der Wand – »so genannt.«
»Das hat er auch verdient…«
»Und billigst Du meinen Entschluß?«
»Ich sagte schon: er beglückt mich. Nur das eine fürchte ich: – daß Du ein zu weites Feld bebauen willst, und dadurch vielleicht gerade die Pflanze vernachlässigen wirst, deren Pflege »er« mit einem Blick auf das Bild – »uns hinterlassen hat. Ich meine jene ganz bestimmte, umgrenzte Bewegung –«
»Ich weiß, was Du meinst: Schiedsgericht – Weltfrieden– – und das nennst Du umgrenzt? Es bedeutet nichts geringeres als die Umwälzung aller landläufigen Erziehung, Politik, Moral, Gesellschaftsordnung – kurz, eine ganze Revolution. Und bemerkst Du nicht, daß wir in einer Zeit leben, in welcher auch wirklich auf allen Gebieten revolutioniert wird? Seit zehn Jahren etwa ist in Deutschland eine »Revolution der Literatur« ausgebrochen; die bildende Kunst nennt ihren Aufstand »Sezession«; die Frauen heißen den ihrigen Emanzipation und die Proletarier – Sozialdemokratie, und so nach allen Seiten – –«
»Nicht jeder, der eine neue Zeit ersehnt, braucht aber auf allen Seiten mitzuarbeiten. Jeder hilft dem andern am besten, wenn er die eigene Aufgabe gut erfüllt.«
»Du, Mutter, interessierst Dich eben nur für die eine Frage – und nicht für den Umschwung in Literatur und Kunst – nicht für die Frauen-noch Arbeiterbewegung?«
»Interessieren? Doch? Wer am Wandel der Zeit Anteil nimmt, der horcht und blickt überall mit Spannung hin … aber kämpfen und wirken, das möchte ich nur in einer Richtung – und wie Du weißt, so weit meine Kräfte reichen, habe ich’s ja durch die Niederschrift meiner Lebensgeschichte auch versucht … In anderer Richtung fehlt mir das Verständnis – die Auffassungskraft. So gestehe ich Dir, daß mich die neue Kunst vielfach abschreckt … daß ich noch an allem hänge, was ich in meiner Jugend als bewunderte und als gut kennen gelernt … Ich habe nicht versucht, aus Sylvia eine »neue Frau« zu machen; ich bin zu alt, um zu –«
»Vielleicht ist das der Unterschied zwischen uns,« unterbrach Rudolf. »Ich bin jung … Ich bin aufgewachsen in der gärenden Atmosphäre, in dem Sturm der »Moderne« … Freilich wehte mich dieser Sturm zumeist nur aus Büchern und Zeitungen an, – denn die Menschen, mit denen wir verkehren, die leben noch so sehr in den alten Anschauungen und Gewohnheiten, die wissen gar nicht, daß die Welt sich bewegt. Höchstens fühlen sie, daß ein miserabler Plebs an der schönen alten Ordnung zerren will – und das wehren sie verächtlich ab. Bis auf den alten Grafen Kolnos kenne ich aus unseren Kreisen gar keinen Menschen mit modernen Ideen. Es gibt deren gewiß ein paar Dutzend, aber ich kenne sie eben nicht.«
»Von Kolnos habe ich heute einen lieben Brief bekommen,« sagte Martha. »Der ist wirklich ein merkwürdiger und herrlicher Typus. Aber nicht, was ich unter modern verstehe: nichts von Dekadententum, nichts von raffiniertem Übermenschentum, nichts von tempelschänderischen Gelüsten.«
»Du mußt nicht gerade die krankhaften Erscheinungen des modernen Geistes ins Auge fassen, Mutter –«
»Freilich, Du hast recht; die meisten Mißverständnisse kommen auch daher: jedes Ding hat so verschiedene Aspekte – und zwei Menschen, die im Grunde eigentlich gleicher Meinung wären, streiten über eine Sache, für die sie nur einen Namen haben, die sie aber von zwei ganz verschiedenen Seiten betrachten … Wovon sprachen wir eigentlich?« »Von Kolnos –«
»Ja, richtig … Wo habe ich seinen Brief? – Ah, da… er hat mir sein neuestes Gedicht geschickt… da lies: er kennt meine schwache Seite, wie Du siehst, sein Lied ist gegen die Kanonen gerichtet.«
Rudolf nahm das Blatt und überflog es. Das dreizehn Strophen umfassende Gedicht, betitelt: »Nach X-tausend Jahren«, schildert eine Szene der fernen Zukunft, da man in dem vergletschert gewesenen Europa alte Funde ausgräbt und darüber Forschungen anstellt, um den Lauf der Kulturentwicklung zu erkunden:
Gelehrte schreiben dicke Bücher Und streiten sich wie heute auch, Um Wert und Schönheit der Antike Und ihrer Werke Nutzgebrauch.
Nun findet man ein rätselhaftes Instrument, über dessen Bestimmung man sich die weisen Köpfe zerbricht. Es ist ein dickes Metallrohr. Sollte es eine Riesenorgelpfeife, ein prähistorisches Flötenstück oder ein Trinkhorn für Giganten gewesen sein? Oder ein mystisches Symbol – sogar in finsteren Zeiten der Gläubigen Götze? Endlich ward ein Stein entziffert, worin die Erklärung eingegraben war. Darauf wäre man freilich von selber nie gekommen: man brauchte das Rohr zum Massenmorde, euphemistisch Krieg genannt:
Und weil der Totschlag gut kanonisch, (Das Mittel heiligte den Zweck) So nannte man das Ding Kanone Und blies damit den Gegner weg.
Robert gab das Blatt zurück.
»Nun, ich sag’s ja: ein moderner Mensch, dieser hohe Sechziger. Denn sein Blick ist nach der Zukunft gerichtet. Er weiß, daß wir in Wandlung begriffen sind. Er schaut erkennend und sehnend nach vorwärts, während meine verehrten Genossen, wenn sie schon Ideale haben, sie immer nur in der Vergangenheit sehen. Die meisten sehen überhaupt nicht weiter als ihre Nase.«
»Dabei sind aber diese Menschen ihrer Anlage nach vielleicht gerade so gescheit wie Du, mein Lieber. Es kommt nur darauf an, auf welche Gedankenpfade, auf welche Kenntnisfelder man zufällig geraten ist. Erziehung ist alles. Und nicht nur Kindererziehung – auch die der Erwachsenen. Tilling hat erst mit vierzig Jahren über gewisse Dinge nachzudenken begonnen – über die ihm dann so weite Horizonte aufgegangen sind.«
»Du denkst doch immer und immer wieder an ihn,« sagte Rudolf in leisem, ehrerbietigem Ton.
Martha hob den Blick zum Himmel:
»Immer. Ich bin stolz darauf, an mir erfahren zu haben, daß es eine Liebe gibt, die stärker ist als der Tod.«
IV.
Ein heißer August-Nachmittag. Die Hitze hindert aber die Bewohner von Brunnhof nicht, sich am Tennisspiel zu ergötzen.
Der Spielplatz liegt in einem um diese Stunde von der Sonne unbeschienenen Teil des Parkes. Von hier ist die Rückseite des Schlosses in Sicht, mit seinen in das Parterre führenden Terrassen. In der Mitte ein großes Wasserbecken, aus welchem ein Springbrunnen steigt. Rings in künstlerischer Anordnung farbenprächtige Teppichbeete. Eben war ein Gärtnergehilfe beschäftigt, den Wasserschlauch auf diese Beete zu richten, die unter dem belebenden Strahl verstärkte Düfte aussandten, die von der schwülen Luft bis zum Tennisplatz, getragen wurden. Unter den gemischten Wohlgerüchen herrschte der etwas betäubende Hauch einiger in der Nähe blühender Vanillensträucher vor. Ein eigentümliches Licht lag auf dem Grün des Rasens und der Bäume. Jene lackierte, theatereffektmäßige Färbung, die den Leuten den Ausruf abzuringen pflegt: »Seht doch! … die sonderbare Beleuchtung …«
Es war zufällig dieselbe Gesellschaft, die beim Tauffest versammelt gewesen, noch vermehrt durch die Gegenwart der jungen Schloßherrin, die jetzt schon vollkommen hergestellt war und auch schon die von ihrer Mutter ihr so dringend empfohlene Wallfahrt nach Mariazell hinter sich hatte.
Man saß da, zur Seite des Tennisplatzes, auf einer Reihe von Bänken und sah den vier Spielenden zu: Sylvia und ihr Bräutigam; Rudolf und der junge Bresser.