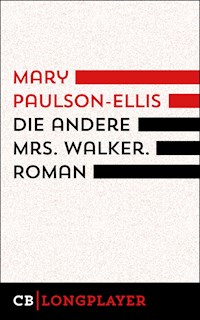16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Solomon Farthing ist ein Edinburgh-Mann, ein Erbenjäger, der Angehörige von Toten aufspürt, die etwas hinterlassen haben. Menschen sind auf die seltsamste Weise miteinander verbunden, besonders in einer Stadt wie Edinburgh. Wenn also ein alter Soldat im Pflegeheim stirbt und im Futter seines Anzugs ein kleines Vermögen steckt, ist das ein Fall für Solomon Farthing. Nur dass dieser Fall ein großes Fass aufmacht: Was geschah wirklich im November 1918 in Nordfrankreich, als Captain Godfrey Farthing sich bemühte, seine kleine versprengte Truppe junger Männer lebendig durch die letzten Wehen des großen Schlachtens zu bringen – jenes Krieges, der alle Kriege beenden sollte? »Ein Gegenwartsroman mit Wurzeln in dunkler Vergangenheit: Die bissig-heitere Story von Solomons Schatzsuche wechselt mit Kapiteln, die in den letzten Wochen des Ersten Weltkriegs an der Westfront spielen und anders klingen: düsterer, realistischer, einfühlsamer, kalt und zutiefst wahr. Diese Autorin hat ein echtes Talent für tiefgründige und komplex verzweigte Krimis.« The Scotsman »Die mitreißende Erzählung, die zwischen Gegenwart und Ende des Ersten Weltkriegs pendelt, folgt dem zwielichtigen Erbenjäger Solomon Farthing auf Beutezug. Ein genial gewebter, anspielungsreicher und berührender Plot.« Woman and Home
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 588
Ähnliche
Das Buch
Solomon Farthing ist ein Edinburgh-Mann, ein Erbenjäger, der Angehörige von Toten aufspürt, die etwas hinterlassen haben. Menschen sind auf die seltsamste Weise miteinander verbunden, besonders in einer Stadt wie Edinburgh. Wenn also ein alter Soldat im Pflegeheim stirbt und im Futter seines Anzugs ein kleines Vermögen steckt, ist das ein Fall für Solomon Farthing. Nur dass dieser Fall ein großes Fass aufmacht: Was geschah wirklich im November 1918 in Nordfrankreich, als Captain Godfrey Farthing sich bemühte, seine kleine versprengte Truppe junger Männer lebendig durch die letzten Wehen des großen Schlachtens zu bringen – jenes Krieges, der alle Kriege beenden sollte?
»Ein Gegenwartsroman mit Wurzeln in dunkler Vergangenheit: Die bissig-heitere Story von Solomons Schatzsuche wechselt mit Kapiteln, die in den letzten Wochen des Ersten Weltkriegs an der Westfront spielen und anders klingen: düsterer, realistischer, einfühlsamer, kalt und zutiefst wahr. Diese Autorin hat ein echtes Talent für tiefgründige und komplex verzweigte Krimis.« The Scotsman
Die Autorin
Mary Paulson-Ellis lebt in Edinburgh. Die frühere Drehbuchredakteurin, Kunstkuratorin und Reiseleiterin studierte Politik und Soziologie. Ihre ganz eigene Erzählweise verknüpft Krimi mit Geschichtsepos, sie sondiert biografisch-historische Spuren und legt erzählerische Fährten durch Jahrhunderte. Paulson-Ellis ist regelmäßig bei BBC Radio Scotland zu hören und rezensiert, was Fernsehen, Film, Theater, Kunst und Bücher aktuell zu bieten haben. Ihr Debüt »Die andere Mrs. Walker wurde« wurde auf Anhieb ein Durchbruch, derzeit schreibt sie am vierten Roman.
Die Übersetzerin
Mary Paulson-Ellis
Das Erbe von Solomon Farthing
Roman
Für Jack, in Liebe Und für meinen Vater,
Solomon Grundy Geboren am Montag Getauft am Dienstag Getraut am Mittwoch Erkrankte am Donnerstag Ward schlimmer am Freitag Starb am Samstag Begraben am Sonntag Das war das Ende von Solomon Grundy Kinderlied
Vorbemerkung von Else Laudan
In Edinburgh stirbt ein alter Mann im Pflegeheim, ohne Testament und ohne Angehörige. Da wittert der absturzgefährdete Erbenjäger Solomon Farthing seine Chance, sich aus einer Pechsträhne und von seinen Spielschulden zu befreien.
Mary Paulson-Ellis hat es faustdick hinter den Ohren. Es steckt viel schottische Seele in der Story um den schwulen Selfmademan Solomon. Mit federleichtem Sarkasmus kommt sie daher, wobei die Fehltritte des titelgebenden Erbenermittlers durchaus liebevoll die Wirrungen des Menschseins reflektieren. Aber dann zieht die Schriftstellerin andere Saiten auf, stellt uns eine kleine Truppe Versprengter des britischen Empire vor, und daraus entspinnt sich ein prickelnder Reigen männlicher Sozio- und Psychogramme des 20. Jahrhunderts. Am Ende kennen wir nicht nur ihre Schwächen und den Inhalt ihrer Taschen, sondern auch die Lösung so manchen Rätsels, das Solomon Farthing auf seiner Jagd nach dem Stammbaum eines Toten zutage gefördert hat. Denn der Verstorbene war nicht ganz das, was er zunächst schien – aber wer ist das schon?
Eine epische Reise durch Verdrängtes und Verschwiegenes, voller Schnipsel wunderbaren Wissens, ein Fest für Lesende, die gern Welten im Kopf zurückbehalten.
Der Anfang
Am Ende war es einer, dabei hätten es zwei sein sollen, tot, hingestreckt zwischen den Walnussschalen, die Haut schon blau. Überm Herzen des Toten blühte eine prachtvolle Rose, da auf seinem zweitbesten Hemd, leuchtend inmitten des Verfalls. Die Verbliebenen schauten weg, dachten an den einen, der hier sein sollte, es aber nicht war, von Lungen wie Eisflügeln am Grund eines Flusses gehalten, wohin ihm nun keiner von ihnen mehr folgen musste. Über ihnen hockten Vögel stumm im Geäst. Der Himmel am Horizont war grau. Es war Morgen. Bald würde es dämmern.
Am Ende losten sie aus, wer zuerst wählen durfte:
ein Wünschelknochen;
ein Sixpencestück;
eine Spule rosa Garn.
Bevor die Übrigen dann auch zum Stöbern kamen. In den Brusttaschen. Den Gesäßtaschen. Den verborgenen Innentaschen an den Nieren und in der Leiste. Der Tote lag widerstandslos da, während die Männer ihre Hände eintauchten. Alles war klebrig. Sie wischten die Handflächen an feuchter hellbrauner Wolle ab und befingerten den Rest des Schatzes:
zwei Würfel;
das grüne Band;
ein Segeltuchheftchen mit Näh- und Stecknadeln.
Sie alle rochen es. Kordit. Und die Kugel, die nun in dem Toten steckte.
Am Ende begruben sie ihn, bevor sie weggingen. Nicht tief, nur eine flache Mulde, geformt wie der Umriss eines Hasen, unter gefallenen Walnussschalen. Ihre Herzen hämmerten – eins-zwei, eins-zwei –, während sie an dem Loch herumkratzten. Sie hinterließen kein Kennzeichen, nur der Matsch an ihren Stiefeln erzählte die Geschichte. Und der Schatz, der als Letztes aus des toten Mannes Taschen auftauchte:
Pfandschein Nr. 125. Dieses kleine blaue Rechteck.
Schließlich zogen die Verbliebenen weiter, im Gänsemarsch über die Felder, geräuschlos bis auf das leise Klötern der Waffen beim Gehen. Keiner von ihnen blickte dahin zurück, woher sie gekommen waren. Keiner von ihnen schaute nach vorn, wohin sie gingen. Nur einer von ihnen blieb noch, um zu beten.
Ein dünner rosa Streifen befleckte den Himmel, als er die Augen schloss und an Felder voller Butterblumen und zwei Sorten Klee dachte. An Luft, so rein wie der Fluss am Fuß des Hügels. Dann das Geflüster der Männer, als sie in ihren Taschen fischten – ein Würfel, ein Penny, ein dicker Stummel von Bleistift. Die Karte in seiner Brieftasche, Mir geht es recht gut als Einziges noch nicht durchgestrichen.
Und er fragte sich, was auf der Karte stehen würde, wenn es vorbei war. An wen sie geschickt werden würde. Und schlug die Augen auf, als Licht seine Haut berührte. Die Morgenröte kroch tief am Horizont heran. Es war November. Das Ende würde bald da sein.
ERSTER TEIL
2016
Eins
Sie nannten ihn Old Mortality. Nach dem Buch. Aber hier zu stranden hatte er denn doch nicht erwartet. Mit dem Gesicht nach unten auf einer Matratze, die nach Urin stank. Nichts zwischen ihm und dem Fußboden als eine Pritsche aus kaltem Beton. Es war Mai, über der stolzen Stadt Edinburgh zog die Morgendämmerung herauf. Doch Solomon Farthing konnte keine Gardinen aufziehen und sie bewundern, denn er war schon in der Gosse gelandet – kein Geld, keine Freunde, keine Wertschätzung –, was von ihm übrig war, sabberte den Steinboden einer Arrestzelle voll, und es gab nicht mal eine Flasche Fino zum Wegspülen der Würdelosigkeit seines Lebens.
»Hopp hopp, hoch mit euch, ihr Nichtsnutze! Aufstehen und feinmachen.«
Draußen vernahm er das Rumoren eines erwachenden Polizeireviers, das seinen Tagesbetrieb aufnahm. Drinnen spürte er das Stottern seines Herzens. Solomon drückte auf das weiche Fett um seine Brustwarze. Er war kein gesunder Mann, das wusste er nur zu gut, ein Wrack aus Gedächtnislücken und Fehltritten, mit gereizter dünner Haut innen wie außen.
Sein jüngstes Dilemma war auch nicht gerade förderlich, wobei er nur aufgrund eigenen Handelns jetzt ohne Schnürsenkel in einer Arrestzelle lag. Was hätte sein Großvater davon gehalten, ein Mann, für den Ehrbarkeit mit dem Auf- oder Zuknöpfen eines Kragens stand und fiel. Und doch war sein Nachkomme nun hier, sechsundsechzig Jahre alt, Tendenz steigend, mit heraushängendem Hemd, die Hosensäume schlammverdreckt. Und die Knie auch.
Dann plötzlich das Schlurfen schwerer Stiefel, zwei Polizisten kamen den Gang entlang und polterten im Vorbeigehen gegen jede Metalltür.
»Zeit zum Aufstehen, Gentlemen.«
Solomon setzte sich auf, leckte eine Handfläche an und fuhr sich damit übers Haar. Er hoffte, dass Detective Inspector Roberts, ehemals Rechercheeinheit, Lakai von DCI Franklin, ihm zur Strafe die Leviten lesen kam. Eine Verwarnung. Eine kleine Geldstrafe. Ein Klaps auf die Finger. Oder mit etwas Glück die unverzügliche Entlassung aus der Tür des Polizeireviers Gayfield in eine elegante Edinburgher Grünanlage. Dieser alte Tummelplatz von Prostituierten und Strichern, erster Wohnsitz jener Immigranten der ersten Generation, die ins Athen des Nordens kamen, um ihre Träume aufzupolieren. Nun natürlich gentrifiziert. Fünfhunderttausend und mehr für vier Zimmer. In Edinburgh mit seiner undurchsichtigen Vergangenheit fand sich immer ein Weg, bei dem irgendwer profitierte.
Solomon zog seine knittrigen rosaroten Socken über den Knöcheln straff und versuchte die Falten eines durchgesumpften Wochenendes zu glätten. Wann genau war er falsch abgebogen?, fragte er sich. Ein echter Edinburgh-Mann mit zumindest dem Anschein eines Berufs sowie der Gabe, die Gezeitenströme des Lebens zu seinem Vorteil zu nutzen, jetzt jedoch aufgeschmissen, fast wie ein im Unwetter ausgesetztes Waisenkind. Sein Hilfeersuchen an die einzige verbleibende Verwandte in der Stadt – eine Tante, die eigentlich nicht seine Tante war – hatte nichts bewirkt als Funkstille. Kein Anruf bei einem Rechtsanwalt. Kein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung. Noch nicht mal frische Kleidung. Solomon schnupperte verstohlen erst an der einen, dann an der anderen Achselhöhle und wartete auf Erlösung in Gestalt eines Polizisten, dem er vielleicht einst, vor langer Zeit, einen Gefallen getan hatte. Es war noch gar nicht so viele Jahre her, da hatte er alle Polizisten der Stadt gekannt – auch beim Vornamen:
Eine Hand wäscht die andere.
Die Fähigkeit, jemanden zu umgarnen, eine von Solomon Farthings wertvolleren Eigenschaften, wobei selbst er wusste, dass sie inzwischen am seidenen Faden hing.
Doch als die Luke geöffnet wurde, kannte Solomon die ausdruckslosen Augen nicht, die ihn durch das Loch in der Tür anstarrten. Weiblich. Jung. Kritisch. Alles, was er nicht war. Die Polizistin betrachtete ihn etwas länger, als angenehm war, dann verschwand sie, bevor Solomon um irgendetwas ersuchen konnte. Einen Schiss. Eine Rasur. Ein Guten Morgen. Von Frühstück gar nicht zu reden. Nicht mehr als die ganz normalen Freuden des Lebens.
In der Zelle nebenan erhob sich ein Stöhnen, dasselbe urige Wehklagen, das ihn den Großteil des Wochenendes wach gehalten hatte.
»Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du Arsch.«
Dann eine Pause. Solomon wartete (die Illusion einer Hoffnung). Dann die Wiederholung.
»Oh Mann, oh Mann, oh Mann …«
Du Arsch.
Was gab es da noch hinzuzufügen?
Der Fehltritt hatte ganz normal angefangen. Ein Versuch, Geld zu machen. Hastig, um ja der Erste zu sein. Nur darauf kam es an, wenn man Erbenermittler war, Jäger all dessen, was zurückblieb, wenn jemand ohne Testament verstarb.
Immobilien waren der Schlüssel, besonders in einer Stadt wie Edinburgh. Vierzimmerwohnung zu verkaufen; fünfhunderttausend Pfund zum Aufteilen unter den Hinterbliebenen. Die Provision war der Ertrag. Zehn Prozent. Zwanzig Prozent. Manchmal sogar dreißig, wenn es gut lief. Das Wichtigste – der Knackpunkt – war, die Immobilien aufzutun, die eine halbe Million und mehr wert waren. Und als Erster an ihnen dran zu sein.
Das Haus stand leer, zumindest war Solomon das gesagt worden. Eine stattliche Immobilie in einer ruhigen Wohngegend, der Eigentümer längst verstorben. Großzügige Einfahrt. Nach hinten raus unverschlossene Terrassentüren. Es war ein Tipp von Freddy Dodds, für gewöhnlich der verlässlichste von Solomons Edinburgh-Leuten, jemand, der ihm Gelegenheiten steckte und dafür als Erster eventuelle Kostbarkeiten abgriff, die niemand vermissen würde. Solomons Plan war simpel, die typische Masche des Erbenermittlers. Eine schnelle Erkundungstour durch die verlassene Immobilie, um den Wert zu schätzen, dann am nächsten Tag, bevor das Crown Office sich einschaltete, Anspruch auf die Erbmasse anmelden samt dem Angebot, Angehörige, die er auftat, beim Veräußern und Entrümpeln zu unterstützen. Fünfhunderttausend und mehr für vier Zimmer. Eine leerstehende Immobilie ohne ersichtlichen Eigentümer – das machte regelmäßig neun von zehn Fällen für einen Erbenermittler aus. Es hätte ein leichter Ein-Abend-Job sein sollen.
Das erste Problem war die Straßenbeleuchtung, die genau in die Lücke schien, durch die Solomon verschwinden musste, um von hinten ans Haus zu gelangen. Er stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite, atmete den kopflastigen Nachtduft von Flieder ein und versuchte auszusehen wie ein Mann, der die Natur wertschätzt, statt wie jemand, der dir kalt lächelnd deinen Nachlass raubt. Gehen. Oder bleiben. Das war hier die Frage. Solomons Instinkt riet ihm Ersteres. Doch obwohl er ein Laissez-faire-Typ war – was du heute kannst besorgen, wartet auch noch gern bis morgen –, wusste Solomon, dass er diesmal keine Zeit zu verlieren hatte.
Sein zweites Problem waren die Terrassentüren, die nicht aufgingen, als er sich zum Handeln durchrang: nicht länger gänzlich unverschlossen, wie Dodds ihm zugesichert hatte.
Das dritte war das Fehlen eines mehr als lukengroßen offenen Fensters zum Hindurchzwängen, als die Bewegungsmelder ihr grelles Leuchten aktivierten. Der ganze Garten urplötzlich zerschnitten in Schatten und blendende Helle. Es war Solomons Selbsterhaltungstrieb, der ihn anschob. Kopf voran, versteht sich.
Auf der Hälfte blieb er stecken. »Scheiße!«
Riss sich den Ärmel seines zweitbesten Hemdes auf. Schlitterte wehrlos auf den Boden einer kalten Toilette. Knallte mit dem Kopf gegen die Kloschüssel und fragte sich, was um alles in der Welt aus seinem Leben geworden war. Ein Mann, dessen Kinderstube fest vorschrieb, jeden Sonntag gewissenhaft die Schuhe zu polieren, Seite an Seite mit seinem Großvater in der Spülküche. Gottlob war der alte Herr längst tot, lag seit über vierzig Jahren im Grab.
Solomon kam sich vor wie selbst schon im Grab, als er sich hochhievte und in den trüben Spiegel starrte, der über dem winzigen Waschbecken hing. Er sah alt aus. Er sah verlottert aus. Er sah besoffen aus. Und alles traf zu. Seine linke Hand hörte nicht auf zu zittern, als er sie unter ein dünnes Rinnsal aus dem Hahn hielt und sich das kalte Wasser ins Gesicht spritzte. Es gab kein Handtuch zum Abtrocknen, also nahm er stattdessen den Zipfel seines zweitbesten Hemdes. Dann stand er an der Tür und horchte, als wäre er insgeheim wieder ein Kind, bevor er in den dunklen Flur hinaustrat.
Das Haus erwartete ihn – die Verheißung einer Schatztruhe, bereit zur Preisgabe ihrer Geheimnisse an den, der zuerst suchen kam. Vielleicht Kästen mit Silberbesteck. Familienporträts in verschnörkelten Goldrahmen. Eine Perlenkette. An derlei Dingen war Dodds interessiert. Von Solomons eigenem Anliegen ganz zu schweigen: vier Zimmer, bezugsfertig, der Traum aller Immobilienmakler. Er pirschte weiter, überprüfte jede Tür, an der er vorbeikam, ein lautloses Öffnen und Schließen der Zimmer, die einem Toten gehörten, wobei hier und da sein Spiegelbild dräute, wo überm Elektrokamin ein Spiegel hing. Jeder Zoll des Hauses war mit Teppich ausgelegt – Zimmer, Flure, Abstellräume und Kammern –, und Solomons ausgelatschte Lederschuhe sanken in den Flor ein, als kosteten sie von einem Luxus, der ihnen einst versprochen, aber nie gewährt worden war. Er merkte schon jetzt, dass das Haus jungfräuliches Gebiet war, noch hatten keine anderen Erbenermittler hergefunden und seinen Claim besudelt.
Er linste in einen Wäscheschrank, fuhr mit der Hand über alle Türrahmen und zog in der Küche jede Schublade heraus, in der Hoffnung auf Ersatzschlüssel. Doch es kam Solomon Farthing nicht in den Sinn, dass der einstige Bewohner noch anwesend sein könnte, im Salon aufgebahrt zwischen zwei Brokatstühlen.
»Himmel!« Solomon sprang schier das Herz aus der Brust, als er die Salontür aufschob und den Holzsarg mit den glänzenden Messinggriffen sah. Und dann gleich noch mal, als jemand ihm antwortete.
»Wer ist da?« Weiblich. Laut. Warnend. Eine Frau, die dort wachte und aufstand, als Solomon die Tür hastig wieder schloss.
Totenwache. Nannte man das nicht so? Solomon verweilte nicht für eine förmliche Vorstellung, er ergriff die Flucht. Sein Herz schlug wild eins-zwei, als die Frau ihm hinterherrief.
»Solomon Farthing?«
Er erreichte die Terrassentüren, jetzt offen, als wären sie es immer gewesen.
Auf der Terrasse fiel er hin. Dann nochmals auf dem Gras. Schaffte es bis zum Friedhof und dann, als Ablenkungsmanöver, auf der anderen Seite wieder hinaus, ehe die blitzenden blauen Lichter kamen, um ihn einzukassieren.
Erst als sie ihn in den Streifenwagen steckten, wobei die zerrissene Manschette ziellos um sein Handgelenk flatterte, wurde Solomon bewusst, dass er ihn verloren hatte. Den silbernen Glücksbringer, den er immer in der Tasche trug – womit alles, was von seiner Kindheit geblieben war, nun zwischen den Dielen eines Toten lag. Ein Regiments-Mützenabzeichen, ein Löwe mit erhobener Pranke. Und das Motto des London Scottish-Regiments:
Strike Sure. Trefft genau.
Zwei
Der Sheriff-Court, das Amtsgericht, lag im Herzen der Stadt. Fünf Gehminuten von der Burg mit ihren Soldaten und Kanonen. Vier von der Greyfriars Kirk mit ihrem Ehrenmal für die Gefallenen. Zwei vom Friedhof, wo Edinburghs Edelste einst Schlösser und Riegel einsetzten, um ihre Toten vor Leichendiebstahl zu schützen. An all diesen Stätten wimmelte es heutzutage von Touristen. Edinburgh hatte seit jeher eine Schwäche für Verblichene – hielt sie gern lebendig, wenn es ging.
Solomon wurde hinten im Streifenwagen zu seinem schmuddeligen Bestimmungsort gekarrt, aufs Neue fixiert von derselben unergründlichen Polizistin, die ihn früh am Morgen durch den Metallschlitz beäugt hatte.
PC Noble. So hatte der Diensthabende im Gayfield-Revier sie angesprochen. Was konnte der Stadt Besseres passieren?
Für Solomon Farthing sah PC Noble wie fünfzehn aus. Allerdings sah er für sie wohl schon halb tot aus. Während sie durch den morgendlichen Verkehr glitten, versuchte er Konversation zu machen. Warum nicht die Jugend umwerben, wo die Alten ihn schon im Stich gelassen hatten.
»Leben Sie in Edinburgh?«, fragte er.
PC Noble warf einen kurzen Blick in den Rückspiegel und sah wieder weg. »Kann sein.«
Kann sein. Was war das denn für eine Antwort?
Trotz der noch recht frühen Stunde herrschte im Zellenbereich unterhalb der Gerichtssäle schon reger Betrieb, und eine lange Reihe der Edelsten der Stadt warteten auf ihr Urteil. Nicht die Rechtsanwälte, Steuerberater, Banker oder Finanzberater, die einen bei einem Bierchen um alle Ersparnisse brachten. Sondern ein anderer Typ Edinburgh-Männer, die sich genau wie Solomon heute früh nicht rasiert oder seit Tagen nicht die Unterwäsche gewechselt hatten. Solomon hielt sich in der Zelle so weit wie möglich abseits, der Dunst der Großen Ungewaschenheit sättigte die Luft. In die Wand neben ihm waren unter einer dünnen Schicht Farbe tausende wütender Schimpfwörter graviert, geritzt und gekerbt. F- Wörter und A-Wörter und Wörter, die das Verlangen nach Gewalt in jeder möglichen Form ausdrückten. Solomon redete sich ein, er selbst wüsste im Fall des Falles seine Umstände deutlich wortgewandter auf den Punkt zu bringen. Eine Elegie darüber, was schiefgelaufen war und was noch gutgehen könnte, geschrieben auf Gefängnispapier, während rings um ihn die Habenichtse flatterten und fluchten. Unterm Strich mochte auch eine Kerkerhaft ihr Gutes haben. Denn was war Freiheit anderes als eine Geisteshaltung? Und sein Geist stand in letzter Zeit schwer unter Druck, heimgesucht von Sorgen, was er alles schuldete, wem und warum. Gefängnis könnte zu seinem Besten sein, ein Ort zum Innehalten.
Allerdings …
»Genießt du dein Wochenende?«
Einer von Solomons Mitgefangenen rutschte über die Bank zu ihm hin, ließ sich in unangenehmer Nähe nieder, Knie an Knie gepresst. Der Mann war jung genug, um Solomons Enkel zu sein, seine Haut grau genug, um sich in seinem kurzen Leben jede erdenkliche Droge reingepfiffen zu haben. Solomon blinzelte, als der junge Mann ihn angrinste und einen kompletten Satz nagelneuer, regelrecht blendender Zähne entblößte. Was war mit den Originalen passiert, dachte Solomon. Und wie hatte so ein Mann diesen Ersatz bezahlt? Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.
»Dodds lässt grüßen«, sagte der junge Mann und beugte sich noch näher, einen Hauch Verwesung im Atem. »Schlägt vor, dass du zum Tee vorbeikommst.«
Solomon spürte sofort eins-zwei die Startpistole in seiner Brust, roch wieder den Flieder und seinen kopflastigen nächtlichen Duft. Also doch kein wohlmeinender Tipp von Profi zu Profi. Sondern eine Botschaft. Eine Warnung. Vielleicht sogar eine Drohung. Freddy Dodds war ein Edinburgh-Mann mit vielen und vielfältigen Facetten, eine verlässliche Quelle, aber kein Typ, mit dem man sich anlegen wollte.
Solomon schloss die Augen und steckte eine zitternde Hand in die Jackentasche, um sich an seinem silbernen Glücksbringer festzuhalten, dann fiel ihm ein, dass sich sein Glück in den Fängen eines Toten befand. Er drehte sich von Dodds’ Abgesandtem weg zur Wand mit ihren F- und A- Wörtern und betete, dass man sich bald seines Falles annehmen würde. Doch wie derzeit alles in Solomon Farthings Leben sollte es nicht sein.
Drei Stunden und siebenunddreißig Minuten später, nach Körperverletzung, Drogen, Diebstahl, Raubüberfall und allgemeinem Fehlverhalten, wurde sein Name aufgerufen.
»Solomon Farthing!«
Und zu guter Letzt betrat er die Anklagebank im Sheriff-Court. Da dies Edinburgh war, verstand sich von selbst, dass die Sheriffin Solomon Farthing kannte, und auch Solomon Farthing kannte die Sheriffin.
»Farthing«, sagte sie. »Wie nett, Sie wiederzusehen.« Und meinte in Wahrheit das Gegenteil.
Das letzte Mal hatte Solomon sie beim Gartenfest der Wohnanlage getroffen, in der sie beide lebten. Ein langer lauer Nachmittag zum kostenlosen Zechen zwischen Rhododendren und mit klebrigen Fingerabdrücken verzierten Tombolapreisen. Über die Jahre hatten sich Gartenfeste als ergiebiger Jagdgrund für einen Erbenermittler bewährt – all die alleinstehenden Edinburgher mit ihren Millionen-Pfund-Häusern, bildeten sich ein, sie würden ewig leben, und vergaßen ein Testament zu machen. Solomon hatte sich betrunken und die Bluse der Sheriffin mit Grillsoße bekleckert, als er sie anzubaggern versuchte. Und erkannte jetzt, dass er dafür gleich die Quittung erhalten würde.
Zur Last gelegt: Trunkenheit. Verstoß gegen die guten Sitten. Ruhestörung. Alles bloß wegen eines Handgemenges auf dem Gayfield-Revier, nachdem man ihn auf der Straße festgenommen hatte. Gebrüll. Solomons Forderung, man solle eine gewisse DCI Franklin aus dem Bett holen. Rangeln und Raufen, als zwei Officer ihn packen wollten. Dann der Tritt, jemand quiekte, das unbesonnene Dreschen einer Faust (seiner), die auf Körperteile traf (nicht seine). Ganz abgesehen von Hausfriedensbruch in räuberischer Absicht.
Als der Beamte die möglichen Konsequenzen vorlas, begann Solomon zu schwitzen. Fünf Jahre in Ihrer Majestät Kittchen. Zehntausend Pfund Geldstrafe. Oder noch schlimmer, Sozialstunden – kleine Hundekacktüten aus den Rinnsteinen der Stadt fischen, wobei man eine dieser schicken leuchtenden Warnwesten trug. Was hätte sein Großvater dazu gesagt, dachte Solomon, ein Mann, für den das Tragen einer Uniform Ehrensache war und nicht ein Stigma durch und durch schlechten Benehmens. Er sah kurz an seinem aktuellen Aufzug hinab, konnte den Mief, der unter dem zerknautschten Tweed aufstieg, förmlich spüren. Wie tief war er gesunken, wenn er in dieser Stadt nicht mal mehr jemanden hatte, der ihm ein sauberes Hemd lieh.
Die Sheriffin räusperte sich und Solomon hob den Blick zur Richterbank. Fragte sich, ob er sich schuldig bekennen und auf ihr Erbarmen bauen sollte (oder zumindest auf den Umstand, dass sie eine Nachbarin war), sah dann aber, wie der Gerichtsdiener ihr einen Zettel reichte. Die Sheriffin runzelte die Stirn, während sie das kleine Quadrat auffaltete und überflog. Als sie aufblickte, galt ihre Aufmerksamkeit nicht länger Solomon Farthing, sondern jemandem hinten im Gerichtssaal. Solomon wandte sich um, sah jedoch nur noch pfirsichfarben gefütterte Mantelschöße zu der sich eben schließenden Schwingtür hinauswehen. Als er sich wieder umdrehte, rückte die Sheriffin ihre Brille zurecht, um das Urteil zu verlesen. Solomon schloss die Augen, war wieder ein kleiner Junge, der neben seinem Großvater betete, um Freiheit oder etwas in der Art. Dann sagte sie es laut.
»Klage abgewiesen.«
Draußen hatte die Stadt ihre Fahnen für den Sommer gehisst, sie flatterten wie Solomons Manschette. Er sah nach links. Dann nach rechts. Dann über die Schulter und wieder nach vorn, fragte sich, ob es Dodds sein würde (oder ein anderer Gläubiger), der seine Schulden als Erster eintrieb. Obwohl er sein Leben lang anderen Geld abgeknöpft hatte, stellte Solomon nun fest, dass er an allen Ecken und Enden der Stadt in der Kreide stand, unbegrenztes Wachstum für seine Schulden, von wegen nachhaltig.
Die fette offene Rechnung im Schnapsladen und dazu die im Feinkostgeschäft;
ein Deckel in seiner Stammkneipe in der Jamaica Street (inzwischen recht lang, anders als der Geduldsfaden seines Vermieters, der immer kürzer wurde);
der frühere Klient, der ihn vor dem Bagatellgericht auf drei Mille – aus einer Erbschaft – verklagte, die Solomon längst ausgegeben hatte;
der Mini, seiner Tante entwendet, die eigentlich nicht seine Tante war, eine Edinburgh-Lady, genau wie die Sheriffin, die stets wusste, wer was für Leichen im Keller hatte.
Dann noch die Schulden von seiner Leidenschaft für einarmige Banditen, immer die drei kreiselnden Siebener des Jackpots vor Augen. Die Spannung, wenn eine Karte nach der anderen umgedreht wurde, das Kribbeln, mit dem er die Würfel über den grünen Spieltisch schleuderte und Geld, das er nicht besaß, in Freddy Dodds’ Kassen schaufelte. An die fünftausend oder so, wenn Solomon einen Überschlag wagte. Woher sollte er denn wissen, dass in dieser Stadt jede Gelegenheit zum Glücksspiel auf die eine oder andere Art Freddy Dodds gehörte? Das war Solomon entgangen, bis es zu spät war.
Als er aus dem schwarzen Tor des Sheriff-Court trat und über die George IV Bridge auf die Statue des Terriers Greyfriars Bobby zuhastete, spürte Solomon Farthing, wie seine Hände an seiner schmuddeligen Cordhose wieder zu zittern anfingen. Er hatte sich lange an Edinburgh gütlich getan, doch jetzt schien Edinburgh im Begriff, sich an ihm schadlos zu halten.
Das Denkmal des berühmten treuen Hundes war von Touristen umlagert, die Fotos schossen – hauptsächlich von sich selbst. Die Tradition war noch neu, an der kleinen Hundenase zu reiben, in der Hoffnung, dass es Glück brachte – das war in den letzten fünf Jahren aufgekommen, und der Stadtrat versuchte es schon zu verbieten. Doch in Ermangelung seines silbernen Talismans nahm Solomon jedes bisschen Glück, das er kriegen konnte.
»Haben Sie etwas Kleingeld, Sir.«
Am Fuß der Statue saß ein Mann auf dem Pflaster. Ein Bettler. Einer von Edinburghs Stammschnorrern. Und neben ihm noch ein kleiner Hund, diesmal lebendig. Solomon zog sein Taschenfutter nach außen.
»Tut mir leid, Mr. Scott. Ich fürchte, da ist nichts zu machen.«
»Solomon Farthing«, sagte der Bettler. »Hab Sie lange nicht gesehen.«
»Harte Zeiten, Mr. Scott. Harte Zeiten.«
Der Bettler rutschte ein Stück zur Seite und bedeutete Solomon, sich zu ihm auf den Pappkarton zu setzen. Warum nicht, dachte Solomon. Reicher, Armer, Bettler, Dieb – na, wen hat das Leben lieb? Drei davon hatte er eh schon ausprobiert. Da konnte er es auch noch mit dem vierten versuchen. Er hockte sich neben den Bettler und spürte die Berührung einer kalten Hundenase am Handgelenk. Der Hund trug ein gepunktetes Halstuch, als wäre er ein Gentleman und alle anderen Schurken.
»Was macht die Kunst, Mr. Scott?«, fragte Solomon. »Laufen die Geschäfte?«
»Geht so«, erwiderte der Bettler. »Das Referendum macht mir Sorgen. Was danach passieren könnte.«
Bleiben oder gehen. Es gab in diesem Sommer kein anderes Thema. Dieselbe Frage, die Solomon umtrieb. In Edinburgh bleiben und sich seinem Schicksal stellen. Oder tun, was er immer getan hatte. Abhauen. Der Hund drehte eine Runde und schnüffelte an einem Geländer in der Nähe. Ein Passant warf eine Münze auf den Pappkarton vor Solomons Füßen. Ein Pfund. Blieben nur noch viertausendneunhundertneunundneunzig. Natürlich plus Zinsen, was immer Dodds da auch nahm. Die Pfundmünze glitzerte im Sonnenlicht, als enthielte sie echtes Gold und kein falsches. Doch Solomon widerstand.
»Nach Ihnen, Mr. Scott, nach Ihnen«, sagte er.
Betteln war in Edinburgh ein Beruf. Es gab eine etablierte Hierarchie, und Solomon Farthing stand wieder mal ganz unten. Wie jeder gute Edinburgh-Mann zierte sich der Bettler nicht, nahm die Münze und steckte sie in eine seiner vielen Taschen.
»Glaube kaum, dass Betteln Ihnen aus der Patsche hilft.«
Zwei schwarze Stiefel. Größe achtunddreißig. Frauenstimme. Jung. Kritisch. Die unergründliche PC Noble war wieder da, um Solomon mit ihrem undurchdringlichen Blick zu piesacken. Dem inzwischen angetrockneten Matsch an Manschetten und Knien zum Trotz bemühte er sich um eine würdevolle Haltung. »Kann ich Ihnen behilflich sein, Officer?«
»Sie haben das hier vergessen«, antwortete PC Noble. Sie hielt ihm einen kleinen Plastikbeutel hin, durchsichtig, damit jeder auf den ersten Blick sah, was Solomon Farthing noch wert war:
eine Schachtel Tic Tac Orange, fast leer;
ein Nokia mit leerem Akku;
eine Walnussschalenhälfte, schon stark abgewetzt.
Er streckte die Hand aus, um die Tüte entgegenzunehmen, doch PC Noble ließ sie stattdessen vor seine Füße fallen. »Machen Sie sich nicht die Mühe aufzustehen.«
Sie war wirklich ein Prachtstück.
Solomon kippte den Inhalt aufs Pflaster – all sein weltlicher Besitz kullerte Greyfriars Bobby vor die Füße. Es ergab irgendwie Sinn. Der Hund mit dem Halstuch kehrte zurück, um an jedem Teil zu schnüffeln, und leckte kurz beiläufig an der Walnussschale. Solomon ließ das tote Nokia in seine Jackentasche gleiten, ebenso die Tic Tacs, merkte dann, dass PC Noble ihm noch etwas hinhielt.
»Sie haben was vergessen.« Klein. Weiß. Eine Visitenkarte. Wie ein anständiger Edinburgh-Mann sie bei sich trug. Oder eine Edinburgh-Lady, versteht sich. Auf der einen Seite stand sauber schwarz gedruckt:
DCI Franklin
Auf der Rückseite, mit Kuli gekritzelt:
Sie sind mir was schuldig.
Da spürte Solomon Farthing es, dieses Zittern in der Hand. Eine Abrechnung stand an, und zwar eher, als er gedacht hatte.
Drei
Um sieben Uhr zweiunddreißig am Morgen erwachte Solomon aus einem Traum von dunklem Wasser und musste um acht Uhr parat stehen. Als er sich mit einem Ächzen umdrehte, bohrte sich ein Schmerz hinter sein Auge, bei dem er sich fragte, ob dies der Augenblick war, da sein Universum explodierte. Aneurysma im Hirn. Plopp. Alles vorbei. Niemand würde nach ihm sehen außer dieser grässlichen Frau, dieser Penny vom Amt für Verlorengegangene, die vorbeikam, um in dem zu stochern, was von seinem Leben blieb, wie ein Aasfresser sich durch Knochen pickt.
Wie angewiesen hatte er tags zuvor bei DCI Franklin angerufen, hatte zum Hörer gegriffen wie ein Bub voller Bammel, Ärger zu kriegen, nur um etwas ganz anderes geboten zu bekommen.
»Ich habe einen Fall, der Sie vielleicht interessieren könnte«, hatte DCI Franklin gesagt. »Frisch. War noch nicht mal beim UH.« Ultimus Haeres, der letzte Erbe – seine üblichen Jagdgründe. »Steht quasi Ihr Name drauf. Kein Erfolg, keine Kohle.« Das Prinzip kein Erfolg, keine Kohle hatte früher Solomons Herz zum Hüpfen gebracht. Jetzt fürchtete er, es könnte ihm endgültig den Garaus machen.
»Welche Art von Fall?«, hatte er gefragt.
Die DCI ließ sich nicht in die Karten blicken. »Das erfahren Sie, wenn Sie zusagen.«
»Also mehr ein Gefallen.«
Darüber hatte sie gelacht, dieses kurze Bellen eines Fuchses in der Nacht. »Wir wissen doch beide, dass es andersrum ist. Ich hol Sie um acht ab.«
Solomon zog sich in der verbliebenen Zeit an, so gut es ging, und tränkte sich mit Patschuli-Körperspray, einem Schnäppchen von Scotmid, um zu kaschieren, dass er es nicht unter die Dusche geschafft hatte. Die Standuhr im Flur begann genau in dem Moment die Stunde zu schlagen, als er versuchte, in ihrem Glas sein Spiegelbild etwas zu glätten.
Ding
Ding
Ding
Acht Uhr früh, Tendenz steigend, eine kleine Sonne ging auf. Kurz den Daumen angeleckt und über einen Matschfleck auf dem Schuh gewischt, dann durchs Haar. Er würde die DCI mit seiner Pünktlichkeit verblüffen. Doch als Solomon die Haustür aufmachte, stand sie schon draußen und wartete nur darauf, ihn zu verblüffen.
Er hatte natürlich nachgeforscht, was DCI Franklin und all ihre Ahnen betraf. Der Fuchs fängt den Fuchs, war das nicht das Prinzip? Rückversicherung nannte es Solomon: die Kompetenz, Familiengeheimnisse auszubuddeln, ein Plus seines Berufs. Früher hatte er das bei allen getan, von denen er vielleicht eines Tages einen Gefallen brauchte.
Eine Hand wäscht die andere.
Natürlich erwiesen sich auch die Angehörigen von DCI Franklin wie so viele normale Leute als ganz gewöhnliche Scharlatane und Heuchler. Hier ein paar Namen geändert, dort bei Geburtsdaten fünfe gerade sein lassen, eine Patina aus Legitimität. Nichts, was nicht jeder brauchbare Erbenermittler bei jedem neuen Fall unter die Lupe nehmen würde. Noch bis unlängst wollte man alles verschleiern, was anrüchig oder regelwidrig war, und eine makellose Generation nach der anderen vorweisen. Doch selbst in Edinburgh – unter der Oberfläche so dreckig, wie es darüber gern blitzeblank wirkte – begann sich das zu ändern, wie Solomon wusste. Heutzutage suhlten sich all die Amateure in jedem Schmutz, den sie finden konnten. Ehebruch. Bigamie. Wahnsinn der ansteckenden Art. Trugen ihre genealogischen Befunde wie Trophäen vor sich her, als brächte das Farbe in ansonsten farblose Leben. Eigentlich hatte diese Schamlosigkeit Solomons Job ruiniert. Das und natürlich das Internet. Da gingen alle Büchsen der Pandora gleichzeitig auf, und weit und breit kein Spezialist wie er, der einschreiten könnte.
Allerdings …
Was die DCI betraf, da gab es etwas. Ein Baby, ein Junge, vor Jahren von einer Krankenschwester davongetragen, bevor seine Mutter auch nur dazu kam, seine winzigen Zehen anzufassen.
Einen Gefallen hatte die DCI es genannt, als sie ihn bat, nachzuforschen. So, wie sie nun Solomon im Gegenzug einen Gefallen erwies. Eine letzte Chance, das Glücksrad in eine etwas vorteilhaftere Richtung zu drehen, wie er es für sie getan hatte. Ein bisschen Buddeln hier. Ein paar Fragen dort. Dann beiseitetreten und zusehen, wie der lang verlorene Sohn der DCI wieder auftaucht, als hätte er die ganze Zeit darauf gewartet, von ihr gefunden zu werden. Über den Flurfunk der Stadt hatte Solomon gehört, dass die DCI inzwischen mit dem Kind in Kontakt stand, ein junger Mann, der sich mit oder ohne Zutun seiner beiden Mütter prächtig entwickelt hatte. Das machte ihn froh. Solomon nahm sich gern Zeit für DCI Franklin. Er fragte sich oft, wie es wohl war, ein Kind zu verlieren, nur weil man einmal einen Fehler gemacht hatte, als man selbst noch ein Kind war.
Als er jetzt zur Beifahrertür von DCI Franklins Wagen strebte, sagte sie kein Wort zur Begrüßung, bedeutete ihm nur mit einem stummen Nicken, er solle hinten einsteigen. Beim Anfahren rutschte Solomon tief ins Lederpolster und fragte sich, was wohl die Nachbarn dachten, wenn sie sahen, wie er von einer abgeholt wurde, an deren Wagen man bereits die drei Buchstaben vor ihrem Namen erkannte. In dieser eleganten Edinburgher Wohnanlage voller eleganter Edinburgh-Männer. Steuerberater und Finanziers. Rechtsanwälte und Advokaten. Ganz zu schweigen von einer Sheriffin irgendwo auf der anderen Seite. Wobei die natürlich eine Edinburgh-Lady war, also ein ganz anderer Schlag. Wie kam es nur, fragte sich Solomon, während der Wagen der DCI dahinglitt, dass er sich ständig inmitten von Gesetzeshütern fand?
Sie fuhren mit würdevollem Tempo ihrem Ziel entgegen, ohne Eile trotz des frühen Termins. Auf dem ganzen Weg konnte Solomon es riechen – frische Erde und tausende klebriger Blütenknospen. Im Gegensatz zu ihm stand die Stadt im vollen Saft.
»Bisschen früh für eine Fallkonferenz, oder?«, sagte er, als sie an einer Gruppe von Kindern auf dem Schulweg vorbeikamen.
»In Ihrer Lage können Sie kaum wählerisch sein, oder?«, erwiderte die DCI. Es war weniger Frage als Feststellung. Was wusste DCI Franklin über seine derzeitigen Lebensumstände? Andererseits war das hier Edinburgh. Was wusste die DCI nicht über jedermanns Tun und Lassen in ihrem Revier? »Im Übrigen schulden Sie mir noch was für das Tamtam im Gayfield.« F-Wörter und A-Wörter und Wörter, die DCI Franklin schon millionenfach gehört haben musste. »Mittlerweile müsste Ihnen doch klar sein, dass man meinen Namen nicht missbraucht.«
Solomon stieg Hitze ins Gesicht. Verlegenheit oder die Nachwirkungen einer Flasche Fino, am Vorabend bis zum letzten Tropfen geleert, das war nicht ganz klar. Er schrumpfte noch weiter in das Leder, als der Wagen links abbog und eine nur zu bekannte Straße entlangrollte. Opulente Einfahrt. Große Terrassentüren auf der Rückseite. Der süßliche Schwall von blühendem Flieder. Was immer Solomon erwartet hatte, es war jedenfalls nicht die Rückkehr zum Haus eines Toten, in das er vor wenig mehr als achtundvierzig Stunden eingebrochen war.
Aber dann erwies sich als Tatort doch nicht das Ziel seines kürzlichen Raubzugs, sondern ein Pflegeheim auf der Hügelkuppe in Edinburghs Südosten. Ein Heim speziell für Soldaten – letzte Ruhestätte für die alte Garde, wo sie einer nach dem anderen abgemustert wurden, so wie ihre Offiziere sie einst angemustert hatten. Die Abrechnung, so hatte Solomons Großvater das genannt, ein finaler Appell derer, die am Ende der Schlacht noch am Leben waren.
Den Eingang des Pflegeheims schmückte ein Jubiläumsbanner. 1916 – 2016: 100 Jahre im Dienst der Truppen.
»War erst ein Krankenhaus für die mit fehlenden Gliedmaßen«, sagte DCI Franklin und parkte auf einem reservierten Stellplatz.
Auch eine Art Abrechnung, dachte Solomon, als er sich aus dem Rücksitz schälte. Das Zählen von Körperteilen, wenn eine Granate eingeschlagen war:
ein Bein;
zwei Beine;
zwei Arme;
fünf Finger.
Was von einem Mann übrig war, worauf er aufbauen konnte.
Drinnen war das Heim voller Leute, die weitgehend noch alle Gliedmaßen hatten, aber durch die Flure wanderten, als wüssten sie, wo es langgeht, obwohl Solomon wusste, dass sie es nicht taten (genau wie er). Ein kleiner Schauder durchfuhr ihn. Trotz seines Berufs mit allem Drum und Dran mochte Solomon alte Leute nicht. Dieser grässliche Mief und Muff des Greisenalters.
Die DCI schwenkte ihre Dienstmarke und marschierte einen langen Korridor hinunter. Solomon folgte ihr, bis ihm ein ältlicher Mann in Pantoffeln und Trainingsanzug, auf den eine Art Wappen gestickt war, in den Weg trat. Der Alte zwinkerte Solomon zu, als der an ihm vorbeiwollte.
»Hallo, Seemann. Gehen wir unter Deck?«
Seine Augen waren verblüffend blau. Solomon blinzelte, als die Betreuerin des Mannes, eine junge Frau mit Haar wie Melasse, lachte und ihren Patienten an der Schulter fasste.
»Kommen Sie, Mr. R. Sie wissen doch, dass er gar nicht Ihr Typ ist.«
Wer weiß, dachte Solomon, als der alte Knabe weggeführt wurde. Er hatte sich in Gesellschaft von Soldaten immer wohlgefühlt. Sie hatten einen guten Humor, dunkel und abgründig. Und sie pichelten auch gern.
Während er hinter DCI Franklin her weiter den Flur entlangging, merkte Solomon, wie seine alten Instinkte einsetzten. Augen links. Augen rechts. Ausschau halten, wer ein vorrangiges Ziel abgab. Hinweise auf versteckten Wohlstand, auf abgängige Familienmitglieder, die aufgespürt werden wollten. Oder noch besser der Geruch der Einsamkeit, diese Nuance, die hieß, dass alle Verwandtschaft, die er finden mochte, weit weg und ohne Bindung war, die Sorte, die gleich unterschrieb, wenn das Angebot stimmte. So ungesund sie auch aussahen, im Altenheim war Geld zu holen, wusste Solomon. All die millionenschweren Immobilien, aus Altersschwäche verlassen, die nur darauf warteten, dass jemand ernten kam. Vielleicht konnte Solomon mal bei einem Lunch aus Omelette mit Erbsen mit Mr. R. plauschen, einen passenden Kandidaten ausbaldowern für seinen nächsten Streifzug in die Vergangenheit. Als er DCI Franklin einholte, die an der Tür eines Zimmers stand, sah er an ihrer Miene, dass sie genau wusste, was er gedacht hatte, und missbilligte, wohin das führen könnte.
»Nach Ihnen.« Sie öffnete die Tür, ohne auch nur anzuklopfen. Es erinnerte Solomon an seinen Einzug in diese Zelle in Gayfield – ein Ort, von dem es womöglich kein Entrinnen gab.
Der Name des Toten war Thomas Methven. Jedenfalls laut DCI Franklin. Solomon fragte sich, wie lange dieser Name angesichts der nichtssagenden Umgebung noch präsent bleiben würde. Bett. Schrank. Stuhl. Nicht mal ein Sesselschoner. Kein Hinweis darauf, dass hier ein Leben stattgefunden hatte, ganz zu schweigen von einem Tod.
»Wie alt?«, fragte er.
»Fünfundneunzig, sechsundneunzig«, sagte die DCI. »Ganz genau weiß es keiner. Seine Frau starb vor rund zwanzig Jahren. Keine Kinder, soweit wir wissen.«
»Geschwister?«
»Einzelkind.«
Solomon entschlüpfte ein kleines Lächeln bei der Vorstellung, dass rings um den Dahingeschiedenen ein großer Leerraum im Familienstammbaum klaffen mochte. »Was ist mit anderen Angehörigen?«, sagte er. »Sind sie schon benachrichtigt?«
»Es gibt keine«, sagte die DCI. »Zumindest sind keine bekannt. Da kommen Sie ins Spiel.«
Und das Geld natürlich. Fünfzigtausend in gebrauchten Scheinen. Darauf lief es hinaus. Der Schatz, den Thomas Methven hinterlassen hatte.
»Eingenäht in seinen Beerdigungsanzug«, sagte die DCI.
»Was?« Solomon waren in seiner Karriere als Erbenermittler schon viele Seltsamkeiten untergekommen. Aber das hatte er noch nie gehört. Geld für die Beerdigung, am Leib getragen wie eine zweite Haut.
»Die Bestatterin hat es gefunden, als sie ihn ankleiden wollte«, sagte DCI Franklin. »Hat das Heim angerufen. Und die uns. Es sollen an die fünfzigtausend sein, grob geschätzt.«
Trotz der frühen Stunde bescherten die Möglichkeiten dieses Falls Solomon ein angenehmes Kribbeln. Fünfzigtausend. In bar. Davon zwanzig Prozent wären ein sehr hübscher Anfang für die Lösung seiner Probleme, besten Dank.
»Er hat wohl keine Anweisungen hinterlassen, was damit passieren soll?«, fragte er. Denn wo ein letzter Wille war, war auch ein Weg, aber nicht für den Erbenermittler. Ein Testament war das Letzte, worüber Solomon stolpern wollte.
»Wir haben nichts gefunden«, sagte die DCI. »Keine Ahnung, wo das Geld herkam oder hinsoll. Im Heim hielt man ihn für mittellos. Margaret Penny vom Amt für Verlorengegangene sollte sich schon um die Einäscherung kümmern, als ich eingegriffen habe.«
Fünfzigtausend in Rauch aufgelöst, dachte Solomon, von der DCI gerade noch gerettet. »Warum ermitteln Sie nicht selbst?«, fragte er.
Die DCI lehnte sich gegen den Türrahmen. Sie wirkte plötzlich müde. »Alles ist rechtens. Ein natürlicher Tod, vom Hausarzt bescheinigt. Gibt keinen Grund, weiter zu ermitteln als bis zum Totenschein.«
Solomon begriff sofort, was sie meinte. Kürzungen. Kürzungen. Und noch mehr Kürzungen. Darauf lief es hinaus. Alles wurde runtergehobelt bis aufs Mark, von Knochen gar keine Rede mehr. Er kannte die Gerüchte über die Auflösung der auf unverdächtige Todesfälle spezialisierten Edinburgher Rechercheeinheit, nun in alle Winde zerstreut, Norden, Süden, Osten und Westen. Sämtliche Experten landeten jetzt am schicken neuen Crime Campus auf der anderen Seite des Landes. Glasgow hatte schon immer jedweden Reichtum protzig zur Schau gestellt. Wohingegen Edinburgh ihn (ganz wie der verstorbene Thomas Methven) lieber unterm Deckel hielt. »Und einfach an UH überstellen?«, sagte er. »Sollen die sich drum kümmern.« Dort würde das Crown Office flüchtig nach möglichen Erben fischen, dann den Fall öffentlich ausschreiben und zusehen, wie die Geier seiner Sorte darauf herabstießen.
»Das tun wir, wenn Sie keinen lebenden Angehörigen finden«, sagte DCI Franklin. »Ich dachte, Sie möchten vielleicht einen Vorsprung.«
Solomon lächelte. Eine Hand wäscht die andere.
»Wo ist das Geld jetzt?«, fragte er und zog betont lässig jede einzelne von Thomas Methvens leeren Schubladen auf.
»Im Safe des Pflegeheims«, sagte die DCI.
»Wollen Sie es nicht sicherstellen?«
»Das tun wir, wenn Sie keinen finden, der Anspruch erhebt«, sagte sie. »Bis dahin ist es eine Fundsache und nichts weiter.«
Wer’s findet, darf’s behalten, dachte Solomon.
»Wie lange habe ich?«, fragte er.
»Vier Tage.«
»Vier Tage!«
»Länger kann ich den Papierkrieg nicht aufhalten.«
Und Solomon wusste genau, was mit Papierkrieg gemeint war. Margaret Penny vom Amt für Verlorengegangene würde einschreiten und wissen wollen, warum eines alten Mannes letzter Wunsch nicht respektiert wurde. Fünfzigtausend mit Thomas Methvens Beerdigungsanzug in Rauch aufgelöst, weil sie eine Korinthenkackerin war. Er befingerte den Saum der Nylongardinen vor dem Fenster und betrachtete den letzten Ausblick des Verstorbenen auf die Welt. Würde es ihm zum Vorteil gereichen, wenn er sich zierte?
Doch als Solomon sich umdrehte, steckte die DCI eine Hand in ihre Tasche, als fischte sie nach einem Glücksbringer, gefunden zwischen den Dielenbrettern eines Toten. »Es gibt da noch etwas, das für Sie spricht.«
Solomon erbleichte, versuchte zu witzeln. »Familiensilber?«
DCI Franklin lächelte, als hätte sie immer gewusst, dass es richtig war, ihn einzubeziehen. Sie zog die Hand aus der Tasche, hielt ihm den Schatz hin. Kein silbernes Abzeichen, kein Löwe mit erhobener Pranke. Sondern ein Pfandschein, Nr. 125. Dieses kleine Stückchen Blau.
1918
Eins
Es war November, der Anfang eines ereignislosen Monats, nichts als kalte Morgen und Eisringe auf dem Rasiereimer, eine Luft, die sie alle mit einer Decke aus Tau beschwerte, sobald sie sich hinauswagten. Der Regen fiel schon wieder, als wolle er die Welt in einen Fluss verwandeln, Wasser strömte unbekümmert durch den Teich hinter dem Bauernhaus – auf der einen Seite hinein, zur anderen hinaus –, und jedes kleine Rinnsal schloss sich mit dem nächsten zusammen, bis es zu etwas wurde, durch das man hindurchwaten musste, wann immer man zur Latrine wollte.
Captain Godfrey Farthing starrte aus dem Bauernhausfenster auf die Pfützen, die sich im Hof bildeten. Es war wie der Fluss, den sie eigentlich überqueren sollten, dachte er, wenn nur der Befehl käme. Ein Wasserlauf, keine zwei Kilometer entfernt, flach und mittelmäßig, gesäumt mit Weiden, die noch nicht von Maschinengewehrfeuer zersiebt waren. Godfrey hatte einen Erkundungsgang gemacht, um ihren Übersetzpunkt in Augenschein zu nehmen. Hatte alles für enttäuschend gewöhnlich befunden. Schösslinge und stummelige Schilfrohrflächen, am anderen Ufer eine Wiese ohne besondere Merkmale bis auf die Wahrscheinlichkeit, dass der Feind sie dort alle niedermähen würde.
Als er sich dann rückwärts durch die Senken und Täler der dazwischenliegenden Sumpflandschaft schlängelte, bis seine Uniform klatschnass und dreckig war, fragte er sich ratlos, ob das wirklich die Mühe wert war. Auf dem Rückweg zum Bauernhaus, wo Quartier bezogen hatte, was von seiner Einheit noch übrig war, sah Godfrey nur vor sich, wie unmöglich es war, ein so flaches unscheinbares Stück Land zu überqueren, ohne seine Männer vollends dem Feind auszusetzen. Sie würden vermutlich unterwegs in irgendeinem Wassergraben ertrinken, im Hagel feindlicher Kugeln dahinstolpernd, bevor sie überhaupt zum Zuge kamen. Ein blödsinniger Tod, unnötig, wie wenn ein Kleinkind in den Zierteich des Nachbarn fiel. Aber war nicht dieser ganze Krieg inzwischen so? Jeden Tag etwas Blödsinniges tun, weil, tja, weil sie eben sonst keine Anweisungen hatten.
Das Ganze erinnerte ihn an Private William Beach.
Wir sehn uns dann.
Verabschiedete sich, als würde er zum Tee nach Hause gehen statt in die große Leere des Todes. Erst viel später fragte sich Godfrey, ob Beachs Worte prophetischer gewesen waren, als ihm bewusst war.
Wir sehn uns dann.
Hätte er nur hingehört. Zu spät.
»Sie wissen, dass das Ende in Sicht ist.« Second Lieutenant Ralph Svenson kippelte mit seinem Stuhl, als wäre er wieder in der Schule und ereiferte sich unter Zehntklässlern (zu denen er unlängst noch gehört hatte). »Ist nur noch eine Sache von Tagen, vielleicht eine Woche.«
Godfrey weigerte sich von der Postkarte aufzusehen, die er an seine Mutter schreiben sollte. »Das haben wir schon öfter gehört.«
Es war typisch für ihre Unvereinbarkeit, dass Second Lieutenant Ralph Svenson gedankenlos auf dem Stuhl kippelte, während Captain Godfrey Farthing diesen Anblick nicht ertragen konnte.
Sie warteten schon seit zehn Tagen, und noch immer hatten sie keinerlei Befehle erhalten, und seien sie noch so läppisch. Weder Exerziervorschriften noch den Auftrag, die Vorräte zu zählen. Keine Aufforderung, Gräben auszuheben, wo keine Gräben nötig waren. Es war, als hätte man sie vergessen, als hätte man sie losgeschickt, ein Lager aufzuschlagen, und dann abgeschrieben, sodass die Truppe nichts zu tun hatte als auszuharren, während woanders der Krieg weiterging. Godfrey wusste, er sollte einen Kurier schicken und nachfragen, warum der Rest seiner Kompanie noch nicht zu ihnen gestoßen war. Doch während jeder Morgen grauer heraufzog als der vorige, schob er das unwillkürlich vor sich her, wieder und wieder, sodass ein Tag still in den nächsten quoll.
»Nein, im Ernst.« Ralph kippelte nach vorn und lehnte sich über den Tisch zu Godfrey, wie um seine Worte noch zu betonen. »Ich glaube, diesmal könnte es stimmen.« Trommelte mit den Fingern auf die Ecke von Godfreys Postkarte.
Godfrey starrte auf die geschrubbten Fingernägel des Jungen. Liebe Mutter, es heißt, das Ende sei in Sicht … Schob die Karte ein Stückchen weg von Ralph Svensons Hand.
Second Lieutenant Svenson war eigentlich noch ein Knabe, erst neunzehn, aber schon Offizier und noch keine sechs Monate im Krieg. Es war zu spät für richtige Gefechte, als er zu ihnen stieß mit einem Grinsen so breit wie der Ärmelkanal und dem Geruch des Zitronenöls, das er sich so gern ins Haar strich. Er war der neue Unteroffizier, eine unwillkommene Erinnerung daran, dass Godfrey den Namen seines Vorgängers schon vergessen hatte. So ging es eben zu, wenn einem alle Männer abhandenkamen. Man wurde einer Truppe Fremder zugeteilt; musste von vorn anfangen. Godfrey wusste, er hätte den Jungen unter seine Fittiche nehmen, eine Art Vaterfigur sein sollen. Doch er stellte fest, dass er das nicht konnte. Ralph hatte so eine Art, sich Anweisungen zu widersetzen. Und dazu etwas, das Godfrey nicht mehr nachempfinden konnte – den ermüdenden Eifer der Jugend.
Ralph zog schmollend seine Hand zurück, kippelte erneut und spielte an etwas in seiner Tasche herum, während er mit seinen seltsam durchsichtigen Augen aus dem Fenster starrte. Godfrey wusste, dass sein Second Lieutenant sich langweilte. Ein junger Mann, gestählt von ein paar Wochen Drill, dann abgestellt, um tatenlos im Dreck zu versauern.
»Es ist ungerecht«, hatte der Junge sich erst am Vortag beschwert, weil er es leid war, die Männer sinnlos exerzieren zu lassen. »Die haben uns sitzenlassen, auf dass wir hier verrotten.« Ralph hatte noch keine Gefechte erlebt. Kein Ducken in einer schlammigen Pfütze in der Erwartung, von Schrapnell aufgeschlitzt zu werden. Kein Sturm auf den Feind mit aufgepflanzten Bajonetten. Deshalb schwelgte er so in den Gerüchten vom Ende. Denn Second Lieutenant Ralph Svenson hoffte, sie würden sich noch nicht bewahrheiten.
Der Bauernhof, den sie requiriert hatten, war recht komfortabel – das reinste Versailles im Vergleich zu allem Vorangegangenen. Den Ratten. Den Erdlöchern. Dem Gasgestank am Boden. Den Unterständen, wo Fingerknochen aus den Wänden ragten. Im Gegensatz dazu bot ihre neue Unterkunft Steinmauern, ein Dach voller intakter Ziegel, Fenster, die noch Läden und Scheiben hatten. Dazu Ställe, groß genug für ein Pferd und eine Kuh, hätte es noch lebendes Vieh gegeben. Eine Scheune, wo die Männer sich einquartieren konnten. Einen Kornspeicher, in dem Private Flint von Wand zu Wand die Wäsche aufhängte. Und dann war da noch der abgenutzte Stummel eines Stiefelkratzers bei der Eingangstür, als wäre es hier das Wichtigste überhaupt, sich um Reinlichkeit wenigstens zu bemühen.
Während sie warteten, hatte Godfrey sich mit Ralph oben in der guten Stube eingerichtet. Ein Kamin mit einem Kaminsims aus Holz. Eine schmale Sitzbank an der Wand. Ein Tisch mit dem ringförmigen Wasserfleck einer Vase. Und dann noch ein kleines Kruzifix links neben der Tür. Godfrey berührte das Kruzifix gern jeden Abend, bevor er zu Bett ging. Zur Erinnerung an alles, was nun hinter ihm lag. Und was vielleicht noch kam.
Es gab sogar einen Rosenbusch im Garten – die Verheißung von Frühling, so dachte Godfrey bei ihrer Ankunft, falls irgendwer von ihnen lange genug durchhielt, um die Blüten zu sehen. Große liederliche Dinger in Rosa und Orange vielleicht, die duftende Blütenblätter in den Sommerwind streuten.
Beach hätte es einen Palast genannt.
Also das ist ja mal doll. Erstmals ausgesprochen, während sie zusammengekauert den dritten Tag eines Bombardements über sich ergehen ließen, das sich später als nutzlos für alle Beteiligten erwies.
Als sie sich an jenem ersten Tag im Gänsemarsch auf dem matschigen Weg dem Bauernhof näherten, hatte auch Godfrey ihn als Palast angesehen. Und doch ging er davon aus, beim Aufschieben der Tür großes Unheil vorzufinden. Einen Mann quer überm Ofen mit einer Kugel im Gesicht. Eine Frau auf dem Küchentisch mit durchschnittener Kehle und hochgeschobenem Kleid. So begegneten sie dieser Tage allem Neuen – als schmeckten sie den Tod, noch ehe er eintraf, und dann packte sie der Drang, zu dem zu flüchten, was sie alle am besten kannten. Dem Matsch. Den Waffen. Den unerbittlichen Bahnfahrten ins Unglück. Dem Wissen, dass das Ende kam, ob es ihnen passte oder nicht.
Doch dann tauchte das Huhn auf, kam um die Ecke des Kornspeichers spaziert, gefolgt von noch einem und noch einem, eine ganze Schar, die um Captain Godfrey Farthings Füße herum scharrte und pickte. Das Huhn richtete seine schwarzen Augen auf Godfrey, als wollte es eine Frage stellen, und er musste an Beachs Augen denken an dem Morgen, als er starb. Dann registrierte er das träge Flattern einer Schürze auf der Wäscheleine; eine Reihe Winterkohlköpfe, in Sackleinen gewickelt, um sie vor dem Frost zu schützen. Wer kümmerte sich schon um Kohlköpfe, dachte er, wenn man selbst übel zugerichtet war? Die Männer teilten offenbar seine Meinung, denn Godfrey hörte sie hinter sich schneller ausschreiten, zu zweit nebeneinander den Weg entlang, und ihr Atem bildete Wolken in der kalten Luft eines weiteren Jahres, das dem Ende zuging.
In der guten Stube stand Second Lieutenant Ralph Svenson unvermittelt auf und nahm einen rohen Holzbecher vom Kaminsims. Er stellte ihn vor Godfrey auf den Tisch, wühlte in seiner Uniform und förderte ein Paar Würfel zutage. »Zwei Sechsen, und es ist in einer Woche vorbei.«
Ralph nannte die Würfel seine Glücksbringer und ging ohne sie nirgendwohin. Godfrey verkniff es sich, seinen Second darauf hinzuweisen, dass er sein Vertrauen in den Zufall setzte. Das war wie den Kopf über die Kante eines Schützengrabens heben, um die Windrichtung zu prüfen.
Er ignorierte Ralphs Aufforderung und dachte darüber nach, was er auf die leere Fläche seiner Postkarte schreiben sollte.
Liebe Mutter …
»Zwei Fünfen, zehn Tage.«
Wir kommen hier alle ganz gut zurecht …
»Zwei Dreien, ein Monat.«
Das Wetter ist nass …
»Kommen Sie, Farthing«, knurrte Ralph. »Wollen Sie denn nicht mal eine kleine Wette wagen?«
Godfrey klammerte sich an seinen Bleistiftstummel. »Sie wissen doch, ich bin kein Spieler.«
»Wir sind hier alle Spieler.«
Godfrey blinzelte. Ralph Svenson lag in vieler Hinsicht falsch, aber in dem Punkt hatte er recht. »Also schön. Dann eben zwei Fünfen.«
Ralph grinste, schüttelte den Holzbecher, als würde er eine Art Cocktail mixen, und ließ die Würfel auf den Tisch kullern.
Eine Sechs, eine Drei. Kein Gewinn. Nicht mal nah dran.
Ralph fing sofort wieder an, ratterte dabei verschiedene Kombinationen herunter, von denen er sicher war, dass sie das korrekte Ergebnis gewährleisteten. Zwei Dreien. Fünf und Eins. Zwei Sechsen, gefolgt von Zwei und Vier. Er würfelte darauf, wann der Krieg vorbei sein könnte – in einer Woche, vierzehn Tagen, einem Monat. Das zumindest sagte er zu Godfrey. Doch Godfrey wusste, dass es andersherum war. Ralph würfelte in der Hoffnung auf ein letztes Gefecht; auf einen Grund, seine Pistole zu ziehen, bevor die Gegenseite alles hisste, was sie an weißem Tuch noch auftreiben konnte.
Er war fast zu bewundern, fand Godfrey, Ralphs Glaube an seine Befähigung, das ersehnte Ergebnis herbeizuwürfeln, selbst wenn es um die Verlängerung des Krieges ging, nur um ja noch seine Waffe abfeuern zu können. Der Junge ging die Sache so an, wie er vielleicht einen Cocktail bestellen würde.
Einen Gin Fizz, aber die Kirsche bitte separat.
Einfach aus dem Handgelenk. Ein bisschen wie Godfreys Fähigkeit, Beach heraufzubeschwören.
Wir sehn uns dann. Diese stumpfen grauen Augen.
Godfrey schaute wieder auf die unbeschriebene Karte unter seiner Hand, während Ralphs Würfel erneut tanzten. Er hatte nie einen Cocktail probiert, bis er nach Frankreich kam. Und dann nur den einen, in einer Bar ein paar Kilometer hinter der Front im ersten Jahr. Eine berauschende Mischung aus Brandy und Champagner, die auch in ihm etwas zum Tanzen brachte. Er hatte nie einen weiteren gewollt, falls der dann nicht an den ersten herankam. Aber in letzter Zeit fragte er sich manchmal, ob diese Einstellung nicht das Leben behinderte. Genuss war ja keine Sünde, oder? Und Vorfreude? Vielleicht kam das Ende ja wirklich bald. Aber danach würde es immer wieder etwas anderes geben.
Draußen im Hof herrschte plötzlich Tumult, Männerstimmen brüllten, andere lachten, dazu hektisches Gackern und Flattern. Ralph ließ von Würfeln und Becher ab.
»Es ist Zeit«, sagte er.
Für das Ende, dachte Godfrey, wenn auch nur des Federviehs. Sein Second Lieutenant stand auf und schob seinen Stuhl unter den Tisch.
»Machen Sie mit?«
Godfrey sah auf das leere Stück Pappe vor sich, wo er bisher nur das Datum hingeschrieben hatte, 5. November. Dann auf seinen Second Lieutenant. Ralphs Augen waren fahl und sehr klar, so wie Godfrey sich Gletscher vorstellte, falls er je Gelegenheit erhielt, einen aus der Nähe zu sehen.
Liebe Mutter und Vater,
wir kommen hier alle ganz gut zurecht. Das Wetter ist nass, doch wir haben reichlich zu essen und die Bedingungen sind günstig. Gestern bin ich ins Dorf gegangen und habe einen Cocktail getrunken.
Schlimmer als das, was bisher passiert war, konnte es nicht werden, oder?, dachte Godfrey, ein plötzliches sprudelndes Perlen auf der Zunge.
»Ich glaube, ich mache einen Spaziergang«, sagte er und legte den Stift hin. »Den Kopf frei bekommen.«
»Wenn Sie meinen.« Ralph war schon an der Tür, eine eifrige Hand strich durchs Haar, die andere zupfte am Uniformrock, und verschwand mit einem Ruf an die Männer draußen in dem steinernen Gang. »Ich komme!«
Der Tumult im Hof wurde lauter, jemand brüllte zurück. »Schnapp dir das Viech!«
Ralph rief erregte Anweisungen. »Hierher! Los, hierher!« Nichts weiter als ein Anführer unter Jungs.
Godfrey steckte die Postkarte in seine oberste Tasche, den Bleistift daneben, und knöpfte sie zu. Er erhob sich vom Tisch mit dem Wasserfleck, zog seinen Feldmantel von der Lehne seines Stuhls. Er würde den Männer ihren Spaß lassen und zur Hintertür hinausgehen, um sie bei ihrem Zeitvertreib nicht zu stören. Sie spielten so gern mit Leben und Tod, selbst wenn es bloß ein Huhn war, ließen die Würfel entscheiden, welches als Nächstes drankam. Aber wenn das Ende wirklich bevorstand, war sich Godfrey Farthing gar nicht sicher, ob er schon etwas damit zu tun haben wollte.
Zwei
Das eigentliche Spiel war am zweiten Abend nach ihrer Ankunft losgegangen, das Licht fiel aus dem Himmel, und sieben Männer streckten sich auf den Zeltböden aus, die auf dem Steinboden der Scheune ausgebreitet waren:
Temporary Sergeant Hawes;
Private Flint;
Private Walker;
Corporal Bertie Fortune;
Private Jackson, genannt Jackdaw;
Private Promise;
sowie Lance Corporal Archie Methven, der Buchhalter. Der Mann, der sie alle in der Spur hielt.
Sieben Uhr und draußen schon dunkel, ihr Koch, George Stone, wusch nach dem Abendessen in der Bauernküche das Geschirr ab, und es war Percy Flint, der die Karten herausholte. Geöltes Haar. Die Manschetten gesäubert. Der Scheitel ein weißer Pfeil auf seinem Skalp.
»Wir sind zu sechst«, sagte Flint. »Ich. Walker. Fortune. Promise. Jackdaw. Hawes. Der Buchhalter macht die Bank.«
Glücksspiel war in der Armee verboten, aber alle spielten. Noch so eine Methode, durch den Tag zu kommen, bis der nächste Morgen graute.
»Ich nicht.« James Hawes, der Temporary Sergeant, dessen Rang bei Kriegsende nichtig werden würde, kräftige Arme, der Nacken von Sommersprossen übersät, saß ein Stück von den anderen entfernt und las ein Buch mit verblichenem rotem Einband. Als er vor über zwei Jahren eintraf, hatte James Hawes jedes Spiel mitgemacht. Jetzt spielte er fast nie mit, blätterte stattdessen ständig die Seiten um.
»Dann zu fünft«, sagte Flint. »Walker, Fortune, Jackdaw, Promise. Ich gebe.« Percy Flint legte gern die Rahmenbedingungen dar. Beim Einfädeln von Transaktionen trat er in den Vordergrund.
Die Spielwilligen scharten sich um einen kleinen Bereich, den Flints Ärmel frei von Sand und Stroh gefegt hatte.
»Mach uns mal Licht, Fortune«, verfügte Flint und fächerte die Karten in einer Hand auf, dann in der anderen.
Corporal Bertie Fortune hatte tags zuvor auf Futtersuche in einem Nebengebäude eine Petroleumlampe aufgetan. Mit seinem schnellen Grinsen und lässigen Zwinkern war Fortune der Tausendsassa der Gruppe, konnte jedem alles besorgen, sofern ein Mann bereit war zu zahlen. Jetzt bastelte er am Docht herum, kauerte dicht darüber, zupfte an den Enden seines gepflegten Schnurrbarts und wartete, ob das Streichholz seinen Dienst tat. Die Flamme zuckte, richtete sich dann plötzlich hoch auf, und Fortune lehnte sich mit zufriedenem Nicken zurück. Die Lampe war schadhaft und qualmte stinkend. Doch die Scheune hatte eine hohe Decke, der hölzerne Dachstuhl war weit über ihnen. Draußen regnete es wieder. Drinnen war es warm, überall hing der süße Geruch von gemähtem Heu.
Percy Flint mischte, eine Hand pflügte über die andere, bevor er die Kanten glatt ausrichtete und auszuteilen begann. Er warf den Männern ihre Karten hin, eine nach der anderen, ließ sie aufs Geratewohl landen. Die Spieler schaufelten ihr Blatt vom Boden, jeder warf einen kurzen Blick darauf, bevor sie in ihren Taschen nach einem ersten Einsatz stöberten.
Ein Streichholz.
Ein Knopf.
Eine Spule rosa Garn.
Typisch Percy Flint, den einen Gegenstand zu besitzen, der sie alle an die französischen Mädchen erinnerte, die in den Bars hinter der Front vin blanc ausschenkten.
»Wogegen hast du das getauscht, Flint?«, fragte Private Alfred Walker.
»Frag nicht«, gab Flint zurück und feixte.
Die Männer lachten. Flint war älter als der Rest. Einer von den vermählten Rekruten, der es so lange wie möglich hinausgezögert hatte, bevor ihn das Schamgefühl zum Musterungsoffizier trieb. »Musste die Frau ganz allein zu Hause lassen«, hatte er anfangs jedem vorgejammert, der ihm zuhörte.
Doch Flint wusste, und sie alle wussten, dass er hätte eher kommen sollen. Eine Gegenleistung für ein Päckchen billige Kippen, ein schnelle Nummer im Hinterzimmer eines Estaminet. Das war Percy Flints Hauptwährung. Der Krieg und seine schmutzigen Trostpflaster erwiesen sich als der ideale Tummelplatz für einen Mann wie ihn.