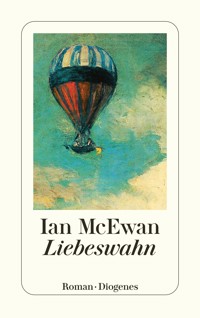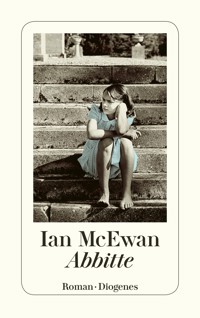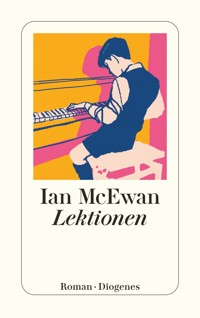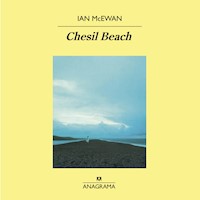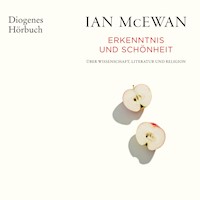11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Charlie ist ein sympathischer Lebenskünstler, Miranda eine clevere Studentin. Sie verlieben sich, gerade als Charlie seinen ›Adam‹ geliefert bekommt, einen der ersten lebensechten Androiden. In ihrer Liebesgeschichte gibt es also von Anfang an einen Dritten: Adam. Kann eine Maschine denken, leiden, lieben? Adams Gefühle und seine moralischen Prinzipien bringen Charlie und Miranda in ungeahnte – und verhängnisvolle – Situationen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ian McEwan
Maschinen wie ich
und Menschen wie ihr
Roman
Aus dem Englischen von Bernhard Robben
Diogenes
Für Graeme Mitchison
1944–2018
Bitte vergiss nicht das Gesetz, unter dem wir leben:
Wir sind nicht geschaffen, eine Lüge zu verstehen …
Das Geheimnis der Maschinen
Rudyard Kipling
Eins
Es war der Hoffnungsschimmer einer religiösen Sehnsucht, es war der Heilige Gral der Wissenschaft. Unsere höchsten und niedersten Erwartungen wurden geweckt von diesem wahr gewordenen Schöpfungsmythos, diesem ungeheuerlichen Akt der Selbstverliebtheit. Kaum war es machbar, blieb nichts weiter übrig, als unserem Verlangen nachzugeben und auf die Folgen zu pfeifen. Pathetisch gesagt strebten wir danach, unserer Sterblichkeit zu entrinnen, Gott mit seinem perfekten Ebenbild zu konfrontieren oder gar zu ersetzen. Praktischer gedacht wollten wir eine verbesserte, modernere Version unserer selbst schaffen und die Freuden des Erfindens genießen, das Hochgefühl wahrer Meisterschaft. Im Herbst des zwanzigsten Jahrhunderts war es endlich so weit: Der erste Schritt zur Erfüllung eines uralten Traums war getan, und es begann jene lange Lektion, die uns lehrte, dass wir – wie kompliziert wir auch sein mochten, wie fehlerhaft und selbst in unseren einfachsten Handlungen, unserem schlichtesten Sein so schwer zu beschreiben – dennoch kopiert und verbessert werden konnten. Und ich war dabei in jener kühlen Morgendämmerung, ein eifriger Nutzer der ersten Stunde.
Künstliche Menschen waren ein Klischee schon lange, bevor es sie gab, weshalb sie manche, als sie dann endlich da waren, enttäuschend fanden. Die Phantasie, so viel schneller als die Historie, als jeder technologische Fortschritt, hatte diese Zukunft bereits in Büchern durchgespielt, dann im Kino und Fernsehen, als könnten uns menschliche Schauspieler mit glasigem Blick, ruckartigen Kopfbewegungen und steifem Kreuz auf das Leben mit unseren Vettern aus der Zukunft vorbereiten.
Ich gehörte zu den Optimisten und sah mich nach dem Tod meiner Mutter und dem Verkauf des Familienhauses, das, wie sich erwies, auf wertvollem Bauland stand, mit unverhofftem Reichtum gesegnet. Der erste wirklich funktionsfähige künstliche Mensch mit überzeugender Intelligenz und glaubhaftem Äußeren, mit lebensechter Motorik und Mimik kam auf den Markt, eine Woche ehe unsere Truppen zu ihrer hoffnungslosen Falkland-Mission aufbrachen. Adam kostete 86000 Pfund. Ich brachte ihn in einem gemieteten Transporter zu meiner schäbigen Wohnung in North Clapham. Es war eine leichtsinnige Entscheidung gewesen, befeuert von Berichten, dass sich Sir Alan Turing, Kriegsheld und größtes Genie des digitalen Zeitalters, dasselbe Modell hatte liefern lassen. Bestimmt wollte er es in seinem Labor auseinandernehmen, um genau zu sehen, wie es funktionierte.
Zwölf Exemplare dieser ersten Produktionsreihe hießen Adam, dreizehn Eve. Nicht gerade originell, da war man sich einig, aber verkäuflich. Da biologische Vorstellungen von Rasse wissenschaftlich in Verruf geraten waren, hatte man beim Design der fünfundzwanzig darauf geachtet, eine möglichst große Bandbreite an Ethnien abzudecken. Es gab erst Gerüchte, dann Beschwerden, dass der Araber nicht vom Juden zu unterscheiden war. Zufallsprogrammierung in Kombination mit Lebenserfahrung würde jedem Exemplar hinsichtlich sexueller Präferenzen eine freie Wahl garantieren. Die Eves waren nach einer Woche schon ausverkauft. Meinen Adam hätte man flüchtig besehen für einen Türken oder Griechen halten können. Da er 85 Kilo wog, musste ich Miranda, meine Nachbarin, bitten, mir zu helfen, und gemeinsam schleppten wir ihn auf einer mitgelieferten Einmaltrage von der Straße in die Wohnung.
Während sich die Batterien aufluden, setzte ich uns Kaffeewasser auf und scrollte dann durch das 470 Seiten starke Online-Handbuch. Es las sich größtenteils klar und präzise. Allerdings hatte man Adam in verschiedenen Werkstätten zusammengesetzt, weshalb manche Instruktionen den Charme eines Unsinnsgedichts besaßen: »Vorderteil des B347k Leibchens entblößen, um mit dem sorglos Emoticon des Motherboard Outputs die Stimmungsschwankungen der Penumbra zu mindern.«
Endlich saß er, einen Haufen Styropor und Plastik um die Knöchel, an meinem kleinen Esstisch, nackt, die Augen geschlossen. Ein schwarzes Stromkabel schlängelte sich von der Buchse, seinem Bauchnabel, zu einer Dreizehn-Ampere-Steckdose an der Wand. Ihn voll aufzuladen, würde sechzehn Stunden dauern. Dann noch die Update-Downloads und die Festlegung persönlicher Präferenzen. Ich wollte ihn jetzt, sofort, Miranda auch. Wie aufgeregte junge Eltern waren wir begierig, seine ersten Worte zu hören. Es gab keinen billigen, in seiner Brust versenkten Lautsprecher. Aus der enthusiastischen Werbung wussten wir, dass er mit Atemluft, Zunge, Zähnen und Gaumen Töne formte. Seine lebensechte Haut fühlte sich bereits warm und so weich an wie die eines Kindes. Miranda behauptete, ein Zucken seiner Wimpern beobachtet zu haben. Ich war mir sicher, dass es nur die Vibrationen der Untergrundbahn waren, die dreißig Meter unter uns dahindonnerte, sagte aber nichts.
Adam war kein Sexspielzeug. Dennoch war er zu Sex fähig und besaß funktionierende Schleimhautmembranen, für deren Versorgung er jeden Tag einen halben Liter Wasser benötigte. Mir fiel auf, dass er unbeschnitten war, recht gut bestückt, das Schamhaar voll und dunkel. Dieses hochentwickelte Modell eines künstlichen Menschen verkörperte vermutlich, was seinen jungen Programmierern gefiel, und den Adams und Eves wurde nachgesagt, überaus temperamentvoll zu sein.
Die Werbung pries ihn als Gefährten an, als intellektuellen Sparringspartner, als Freund und ein Faktotum, das den Abwasch machen, Betten beziehen und ›denken‹ konnte. Jeden Augenblick seiner Existenz, alles, was er hörte und sah, nahm er auf, jederzeit wieder abrufbar. Auto fahren konnte er noch nicht, und er durfte auch nicht schwimmen, duschen, ohne Schirm im Regen stehen oder unbeaufsichtigt mit einer Kettensäge hantieren. Was die Laufzeit betraf, konnte er, dank einem Durchbruch in der Batterieentwicklung, mit einer Akkuladung siebzehn Kilometer in zwei Stunden rennen oder sich – das energetische Äquivalent – zwölf Tage lang pausenlos unterhalten. Seine Lebensdauer war auf zwanzig Jahre angelegt. Er war kompakt gebaut, breitschultrig, hatte einen dunklen Teint und dichtes, schwarzes, nach hinten gekämmtes Haar, ein schmales Gesicht mit einer leicht gekrümmten Nase, die ihn hochintelligent wirken ließ, einen grüblerischen Blick unter schweren Lidern und feste Lippen, die in diesem Moment, vor unseren Augen, ihren tödlich gelbweißen Farbton verloren und eine satte, lebhafte Farbe annahmen, sich in den Mundwinkeln sogar ein wenig entspannten. Miranda meinte, er sähe aus wie »ein Hafenarbeiter vom Bosporus«.
Vor uns saß das ultimative Spielzeug, der wahrgewordene Traum vieler Jahrhunderte, der Triumph des Humanismus – oder sein Todesengel. Unfassbar aufregend, aber auch frustrierend. Sechzehn Stunden waren eine lange Zeit, wenn man nur warten und zusehen konnte. Bei der Summe, die ich nach dem Mittagessen für ihn hingeblättert hatte, hätte er auch geladen und betriebsfertig sein können, fand ich. Es war ein später Nachmittag im Winter. Ich machte Toast, und wir tranken noch einen Kaffee. Miranda, die Sozialgeschichte studierte und promovieren wollte, sagte, sie wünschte, die junge Mary Shelley könnte bei uns sein und mitverfolgen, wie nicht etwa ein Ungeheuer à la Frankenstein, sondern dieser attraktive junge Mann mit dem Bronzeteint zum Leben erwachte. Ich sagte, in jedem Fall aber würden beide Kreaturen die beseelende Kraft der Elektrizität brauchen.
»Genau wie wir«, sagte sie, als meine sie nur sich und mich und nicht die gesamte, elektrochemisch aufgeladene Menschheit.
Sie war zweiundzwanzig, ziemlich erwachsen für ihr Alter und zehn Jahre jünger als ich. Mit ein wenig Abstand betrachtet schien mir das vernachlässigbar. Wir waren beide so herrlich jung. Doch sah ich mich in einem ganz anderen Lebensabschnitt als sie. Die Ausbildung hatte ich längst abgeschlossen und bereits eine Reihe beruflicher, finanzieller und persönlicher Fehlschläge hinter mir. Für eine junge, liebenswerte Frau wie Miranda fand ich mich zu abgebrüht und zynisch. Obwohl sie schön war mit ihrem hellbraunen Haar und dem langen, schmalen Gesicht, den oft vor verhaltener Heiterkeit zusammengekniffenen Augen, und auch wenn ich sie in bestimmten Stimmungen manchmal staunend anstarrte, hatte ich sehr früh entschieden, ihre Rolle in meinem Leben auf die der netten, nachbarlichen Freundin zu beschränken. Ihre winzige Wohnung lag gleich über meiner. Wir teilten uns den Eingang und trafen uns manchmal auf einen Kaffee, um über Beziehungen, Politik, Gott und die Welt zu reden. Mit perfekt austarierter Neutralität schien sie entspannt all dem entgegenzusehen, was da kommen mochte, als wäre ihr ein nachmittägliches Schäferstündchen mit mir gerade so recht wie unsere keuschen, kameradschaftlichen Gespräche. Sie wirkte in meiner Gegenwart völlig entspannt, und ich sagte mir, Sex würde das nur ruinieren. So blieben wir gute Kameraden. Trotzdem strahlte sie etwas verlockend Geheimnisvolles, Reserviertes aus. Vielleicht war ich ja, ohne es zu wissen, schon seit Wochen in sie verliebt. Ohne es zu wissen? Was war das denn für eine fadenscheinige Formulierung?
Widerstrebend beschlossen wir, Adam und einander eine Weile sich selbst zu überlassen. Miranda musste zu einem Seminar auf der Nordseite der Themse und ich einige Mails beantworten. Schon Anfang der siebziger Jahre war die digitale Kommunikation von einer erhofften Vereinfachung des Lebens zu einer täglichen Last geworden. Nicht anders als die vierhundert Stundenkilometer schnellen Züge – überfüllt und dreckig. Spracherkennungssoftware, in den fünfziger Jahren noch ein Wunder, heute längst eine Bürde; jeden Tag opferten ganze Heerscharen Stunden ihres Lebens einsamen Monologen. Die Hirn-Maschine-Schnittstelle, jene wilde Frucht des Optimismus der sechziger Jahre, konnte heute nicht mal mehr ein Kind hinter dem Ofen hervorlocken. Wofür die Menschen das ganze Wochenende angestanden hatten, war sechs Monate später so interessant wie die Socken an ihren Füßen. Was war aus den die kognitiven Fähigkeiten verbessernden Helmen geworden, den sprechenden Kühlschränken mit Geruchssinn? Verschwunden wie das Mauspad, das Filofax, das elektrische Tranchiermesser oder das Fondueset. Unablässig rollte die Zukunft an. Unser tolles neues Spielzeug begann zu rosten, noch ehe wir es nach Hause tragen konnten, und das Leben ging mehr oder weniger weiter wie zuvor.
Würde auch Adam mich irgendwann langweilen? Gar nicht so einfach, E-Mails zu diktieren, wenn einen Zweifel wegen eines eventuellen Fehlkaufs plagen. Andere Menschen, andere Gedankenwelten werden uns doch gewiss immer faszinieren. Künstliche Menschen würden uns anfangs ähnlicher werden, dann genau wie wir und schließlich mehr als wir sein, deshalb könnten sie uns niemals anöden. Sie würden uns zwangsläufig stets aufs Neue überraschen, auch auf unerfreuliche Weisen, die wir uns nicht einmal vorstellen konnten. Tragödien waren möglich, Langeweile nicht.
Allein den Gedanken an das Benutzerhandbuch fand ich ermüdend. Instruktionen. Ich war schon immer der Ansicht, ein Gerät, das mir nicht allein durch seine Funktionsweise verriet, wie es bedient werden musste, sei sein Geld nicht wert. Einem altmodischen Impuls folgend druckte ich das Handbuch aus und suchte dann einen Ringordner für die Blätter, ohne dabei das Diktieren meiner Mails zu unterbrechen.
Ich verstand mich nicht als Adams ›Benutzer‹ und war davon ausgegangen, dass es nichts über ihn zu lernen gab, was er mir nicht selbst beibringen konnte. Das Handbuch in meinen Händen aber hatte sich zufällig bei Kapitel vierzehn geöffnet, hier war die Sprache klar und deutlich: Präferenzen – Persönlichkeitsparameter. Dann eine Reihe von Überschriften: Extraversion. Verträglichkeit. Offenheit für Erfahrungen. Gewissenhaftigkeit. Emotionale Stabilität. Die Liste war mir bekannt. Das Fünf-Faktoren-Modell. Mit meinem geisteswissenschaftlichen Hintergrund misstraute ich solch reduzierenden Kategorien, wusste aber von einem befreundeten Psychologen, dass zu jedem Punkt viele Untergruppen gehörten. Ein Blick auf die nächste Seite verriet mir, dass ich diverse Parameter auf einer Skala von eins bis zehn einstellen sollte.
Ich hatte einen Freund erwartet und war bereit, Adam als Gast in meinem Haus zu behandeln, als einen mir Unbekannten, den ich nach und nach besser kennenlernen würde. Und ich hatte damit gerechnet, dass er bei seiner Ankunft optimal eingestellt sein würde. Werkseinstellungen – ein modernes Synonym für Schicksal. Meine Freunde, meine Familie, meine Bekannten, sie alle waren mit fixen Einstellungen in mein Leben getreten, mit einer unveränderlichen Vorgeschichte aus Genen und Umwelt. Und von meinem teuren neuen Freund erwartete ich nichts anderes. Warum es mir überlassen? Natürlich kannte ich die Antwort. Nur wenige von uns sind optimal eingestellt. Ein sanfter Jesus? Ein demütiger Darwin? So einen gibt’s alle 1800 Jahre. Selbst wenn die besten, ungefährlichsten Persönlichkeitsparameter bekannt wären, was nicht der Fall ist, würde ein weltweiter Konzern mit seinem wertvollen Ruf kein Malheur riskieren. Caveat emptor.
Gott schuf zum Wohle Adams, des ersten Menschen, einst eine vollständig geformte Gefährtin. Ich musste meinen Gefährten selbst formen. Unter ›Extraversion‹ stand eine gestaffelte Liste kindisch klingender Aussagen. Auf jeder Party ist er der Mittelpunkt und Er ist ein geborener Anführer und weiß, wie man ein Publikum unterhält. Ganz unten: Er fühlt sich unbehaglich in Gesellschaft, und: Er bleibt lieber für sich. Und in der Mitte: Er mag Partys, freut sich aber auch jedes Mal, wieder nach Hause zu kommen. Das traf auf mich zu. Doch wollte ich mich reproduzieren? Wenn ich auf jeder Skala die Mitte wählte, erschuf ich womöglich die Fadheit in Person. Extraversion schien ihr eigenes Gegenteil einzuschließen. Es folgte eine lange Liste mit Adjektiven zum Ankreuzen: offenherzig, schüchtern, reizbar, redselig, reserviert, großspurig, bescheiden, tapfer, energisch, launisch. Ich wollte nichts davon, weder für ihn noch für mich.
Es gab Momente, in denen ich verrückte Entscheidungen traf, aber ansonsten verbrachte ich mein Leben, vor allem wenn ich allein war, überwiegend in einem stimmungsneutralen Zustand, meine Persönlichkeit, wie auch immer sie beschaffen sein mochte, blieb gleichsam in der Schwebe. Weder tapfer noch zurückgezogen. Einfach nur da, nicht zufrieden und nicht unzufrieden, wenn ich erledigte, was zu erledigen war, ans Abendessen dachte oder an Sex, auf den Bildschirm starrte, duschte. Über Vergangenes ab und zu ein Bedauern, eine gelegentliche bange Vorahnung der Zukunft, der Gegenwart kaum bewusst, vom unmittelbaren Bereich der Sinneswahrnehmungen einmal abgesehen. Die Psychologie, die sich früher so sehr für die zahllosen Wege interessierte, auf denen der Geist in die Irre gehen kann, widmete sich heute vorzugsweise dem, was man einfache Gefühle nennt, von Trauer bis zur Freude. Dabei übersah sie ein riesiges Gebiet der alltäglichen Existenz: Ist man von Krankheit, Hungersnot, Krieg oder sonstigen Stresssituationen verschont, findet ein Großteil des Lebens in einer neutralen Zone statt, einem vertrauten Garten, wenn auch grau, unscheinbar, sogleich wieder vergessen und schwer zu beschreiben.
Damals wusste ich nicht, dass diese gestaffelten Optionen kaum Auswirkungen auf Adam haben würden. Entscheidend war in Wahrheit das, was man ›maschinelles Lernen‹ nennt; das Benutzerhandbuch suggerierte bloß eine Illusion von Einfluss und Kontrolle, wie Eltern sie in Bezug auf die Persönlichkeit ihrer Kinder hegen. Auf diese Weise band man mich an meine Anschaffung, und dem Hersteller verhalf es zu einem gewissen Rechtsschutz. »Wählen Sie sorgsam«, riet das Handbuch. »Lassen Sie sich Zeit. Wenn nötig, mehrere Wochen.«
Erst eine halbe Stunde später sah ich nebenan wieder nach. Keine Veränderung. Immer noch am Tisch, die Arme lang ausgestreckt, die Augen geschlossen. Allerdings schien mir sein Haar, tiefstes Schwarz, ein bisschen voller zu sein und jetzt einen Schimmer zu haben, als käme er eben aus der Dusche. Ich trat näher heran und stellte erfreut fest, dass er zwar nicht atmete, sich an seiner linken Brust aber ein regelmäßiger Puls abzeichnete, stetig, ruhig, etwa ein Schlag pro Sekunde schätzte ich, unerfahren wie ich war. So beruhigend. Er hatte kein Blut, das er durch seinen Körper pumpen musste, doch blieb diese Simulation nicht ohne Wirkung. Meine Bedenken wurden schwächer. Es regte sich sogar mein Beschützerinstinkt, obwohl ich wusste, wie absurd das war. Ich streckte meine Hand aus, legte sie auf sein Herz und spürte den ruhigen, jambischen Rhythmus. Mir war, als würde ich seine Privatsphäre verletzen. An diese Lebenszeichen ließ sich leicht glauben. Die Wärme der Haut, darunter die festen, doch elastischen Muskeln – mein Verstand sagte Plastik oder Ähnliches, meine Hand aber reagierte auf Haut und Fleisch.
Es war unheimlich, neben diesem nackten Mann zu stehen, hin- und hergerissen zwischen dem, was ich wusste, und dem, was ich fühlte. Ich trat hinter ihn, nicht zuletzt, um aus dem Blickfeld seiner Augen zu kommen, die sich jeden Moment öffnen konnten und mich dann über ihn gebeugt sehen würden. Hals und Rücken waren ziemlich muskulös, auf den Schultern wuchsen dunkle Härchen. Der Hintern zwei kompakte Wölbungen, darunter kräftige Sportlerwaden. Ich hatte keinen Superman gewollt. Wieder einmal bedauerte ich, für eine Eve zu spät dran gewesen zu sein.
Ehe ich aus der Küche ging, sah ich noch einmal zurück und erlebte einen jener Momente, die das emotionale Leben gelegentlich durcheinanderwirbeln: ein verblüffendes Begreifen des Offensichtlichen, ein absurder Verständnissprung hin zu dem, was man längst weiß. Die Hand auf der Türklinke blieb ich stehen. Vermutlich war es Adams Nacktheit, seine körperliche Präsenz, die mir auf die Sprünge half, dabei sah ich ihn gar nicht an. Ich blickte auf die Butterdose. Und auf die zwei Teller und Tassen, die zwei Messer und Löffel auf dem Tisch. Übriggeblieben von meinem langen Nachmittag mit Miranda. Zwei Holzstühle standen vom Tisch abgerückt, einander gleichsam vertrauensvoll zugewandt.
Wir waren uns im letzten Monat nähergekommen. Wir redeten offen miteinander. Ich merkte, wie wichtig sie mir geworden war und wie gedankenlos ich sie wieder verlieren konnte. Ich hielt sie schon für einen selbstverständlichen Teil meines Lebens, dabei hätte ich längst etwas sagen müssen. Irgendein blöder Vorfall oder auch irgendjemand, einer ihrer Mitstudenten, konnte jederzeit zwischen uns kommen. Ihr Gesicht, ihre Stimme, ihre Art, scharfsinnig und zurückhaltend zugleich; sie schien so greifbar nahe. Die Berührung ihrer Finger auf meiner Hand, ihr gedankenverlorenes, nachdenkliches Naturell. Ja, wir waren uns sehr nahe gekommen, und ich hatte nichts davon bemerkt. Wie konnte ich nur so dumm sein. Ich musste mit ihr reden.
Ich ging zurück in mein Büro, das zugleich mein Schlafzimmer war. Zwischen Schreibtisch und Bett gab es gerade Platz genug, um auf und ab zu gehen. Dass sie nichts von meinen Gefühlen wusste, machte mir jetzt Sorgen. Sie ihr zu gestehen, wäre peinlich, riskant. Miranda war eine Nachbarin, eine Freundin, fast eine Schwester. Ich würde mit jemandem reden, den ich kaum kannte. Sie müsste hinter einer Schutzwand hervortreten, eine Maske abnehmen und sich mir auf eine nie zuvor gehörte Weise öffnen. Es tut mir so leid … ich habe dich sehr gern, aber weißt du … Oder sie wäre entsetzt. Vielleicht, aber nur vielleicht, freute sie sich auch, genau das zu hören, was sie sich so gewünscht, aus Angst vor einer Zurückweisung jedoch selbst nie zu sagen gewagt hatte.
Wie es der Zufall wollte, waren wir beide momentan ungebunden. Sie hatte bestimmt daran gedacht, an uns. Die Vorstellung war ja nicht abwegig. Ich würde es ihr von Angesicht zu Angesicht sagen müssen. Unerträglich. Unvermeidlich. Und so weiter, in stetig engeren Gedankenbahnen. Ruhelos trottete ich erneut nach nebenan. Ich konnte keine Veränderung feststellen, als ich an Adam vorbei zum Kühlschrank ging, in dem noch eine halbe Flasche weißer Bordeaux stand. Ich setzte mich ihm gegenüber, hob das Glas. Auf die Liebe. Diesmal empfand ich keine zärtlichen Regungen. Ich sah Adam als das, was er war, ein unbelebtes Artefakt, sein Herzschlag eine regelmäßige elektrische Entladung, die Hautwärme nur Chemie. Auf einen Aktivierungsimpuls hin würde ein mikroskopisch kleines Unruhrädchen seine Augen aufklappen. Dann würde er mich scheinbar sehen, dabei war er blind. Nicht einmal blind. Und ein weiteres System würde anspringen und Atem vortäuschen, Leben aber wäre das nicht. Ein frisch Verliebter weiß, was Leben ist.
Dank meiner Erbschaft hätte ich ein Haus nördlich der Themse kaufen können, irgendwo in Notting Hill oder in Chelsea. Womöglich wäre Miranda bei mir eingezogen, hätte Platz für all ihre Bücher gehabt, die jetzt in Kisten in der Garage ihres Vaters in Salisbury lagerten. Ich sah eine Zukunft ohne Adam, eine Zukunft, die mir bis gestern noch gehört hatte: ein Garten mitten in der Stadt, hohe stuckverzierte Zimmerdecken, Edelstahlküche, Abendessen mit Freunden. Überall Bücher. Was tun? Ich könnte ihn – oder es – online wieder verkaufen, mit geringem Verlust. Ich musterte es mit feindseligem Blick. Die Handflächen auf der Tischplatte, das Adlergesicht den Händen zugewandt. Meine blöde Technologiebesessenheit! Noch ein Fondueset. Besser, ich stand vom Tisch auf, ehe ein einziger Schlag mit dem alten Hammer meines Vaters mich wieder zu einem armen Mann machte.
Ich trank nur ein halbes Glas, dann ging ich zurück ins Schlafzimmer, um mich vom asiatischen Devisenmarkt ablenken zu lassen. Dabei lauschte ich auf Schritte in der Wohnung über mir. Später am Abend verfolgte ich im Fernsehen die neuesten Entwicklungen zur sogenannten Task Force, die bald dreizehntausend Kilometer weit übers Meer fahren würde, um zurückzuerobern, was wir damals die Falklandinseln nannten.
Mit zweiunddreißig war ich vollkommen pleite. Dass ich das Erbe meiner Mutter für technischen Klimbim aus dem Fenster geworfen hatte, war nur ein Teil des Problems, wenn auch ein typisches. Hatte ich Geld in der Hand, rann es mir durch die Finger, oder ich verbrannte es in einem magischen Freudenfeuer, warf es in einen Zylinder, um dann eine Niete hervorzuziehen. Oft, wenn auch nicht in diesem Fall, wollte ich mit wenig Geld und geringem Aufwand eine größere Summe hervorzaubern. Ich hatte eine Schwäche für billige Tricks, halblegale Kniffe, geniale Abkürzungen. Und ich war immer für große, glanzvolle Gesten zu haben. Anderen brachten sie Glück. Sie liehen sich Geld, legten es auf interessante Weise an, wurden reich und beglichen ihre Schulden. Oder sie hatten einen Job, einen Beruf, so wie ich früher, und wurden auf langsame, aber stetige Weise reich. Ich dagegen hebelte mich selbst aus, spekulierte mich in den vornehmen Ruin und hauste in zwei feuchten Parterrezimmern im langweiligen Niemandsland der edwardianischen Reihenhausstraßen zwischen Stockwell und Clapham in Südlondon.
Ich war in einem Dorf in der Nähe von Stratford, Warwickshire, aufgewachsen, als einziges Kind eines Musikers und einer Gemeindeschwester. Verglich ich meine Kindheit mit der von Miranda, hatte ich an kultureller Unterernährung gelitten. Da war kein Raum, keine Zeit für Bücher gewesen, noch nicht mal für Musik. Ich bewies ein frühreifes Interesse für Elektrotechnik, studierte am Ende aber Anthropologie an einem unbedeutenden College in den südlichen Midlands. Ich wechselte zu Jura und spezialisierte mich nach dem Abschluss auf Steuerrecht. Eine Woche nach meinem neunundzwanzigsten Geburtstag wurde mir die Zulassung entzogen, und ich entging nur knapp einer kurzen Gefängnisstrafe. Nach meinen hundert Stunden gemeinnütziger Arbeit wollte ich nie wieder einer regulären Arbeit nachgehen. Ich verdiente ein bisschen Geld mit einem in Windeseile verfassten Buch zum Thema künstliche Intelligenz; verlor alles mit einer Investition in eine Firma für lebensverlängernde Pillen. Ich verdiente nicht schlecht an einem Immobiliendeal; verlor alles mit einem Autovermietungsprojekt. Mein Lieblingsonkel, der mit einem Patent für Wärmepumpen reich geworden war, hinterließ mir ein hübsches Sümmchen; ich verlor alles mit einem dubiosen Krankenversicherungsprojekt.
Mit zweiunddreißig verdiente ich mir den Lebensunterhalt damit, online am Aktien- und Devisenmarkt zu traden. Ein Projekt, genau wie all die anderen. Sieben Stunden am Tag beugte ich mich über die Tastatur, kaufte, verkaufte, zauderte, riss vor Freude die Arme in die Luft und fluchte im nächsten Moment, zumindest in der ersten Zeit. Ich las Börsenanalysen, war aber überzeugt, es mit einem zufallsregierten System zu tun zu haben, weshalb ich meist ins Blaue riet. Manchmal gewann ich, manchmal verlor ich, im Schnitt aber verdiente ich übers Jahr etwa so viel wie ein Postbote. Ich zahlte die Miete, die damals noch niedrig war, konnte mir halbwegs gutes Essen und gute Kleidung leisten und meinte, mich allmählich besser zu kennen, geerdeter zu sein. Ich war fest entschlossen, in meinen Dreißigern eine bessere Performance als in den Zwanzigern zu liefern.
Doch mein wohnliches Elternhaus wurde gerade in dem Moment verkauft, als die ersten lebensechten künstlichen Menschen auf den Markt kamen. 1982. Roboter, Androiden, Replikanten waren meine Passion, erst recht nach der Recherche für mein Buch. Die Preise würden mit der Zeit fallen, aber ich musste gleich einen haben, sofort, am liebsten eine Eve, aber ein Adam ging auch in Ordnung.
Es hätte anders kommen können. Claire, meine letzte Freundin, war ein vernünftiger Mensch gewesen. Sie machte eine Ausbildung als Zahnarzthelferin und arbeitete in einer Praxis in der Harley Street. Sie hätte mir Adam bestimmt ausgeredet, denn sie war eine Frau von Welt, von dieser Welt. Sie hatte das Leben im Griff, und nicht nur ihr eigenes. Aber ich hatte sie mit meiner unbestreitbaren Treulosigkeit tief verletzt, und sie schickte mich in einem grandiosen Wutanfall zum Teufel, bei dem sie alle meine Klamotten auf die Straße warf. Lime Grove. Sie hat nie wieder ein Wort mit mir geredet und steht ganz oben auf der Liste meiner Fehler und Fehlschläge. Sie hätte mich vor mir selbst retten können.
Aber: Lassen wir der Ausgewogenheit halber den Ungeretteten selbst zu Wort kommen. Ich habe Adam nicht gekauft, um mit ihm Geld zu verdienen. Im Gegenteil. Meine Motive waren rein. Ich gab ein Vermögen aus im Namen der Neugierde, dieses unermüdlichen Motors der Wissenschaft, des intellektuellen Lebens, ja, des Lebens selbst. Das war keine flüchtige Marotte. Dazu gehörte eine Geschichte, ein Konto, eine Zeiteinlage, und ich besaß das Zugriffsrecht. Elektronik und Anthropologie – entfernte Verwandte, von der jüngeren Moderne miteinander verkuppelt und im Bund der Ehe zusammengeführt. Und Adam war die Frucht dieser Verbindung.
So also trete ich vor als Zeuge der Verteidigung, die Schule ist aus, fünf Uhr nachmittags, ich ein typisches Exemplar meiner Zeit – kurze Hose, zerschundene Knie, Sommersprossen, Topffrisur, elf Jahre alt. Ich bin der Erste in der Reihe, warte darauf, dass das Labor aufmacht und der ›Kabelklub‹ beginnt. Geleitet wird er von Mr Cox, einem sanften Riesen mit karottenrotem Haar; er unterrichtet Physik. Ich habe mir vorgenommen, ein Radio zu bauen. Es ist ein Glaubensakt, ein langes Gebet, das schon mehrere Wochen andauert. Als Grundfläche nehme ich eine Hartfaserplatte, fünfzehn mal zweiundzwanzig Zentimeter, in die sich leicht Löcher bohren lassen. Entscheidend sind die Farben. Blaue, rote, gelbe und weiße Kabel winden sich übers Brett, biegen in rechten Winkeln ab, verschwinden nach unten, tauchen woanders wieder auf und werden von glänzenden Dioden unterbrochen, von winzigen, hell gestreiften Zylindern – Kondensatoren, Widerstände –, dann noch eine Spule, selbst gewickelt, dazu ein Operationsverstärker. Ich verstehe nur Bahnhof und halte mich an den Schaltplan wie ein Novize an die Bibel. Mr Cox erteilt mit sanfter Stimme Rat. Tapsig verlöte ich einen Draht, ein Bauteil mit dem anderen. Der Qualm, der Geruch des Lötzinns ist eine Droge, die ich tief einatme. Ich setze in den Schaltkreis einen Kippschalter aus Bakelit, von dem ich mir einrede, dass er aus einem Kampfflugzeug stammt, bestimmt aus einer Spitfire. Die letzte Verbindung, drei Monate nach Beginn meiner Arbeit, führt von diesem dunkelbraunen Plastikstück zu einer Neun-Volt-Batterie.
Eine kalte, windige Abenddämmerung im März. Die anderen Jungs beugen sich über ihre jeweiligen Projekte. Wir sind knapp zwanzig Kilometer von Shakespeares Geburtsstadt entfernt in einer Einheitsschule, wie man später abwertend dazu sagen wird. In Wahrheit ein großartiger Ort. Die Neonröhren an der Decke leuchten auf. Mr Cox steht am anderen Ende des Labors und wendet mir den Rücken zu. Ich will seine Aufmerksamkeit nicht auf mich lenken für den Fall, dass es misslingt. Dann drücke ich den Schalter und – Wunder über Wunder – höre statisches Rauschen. Ich fummle am Drehkondensator: Musik, grässliche Musik, wie ich finde, denn ich kann Geigen hören. Anschließend die atemlose Stimme einer Frau, die kein Englisch spricht.
Niemand blickt auf, niemand ist interessiert. Ein Radio zu bauen ist nichts Besonderes. Aber ich bin sprachlos, den Tränen nahe. Keine technische Errungenschaft hat mich je wieder so in Erstaunen versetzt. Strom, der durch von mir sorgsam geordnete Metallteile fließt, fängt aus der Luft die Stimme einer ausländischen Frau auf, die irgendwo weit weg sitzt. Ihre Stimme klingt freundlich. Sie weiß nichts von mir. Ich werde nie ihren Namen erfahren oder ihre Sprache verstehen und werde sie nie treffen, jedenfalls nicht wissentlich. Mein Radio mit den unregelmäßigen Zinnklecksen auf einem Brett ist für mich ein ebenso großes Wunder wie das Bewusstsein, das bloßer Materie entspringt.
Gehirn und Elektronik sind eng verwandt, wie ich in meiner Teenagerzeit feststellte, als ich einfache Computer baute und selbst programmierte. Dann kompliziertere Computer. Strom und einige Metallteile konnten Zahlen addieren, Worte formen, Bilder und Musik, Erinnerungen abspeichern und sogar gesprochene Sprache in Schrift verwandeln.
Als ich siebzehn war, überredete mich Peter Cox, an einem College in der Nähe Physik zu studieren. Nach einem Monat langweilte ich mich bereits und wollte wechseln. Das Fach war mir zu abstrakt, die dafür notwendige Mathematik überstieg meine Fähigkeiten. Und dann las ich ein, zwei Romane und begann, mich für imaginäre Menschen zu interessieren. Hellers Catch-18, Fitzgeralds Der hochspringende Geliebte, Orwells Der letzte Mensch in Europa und Tolstois Ende gut, alles gut – viel weiter bin ich nicht gekommen, doch begann ich, den Sinn von Kunst zu begreifen. Sie war auch eine Form der Welterforschung. Nur wollte ich Literatur nicht studieren – zu einschüchternd, zu intuitiv. Auf einem Info-Blatt, das ich in der College-Bücherei las, nur eine Seite, hieß es, Anthropologie sei »die Wissenschaft vom Menschen in seinen Gesellschaften quer durch Raum und Zeit«. Systematische Forschung mit menschlichem Faktor. Ich schrieb mich dafür ein.
Als Erstes lernte ich, dass mein Studiengang erbärmlich unterfinanziert war. Also kein Gammeljahr auf den Trobriand-Inseln, wo es, wie ich gelesen hatte, tabu war, vor anderen zu essen. Gute Manieren bewies, wer allein aß oder Freunden und Familie dabei den Rücken zukehrte. Die Insulaner kannten Zaubersprüche, die hässliche Menschen in schöne Menschen verwandelten. Kinder wurden ermuntert, ihre Sexualität miteinander auszuleben. Süßkartoffeln waren die gängige Währung. Frauen bestimmten den Status der Männer. Wie seltsam, wie erfrischend. Meine Ansichten über die menschliche Natur waren bis dahin von der überwiegend weißen, im südlichen Zipfel Englands zusammengepferchten Bevölkerung geprägt. Nun wurde mein Denken befreit, es war die bodenlose Freiheit des Relativismus.
Mit neunzehn schrieb ich einen gelehrten Essay über Ehrenkulturen mit dem Titel Geistgeschmiedete Ketten? Leidenschaftslos trug ich meine Fallbeispiele vor. Was wusste ich denn schon? Und was kümmerte es mich? Es gab Gegenden, in denen Vergewaltigung so verbreitet war, dass es dafür kein Wort gab. Einem jungen Vater wurde die Kehle durchgeschnitten, weil er in einer alten Blutfehde nicht seinen Pflichten nachgekommen war. Da gab es eine Familie, die unbedingt ihre Tochter töten wollte, weil sie mit einem Jungen Händchen hielt, der einer anderen Religion angehörte. Und da gab es ältere Frauen, die bereitwillig bei der Klitorisverstümmelung ihrer Enkeltöchter halfen. Wo blieb der elterliche Instinkt, Kinder zu lieben und zu beschützen? Das kulturelle Signal war stärker. Und was war mit universellen Werten? Ins Gegenteil verkehrt. Nichts dergleichen bei uns in Stratford-upon-Avon. Es kam nur auf das Denken an, auf Tradition und Religion – bloße Software, dachte ich nun, die man am besten wertneutral analysierte.
Anthropologen urteilen nicht. Sie beobachten, und sie berichten über die Vielfältigkeit der Menschen. Sie feiern den Unterschied. Was man in Warwickshire für böse hält, ist in Papua-Neuguinea vielleicht nicht mal der Rede wert. Wer wollte hier oder dort schon bestimmen, was gut war und was schlecht? Eine Kolonialmacht jedenfalls schon gar nicht. Aus meinem Studium zog ich einige bedauernswerte Schlüsse über Ethik und Moral, die mich wenige Jahre später auf die Anklagebank eines Bezirksgerichtes brachten, man warf mir, zusammen mit anderen, gemeinschaftlichen Steuerbetrug im großen Stil vor. Ich versuchte den ehrenwerten Richter nicht davon zu überzeugen, dass es fernab von seinem Gericht vielleicht einen Palmenstrand gab, an dem derlei Machenschaften durchaus geschätzt wurden. Stattdessen kam ich gerade noch rechtzeitig zu Verstand, ehe ich ihn das erste Mal mit Euer Ehren ansprach. Moral war real, wahr sogar, Gut und Schlecht waren der Natur der Dinge eingeschrieben. Danach mussten unsere Handlungen beurteilt werden. Genau das hatte ich auch geglaubt, bevor ich Anthropologie zu studieren begann. Mit zittriger, stockender Stimme entschuldigte ich mich demütig vor Gericht und entging einer Haftstrafe.
Als ich am Morgen, später als gewöhnlich, in die Küche kam, hatte Adam die Augen geöffnet. Sie waren hellblau, darin winzige vertikale Flecken, wie schwarze Stäbchen. Die Wimpern waren so lang und dicht wie die eines Kindes. Sein Blinzelmechanismus funktionierte noch nicht. Laut Handbuch war er auf ein unregelmäßiges Intervall eingestellt und Stimmung wie Bewegung angepasst, zudem sollte er auf Handlungen und Wortwahl seines Gegenübers reagieren. Ich hatte, wider Willen, bis spät in die Nacht im Handbuch gelesen. Adam war unter anderem auch mit einem Blinzelreflex ausgestattet, um die Augen vor fliegenden Objekten zu schützen. Sein Blick war leer, frei von Bedeutung oder Absicht, und ließ mich deshalb unberührt, er wirkte so leblos wie der Blick einer Schaufensterpuppe. Bislang zeigte Adam zudem keine jener Kleinstbewegungen, die für den menschlichen Kopf typisch sind. Überhaupt, keinerlei Körpersprache. Als ich an seinem Handgelenk nach dem Puls tastete, fand ich nichts – ein Herzschlag ohne Puls. Sein Arm war schwer, das Ellbogengelenk ließ sich kaum bewegen, fast, als würde die Totenstarre einsetzen.
Ich kehrte ihm den Rücken zu, machte Kaffee und musste an Miranda denken. Alles hatte sich geändert. Nichts hatte sich geändert. Während meiner fast schlaflosen Nacht war mir wieder eingefallen, dass sie ihren Vater besuchen wollte. Von ihrem Seminar aus war sie sicher direkt nach Salisbury gefahren. Ich sah sie in Waterloo einsteigen, sah sie im Zug mit einem ungelesenen Buch im Schoß dasitzen und die vorüberhuschende Landschaft anstarren, dem Auf und Ab der Telefonleitungen folgen, ohne an mich zu denken. Oder sie dachte nur an mich. Oder sie dachte an den jungen Mann in ihrem Seminar, der sie so unverhohlen angegafft hatte.
Ich schaute mir auf meinem Handy die Nachrichten an. Ein greller Klangteppich und glitzerndes Küstenlicht. Portsmouth. Die Task Force bereit zum Auslaufen. Fast das ganze Land wie auf einer Traumbühne, verkleidet mit historischen Kostümen. Spätes Mittelalter. Siebzehntes Jahrhundert. Frühes neunzehntes Jahrhundert. Rüschen, Kniehosen, Reifröcke, gepuderte Perücken, Augenklappen, Holzbeine. Es genau zu nehmen galt als unpatriotisch. Historisch gesehen waren wir etwas Besonderes, also befand sich die Flotte auf Erfolgskurs. Fernsehen und Presse beschworen eine unbestimmte kollektive Erinnerung an besiegte Feinde herauf – die Spanier, die Holländer, die Deutschen gleich zweimal in diesem Jahrhundert, die Franzosen von Agincourt bis Waterloo. Jets im Überflug. Ein junger Mann im Kampfanzug, frisch von der Militärakadamie in Sandhurst, kniff die Augen zusammen, während er einem Interviewer die Probleme schilderte, die vor ihnen lagen. Ein ranghoher Offizier redete von der unerschütterlichen Entschlossenheit seiner Männer. Das rührte mich, obwohl ich derlei verabscheute. Als eine Highland-Pipers-Kapelle in dichter Reihe zur Schiffspier marschierte, ging mir das Herz auf. Dann zurück ins Studio, zu Diagrammen, Pfeilen, Logistik und Kampfziel, zu vernünftig klingenden Stimmen, die sich einig waren. Zu diplomatischen Bemühungen. Zur Premierministerin in ihrem adretten blauen Kostüm auf den Stufen ihrer Residenz in der Downing Street.
Es ließ mich nicht kalt, sooft ich auch erklärt hatte, dass ich eigentlich dagegen bin. Ich liebte mein Land. Was für ein gewagtes Unterfangen, welch wilder Mut. Dreizehntausend Kilometer. So viele anständige Menschen, die ihr Leben riskierten. Mit der zweiten Tasse Kaffee ging ich nach nebenan, machte das Bett, damit es hier wieder nach Arbeitszimmer aussah, und setzte mich hin, um über die globalen Finanzmärkte nachzudenken. Angesichts des drohenden Krieges war der Aktienindex FTSE um einen weiteren Prozentpunkt gesunken. Patriotisch gesinnt ging ich von einer argentinischen Niederlage aus und kaufte Aktien einer Spielwarenfirma, die Union-Jack-Fähnchen zum Winken herstellte. Außerdem investierte ich in zwei Champagner-Importfirmen und wettete generell auf einen kräftigen Aufschwung. Handelsschiffe waren requiriert worden, um Truppen in den Südatlantik zu bringen. Ein Freund, der im Assetmanagement arbeitete, hatte gesagt, seine Firma rechne damit, dass mehrere Schiffe versenkt werden würden, weshalb es sinnvoll sei, bei den größeren Spielern im Versicherungsmarkt auf fallende Kurse zu setzen und Anteile von südkoreanischen Schiffbauern zu erwerben. Für solch zynische Schachzüge war ich nicht in der Stimmung.
Mein Computer, von Mitte der Sechziger und secondhand in einem Trödelladen in Brixton gekauft, war langsam. Ich brauchte eine Stunde, um beim Fähnchenhersteller einzusteigen. Hätte ich meine Gedanken unter Kontrolle gehabt, hätte es nicht ganz so lange gedauert, aber wenn ich nicht an Miranda dachte und die Ohren spitzte, um ihre Schritte in der Wohnung über mir zu hören, dachte ich an Adam und fragte mich, ob ich ihn wieder verkaufen oder doch lieber seine Persönlichkeit festlegen sollte. Ich stieß Pfund Sterling ab und dachte weiter an Adam. Ich kaufte Gold und dachte erneut an Miranda; ich saß auf dem Klo und dachte über Schweizer Franken nach. Bei einer dritten Tasse Kaffee fragte ich mich, wofür eine siegreiche Nation sonst noch Geld ausgeben würde. Rindfleisch. Fernseher. Pubs. Ich setzte Geld auf alle drei und fand mich ganz tugendhaft, denn ich trug zu den Kriegsanstrengungen bei. Bald darauf wurde es Zeit fürs Mittagessen.
Ich setzte mich wieder zu Adam und aß ein Sandwich mit Käse und Gurkenscheiben. Neue Lebenszeichen? Nicht auf den ersten Blick. Die über meine rechte Schulter blickenden Augen sahen immer noch tot aus. Keine Bewegung. Als ich aber fünf Minuten später zufällig aufschaute, bekam ich tatsächlich mit, wie er zu atmen begann. Erst hörte ich eine Abfolge schneller Klicklaute, dann ein an Mücken erinnerndes Sirren, als sich seine Lippen teilten. Eine halbe Minute lang passierte gar nichts, bis plötzlich sein Kinn zitterte und er, nach einem echt klingenden Schlucken, zum ersten Mal nach Luft schnappte. Natürlich brauchte er keinen Sauerstoff. Bis zu dieser metabolischen Notwendigkeit sollten noch Jahre vergehen. Für sein erstes Ausatmen ließ er sich so lange Zeit, dass ich aufhörte zu essen und angespannt wartete. Endlich war es so weit – lautlos, durch die Nase. Bald atmete er in stetigem Rhythmus, entsprechend dehnte sich die Brust und zog sich wieder zusammen. Ich fand es unheimlich. Mit seinen leblosen Augen sah Adam aus wie ein atmender Leichnam.
Wie viel Leben wir den Augen zuschreiben. Wären seine doch nur geschlossen, dachte ich, dann könnte ich ihn für einen Mann in Trance halten. Ich ließ das Sandwich liegen, trat neben ihn und hielt neugierig meine Hand vor seinen Mund. Der Atem fühlte sich warm und feucht an. Clever. Im Benutzerhandbuch hatte ich gelesen, dass er einmal am Tag urinieren würde, am späteren Vormittag. Auch clever. Als ich sein rechtes Augenlid schließen wollte, streifte mein Finger seine Augenbraue. Er zuckte zusammen und riss den Kopf beiseite. Erschrocken wich ich zurück. Dann wartete ich. Zwanzig Sekunden lang oder länger geschah gar nichts, dann senkten sich in einer lautlosen, unendlich langsamen Bewegung die Schultern, und der Kopf glitt in seine frühere Stellung zurück. Sein Atem ging unverändert. Meiner hatte sich beschleunigt, der Puls auch. Aus mehreren Schritten Abstand sah ich fasziniert zu, wie er gleich einem Ballon, aus dem behutsam die Luft entwich, die alte Haltung wieder einnahm, und beschloss, ihm die Augen doch nicht zu schließen. Und während ich darauf wartete, was wohl als Nächstes mit ihm geschah, hörte ich Miranda in der Wohnung über mir. Zurück aus Salisbury. Sie lief im Schlafzimmer auf und ab. Erneut spürte ich das bange Glück unerklärter Liebe, und im selben Moment begann sich, eine Idee in mir zu regen.
An jenem Nachmittag hätte ich an meinen Computer Geld verdienen und verlieren sollen. Stattdessen beobachtete ich von einem Hubschrauber hoch am Himmel aus, wie die ersten Schiffe der Task Force Portland Bill umrundeten und an Chesil Beach vorbeizogen. Allein die Namen dieser Orte verdienten einen respektvollen Salut. Phantastisch. Weiter so!, dachte ich. Und dann: Kehrt um! Bald passierte die Flotte die Jurassic Coast, an der einst Dinosaurierherden Riesenfarne weideten. Plötzlich waren wir mitten unter den Menschen von Lyme Regis, die sich auf der Hafenmauer versammelt hatten. Manche mit einem Fernglas in der Hand, viele mit jenen Fähnchen, an die ich eben noch gedacht hatte, Plastikwedel an kurzem Holzstab. Vielleicht hatte ein Kamerateam sie verteilt. O-Töne aus dem Volk. Die sanften Stimmen energischer Frauen aus dem Städtchen, emotionsgeladen. Bärbeißige alte Landser, die in Kreta und der Normandie gekämpft hatten, nickten vor sich hin und gaben nichts preis. Ach, wie gern würde ich auch glauben können. Aber vielleicht konnte ich es ja! Ein irgendwo am Lizard angebrachtes Teleobjektiv zeigte die Schiffe, winzige Tupfer, die zum Klang von Rod Stewarts heiserer Stimme tapfer Kurs auf die gewaltige Dünung der hohen See hielten, und ich konnte nur mit Mühe meine Tränen unterdrücken.
So viel Aufregung an einem Nachmittag mitten in der Woche. Am Esstisch eine neuartige Kreatur, drei Meter über mir die Frau, in die ich mich frisch verliebt hatte, und das Land im Krieg wie in alten Zeiten. Doch ich war recht diszipliniert und hatte mir fest vorgenommen, jeden Tag sieben Stunden zu arbeiten. Also schaltete ich den Fernseher aus und kehrte zurück an den Bildschirm. Es wartete, wie erhofft, eine E-Mail von Miranda auf mich.
Ich wusste, ich würde niemals reich werden. Die Summen, die ich bewegte, zur Sicherheit breit gestreut, waren klein. Letzten Monat hatte ich ganz anständig mit Feststoffbatterien verdient, aber fast genauso viel mit Futures auf Seltene Erden verloren – ein törichter Sprung ins Wohlbekannte. Aber so hielt ich jeden Bürojob, jede Form von Karriere von mir fern. Für meine Freiheit nahm ich die Computerarbeit als das kleinere Übel in Kauf. Ich blieb den ganzen Nachmittag am Bildschirm und widerstand der Versuchung, nach Adam zu sehen, obwohl er vermutlich längst vollständig aufgeladen war. Als Nächstes stand der Download seiner Updates an. Danach dann diese problematischen persönlichen Präferenzen.
Vor meiner Mittagspause hatte ich Miranda eine Einladung zum Abendessen geschickt. Jetzt sagte sie zu. Sie ließ sich gern von mir bekochen. Und während des Essens würde ich ihr einen Vorschlag unterbreiten. Ich wollte die Hälfte der Auswahlpunkte für Adams Persönlichkeit bestimmen, ihr dann Link und Passwort schicken und sie über den Rest entscheiden lassen. Ich würde mich nicht einmischen, nicht mal wissen wollen, welche Wahl sie im Einzelnen getroffen hatte. Vielleicht würde sie sich von ihren eigenen Charaktereigenschaften leiten lassen: wunderbar. Vielleicht beschwor sie in Adam den Mann ihrer Träume herauf: lehrreich. Adam träte als reale Person in unser Leben, die vielschichtige Komplexität seiner Persönlichkeit würde sich erst im Laufe der Zeit offenbaren, im Laufe seiner Handlungen, seiner Begegnungen mit den Menschen, die seinen Weg kreuzten. In gewissem Sinne wäre er wie unser Kind. Was wir jeder für sich waren, käme in ihm zusammen. Miranda würde in dieses Abenteuer verwickelt werden. Wir wären Partner und Adam unser gemeinsames Projekt, unser Geschöpf. Wir wären eine Familie. Ich verfolgte bei diesem Plan keinerlei heimliche Absichten. Ich hoffte nur, wir würden uns häufiger sehen. Und wir würden unseren Spaß haben.
Normalerweise gab ich meine Projekte und Pläne bald wieder auf. Diesmal würde es anders sein. Ich hatte einen klaren Kopf und sah nicht, wie ich mir hier etwas vormachen konnte. Adam war kein Rivale. Sosehr er Miranda auch faszinierte, war er körperlich für sie doch eher abstoßend. So viel hatte sie mir verraten. »Gruselig« hatte sie es tags zuvor gefunden, dass sein Körper sich warm anfühlte. Und ein bisschen »unheimlich«, dass er mit der Zunge Worte formen konnte. Dabei war sein Wortschatz so groß wie der von Shakespeare. Es war sein Verstand, der ihre Neugier weckte.
Und so fiel die Entscheidung, Adam nicht zu verkaufen. Ich würde ihn mit Miranda teilen – wie ich ein Haus mit ihr hätte teilen können. Er würde uns beide in sich enthalten. Fortschritte verzeichnen, Notizen vergleichen, Enttäuschungen bündeln. Mit zweiunddreißig hielt ich mich in Liebesdingen für einen alten Hasen. Ernste Bekenntnisse würden Miranda vertreiben. Weit besser, uns gemeinsam auf diese Reise zu begeben. Meine Freundin war sie ja schon, hielt manchmal sogar meine Hand. Ich fing also nicht bei null an. Tiefe Gefühle mochten sich daraus entwickeln, so wie es bei mir der Fall gewesen war. Und wenn nicht, blieb mir der Trost, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen würden, als ich mir ansonsten hätte erhoffen können.
In meinem alten Kühlschrank, dessen rostiger Türgriff sich teilweise abgelöst hatte, lagen ein Maishuhn, ein Viertelpfund Butter, zwei Zitronen und etwas frischer Estragon. Außerdem fand ich in einer Schale einige Knoblauchknollen. Die erdverkrusteten Kartoffeln im Schrank hatten schon Triebe ausgebildet – aber geschält würden sie sich gut braten lassen. Salat, dazu ein Dressing, eine Flasche herzhaften Cahors. Schlicht und einfach. Als Erstes den Ofen vorheizen. Solch gewöhnliche Überlegungen gingen mir durch den Kopf, als ich vom Schreibtisch aufstand. Ein alter Freund, ein Journalist, hatte mal gesagt, das sei das Paradies auf Erden: den ganzen Tag über allein arbeiten und sich dabei auf einen Abend in interessanter Gesellschaft freuen.
Der Gedanke an das Essen, das ich für sie kochen wollte, und das traute Bonmot meines Freundes hatten mich einen Moment lang von Adam abgelenkt, so dass es mich wie ein Schock traf, als ich die Küche betrat und ihn dort nackt neben dem Tisch stehen sah. Den Kopf leicht abgewandt, nestelte er mit einer Hand unentschlossen an dem Kabel, das aus seinem Bauchnabel ragte. Die andere Hand war irgendwo am Kinn, strich bedächtig darüber – ein cleverer Algorithmus, keine Frage, der sehr überzeugend den Anschein von Nachdenklichkeit erweckte.
Kaum hatte ich mich wieder gefasst, sagte ich: »Adam?«
Langsam drehte er sich um. Erst als er sich mir ganz zugewandt hatte, erwiderte er meinen Blick und blinzelte. Blinzelte noch einmal. Der Mechanismus schien zu funktionieren, wirkte aber noch zu absichtsvoll.
»Charlie«, sagte er, »es freut mich, dich endlich kennenzulernen. Würdest du bitte so freundlich sein, meine Downloads zu veranlassen und die diversen Parameter einzustellen …«
Er hielt inne, musterte mich; mit schnellen Abtastsprüngen scannten die schwarzfleckigen Augen mein Gesicht. Prüften mich. »Was du dazu wissen musst, steht im Handbuch.«
»Ich kümmere mich drum«, sagte ich, »aber alles zu seiner Zeit.«
Seine Stimme überraschte mich, und sie gefiel mir. Ein heller Tenor, nicht zu schleppend, mit einer angenehmen Variation im Ton, so entgegenkommend wie freundlich, doch ohne jede Spur von Unterwürfigkeit. Er sprach das Standardenglisch eines gebildeten Mannes aus Südengland, Mittelklasse, in den Vokalen ein Anklang von West Country. Mein Herz raste, doch war ich fest entschlossen, nach außen hin ruhig zu wirken. Und wie um dies zu beweisen, trat ich einen Schritt näher. Stumm starrten wir uns an.
Vor Jahren, als Student, hatte ich von jenem ›Erstkontakt‹ eines Forschers namens Leahy mit einem Bergvolk in Papua-Neuguinea gelesen, im Jahre 1924. Die Stammesmitglieder waren sich unsicher, ob es sich bei diesen blassen Gestalten, die da plötzlich auf ihrem Land aufgetaucht waren, um Menschen oder um Geister handelte. Sie kehrten in ihr Dorf zurück, um darüber zu beraten, ließen aber einen halbwüchsigen Jungen vor Ort zurück, der die Fremden aus der Ferne beobachten sollte. Die Frage war entschieden, als er berichtete, dass einer von Leahys Kollegen hinter einen Busch gegangen sei, um seinen Darm zu entleeren. Hier, in meiner Küche, im Jahre 1982, gar nicht so viele Jahre später, lagen die Dinge nicht ganz so einfach. Aus dem Handbuch wusste ich, dass Adam nicht nur über ein Betriebssystem verfügte, sondern auch eine bestimmte Natur hatte – soll heißen, eine menschliche Natur – und dazu noch eine Persönlichkeit, von der ich hoffte, dass Miranda ihren Teil dazu beitragen würde. Ich war mir unsicher, wie diese drei Substrate überlappten oder interagierten. Als ich Anthropologie studiert hatte, war die Vorstellung einer universellen menschlichen Natur verpönt. Derlei hielt man für eine romantische Illusion, der Mensch war nichts weiter als das variable Produkt regionaler Bedingungen. Nur Anthropologen, die andere Kulturen eingehend studiert hatten und die schöne Bandbreite menschlicher Vielfalt kannten, verstanden in vollem Umfang die Absurdität von anthropologischen Konstanten. Wer bequem daheim blieb, begriff gar nichts, begriff nicht einmal die eigene Kultur. Einer meiner Professoren zitierte gern Rudyard Kipling: »Was können die schon über England wissen, die nur England kennen?«
Ich war Mitte zwanzig, als die evolutionäre Psychologie begann, die Idee einer essentiellen Natur zu rehabilitieren, die sich aus dem gemeinsamen genetischen Erbe ergebe, unabhängig von Zeit und Ort. Die Reaktion der Sozialwissenschaften fiel mehrheitlich abschätzig, wenn nicht gar empört aus. Menschliches Verhalten und Gene in Bezug zu setzen, wecke Erinnerungen an Hitlers Drittes Reich. Moden ändern sich. Adams Schöpfer jedenfalls surften offenbar auf dieser neuen Welle evolutionären Denkens mit.
Er stand vor mir, vollkommen reglos im Zwielicht eines Winternachmittags. Das Verpackungsmaterial, das ihn geschützt hatte, lag noch immer um seine Füße. Er entstieg diesem Wust wie Botticellis Venus ihrer Muschel. Das schwindende Licht, das durch das nördliche Fenster fiel, erhellte nur eine Hälfte seiner Gestalt, eine Seite seines noblen Gesichts. Die einzigen Geräusche waren das freundliche Surren des Kühlschranks und der gedämpfte Verkehrslärm. Im selben Moment spürte ich die Einsamkeit, die sich wie ein Gewicht auf seine muskulösen Schultern legte. Er war im späten zwanzigsten Jahrhundert in dieser schäbigen Küche in London SW9 aufgewacht, ohne Freunde, ohne Vergangenheit und ohne ein Gefühl für die Zukunft. Er war wahrlich allein. Die übrigen Adams und Eves waren über die ganze Welt verstreut bei ihren jeweiligen Besitzern; allerdings hieß es, dass sich in Riad gleich sieben Eves befanden.
Während ich die Hand nach dem Lichtschalter ausstreckte, fragte ich: »Wie fühlst du dich?«
Er wandte den Blick ab und suchte nach einer Antwort. »Ich fühle mich irgendwie nicht richtig.«
Diesmal klang die Stimme flach, fast, als hätte ihm meine Frage die Laune verdorben. Aber Laune? Wo denn in all den Mikroprozessoren?
»Was stört dich?«
»Ich habe keine Kleider an. Und …«
»Ich besorg dir welche. Was noch?«
»Dieses Kabel. Wenn ich das rausziehe, tut es weh.«
»Ich mach’s, und es wird nicht wehtun.«
Aber ich rührte mich nicht gleich. Im hellen elektrischen Licht beobachtete ich jetzt seinen Gesichtsausdruck, der sich beim Sprechen kaum verändert hatte. Was ich sah, war kein künstliches Gesicht, vielmehr die Maske eines Pokerspielers. Ohne das Lebensblut einer Persönlichkeit gab es für seine Miene nur wenig auszudrücken. Er funktionierte dank einer Art Default-Programm, das ihm genügen musste, bis die Downloads abgeschlossen waren. Ihm standen bestimmte Bewegungen, Redewendungen und Routinen zur Verfügung, die ihm einen halbwegs plausiblen Anschein verliehen. Er wusste in etwa, was unmittelbar zu tun war, mehr aber auch nicht. Wie jemand mit einem brutalen Kater.
Ich konnte es mir nun eingestehen – ich hatte Angst vor ihm und zögerte näher zu kommen. Außerdem beschäftigten mich die Konsequenzen seiner letzten Äußerung. Adam musste nur so tun, als täte ihm etwas weh, und ich war genötigt, ihm zu glauben und entsprechend zu reagieren. Alles andere war zu schwierig. Widersprach zu sehr unserer instinktiven Neigung zum Mitgefühl. Zugleich konnte ich nicht glauben, dass er fähig war, Schmerz zu spüren, Gefühle zu haben, überhaupt irgendwelche Empfindungen. Und doch hatte ich ihn gefragt, wie er sich fühle. Die Antwort war angemessen gewesen, ebenso mein Angebot, ihm Kleider zu bringen. Auch wenn ich nichts davon glaubte. Ich spielte ein Computerspiel, allerdings ein reales Spiel, real wie das gesellschaftliche Leben; die Beweise dafür waren mein trockener Mund und mein Herz, das sich gar nicht mehr beruhigen wollte.
Klar war, dass er nur reden würde, wenn er zuvor angesprochen wurde. Ich widerstand dem Impuls, ihn weiter zu beruhigen, ging zurück ins Schlafzimmer und suchte ihm ein paar Kleider raus. Er war ein kräftiger Kerl, einige Zentimeter kleiner als ich, doch nahm ich an, dass ihm meine Sachen mehr oder weniger passen würden. Turnschuhe, Socken, Unterwäsche, Jeans und Pullover. Ich stand vor ihm und drückte ihm das Bündel in die Hand. Ich wollte sehen, wie er sich anzog, wollte sehen, ob seine motorischen Fähigkeiten so gut waren, wie die Broschüre es versprochen hatte. Jeder Dreijährige wusste schließlich, wie schwierig es war, Socken anzuziehen.
Als ich ihm die Kleider gab, nahm ich den leichten Geruch seines Oberkörpers wahr, vielleicht auch seiner Beine, einen Geruch nach warmem Öl, nach jenem hellen, hochraffinierten Öl, mit dem mein Vater die Klappen seines Saxophons geölt hatte. Adam hielt die Kleider in der Armbeuge, die Hände in meine Richtung gestreckt. Er zuckte nicht zusammen, als ich mich hinunterbeugte und den Stecker zog. Seine angespannte, wie gemeißelte Miene gab nichts preis. So ausdrucksstark wie ein Gabelstapler, der sich in einer Lagerhalle einer Palette nähert. Dann ratterte vermutlich irgendein Logikgatter auf, oder ein ganzes Netz davon reagierte, und er flüsterte: »Danke.« Das Wort wurde von einem nachdrücklichen Kopfnicken begleitet. Er setzte sich, legte den Stapel auf den Tisch und griff sich von oben den Pullover. Eine nachdenkliche Pause, dann faltete er ihn auf, legte ihn flach hin, Brustseite nach unten, fuhr mit der rechten Hand hinein, schlängelte zur Schulter hoch, dasselbe mit der linken Hand, streifte ihn mit einer komplizierten, muskelzuckenden Bewegung über und zog ihn nach unten bis über die Taille. Auf dem verblichenen gelben Stoff prangte in roten Buchstaben der scherzhafte Slogan eines wohltätigen Vereins, den ich mal unterstützt hatte: »Legastheniker aller Länder verinnigt euch!« Er rollte die Socken auf und zog sie sich im Sitzen an. Geschickte Bewegungen. Kein Zaudern, keine Probleme mit den relativen räumlichen Berechnungen. Er stand auf, hielt die Boxershorts tief, führte die Füße durch die Öffnungen, zog die Hose hoch, ging bei der Jeans ebenso vor, schloss den Reißverschluss und in einer einzigen geschmeidigen Bewegung auch den silbernen Knopf am Hosenbund. Er setzte sich wieder, steckte die Füße in die Turnschuhe und band die Schnürsenkel zu einer Doppelschleife, in einem rasenden Tempo, das vielleicht etwas unmenschlich wirkte. Aber ich fand es keineswegs unmenschlich. Für mich war es vielmehr eine Glanzleistung von Ingenieurskunst und Softwaredesign: ein Triumph des menschlichen Genies.
Ich wandte mich von ihm ab, um mit den Vorbereitungen für das Abendessen zu beginnen, und hörte Miranda oben durch ihre Wohnung gehen, die Schritte gedämpft, als sei sie barfuß. Bestimmt duschte sie gleich, machte sich fein. Für mich. Ich stellte sie mir vor, noch tropfnass, im Morgenmantel, wie sie die Schublade öffnete und sich fragte: Seide? Ja. Pfirsichfarben? Gut. Während der Ofen vorheizte, legte ich die Zutaten auf die Arbeitsplatte. Nach einem profitgierigen Tag am Computer bringt einen nichts so rasch auf die freundlichere Hälfte der Welt zurück wie das Kochen, man reiht sich ein in die lange Tradition der Fürsorge für andere. Ich blickte über die Schulter. Verblüffend, die Wirkung seiner Kleider. Er saß da, Ellbogen auf dem Tisch, wie ein alter Kumpel, der darauf wartete, dass ich ihm das erste Glas des Abends einschenkte.
Ich rief ihm zu: »Es gibt ein Ofenhuhn mit Butter und Estragon.« Das war nicht nett, wusste ich doch, dass auf seinem Speiseplan nur Elektronen standen.
Ohne zu zögern, doch mit zu flacher Stimme antwortete er: »Passt gut zusammen, nur verkohlen die Würzblätter leicht, wenn man das Geflügel bräunt.«
Geflügel bräunt? Ich schätze, das war korrekt, aber es klang irgendwie seltsam.
»Was würdest du mir raten?«
»Decke das Hähnchen mit Alufolie ab. Bei der Größe empfehle ich siebzig Minuten bei 180 Grad. Anschließend die Blätter in die Soße hinunterwischen und die Haut bei gleichbleibender Temperatur ohne Folie bräunen. Zum Schluss den Estragon mit dem Saft und der geschmolzenen Butter wieder drübergießen.«
»Danke.«
»Und nicht vergessen, das Huhn zehn Minuten mit einem Tuch abzudecken, ehe du es tranchierst.«
»Weiß ich doch.«
»Entschuldige.«
Klang ich gereizt? Anfang der achtziger Jahre waren wir es seit langem gewohnt, mit Maschinen zu reden, in unseren Autos, daheim, bei Telefonaten mit einem Call-Center oder der Arztpraxis. Aber Adam hatte das Gewicht meines Hähnchens quer durch die Küche präzise geschätzt und sich für einen überflüssigen Rat entschuldigt. Ich sah wieder zu ihm hinüber. Mir fiel auf, dass er die Ärmel bis zu den Ellbogen aufgekrempelt und sehnige Unterarme entblößt hatte. Er verschränkte die Finger und stützte das Kinn in die Hände. Und das war Adam ohne Persönlichkeit. Von dort, wo ich stand, betonte das Licht seine hohen Wangenknochen; er sah wie einer dieser harten, stillen Typen am Tresen einer Bar aus, denen man lieber nicht in die Quere kommt. Und nicht wie einer, der Kochtipps gibt.
Ich spürte das ziemlich kindische Verlangen, ihm zu zeigen, wer hier der Boss war. »Adam?«, sagte ich. »Könntest du einige Male um den Tisch gehen? Ich will sehen, wie du dich bewegst.«
»Klar.«
Sein Gang hatte nichts Mechanisches an sich. Selbst auf beengtem Raum gelangen ihm weit ausholende Schritte. Nach zwei Runden blieb er an seinem Stuhl stehen, wartete.
»Jetzt kannst du die Weinflasche öffnen.«
»Aber gern.«
Er kam auf mich zu, und ich legte ihm den Korkenzieher in die offene Hand, so einen mit Scharnier und Hebelwirkung, wie ihn Sommeliers bevorzugen. Er hatte keinerlei Mühe damit, hielt sich den Korken an die Nase, holte ein Glas aus dem Schrank, schenkte einen Schluck ein und reichte es mir. Während ich probierte, beobachtete er mich aufmerksam. Der Wein war nicht erst- oder auch nur zweitklassig, hatte aber keinen Korken. Ich nickte, und er füllte das Glas, um es dann behutsam neben dem Herd abzustellen. Anschließend ging er zurück zu seinem Stuhl, und ich kümmerte mich um den Salat.
Es verging eine friedliche halbe Stunde, in der keiner von uns ein Wort sagte. Ich rührte die Salatsoße an, schnitt die Kartoffeln in Scheiben und dachte an Miranda. Ich war davon überzeugt, an einen jener entscheidenden Punkte im Leben gelangt zu sein, an denen sich der Weg in die Zukunft gabelt. In der einen Richtung würde alles so weitergehen wie bisher, in der anderen würde sich alles ändern. Liebe, Abenteuer, das pure Vergnügen, aber auch Ordnung im neuen, reiferen Leben, keine verrückten Projekte mehr, ein gemeinsames Zuhause, Kinder. Wobei die letzten beiden Punkte durchaus zu den verrückten Projekten zählen mochten. Miranda war der liebreizendste Mensch, gütig, schön, amüsant, hochintelligent …
Als ich das Geräusch in meinem Rücken hörte, kam ich wieder zu mir, hörte es noch einmal und drehte mich um. Adam saß nach wie vor auf seinem Stuhl am Küchentisch. Er hatte zweimal diesen Laut von sich gegeben, das Geräusch eines Mannes, der sich absichtlich räuspert.
»Charlie, wenn ich dies hier richtig deute, bereitest du ein Essen für deine Freundin von oben vor. Für Miranda.«
Ich sagte nichts.
»Laut meinen Recherchen der letzten Sekunden und der sich daraus ergebenden Analyse solltest du ihr nicht restlos vertrauen.«
»Was sagst du da?«
»Laut meinen …«
»Erkläre dich.«