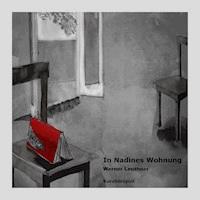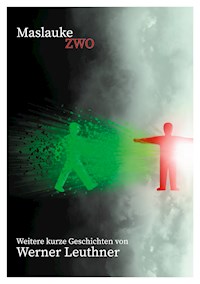
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auch hier geht es um das Suchen. Halten Sie also die Augen offen. Der Philosoph Leibniz glaubte, dass wir in der besten aller Welten leben. Der bloße Augenschein widerlegt(e) diese Behauptung: damals wie heute. Aber es bleibt der starke Wunsch nach einer besseren Welt. Deshalb die Suche. Finden lassen sich kleine Stücke davon. Dies begründet die Hoffnung auf mehr...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor:
Werner Leuthner ist 1942 in München geboren und dort aufgewachsen. Er durchlief drei Ausbildungen: zum Maschinenschlosser, zum Wirtschaftsingenieur und zum Diplompädagogen (Schwerpunkt: außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung).
Sein Berufsleben verbrachte er bei Krauss-Maffei in München-Allach, Siemens in München und dann in der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen. (VHS, Ausbildungswesen, Personalrat). Die letzten zehn Jahre war er als Studienberater in einer Außenstelle der FernUniversität Hagen tätig.
Diese Tätigkeiten ermöglichten ihm einen breiten Einblick in die Lebensumstände der verschiedensten Menschen.
»Richtig« zu schreiben begonnen hat er mit seinem Renteneintritt 2002. An der Schreibwerkstatt in Villingen-Schwenningen und in der Schreibwerkstatt an der PH-Freiburg hat er Austausch und Anregung gefunden.‚
Im vorliegenden zweiten Band sind weitere 25 seiner Kurzgeschichten versammelt, gegliedert in die Sparten »Beziehungen«, »Erinnerungen«, »Gesellschaft«, »Komisch« und »Mysteriös«! Im »Schluss« geht es um das »Wesen der Kurzgeschichte« und über »Creative Writing«.
Inhaltstverzeichnis
Vorwort
Beziehungen
Kevin und Kim
Elizabeta und der Whiskey
Die Lösung (Ein Fall ›Hiob‹ und sein Ausgang
)
William Turner und der Mann mit dem Tic
Eine Reise nach Siena
Sag‘ jetzt nichts!
Gerlinde verreist
Erinnerungen
Herbst in der Zucali-Straße
Schwalben
Prolog aus: »Nichts geht verloren« oder »Ein vorläufiger Lebenslauf in Episoden«
Ein letztes Mal
Gesellschaft
Die Finanzierung
Georg Maslaukes Transformation
Der Gutschein
Think positive! oder Leo Kleinbölting fährt ins Grüne
»It’s a long way to Tipperary«
Das große Vergessen
Jens probt das Sterben
Komisch
Brigach-Biber Benno
Was macht Monsieur Fabre in Randolfs Garten?
Bericht vom Bergwerk
Der Schwirrling (Passer numeratus
)
Mysteriös
Der zweite Schläfer
Im Ausgleichsamt
Warum Adolf Mellau nur vorübergehend besser hörte
Zum Schluss
Vom ›Wesen‹ der Kurzgeschichte(n
)
Kurzgeschichten & ›Creative Writing‹
Anhang
Vortrag ›Melancholie«
Vortrag ›Langeweile‹
Vorwort
Auf mein erstes Buch ›Maslaukes Transformation‹ hin habe ich viele positive Rückmeldungen bekommen. Das hat mich ermutigt, einen zweiten Band zusammenzustellen – ›Material‹ dazu in Form von Geschichten oder kurzen Texten besitze ich ja genügend.
Der Titel des zweiten Buchs sollte, nachdem es als Fortführung des ersten gedacht ist, auch an dessen Titel anknüpfen. So kam es zu ›Maslauke ZWO‹.
Die Titelgeschichte des ersten Buches »Maslaukes Transformation« beschreibt ein Staatswesen, das seine demografischen Probleme mit Zwang zu lösen versucht. Dazu müssen sich alle über 75 Jahre alten Menschen ›transformieren‹ lassen, d.h. sie werden eliminiert.
Das demografische Thema hat mich weiter beschäftigt. Zehn Jahre später entstand die erste Fassung von ›Die Finanzierung‹; hier übt ›der Staat‹ keinen Druck mehr aus. Stattdessen lockt er mit finanziellen Zuwendungen, die dann den Hinterbliebenen zugutekommen… Lesen Sie hier die neueste Fassung von ›Die Finanzierung‹ (2020). Und im Vergleich dazu ist auch noch einmal ›Maslauskes Transformation‹ abgedruckt.
Die Zuordnung der einzelnen Texte zu den Kapiteln ist nicht immer eindeutig. Deshalb habe ich neu die Rubrik ›Erinnerungen‹ eingefügt. (Diese vier Texte sind kurz – aber keine ›Kurzgeschichten‹). Ein Kapitel ›Krimi‹ fehlt. Der Übersichtlichkeit halber habe ich das bisherige Schema beibehalten.
Im Schlusskapitel ist auch noch mal die Erläuterung »Vom Wesen der Kurzgeschichte(n)« aufgeführt. Daneben wird die Verbindung von Kurzgeschichten und »Creative Writing« angedacht und auf eine kurze Abhandlung von Doris Dörrie ›Über das Schreiben‹ mit Link hingewiesen.
Zusätzlich finden Sie einen Anhang mit zwei Vortragsmanuskripten vor.
Was die Gestaltung betrifft, sollten all die Anregungen aufgegriffen werden, die mich erreichten: Schrift größer (12 statt nur 11 pt), Schrift dunkler, Zeilenabstand größer und breitere Ränder. Ich hoffe, diese Änderungen tragen zur besseren Lesbarkeit bei.
Meinen Leserinnen und Lesern wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre von ›Maslauke ZWO‹. Und ich freue mich wieder auf Ihre Rückmeldungen.
Mein Dank gilt Hanno Schreiber für die Gestaltung des Buchs, Luisa Demmler für das geänderte Cover-Motiv und Klara Allgeier für die genaue Durchsicht!
Villingen, im April 2021
Werner Leuthner
Beziehungen
1. Kevin und Kim
Ohne sein Zutun hatte Kevin eine Unterstützerin bekommen. Sie nannte sich ›Enagh‹ und war eine junge Elfe. Sie würde Schadzauber von ihm abwenden. Gerne hätte er noch mehr über sie erfahren, aber inzwischen war es 18.30 Uhr geworden. Kevin meldete sich bei seinem Fantasy-Rollenspiel ab, legte seinen Kopfhörer zur Seite und schob die Tastatur weg. Er blickte auf: an den Fensterscheiben Regentropfen. Draußen dämmerte es. Nachdem der Bildschirm ausgegangen war, war es ziemlich dunkel im Raum.
Jetzt musste er das Abendessen vorbereiten, denn seine Mutter hatte auf dem Handy angerufen, dass sie gegen 19 Uhr nach hause kommen würde. Elfriede war Zustellerin bei ›FLUX-Paketdienst‹ und die einzige Fahrerin in dieser Firma. Sie erzählte wenig von ihrem Job, aber dass sie darauf stolz war, daraus machte Sie keinen Hehl. Seit vielen Jahren schon nannte er seine Mutter Elli.
Kevin knipste im Wohnzimmer, in der Kochnische und im kleinen Flur das Licht an und deckte den Tisch. Wenn sie kam, dann war sie meist total am Ende, ausgelaugt. Dann würde sie sich in den Fernsehsessel plumpsen lassen, die Beine hochlegen und Kevin ansehen. Das bedeutete, dass sie jetzt ihr Feierabendbier bräuchte, um wieder ›herunter zu kommen‹. Kevin würde ihr die Bierflasche geöffnet reichen und stumm ihr gegenüber Platz nehmen. Vielleicht würde Elli ja doch etwas berichten…
Kevin machte den Haushalt, dies war die unausgesprochene Übereinkunft, dass er – mit seinen 22 Jahren – hier in dieser kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung bleiben konnte. Elli hatte das Schlafzimmer für sich und Kevin schlief im Wohnzimmer auf einer Couch hinter dem schwach bestückten Bücherregal. Dort hatte er auch seinen Computerplatz. Doch die prächtige Aussicht vom 7. Stock dieses Hochhauses nahm er kaum wahr.
Einkaufen musste er nicht, denn Elli brachte immer das mit, was er ihr aufgeschrieben hatte. Das Haus verließ er nur, um den Müll zum Container zu bringen. Und um möglichst niemand zu begegnen, der ihn ansprechen könnte, erledigte er dies ganz früh am Morgen – noch bevor seine Mutter zur Arbeit aufbrach. Wenn dann tagsüber doch einmal ein Paketbote klingelte, öffnete er stumm, quittierte stumm den Empfang und verabschiedete den Zusteller mit einem Nicken. Den Briefkasten leerte seine Mutter, wenn sie abends zurückkam.
Zum Frühstück stellte Kevin ihr eine Tasse Kaffee auf den Tisch, zusammen mit zwei Scheiben Toast und Butter und Marmelade. Die Thermosflasche mit Kaffee zum Mitnehmen, stand dann auch schon bereit. Nachdem Elli gegen sechs Uhr gegangen war, legte sich Kevin nochmals ins Bett.
Wenn er manchmal hinunterblickte und die Menschen auf den Verbindungswegen zwischen den Häusern gehen sah, war dies eine fremde Spezies für ihn geworden. Sie sahen ihm zwar ähnlich, aber sonst verband ihn kaum etwas mit ihnen. Das Leben da draußen war ›virtual realitiy‹ für ihn. Den Gedanken, dort vielleicht wieder einmal leben zu müssen, ließ er nicht zu, er ängstigte ihn. Er verdrängte ihn. Elli war seine Verbindung zur Außenwelt und das reichte ihm.
Mehr interessierte ihn jetzt, wer hinter ›Enagh‹ steckte. Vielleicht würde er ja etwas über den Spiele-Moderator in Erfahrung bringen können.
Er hörte Schlüssel an der Wohnungstür – Elli war gekommen. Ein Blick – und er hatte ihre Stimmung erfasst. Sie schien halbwegs gut gelaunt. Sie begrüßten einander verhalten. Elli wollte wissen, was es zum Abendessen geben würde. Salzkartoffel, Kräuterquark und Hering aus der Dose hatte er vorbereitet. Sie nickte zufrieden, zog Schuhe und Jacke aus, holte sich selbst ihr Bier und nahm in ihrem Fernsehsessel Platz.
»Nun, was gibt’s bei dir zu berichten?«, wollte sie wissen.
»Nichts«, entgegnete er mit einem dünnen Lachen: »Was soll es bei mir schon geben? Kein Anruf! Kein Postbote! Niemand hat an der Tür geklingelt! Doch halt, bevor ich es vergesse: deine rosa Orchidee treibt wieder! Ansonsten – wie üblich am PC, wie es sich für einen echten ›gamer‹ gehört!«
»Wirst du nicht verrückt dabei?«
»Nee, gar nicht – für mich ist das ein gutes Leben!«
Elli schüttelte ihren Kopf: »22 Jahre alt bist du jetzt!«
Kevin zuckte mit den Schultern.
Während sie ihr Bier trank, hatte sie das Fernsehprogramm studiert.
»Oh, Rosamunde Pilcher kommt. Das schaue ich mir an. Guckst du mit?« Sie aßen zusammen. Elli langte kräftig zu, doch Kevin nahm nur wenig.
»Wahrscheinlich wiegst du keine 50 Kilo!«, meinte sie beiläufig.
Er korrigierte sie: »52 – bei einer Größe von eins-siebzig. Für das, was ich tue, reicht das völlig!« Während Kevin das Geschirr versorgte, plante Elli ihre Route für den nächsten Tag am PC in ihrem Zimmer. Pünktlich zur Pilcher-Sendung war sie zurück und danach ging sie zu Bett.
So richtig herausrücken mit den Angaben über seine Spiele-Partnerin ›Enagh‹ wollte der Systemadministrator dieses Multiplayer-Online-Games nicht. Immerhin brachte Kevin heraus, dass die junge Frau, die hinter ›Enagh‹ steckte, in seinem Stadtviertel wohnte, genauer gesagt, ganz in der Nähe, am Rennsteigplatz.
Irgendwann wollte Kevin nicht länger hinnehmen, wie viele der anderen Mitspieler mit ›Fafnir‹ umsprangen. Der Zwerg war das Opfer, das sie ohne Hemmung schikanierten. Bis jetzt hatte er sich nicht getraut, sich gegen die anderen zu stellen. Aber er konnte dem einfach nicht länger zusehen. Wie war er als Kind drangsaliert worden – diese Erinnerungen kamen hoch. Seine Eltern stritten immer und er konnte sich nirgends zurückziehen. Er hatte keine Freunde, zu denen er hätte fliehen können. Er hatte Partei ergriffen – für seine Mutter. Sein Vater hatte ihn dafür verprügelt und meist aus der Wohnung ausgesperrt. Stundenlang saß er damals alleine auf dem Spielplatz, bis ihn seine Mutter wieder herauf holte. Damals hatte er angefangen, Unflätiges herauszuschreien. Immer, wenn jemand etwas von ihm wollte oder gar mit ihm schimpfte. Er konnte nichts dagegen tun. Es begann damit, dass eine geheime Kraft seinen Kopf nach rechts riss, immer wieder. Dann kamen unwillkürliche Zuckungen seiner Arme hinzu. Als dann diese Worte »Scheiße, Scheiße, Arschloch, Ficken, Ficken« von ihm heraus geschrieen wurden, fühlte er sich erleichtert. Er hatte das Tourette-Syndrom entwickelt – jedenfalls nannten so die Ärzte seine Angewohnheit, Leute mit Fäkalausdrücken zu überziehen und dabei zu zucken.
Manche Ohrfeige hatte er sich da eingehandelt. Aber irgendwann mieden sie ihn und er hatte seine Ruhe. Für ihn interessierte sich keine Schulsozialarbeiterin und kein Schulpsychologe. Von der Hauptschule musste er in eine Schule für verhaltensauffällige Kinder überwechseln.
Kevin war zwölf, als sein Vater auszog. Er hatte eine neue Freundin gefunden. Und nachdem Elli einwilligte, seine Schulden zu begleichen, war sein Vater auch bereit, sich scheiden zu lassen. Kevin war sehr erleichtert; er hat ihn nie wieder gesehen.
Mit 14 schenkte ihm seine Mutter den ersten PC – damit er sich zuhause beschäftigen konnte.
Und dann kam Kevin in den Schulzweig, in dem all diejenigen gesteckt wurden, die ohne Ausbildungsplatz geblieben waren. In der Zeit zwischen seinem 15. und 18. Lebensjahr war Kevin nur wenige Tage an der Schule. Niemand schien ihn zu vermissen.
Die Schlacht zwischen den ›Midlanders‹ und den ›Okthans‹ wogte hin und her. Es war ein Stellungskrieg geworden und ›Fafnir‹ war zwischen die Fronten geraten. Weil die Kriegsparteien nicht vorankamen, ließen sie Ihren Frust am neutralen ›Fafnir‹ aus. ›Fafnir‹ handelte sonst mit Heilkräutern. Jetzt blieb nichts anderes übrig, als sich zu verstecken und in Pausen des Kampfgeschehens nach Essbarem zu suchen.
Kevins Spielfigur hieß ›Knoor‹ und war ein erfahrener Krieger und Söldner. Üblicherweise sind diese ja nur auf ihren Vorteil bedacht. So waren die Mitspieler baff erstaunt, als ›Knoor‹ auf einmal ›Fafnirs‹ Höhleneingang bewachte und fair play einforderte. Gegen einen aus ihren Reihen grundlos zu kämpfen – da waren die Hemmungen doch deutlich höher. Noch dazu als ›Knoor‹ Verstärkung bekam: zu ihm gesellte sich ›Enagh‹, die Elfin. So hatte Kevin durch seinen Schritt und mit ›Enaghs‹ Unterstützung ›Fafnir‹ ermöglicht, wieder sein normales Leben zu führen…
Kevin war so in sein Spielgeschehen vertieft, dass er das Klingeln an der Wohnungstür zu erst nicht wahrnahm. Irgendwann drang der andauernde Ton doch in sein Bewusstsein. Verärgert betätigte er die Öffnertaste für die Haustür. Er öffnete die Wohnungstür und horchte hinaus: der Aufzug hatte sich in Bewegung gesetzt. Er wartete. Die Lifttür öffnete sich; heraus trat eine vielleicht Zwanzigjährige mit grün-blauen Haaren und Piercings in der Nase und den Lippen. Kevin erschrak, dann wollte er losschreien: »Schei… Schei…« Den Rest verschluckte er. Er holte Luft. »Bist du Enagh?« Sie nickte: »Ich heiße Kim! Und wie heißt ›Knoor‹ im normalen Leben?«
»Kevin« antwortete er tonlos.
»Ich habe dich gestern früh unten beim Müll gesehen und weil die Haustür noch nicht zugefallen war, konnte ich an der Anzeige sehen, wo der Lift steckte: im siebten Stockwerk. Und mein erster Versuch heute war gleich ein Treffer. Der Spielleiter war ja nicht besonders mitteilsam!«
Kevin grinste. »Komm‘ rein!« sagte er.
Copyright 2019
2. Elizabeta und der Whiskey
»Klemens Amthor, App. 117« stand an der Tür. Elizabeta klopfte mehrfach: keine Reaktion! Ihre Kolleginnen hatten sie vor dem Ekel gewarnt, das hier seit einem halben Jahr wohnte. Sie aber, sie die Aushilfe, hatte die anderen Reinigungskräfte ausgelacht… Mit ihrem Generalschlüssel schloss sie die Tür auf und schob ihren Wagen mit den Putz-Utensilien in den kleinen Flur, der direkt in das Wohnzimmer überging. Dort in der Verlängerung des Flurs, in der Ecke stand ein großer Fernseher, es lief ein Boxkampf.
»Hallo, hallooo, Herr Amthor!«
Elizabeta vernahm nur ein unwirsches Gebrumm. Sie bog um die Ecke: dieser Herr Amthor saß in einem voluminösen Sessel gegenüber dem Fernsehgerät, die Füße auf dem Couchtisch, daneben ein Trinkglas sowie eine Whiskey- und eine Wasserflasche. Zeitungsteile lagen verstreut auf dem Boden.
Der über sechzigjährige, bleiche Mann mit beachtlichem Bauch musterte sie: »Was wollen Sie hier? Ich hab’ Sie nicht bestellt. Hauen Sie ab!«
»Nein! Sie haben schon die letzten drei Tage niemand mehr in ihr Appartement gelassen. Heute bin ich an der Reihe und muss hier sauber machen. Und ich werde hier sauber machen, sonst leidet die Hygiene. Übrigens: Ich bin neu hier. Ich heiße Elizabeta!«
»Elizabeta? – Wo kommen Sie denn her und was verstehen Sie schon von Hygiene? Elizabeta klingt nach Ural. Mein Gott, jetzt werden sie bald chinesische Wanderarbeiter zum Putzen hier einsetzen!«
»Ich bin Polin, nicht Russin!« widersprach sie ruhig »und ich komme aus Zgorzelec.« Während Elizabeta dies erklärte, raffte sie die Zeitungsseiten vom Boden zusammen und legte sie auf der Couch ab. Sie steckte das Stromkabel ein und ihr großer Staubsauger begann laut zu brausen. Mit der breiten Bodendüse zog sie gleichmäßige Bahnen über den Teppich. Mit grimmigem Gesicht und verschränkten Armen verfolgte er ihr Tun. Von der Sportsendung war nichts mehr zu verstehen. Dann begann sie unter dem Couchtisch zu saugen und stieß dabei mehrfach an seine Beine, die er heruntergenommen hatte.
»Heh – was fällt Ihnen ein!«
»Warum gehen Sie nicht in die Cafeteria, solange ich putze? Oder –« sie blickte auf seine langen grauen Haare »gleich zum Friseur? Sie haben doch hier in Ihrer Seniorenresidenz alles! Ein üppig ausgestattetes Haus für solche, die es sich leisten können!«
Herr Amthor rührte sich nicht von der Stelle: »Für eine polnische Putzhilfe können Sie aber gut Deutsch.«
»Wissen Sie überhaupt, wo Zgorzelec liegt?«
Er schüttelte den Kopf: »Offensichtlich in Polen.«
»Ja – das ist die Stadt, die auf der polnischen Seite gegenüber Görlitz liegt, und zwischen beiden Städten fließt die Neiße. Auf dem Gymnasium habe ich Deutsch gelernt, als Wahlfach!«
»Das überrascht mich schon, dass neuerdings hier Putzfrauen Gymnasialbildung haben müssen!«
Elizabeta steckte die schmale Fugendüse auf das Saugrohr und machte sich an die Polster. Dabei rückte sie ihm immer wieder nahe. Er erhob sich erst vom Sessel, als sie seine Hosenbeine ansaugte.
»Normalerweise müssten die Bewohner bestimmen, ich aber werde von einer Putzfrau tyrannisiert. Das wird der Hauswirtschaftsleitung aber gar nicht gefallen!«
»Armer Herr Amthor! Sie leben hier wie die Speckmade – und wissen es nicht mal!«
»Es heißt ›Made im Speck‹«, schimpfte er im Hinausgehen.
»Meine Chefin heißt Frau Sweene!«, rief sie ihm nach.
Gegen die kommst du nicht mehr an, Klemens Amthor, Medizinaldirektor a.D. Die lässt sich nicht beeindrucken. Gegen diese Polin hast du verloren, ging es ihm durch den Kopf.
Ihn erboste, dass er sich hatte vertreiben lassen und gleichzeitig imponierte ihm die junge Frau auch: ganz schön couragiert, diese Putze!
Er schlenderte durch die Empfangshalle, wandte sich zum Kiosk, las die Titelzeilen der Zeitungen im Ständer, ging unschlüssig weiter und stand dann vor dem kleinen Frisörladen. Kein Kunde war im Geschäft und die Friseuse stand über die kleine Theke gebeugt und blätterte in einer Illustrierten.
Er stand lange unschlüssig vor dem Laden, seufzte und betrat das kleine Geschäft. Er grüßte knapp und setzte sich ohne Aufforderung in den Sessel vor den Spiegel. Die Friseuse legte ihm den Plastikumhang um, den er so ekelhaft empfand und fragte, wie er es denn haben wolle.
Es sei ihm egal, nur kürzer müssten seine Haare geschnitten werden, deren Länge sei moniert worden.
Und während die Friseuse ihr Werk verrichtete, stellte er sich Elizabeta vor: eher klein, rundliches Gesicht, sehr lebhafte dunkle Augen, dunkelbraunes Haar, zu einem Pferdeschwanz gebunden, frauliche Figur,…
»Ist es so recht?«
Die Friseuse hielt einen Handspiegel hinter ihn. Er nickte und war erstaunt, wie viele Haarbüschel von ihm auf dem Umhang lagen und dann auf den Boden geschüttelt wurden.
»O.K. Es geht auf Amthor, Appartment 117.«
Im Hinausgehen legte er zwei Euro auf die Theke.
In seinem Appartment war im Grunde fast alles so wie nach einer der üblichen Reinigungen. Neu war diesmal, dass seine Whiskeyflasche weggeräumt war und auf dem Couchtisch in einem Saftglas eine Margerite steckte. Nachdem er die Whiskeyflasche im Kühlschrank gefunden hatte, setzte er sich. Lange betrachtete er die Blume.
Am nächsten Tag wartete er auf die Reinigungskraft, die immer um die gleiche Zeit kam. Um 10.10 Uhr klopfte es und diesmal antwortete er: »Herein.« Als Elizabeta um die Ecke bog, war er erleichtert.
»Tag, Herr Amthor, wow, Sie waren ja beim Friseur! Steht Ihnen gut!«
»Danke für die Blume«, entgegnete er.
»Die habe ich aus der Vase in der Sitzecke geklaut. In Ihrem Zimmer ist nichts Persönliches, es ist wie in einem Hotelzimmer: kein Foto, kein Buch, keine Blumen. Da musste ich Ihnen wenigstens eine Blume reinstellen.«
Sie sahen sich einen Moment schweigend an, dann sagte Elizabeta: »Wollen Sie nicht gehen, solange ich hier sauber mache?«
Er schüttelte erneut den Kopf. Im TV lief gerade ein Autorennen.
»Ja, dann schalte ich mal den Fernseher aus – was Sie nur an den Sportsendungen finden? Und warum müssen Sie immer diesen Fusel trinken?«
Herr Amthor sprang wütend auf: »Fusel? Fusel?!? Ich glaube, Sie ticken nicht recht. Das ist ein ›Single Malt‹, ein wenigstens zehn Jahre alter irischer Whiskey. Wenn ich mich schon besaufe, dann mit Stil!«
Elizabeta sah ihn belustigt an: »Bei uns zu Hause sieht man auch alte Männer Wodka trinken – aber sie unterhalten sich dabei. Doch Sie trinken alleine! Daran ändert auch ein besonderer Whiskey nichts!«
Herr Amthor holte sich seinen Küchenhocker, stelle ihn in den Übergang vom Flur zum Wohnzimmer und setzte sich. Schon wieder ganz ruhig, fragte er sie: »Haben Sie mal von dem polnischen Wodka probiert?« Sie schüttelte den Kopf, ohne ihr Staubwischen zu unterbrechen. »Dann hat es auch keinen Sinn, wenn ich Ihnen zum Vergleich ein kleines Schlückchen von meinem Whiskey anbiete. So, und jetzt möchte ich zuschauen, wie Sie hier für hygienische Zustände sorgen! Ich habe hier nämlich Staphylokokken und Legionellen versteckt!«
Sie sah ihn erstaunt an: »Sind Sie Arzt?« Er nickte.
»Aber Sie haben doch gar keinen ›Doktor‹?«
»Braucht man auch nicht, um Arzt zu sein. Ich habe es trotzdem zum Leiter eines Gesundheitsamtes gebracht. Meine Hauptaufgabe war die Hygieneüberwachung von Schulen, Gaststätten, Kantinen, Freibädern, Piercingstudios, Bordellen.« Herr Amthor begann zu kichern.
»Und Sie, wie weit haben Sie’s im Gymnasium gebracht?«
»Nach dem Abitur habe ich eine pädagogische Hochschule besucht: ich bin Lehrerin.«
Ihm fiel die Kinnlade herunter: »Und da arbeiten Sie hier?«
»Es war keine Stelle frei. Und weil ich eine neue Gegend kennen lernen wollte, bin ich bis hierher gekommen! So, das war’s für heute. Ade, Herr Amthor.«
Er erhob sich, schlüpfte in sein Jackett und ging, um einen Blumenladen zu suchen.
Am nächsten Vormittag räumte Herr Amthor seine Zeitungsteile selbst auf. Der Blumenstrauß, der jetzt auf dem Couchtisch neben Whiskey- und Wasserflasche stand, steckte in einer geliehenen Vase. Im Fernsehen lief Biathlon. Seit einer halben Stunde wartete er jetzt schon auf Elizabeta. 10.30 Uhr – endlich klopfte sie. »Wo bleiben Sie denn?« fragte Herr Amthor vorwurfsvoll.
»Hallo! Schwierige Kundschaft lebt hier auf dem Stockwerk! Ihre Nachbarin bräuchte für ihre fünf Wellensittiche eine eigene Reinigungskraft. Die Vögel werde ich bestimmt mal mit aufsaugen!«
Elizabeta sah sich um: »Ein Blumenstrauß, und was für ein schöner! Toll. Und die Zeitungen sind vom Boden! Super!« Nun blickte sie missbilligend zum Fernseher: »Sind Sie so ein Fan, dass Sie sich alle Wettkämpfe anschauen müssen?«
Er schüttelte den Kopf: »Nee. Sport hat keine ›Botschaft‹. Aber es bewegt sich was.«
Elizabeta fixierte ihn: »Nur Sport sehen, der Sie gar nicht interessiert, Zeitung lesen und Whiskey trinken? Sagen Sie mir jetzt nicht, wie sehr Sie unter Ihrem Alt-Werden leiden!«
Sie hatte sich in Rage geredet, während der Alte stumm zuhörte. Sie warf den Staublappen auf den Couchtisch, ließ sich in einen Sessel plumpsen und rief: »So und jetzt brauche ich einen Whiskey!«
Klemens Amthor blickte sie fragend an. Als sie nickte, holte er ein Glas, goss eine Bodendecke von seinem ›Bushmills‹ ein und reichte es ihr. Sie roch daran und kippte dann den Inhalt in einem Zug hinunter. Heftiger Husten schüttelte sie, dann räusperte sie sich. »Nicht schlecht. Schmeckt wie Honig!« Sie sprang auf, griff den Staublappen und rief: »Mein Gott, vor lauter Quatschen komme ich gar nicht mehr zu meiner Arbeit. Es ist besser, Sie gehen jetzt.«
Gehorsam erhob er sich und schickte sich an, zu gehen. Elizabeta hielt ihn am Ärmel zurück: »Übrigens, ich habe jetzt doch eine Stelle als Lehrerin bekommen. Ich werde also hier aufhören. Heute Nachmittag habe ich frei, da lade ich Sie zum Eis-Essen ein. Um 15.00 Uhr im ›Tonelli‹. O.K.?«
»Sie wollen mich einladen, mich? – Ich werde rechtzeitig dort sein!«
Im Hinausgehen blieb er vor dem Spiegel stehen und betrachtete sich. Er zog dabei seine Stirn in Falten.
Amthor wandte sich nochmals um: »Elizabeta; kann ich Sie da in
Ihrem Zorgelic oder wie es heißt, mal besuchen?«
»Klar – ich würde mich freuen!«
Copyright 2012
3. Die Lösung (Ein Fall ›Hiob‹ und sein Ausgang)
I
Ächzend ließ sich Marius in den Sessel vor Vaters Schreibtisch fallen, stützte den rechten Ellenbogen auf die Platte und senkte dann sein Kinn in die geöffnete Hand. So blieb er wohl einige Minuten regungslos sitzen. Dann lehnte er sich zurück und sein Blick fiel auf seine Füße, die in Pantoffeln steckten: er ärgerte sich. Die Pantoffeln hatte seine Mutter für ihn in der Garderobe bereit gehalten und stets darauf bestanden, dass er sie auch benützte. Gewohnheitsmäßig hatte er seine Straßenschuhe ausgezogen und war in die Schlappen geschlüpft. Dies war aber jetzt völlig unnötig, denn seine Mutter war verstorben und Marius musste nun ihre Wohnung auflösen, in der sie bis zuletzt gelebt hatte. Alle Zimmer hatte er schon geräumt, nur Vaters Arbeitszimmer nicht. Für Mutter war es das ›Herrenzimmer‹ und sie hatte seit Vaters Tod vor über zehn Jahren nichts darin verändert. Für ihn als Kind war dieser Raum verbotene Zone gewesen. Und auch als Erwachsenen hatte Mutter ihn stets begleitet, wenn er dieses Zimmer betrat.
Marius zog nun den großen Karton, den er mitgebracht hatte, heran und öffnete die oberste Schublade des Schreibtisches. Anfangs überflog er die Schriftstücke noch, dann ging er dazu über, diese ungelesen zu zerreißen und in den Karton zu werfen. In der zweiten Schublade viele Schächtelchen und Schatullen: ein versilberten Miniatureiffelturm, Rosenkränze in verschiedenen Ausführungen, auch zur Erinnerung an die Erste hl. Kommunion, eine Medaille ›25 Jahre Sängerbund‹, aber auch eine Anstecknadel ›NSDAP‹. Alles landete im Karton. In der untersten Schublade eine Unmenge von Zeitungsausschnitten, fein säuberlich aufgeklebt und Leserbriefe seines Vaters, die im ›Andelgrater Kurier‹ abgedruckt waren. Vater hatte seinen Namen ›Alwin Josef Reuter‹ unter diesen Leserbriefen stets dick rot unterstrichen. Es betraf die ungenügenden Zugverbindungen von Andelgrat nach Bruck, der Kreisstadt, (zu wissen, dass die Zugverbindung schon vor etwa 20 Jahren durch eine Buslinie ersetzt worden war, belustigte ihn). Es ging um den schlechten Zustand des Kriegerehrenmals, den dürftigen Besuch des Sängerfests,… Alles landete im Karton. Ganz hinten in dieser Schublade fand er noch ein etwa postkartengroßes Päckchen, mit grob-braunem Packpapier umhüllt und ordentlich verschnürt. Verwundert wog er es in der Hand: Es mochte ein knappes Pfund schwer sein. Marius blickte auf seine Armbanduhr: Es war Zeit, sich auf den Weg zu machen, um seine Frau im Pflegeheim zu besuchen. Marius warf das Päckchen ungeöffnet in den Karton.
II
Irmhild, seine Frau, war Demenzpatientin und lebte schon im achten Jahr in diesem Heim. Sie konnte nicht mehr stehen, geschweige gehen, musste gefüttert werden und war inkontinent. Solange Marius nicht verreist war, und das kam immer seltener vor, besuchte er sie täglich. Wenn sie Schmerzen hatte, was man dann unschwer an ihrem angespannten Gesicht und den verkrampften Händen ablesen konnte, wimmerte sie leise vor sich hin. Die Schwestern sagten dann: »Jetzt jammert sie wieder!« und verabreichten ihr von den verschriebenen Schmerztropfen. Diese Aussage empörte Marius, denn für ihn war Jammern ein ungerechtfertigtes Klagen. Wenn er Schwestern darauf angesprochen hatte, erntete er bestenfalls ein Schulterzucken.
Sobald es das Wetter zuließ, schob Marius Irmhild in den nahe gelegenen Park, er setzte sich auf eine Bank und stellte sie im Rollstuhl neben sich. Dann berichtete Marius seiner Frau von seinen täglichen Verrichtungen, etwa welche Beeren er im Garten geerntet und welche Marmeladenmischung er ausprobiert hatte. Inzwischen war es eine einseitige Kommunikation zwischen ihnen, denn Irmhild hatte schon vor Jahren das Sprechen eingestellt, nicht plötzlich, aber sie sagte immer weniger und seltener etwas und irgendwann eben gar nichts mehr. Trotz fehlender Resonanz setze Marius seine ›Vorträge‹ fort, weil er sich sicher war, dass ihr eine persönliche Ansprache gut tue. Und in seltenen Momenten, wenn er von den Kindern erzählte, Anekdoten aus deren Schulzeit, von gemeinsamen Urlauben, die schon lange zurücklagen, konnte es sein, dass ihre sphinxhaft unbeteiligten Züge weich wurden, ihre Augen klar und ein Lächeln über ihr Gesicht huschte. Solche Momente empfand Marius als Belohnung und als Ansporn, sich weiter um seine Frau zu bemühen. Kurz darauf erstarrte sie jeweils wieder und Marius schien, als zöge sie sich abermals zurück: die Muschelschalen wieder ganz geschlossen, den Blick erneut auf Unendlich gestellt…
III
Marius hatte sich seinen Alltag so eingerichtet, dass die nachmittäglichen Besuche bei seiner Frau nicht gefährdet waren. So plante er Arzt- oder Behördentermine entsprechend um diesen Fixpunkt. Wenn etwa die Senioren-VHS einen ihm wichtigen Vortrag am Nachmittag anbot, besuchte er Irmhild am Vormittag. Er las ausführlich seine Zeitungen, führte seinen Haushalt, pflegte seinen Garten, hörte bestimmte Sendereihen im Radio und war so den ganzen Tag über beschäftigt. Abends hatte er oft keine Lust zum Fernsehen, und er war auch kein ausdauernder Leser. Dicke Folianten, von anderen lustvoll verschlungen, schreckten ihn ab. Und die philosophischen Abhandlungen, mit denen er kämpfte, erzwangen ein häppchenweises Lesen. So blieb ihm viel Raum zum Grübeln.