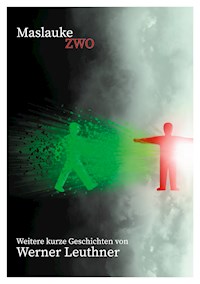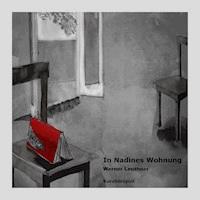4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hier geht es um das Suchen. Fast alle Menschen suchen. Manche nur nach einem Puzzle-Stein oder andere nach einem neuen Weg (dem richtigen?). Manche suchen nach einer Erklärung oder nach Zusammenhängen. Es gibt auch welche, die nach Erleuchtung suchen. Finden ist möglich. Aber wenn es kein Zufallsfund ist, ist man in der Regel lange unterwegs. In dem vorliegenden Bändchen sind Geschichten aus fast zwanzig Jahren versammelt. Fast alle beschäftigen sich mit dem Unterwegssein, also auch mit dem Suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der Autor:
Werner Leuthner ist 1942 in München geboren und dort aufgewachsen. Er durchlief drei Ausbildungsstufen: zum Maschinenschlosser, zum Wirtschaftsingenieur und zum Diplompädagogen (Schwerpunkt: außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung).
Sein Berufsleben verbrachte er bei Krauss-Maffei in München-Allach, Siemens in München und dann in der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen. (VHS, Ausbildungswesen, Personalrat.) Die letzten zehn Jahre war er als Studienberater in einer Außenstelle der FernUniversität Hagen tätig.
Diese Tätigkeiten ermöglichten ihm einen breiten Einblick in die Lebensumstände der verschiedensten Menschen.
»Richtig« zu schreiben begonnen hat er mit seinem Renteneintritt 2002. An der Schreibwerkstatt in Villingen-Schwenningen und in der Schreibwerkstatt an der PH-Freiburg hat er Austausch und Anregung gefunden.
Im vorliegenden Band sind 35 seiner Kurzgeschichten versammelt, gegliedert in die Sparten »Beziehungen«, »Gesellschaft«, »Komisch«, »Krimi« und »Mysteriös«! Im »Schluss« geht es um das »Wesen der Kurzgeschichte«.
Inhaltstverzeichnis
Vorwort
Beziehungen
Ein Gespräch auf der Parkbank
Mein Starker Vater
Dr. Hornicks Begräbnis
Das Zeichen
.
Adieu, mon Amour
Herr Grosse und seine Frauen
Heute schon geküsst?
Das Date
Damals in Guilvinec
Die Dienstreisen des Herrn Banholtz
Gesellschaft
Georg Maslaukes Transformation
Nächster Halt »Wilhelmshöhe«
Ach Leute, wie die Zeit vergeht
Wenzel und sein Metronom
Adrian Gnack und das Ministerium für Unterhaltsame Vollbeschäftigung
Kramers letztes Abenteuer
Bruckmann in Bedrängnis
Die Bürde des Menschen
Mein Sohn Ben, der Androide
Damian Krukal und der Notstand
Komisch
Augenblick & Wimpernschlag
Die Verwechslung
Als ich zu fliegen begann
Anna
Ein unvollkommener Buddha
PROSPEROL™
Krimi
Das geliehene Ohr
Der Fall Peter Zolg
Mysteriös
Der Junge im Lotossitz
Ein überraschender Todesfall
Ein Deal ist ein Deal
Der Rabe
Gerd – bist du es?
Helens Geheimnis
.
Der blinde Bote
Nadines Wohnung
Zum Schluss
Vom »Wesen« der Kurzgeschichte(n
)
Die Kurzgeschichte – zwischen Twitter und Roman?
Vorwort
Gegen eine Veröffentlichung meiner Geschichten bei »Books on Demand« oder in einem Eigenverlag mit Übernahme aller anfallenden Kosten habe ich mich lange gewehrt. Für mich ist eine selbst veranlasste Veröffentlichung eben keine »richtige« Veröffentlichung. Zu einer solchen gehört, dass ein Verlag das Manuskript annimmt, das Buch erstellt, für Vertrieb und Marketing sorgt und ein Honorar bezahlt.
Vor vielen Jahren hatte ich im Rahmen der Stuttgarter Buchwoche einige Verleger an ihren Ständen angesprochen, um ihnen »Kostproben« meines Schreibens vorzulegen - die meisten haben gleich abgewunken. Einer jedoch nahm sich (etwas) Zeit, überflog den Text und gab ihn mir mit den Worten zurück: »Für Kurzgeschichten gibt es keinen Markt. Vor allem dann, wenn sie von einem literarischen Nobody stammen.« Ich entgegnete, dass auch bekannte Autorinnen und Autoren ja einmal als Nobodies begonnen haben müssen. Der Verleger zuckte mit den Schultern.
Von da an habe ich nie mehr versucht, meine Geschichten bei einem Verlag unterzubringen.
Doch ich war mir bewusst, dass die Tatsache, bei einem Verlag abgelehnt worden zu sein, nicht bedeutet, dass diese Texte nichts taugen.
So habe ich mich nicht entmutigen lassen und weitergeschrieben. Meine Sparte waren und blieben die Kurzgeschichten. Das resultierte auch daraus, dass ich als ›langsamer Leser‹ eine gewisse Scheu vor voluminösen Romanen entwickelt hatte.
Es macht mir Freude, in einem überschaubaren Feld etwas zu gestalten, von der ersten Idee, über den Aufbau (die »Dramaturgie«) bis zur fertigen Geschichte. Meist mit Offenem Ende, damit die Lesenden den Faden weiter spinnen können. Und ich war stets gespannt, welche Anregungen oder Einwände Schreibkolleg*Innen aus der Literaturwerkstatt vorbringen würden.
Ich habe mich häufig an Schreibwettbewerben beteiligt oder habe Texte bei »meiner« Zeitung eingereicht. So sind mehrere meiner Geschichten von der Südwestpresse/Neckarquelle angenommen und abgedruckt worden. Und eine Reihe meiner Texte fanden Eingang in Anthologien.
Den Ausschlag dafür, nun doch einen Teil meiner Geschichten selbst zu verlegen, gaben Freunde, die quasi ein Abonnement an ihnen haben. Sie äußerten den Wunsch, doch eine Zusammenfassung zu bekommen. Nun habe ich aus meinem Fundus etwa ein Viertel der Texte herausgesucht und thematisch geordnet. Diese Geschichten entstanden im Laufe von knapp 20 Jahren. Das Entstehungsjahr des jeweiligen Textes ist mit angegeben.
Allen, die zum Entstehen dieses Buchs beigetragen haben, möchte ich danken, insbesondere Klara Allgeier für die Schlussdurchsicht.
Meinen Leserinnen und Lesern wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre.
Villingen, im Dezember 2020
Werner Leuthner
Beziehungen
1. Ein Gespräch auf der Parkbank
Obwohl ich keine Unterhaltung suchte, setzte ich mich zu dem älteren Herrn auf die Parkbank: zehn Meter weiter und die nächste Bank wäre frei gewesen. Aber mir war an einer – wenn auch stummen – Gesellschaft gelegen. Ich nickte ihm zu und schaute dann den Leuten nach, die alle diese Stelle passierten. Er betrachtete mich die ganze Zeit von der Seite her, das spürte ich. Da wandte ich mich ihm zu. Er war mir nicht unsympathisch, dieser kleine Grauhaarige in seinem Anzug, deshalb nickte ich ihm erneut zu und bemühte ich mich gleichzeitig, ein bisschen freundlich zu wirken.
Irgendwann, so begann er vor sich hin zureden, irgendwann sind sie alle vom Leben weichgekocht. Manche werden Zyniker, das sind die Schlimmsten – sie können keine positive Regung mehr zulassen und fürchten sich vor Fröhlichkeit und vor Farben, alles zersetzen sie säuregleich mit ihrem Zynismus, nur Grau hat bei ihnen Bestand.
Da sind mir die stillen, die traurigen Trinker lieber, die auf ihren speziellen Pegel hinsteuern. Erst dieser Pegel lässt sie Mensch sein, erlaubt ihnen ein Überleben in ihrer Welt. In diesem Zustand kommen ihnen die erstaunlichsten Einsichten. Ich sage Ihnen, wahre Philosophen sind sie dann. Oft fühlen sie sich so der allumfassenden Lösung ganz nahe, der Lösung für alle Probleme. Man sieht es dann ihren Gesichtern an, wenn sie zu leuchten beginnen. Sie wollen sich die Lösung einprägen, abspeichern für den nächsten Tag, an dem sie endlich aktiv werden wollen. Und dann sind sie besonders traurig, wenn ihnen dies nicht gelingt, wenn ihnen die Lösung wieder mal entgleitet. Es ist schon paradox: wenn sie die Lösung haben, können sie sie nicht umsetzen und wenn sie die Lösung umsetzen könnten, fällt sie ihnen nicht mehr ein.
Nach einer kleinen Pause fuhr er fort: Die lauten Trinker mag’ ich nicht, die da herum poltern und andere belästigen. Ebenso wenig mag’ ich die Hektiker, die mit ihrer Geschäftigkeit all die leeren Pausen zudecken wollen. Buddhist müsste man sein. Wenn so jemand keine Erwartungen mehr an das Leben hat, können ihm die Widrigkeiten des Lebens auch nichts mehr anhaben, dann ist er frei. Aber wer schafft das schon – ohne Bedürfnisse und ohne Erwartungen an das Leben zu sein. Unsereins ohne Bedürfnisse – da wären wir wohl schon tot!
Nach einer erneuten Pause drehte er sich ganz zu mir herüber, sah mich direkt an und sagte: Und – wenn ich Sie fragen darf – wie halten Sie es?
Ich erschrak und für einen Moment war ich sprachlos; ich zuckte mit den Schultern. Dann hörte ich mich sagen: ich muss in Bewegung bleiben, muss mich immer wieder in Bewegung setzen. Das Ziel kenne ich auch nicht, trotzdem hoffe ich, ihm näher zu kommen.
Mit einem Ruck stand ich auf, verabschiedete mich mit einem Nicken und setzte meinen Rundgang im Park fort. Irgendwann, so klang es in mir nach, irgendwann sind sie alle vom Leben weichgekocht.
Copyright 2002
2.
Mein Starker Vater
Mein Vater ist Vierfüßler geworden. Heute muss er sich fit fühlen: er geht im Paß. Er bewegt die rechte Krücke vor und gleichzeitig das rechte Bein und dann die linke Krücke und dazu das linke Bein. Langsam und konzentriert bewegt er sich. Kein Schritt ist weiter als seine Schuhe lang sind. Um jede Stolperfalle zu vermeiden, wurde der Läufer im Flur aufgerollt und zur Seite gelegt. So hat er sechs Meter glatten Flurboden vor sich in die eine Richtung und auch sechs Meter wieder zurück. Und dies dreimal am Tag für 15 Minuten. Sehr konsequent absolviert er sein Trainingsprogramm – auch wenn er sich nicht wohl fühlt. Obwohl ich nur selten zu Besuch in meinem Elternhaus bin, merke ich es dann an seinem Gehen. Wenn er nicht »gut drauf ist«, bewegt er nämlich Krücken und Beine einzeln: zuerst die rechte Krücke vor, Pause, dann das rechte Bein, Pause, die linke Krücke vor, Pause, das linke Bein.
Ich sitze am Ende des Flurs auf der zweiten Stufe der Treppe, die in das Obergeschoss führt. Ich sitze hier, weil ich ihm auch bei seinem Gehen Gesellschaft leisten will. Erreicht er das Ende des Flurs bei der Treppe, so hält er kurz inne und wendet sich mir zu. Dann richtet er eine Frage an mich, zum Beispiel »Wie geht es deinen Kindern?« Oder: »Wie geht es dir in deinem Beruf?« Wenn ich zu antworten beginne, setzt er sich wieder in Bewegung. Ich weiß, dass er meine Antwort nicht mitbekommt – nicht nur weil er schlecht hört, nein, vor allem weil er sich so auf das Gehen konzentrieren muss. Aber er hört, dass ich zu ihm spreche und das genügt jetzt wohl.
Vielleicht will er mir heute auch nur vormachen, dass es ihm vergleichsweise gut geht und darum dieser zügige Gang. Auf der einen Seite imponiert mir diese Disziplin, die er sich selbst mit seinen 87 Jahren auferlegt. Auf der anderen Seite kommt alles in mir hoch, was uns so viele Jahre trennte.
Er war immer hart gegen sich: nur so konnte er – aus einfachen Verhältnissen kommend und demzufolge mit kärglicher Unterstützung von zuhause – sein Studium an der TH Stuttgart erfolgreich abschließen. Nur so konnte er fünf Jahre Kriegsgefangenschaft in Russland überleben und dann ab Herbst 1949 in München einen beruflichen Neuanfang starten. Da in seiner alten Dienststelle bei der Bundesbahn kein Platz mehr für ihn war, musste er sich zuerst als freiberuflicher Diplomingenieur durchschlagen.
Ich war nicht aus diesem harten Holz geschnitzt. Ich spielte ausgiebig und als ich größer wurde, las ich viel und träumte vor mich hin. Mein Vater hielt dagegen: »Schnell, präzise und schön«, so hätte ich damals meine Hausaufgaben erledigen sollen. Meine bescheidenen Schulnoten belegten, dass ich mir diese Devise nicht zu eigen gemacht hatte. Als logische Konsequenz daraus nahm er mich nach der 10. Klasse vom Gymnasium und steckte mich in eine Lehre.
»Wer sein Kind liebt, der züchtigt es« steht wohl irgendwo in der Bibel. Mein Vater hielt sich daran. Demzufolge hätte er mich lieben müssen. Ich habe es damals nicht so empfunden – im Gegenteil!
Sein ausschließlich zweckrationales Denken ließen ihn berufliche Karriere machen: ging er doch als der technische Leiter einer staatlichen Sachversicherung in Pension. Diesen Erfolg hatte er in seiner Vorstellung ja auch für die Familie errungen. Und es enttäuschte ihn sehr, von mir dafür keinerlei Anerkennung oder Dankbarkeit zu erfahren.
Ich konnte einfach nicht glauben, dass niemals in ihm Zweifel aufgekommen sind. Diese zuzulassen, muss eine sehr bedrohliche Vorstellung für ihn gewesen sein. Wie vermisste ich bei ihm all die Empfindungen und Gefühle, die in meiner Welt so wichtig waren.
Ich spürte, dass ich für ihn weder als Kind noch als Jugendlicher oder junger Erwachsener der Sohn war, den er sich gewünscht hatte. Seine Fürsorge für die Familie stellte ich nie in Abrede. Trotzdem erlebte ich ihn wie einen in engen Grenzen laufenden effektiven Apparat, der keinen persönlichen Spielraum sucht. So litten wir beide aneinander.
Erst spät näherten wir uns einander an: ich holte Abitur und Studium auf Umwegen nach und machte beruflich meinen Weg. Und mein Vater interessierte sich als Pensionär plötzlich intensiv für Geschichte, Psychologie, Philosophie und gar für kritische Theologie. Mir schien, als wolle er all dass nachholen, was er so lange vernachlässigt hatte: staunen über die nicht-technische Welt und auch Zweifel zulassen. Unsere früheren gegenseitigen Erwartungen erfüllten sich so und erleichterten uns den Umgang miteinander. Aber Vaters späte Veränderungen machten für mich meine Kindheit und Jugend nicht ungeschehen.
Mein starker Vater: wie hatte ich als Kind Angst, wenn er abends nach hause kam. Mutter musste stets berichten, was alles ich tagsüber getan oder wieder unterlassen hatte. Oft genug donnerte noch vor dem Abendessen das Strafgericht auf mich herunter.
Jetzt stakt er wie ein seltsames Wesen, vierbeinig zwar und doch aufrecht, den Flur entlang bis zur Küchentür und dann wieder zurück bis zur Treppe und ich sehe ihm dabei zu. Plötzlich drängt es mich, ihm die Krücken wegzureißen. Schwanken und stürzen wird er, der starke Vater. Dann werde ich über ihm stehen und auf ihn hinunter blicken, hinunter auf den schwachen alten Vater.
Ich stehe auf und wende mich ihm zu. Heftig erschrecke ich und muss tief atmen. »Komm, Vater«, höre ich mich nach einer Pause sagen, »für heute reicht dein Training« und er lässt sich von mir zu seinem Platz im Esszimmer geleiten.
Copyright 2005
3.
Dr. Hornicks Begräbnis
Dr. Hornicks Infarkt mit 64 Jahren war ihnen gerade passend gekommen. In der Privatbank ›Ruppin & Kargerer KG‹, in der er gearbeitet hatte, wollten sie seit längerem seinen Geschäftsbereich mit einem anderen zusammenlegen. Das hatten sie während seiner Rekonvaleszenz ganz schnell über die Bühne gebracht und so ging sein Krankenurlaub nahtlos in seinen Ruhestand über.
Ruhestand? Im Gegenteil, die so plötzlich erzwungene Untätigkeit trieb ihn jeden Tag auf das Neue in die Stadt.
Vor der Schaufensterfront eines Bestattungsunternehmers hielt Dr. Hornick inne: ihn überraschte die Vielfalt, aus der die trauernden Hinterbliebenen aussuchen können: von diversen Urnen, über einen einzigen schlichten Fichtenholzsarg bis hin zu verschieden prunkvollen, unterschiedlich lackierten und mit aufwändigen Beschlägen versehenen Gehäusen. Mehrfach ging er die Schaufenster auf und ab.
Ein mächtiger schwarzer Sarg, dessen Füße in Form von Tierpfoten geschnitzt und dessen Griffe und Scharniere aus schwerem Messing gefertigt waren, faszinierte ihn besonders. Ein ungewöhnlich repräsentatives Stück, zu schade zum Vergraben, dachte er sich und öffnete die Ladentür. Es summte dezent und im rückwärts gelegenen, durch eine Glaswand abgetrennten Büro erhob sich auch schon jemand und kam auf ihn zu. Dr. Hornick registrierte zuerst dessen korrekte Kleidung und dann die überaus freundliche Begrüßung durch seinen Gegenüber. Wie bei ›Ruppin & Kargerer‹ ging es Dr. Hornick durch den Kopf und er fühlte sich erleichtert.
Er wolle jetzt schon Vorsorge treffen für seine eigene Bestattung, die ja – so sicher wie das Amen in der Kirche – auch irgendwann anstünde und so seiner Frau und der Verwandtschaft etwas von dieser schweren Bürde nehmen. Verständnisvoll nickte der Bestatter und murmelte etwas von bemerkenswerter Rücksichtnahme.
Dr. Hornick führte den Bestatter zu seinem Favoriten, den schwarzen Tierpfotensarg und ließ sich alle Einzelheiten erklären: das massive, abgelagerte Holz, die diversen Lackschichten, die geschmiedeten Beschläge aus reinem Messing, die Widerstandsfähigkeit gegen Verwitterung in Kies- oder in Lehmboden.
Mehrfach öffnete und schloss Dr. Hornick den schweren, in Scharnieren geführten Sargdeckel und ihn faszinierte, dass dies ohne Quietschen, mehr noch, völlig geräuschlos möglich war. Ein Konzertflügel kam ihn in den Sinn und er war begeistert.
Da meldete sich der Bestatter wieder zu Wort: »Allerdings kostet dieses edle Stück…« Mit einer Handbewegung unterbrach ihn Dr. Hornick und strich sanft über die Matratze, die Kissen und die Decke im Sarg.
Das Telefon im Büro klingelte, der Bestatter sah Dr. Hornick fragend an und dieser entließ ihn mit einem Nicken in Richtung Büro. Kurz darauf meldete sich der Bestatter wieder und teilte entschuldigend mit, dass das Gespräch sehr wichtig sei und wohl länger dauern würde. Dr. Hornick nickte ihm freundlich zu und meinte, dass er schon alleine zurecht käme.
Er umrundete noch zweimal den Sarg, der ihn so magisch anzog. Er blickte zum Büro: der Bestatter war tief über seine Papiere gebeugt, mit der Linken hielt er den Telefonhörer und mit der rechten Hand führte er eifrig einen Stift. Da konnte Dr. Hornick seiner Müdigkeit und der Versuchung, hier auszuruhen, nicht länger widerstehen, stieg in den Sarg und legte sich hin. Tief atmete er durch; weder die Verkehrsgeräusche von der Straße her störten ihn noch das Wissen um den Mann im nahen Büro. Er spürte eine lang vermisste Ruhe und Gelassenheit in sich aufkommen und kostete dieses Gefühl aus. Nach einer Weile wollte er sich noch bequemer in die Kissen betten, reckte und streckte sich und bewegte heftig die Schultern. Da klappte mit einem lauten ›Klack‹ der Sargdeckel zu. Reflexartig richtete Dr. Hornick seinen Oberkörper auf. Seine Stirn stieß heftig an die Innenseite des Deckels und stöhnend sank er zurück.
Er war auf einmal zuhause und ging durch die Wohnung. Im Obergeschoss sah er Elvira ganz in Schwarz vor dem Spiegel sitzen – sie überprüfte ihr Make-up und summte dabei eine Melodie, die ihm unbekannt war. Lange beobachtete er sie so, bis sie ihn schließlich bemerkte. Sie drehte sich erstaunt um: »Mensch, Karl, du solltest längst auf dem Friedhof sein. Zieh’ mal schnell deinen guten schwarzen Anzug an, so kannst du an diesem gesellschaftlichen Ereignis nicht teilnehmen. Du bist heute die Hauptperson, alles wird sich um dich drehen und Herr Kargerer, euer Vorstandsvorsitzender, will es sich nicht nehmen lassen, selbst die Ansprache zu halten. Er meinte noch, dass es doch sehr selten sei, wenn die offizielle Verabschiedung und das Begräbnis zusammenfielen. Nun mach’ schon!«
»Habt ihr denn für mich auch den schönen schwarzen Sarg genommen, den ich ausgewählt hatte?«
»Nein, wir haben ein deutlich günstigeres Exemplar gefunden, auch in schwarz und durchaus ansehnlich, aber das spielt doch keine Rolle mehr, jetzt, wo du tot bist. Also, sei pünktlich um 14.00 Uhr in der Aussegnungshalle. Ich muss jetzt meine Freundin Nelly abholen; das Ganze hat sie fürchterlich mitgenommen!« Dr. Hornick war sehr enttäuscht.
Er sah seinen Körper in dem schlichten schwarzen Sarg liegen, der über der Grube von Stangen gehalten wurde. Er beobachtete die ganze Trauergemeinde und hörte alles, was gesprochen wurde. Seine Frau Elvira tröstete die schluchzende Nelly: »Ja, Karl war ein guter Ehemann, wir haben uns sicher die letzten 30 Jahre nicht mehr gestritten. Aber er hatte ja auch einen guten Tod, so rasch und damit sicher schmerzlos – fast beneidenswert!« Nelly schluchzte weiter und Dr. Hornick, überrascht von soviel Gefühlsäußerung, nahm sich vor, sie näher kennen zu lernen.
Herr Kargerer richtete sich auf, blickte mit ernster Miene in die Runde und begann feierlich: »Unser lieber Karl…«
Dr. Hornick kam es hoch – all die Male, in denen Kargerer ihm Knüppel zwischen die Beine geworfen und ihm seinen Erfolg missgönnt hatte, kamen ihm in den Sinn.
»…äußerst ungern haben wir ihn ziehen lassen – wir werden seinen Rat sehr vermissen!…«
Mein Infarkt ist euch doch gerade recht gekommen; die Zusammenlegung des Privat- und Geschäftskundengeschäfts habt ihr so ohne Widerstand durchziehen können und jetzt einen Vorstandsposten eingespart!
»…nach einem erfüllten Leben, voller Fürsorge für die geliebte Gattin und unermüdlicher Schaffenskraft für unser Haus, die ›Ruppin & Kargerer KG‹…«
Und was habe ich davon gehabt? Jetzt reicht es mir aber mit diesem Gesülze! Ich hatte kein erfülltes Leben – aus Angst vor dem Leben wurde ich ein Workaholic und war froh, dass Elvira so in ihrem Beauty- und Wellness-Tick aufging. Nun weiß ich es: Ich habe noch gar nicht richtig gelebt. ICH HABE NOCH GARNICHT RICHTIG GELEBT, schrie Dr. Hornick, bäumte sich auf und stieß erneut seine Stirn an die Innenseite des Sargdeckels.
Der Deckel wurde geöffnet und Dr. Hornick blickte in das verwunderte Gesicht des Bestatters: »Ich habe Sie schon gesucht und dann den Schlag gehört! Aber dass Sie Ihren Wunschsarg auch von innen testen, überrascht mich doch!«
Copyright 2006
(Abgedruckt in der Broschüre »Anders sein«
vom 7. Völklinger Senioren Literaturpreis 2006)
4.
Das Zeichen
»Und denk’ daran, Harmonie ist das höchste Gut!« Ich weiß’ es noch wie heute, mit diesem Satz hat mich meine Mutter in die Flitterwochen verabschiedet. Ich hatte anderes im Sinn, die Reise, die bevorstand, und ob wir auch nichts Wichtiges vergessen hatten, so nickte ich ihr verständnisvoll zu und küsste sie auf die Wange. Gute Mütter machen sich eben immer Sorgen.
Die Fahrt durch ein Stück des Atlasgebirges mit Geländewagen war aufregend und anstrengend. Und dann der Gegensatz: die faszinierenden marokkanischen Königsstädte und die super Hotels. Nein, diese Reise stellte meine Harmoniefähigkeit auf keine Probe.
Agnes seufzte, trat einen Schritt vom Fenster zurück und zog den transparenten Vorhang zu. Sie setzte sich an den Couchtisch goss sich von ihrem Grünen Tee ein und nippte daran.
Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass es zwischen Bruno und mir jemals Probleme geben könnte. Wenn einmal Probleme auftauchen sollten, so könnten sie nur von außen kommen. Und wir würden sie alle gemeinsam bezwingen, davon war ich felsenfest überzeugt. »Probleme – wo seid ihr? Ihr habt bei uns keine Chance!« habe ich damals übermütig gerufen, wenn ich alleine war.
Und heute? Also 15 Jahre später: Bruno und ich haben weiter keine Probleme miteinander.
Wir sind beide gesund. Auch von außen gab es keine Probleme. Bruno hat Karriere gemacht. Jetzt, da er im Vorstand der Volksbank in Bramsmühl ist, ist er noch mehr belastet als früher. Trotzdem, wenn er so um 7 Uhr abends heimkommt, begrüßt er mich weiter mit einem Küsschen, jetzt auf die Stirn, versucht irgend etwas Nettes zu sagen, bringt sicher einmal in der Woche Blumen mit und hat noch nie unseren Hochzeitstag vergessen. Er mäkelt nie an dem Essen, das ich uns vorbereitet habe. Doch dann merke ich, wie mühsam ihm die Unterhaltung fällt.
Er fragt so nach, was sich bei mir ereignet hat, den Tag über. Was sollte sich bei mir schon ereignen? Vormittags mache ich meinen Job im Grundbuchamt, also Grundbuchauszüge fertigen und nachmittags bin ich zu hause, mache meinen Haushalt und warte.
Ein halbes Jahr nach unserer Heirat habe ich meine Stelle reduziert auf 50%. Dabei musste ich wechseln vom Bürgeramt mit dem vielen Publikumsverkehr ins Grundbuchamt. Die halbe Stelle war vorsorglich, wenn dann ein Kind kommt. Aber es wollte keines kommen. Was haben wir alles unternommen – vergeblich. Aber Bruno wollte keinesfalls ein Kind adoptieren: man weiß nie, welche Laus man sich da in den Pelz setzt! sagte er. Das war’s dann. Auch sollte ich nicht wieder Vollzeit arbeiten, es könnte ja doch noch – wider Erwarten – klappen. Dabei haben wir seit Jahren nicht mehr miteinander geschlafen. Nicht dass ich darauf ein besonderes Verlangen gehabt hätte. Aber es wäre ein Mehr an Nähe gewesen. Wenn ich zu ihm hinüber auf seine Seite gerutscht bin, hat Bruno abgewehrt: Ach Schatz, das ist aber lieb von Dir, aber ich bin wirklich so müde – ein anderes mal!
Ja, das mit dem Erschöpftsein war nicht mal gespielt, ich merkte ja, dass er gleich in Tiefschlaf fiel und der Wecker ihn um 06.00 Uhr am Morgen von weit her holte. Ich konnte dagegen immer schlechter schlafen und lag stundenlang wach. Manchmal bin ich dann aufgestanden, habe auf der Couch in unserem Marokko-Album geblättert oder ganz leise zum Beispiel Giora Feidmanns »Dance of Joy« gehört und an einem Schlückchen Portwein genippt. Das wärmt so schön.
Aber ich schweife ja ab.
Auf seine Frage, wie ich so meinen Tag erlebt habe, erwidere ich: Nichts Besonderes – the same procedure as every day. Alles o.k. – Erzähl’ doch Du: Hat der Karstadt in Bramsmühl schon dicht gemacht? Ist der Bahnhof dort endlich fertig? Was erlebst Du bei Deinen Fahrten? Gehst Du noch dort in die Kantine? Schmeckt es Dir dort?
Bruno macht mir den Gefallen und beantwortet meine Fragen kurz. Spätestens beim fünften Satz ist er bei seiner Volksbank, den schönen Bilanzen, den guten Provisionen, eine Übernahme einer kleinen Privatbank und alles bedeutet sehr, sehr viel Arbeit für ihn, wenn es weiter so gut laufen soll.
Vielleicht sollte ich umschulen auf Bankkauffrau – nicht um in diesem Beruf zu arbeiten, nur um ihm eine angemessene Zuhörerin zu sein?
Agnes seufzte und nippte wieder an ihrem Tee. Er war inzwischen kalt.
Nein, das würde nichts ändern.
Inzwischen gehöre ich genauso zu seinem zuhause wie diese Couch hier, das Sideboard, die Regalwand, der Ledersessel unter der Stehlampe.
Wenn ich weg wäre, würde er mich vermissen, tatsächlich, es würde ihm die Agnes fehlen wie zum Beispiel die Stehlampe, wenn ich diese in den Speicher brächte.
Wenn ich nun schon zu einem Bestandteil dieser Wohnung geworden bin, dann könnte ich ja gehen. Zumindest probeweise. Zum Beispiel in den Speicher. Aber was sollte ich im Speicher? Verstecken spielen und hoffen, dass mich Bruno bald findet und dann hoch zufrieden ist, dass nichts aus der Wohnung fehlt?
Nein. NEIN.
Ich sollte gehen! Aber wo sollte ich hin?
Agnes seufzte tief.
Ich hab’ doch keinen Grund! Viele Frauen würden sich die Finger schlecken nach so einem Leben. Geordnete Verhältnisse, gute Verhältnisse. Jeden Winter eine Woche Skifahren in Damüls, seit Jahren in der gleichen Pension, jeden Sommer 14 Tage wandern rund um Meran, auch seit Jahren in der gleichen Pension.
Agnes ächzte: der völlige Mangel an Problemen beunruhigte sie jetzt.
Sie fand, die ewige Gleichförmigkeit gab ihr eine Sicherheit, die für sie wichtig war. Aber irgendwie war es zu viel davon geworden. Es lähmte sie und nahm ihr gleichzeitig den Atem.
Es muss sich was ändern!
Aber was und wie?
Agnes trat wieder an das Wohnzimmerfester, zog den Stohr zurück und blickte hinunter auf die Straße. Es dämmerte bereits.
Wenn mir nur jemand die Entscheidung abnehmen würde. Jemand, der mir klar sagt: ja – das ist ein unwürdiger Zustand, den man nicht fortführen kann, nicht fortführen darf, wenn man die Achtung vor sich selbst nicht verlieren soll.
Wenn ich nur ein Zeichen bekäme!
Hier in dieser Wohnung mit ihrer ewigen Gleichförmigkeit kann ich kein Zeichen erwarten, ich muss raus.
Agnes zog Schuhe und Mantel an, griff sich ihr kleines Handtäschchen, kontrollierte, ob sich Papiertaschentücher, Schlüssel und Geldbeutel darin befanden und hängte es um. Unten auf der Straße überlegte sie noch, ob sie für Bruno einen Zettel hätte schreiben sollen. Sie verwarf diesen Gedanken. Jetzt war es 18.00 Uhr und in einer Stunde – zu Brunos Eintreffen – wäre sie sicher zurück. Er wird dann eben einmal auf sein Abendbrot etwas warten müssen. Ein Ziel hatte sie nicht, ihre Beine gingen für sie.
Agnes überlegte: wie erkenne ich ein Zeichen? Dass es nur für mich ist, speziell für mich. Ein besonderes Ereignis auf meinem Weg? Ein spektakulärer Unfall oder ein keines Kind, das im Treiben der Fußgänger den Anschluss an die Mutter verloren hat? Das flüchtige Lächeln einer Passantin, die mich aus Versehen angerempelt hat? Eine Ente, die verstört auf einer Verkehrsinsel hockt?
Und wenn ich denn so ein Zeichen entdecken würde, wie könnte ich es entziffern? Welche Botschaft könnte ich dann für mich herauslesen?
Agnes war am Bahnhof angekommen. Sie hob die Schultern, ließ sie wieder fallen und seufzte dabei: Ja, wenn ich schon hier bin, dann hole ich eben Bruno ab – der wird aber überrascht sein. Sie strebte dem S3-Bahnsteig zu, denn da kommen auch die Pendler von Bramsmühl an. Oben an der Rolltreppe verharrte sie und beobachtete die Menge unten, alle strömten der Rolltreppe zu. Nur zwei nicht, die standen im Weg: sie hatten sich eng umschlungen und küssten sich. Um dieses Hindernis herum flutete die Masse. Da hob der Mann das Gesicht und sah nach oben: es war Bruno.
Copyright 2011
(Abgedruckt in der Südwestpresse/Neckarquelle
am 19.03.2015 unter »Kultur in der Region«)
5.
Adieu, mon Amour
Missmutig kramte Winfried Starol in dem Trog mit den Socken- Sonderangeboten: jeweils im Fünferpack, preislich günstig, aber mit hässlichen Mustern oder so hohem Kunststoffanteil, dass er allein beim Befühlen schon Widerwillen verspürte. Er wandte sich wieder dem Ständer mit den Markensocken zu und ärgerte sich hier über Preise von 12 oder mehr Euro pro Paar. So wechselte er mehrfach unentschlossen zwischen dem Trog und dem Ständer hin und her.
Durch einen heftigen Wortwechsel an der Rolltreppe abwärts wurde er abgelenkt: offensichtlich hatte ein Jugendlicher überholen wollen und dabei eine ältere, dicke Frau angerempelt. Diese hatte den Jugendlichen an seinem Parka gepackt und hielt ihm nun eine Standpauke. Da die beiden den Zugang zur Rolltreppe blockierten, kam es zum Stau. Schon sechs oder sieben weitere Kaufhausbesucher warteten ungeduldig, einige schimpften. Winfried musterte die kleine Ansammlung, als er einen Stich verspürte: die etwa 55-jährige Frau, die er von der Seite sah, kam ihm bekannt vor. Sofort wusste er, wem sie ähnlich sah: sie sah aus wie Massoudeh, seine studentische Freundin und Geliebte vor langen Jahren. Natürlich nicht wie die 22-jährige Massoudeh von damals, sondern entsprechend älter. Immer wieder hatte er an sie gedacht… Winfried warf das Sockenbündel, das er in der Hand hielt, auf den Wühltisch zurück und hastete auf die Gruppe an der Rolltreppe zu. Sein Blick fraß sich geradezu in der Frau fest: die leicht gelockten, dunklen Haare, inzwischen mit einem grauen Schimmer, der dunkle Teint, die elegante Erscheinung… so musste die älter gewordenen Massoudeh aussehen, es musste sie sein. Die Frau war inzwischen auf Winfried aufmerksam geworden, der sie so ungeniert anstarrte. Sie hielt seinem Blick stand, aber schüttelte dabei missbilligend den Kopf. Inzwischen hatte die Dicke den Jungen freigegeben und dieser rannte die fahrenden Stufen hinunter. Ohne Pfropf löste sich der Stau schnell auf. Auch Massoudeh drehte sich um und betrat die Rolltreppe. Winfried war blockiert. Als sie schon nicht mehr zu sehen war, brach es laut krächzend aus ihm heraus: »Massoudeh«. Einige Kunden sahen ihn verwundert an. Da löste sich seine Lähmung, er eilte zum Zugang und drängte sich von der Seite an den Wartenden vorbei auf die Rolltreppe. »Rücksichtslos« und ähnliche Ausrufe hörte er hinter sich, die er nicht beachtete. Wie der Jugendliche vor ihm, lief er die fahrende Treppe hinunter, allerdings nicht ohne seine Hände auf den dicken Gummibändern entlang gleiten zu lassen, die mit der Treppe laufen und so einen Halt geben. Im Stockwerk darunter hielt er kurz inne und suchte die nähere Umgebung ab. Da er Massoudeh nicht erdeckte, rannte er zur Rückseite der Treppenanlage, um die nächste, nach unten führende Rolltreppe zu erreichen.
Erst im Erdgeschoss entdeckte Winfried sie; sie strebte dem Ausgang zu. »Massoudeh« brüllte er, viele der Kaufhausbesucher sahen sich nach ihm um, auch sie und als sie ihn geradewegs auf sich zulaufen sah, blieb sie stehen.
»Sie müssen mich mit jemandem verwechseln«, sagte sie zu Winfried in akzentfreiem Deutsch, als er sie erreichte »oder stehen sie auf ausländisch aussehende Frauen und das ist ihre besondere Art der Anmache?«
»Nein. Ganz bestimmt nicht!« Und nach einer kurzen Pause fuhr Winfried fort: »Sie sind Massoudeh Tabalani, geboren in Meshed im Norden vom Iran, Sie lebten in Teheran, bevor Sie in München ihr Studium aufnahmen. Dort an der Uni, an den pädagogischen Instituten lernten wir uns kennen, später sogar gut kennen. Ich war damals Assistent am Lehrstuhl für Empirische Pädagogik – ich bin Winfried.« Winfried sah sie erwartungsvoll an.
»Wir stören hier die Passanten, treten wir zur Seite!«
»Wollen wir uns nicht in ein Café setzen?« schob Winfried nach.
»Gut, Ihre Geschichte klingt interessant – das nächste Café ist das hier im 6. Stock dieses Kaufhauses. Wir nehmen den Lift!«
Massoudeh ging voraus. Sie bewegten sich mühsam dem Strom von Menschen entgegen, die dem Ausgang zustrebten, an der Information vorbei, bis sie seitlich abbiegen konnten zum Lift. Im Lift sprachen sie kein Wort miteinander. Winfried kamen Zweifel – vielleicht hatte er sich doch geirrt und eine Doppelgängerin angesprochen. Oben im Café angekommen, knöpfte Massoudeh ihren Mantel auf und setzte sich an den nächsten freien Tisch. Sogar ihr Handtäschchen behielt sie umgehängt. Winfried wickelte umständlich seinen langen roten Schal ab, schlüpfte aus seinem dunklen Mantel und legte beides auf den freien Stuhl. Mit einem Seufzen nahm er Platz. Sie sahen sich beide an. Sie bestellte ein Tässchen Mokka und er ein kleines Bier. Sie unterbrach das Schweigen: »Nun, erzählen Sie weiter! Was war dann mit der jungen Iranerin, die sie Massoudeh nennen?«
Winfried antwortete ganz verstört: »Sie müssen es doch wissen. Sie sind doch Massoudeh, oder? Du« und das ›Du‹ betonte er besonders, »bist doch Massoudeh!« Als sie nicht darauf reagierte, fuhr er nach einer Pause fort: »Du bist doch schon als 16-Jährige verheiratet worden. Deine Eltern und Deine künftigen Schwiegereltern hatten die Ehe arrangiert. Im Nachhinein hattest Du diese Verbindung mit dem Ausspruch ›Geld zu Geld‹ beschrieben. Aufgrund der gutsituierten und westlich orientierten Familie konntest Du auch als junge Ehefrau Dein Abitur machen und am Goethe-Institut Deutsch lernen. Mit neunzehn Jahren – so hast Du es mir erzählt und ich kann mich an all das genau erinnern – brach diese Deine kinderlos gebliebene Ehe auseinander. Du gingst wieder zu Deinen Eltern zurück und hast Dich mit dem Alphabetisierungsprogramm des Schahs in ländlichen Regionen beschäftigt. Als Du zwanzig Jahre alt geworden warst, hattest Du Deinen Eltern ein Studium im Ausland abgetrotzt. Und so bist Du nach München gekommen…«
Während seines Erzählens war sich Winfried wieder sicher geworden: diese Gesichtszüge – es musste Massoudeh sein. Außerdem, wer würde sich sonst schon so eine Geschichte anhören? Gut sah sie aus: unter dem Mantel trug sie einen dunkelgrauen Hosenanzug mit dünnen weißen Streifen und eine dunkelrote Bluse mit einem weiten Kragen, der über dem Kragen ihres Jacketts lag. Gelegentlich spielte sie mit dem Ring, der am Mittelfinger ihrer linken Hand steckte. Der Ring hielt einen großen, rechteckig geschliffenen und violetten Stein. Er erinnerte sich an ihre Vorliebe für Amethyst. Massoudeh bemerkte, wie er sie musterte. »Wie ging es dann an der Uni in München weiter?«