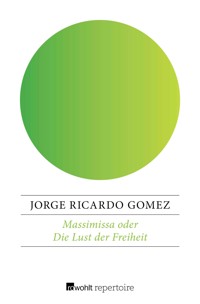
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die unerschrockene Beichte eines jungen Mannes, der von unüberwindbarer sinnlicher Sehnsucht zu seiner Schwester und seiner Mutter heimgesucht wird. In einem dämonisch-inzestuösen Verhältnis erlebt die ganze Familie Orgien des Lasters, in die auch die Sklaven auf der Plantage in Kolumbien einbezogen werden. Auf ebenso schicksalhafte wie mutige Weise wird der Ich-Erzähler auch in die Befreiungskämpfe seiner Heimat während des 19. Jahrhunderts verstrickt, wodurch er schließlich Besitz und Leben verliert. Ein schockierender Roman über verbotene Lüste, die sich nicht mehr unterdrücken lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Jorge Ricardo Gomez
Massimissa oder Die Lust der Freiheit
Aus dem Französischen von Jürgen Abel
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Die unerschrockene Beichte eines jungen Mannes, der von unüberwindbarer sinnlicher Sehnsucht zu seiner Schwester und seiner Mutter heimgesucht wird. In einem dämonisch-inzestuösen Verhältnis erlebt die ganze Familie Orgien des Lasters, in die auch die Sklaven auf der Plantage in Kolumbien einbezogen werden. Auf ebenso schicksalhafte wie mutige Weise wird der Ich-Erzähler auch in die Befreiungskämpfe seiner Heimat während des 19. Jahrhunderts verstrickt, wodurch er schließlich Besitz und Leben verliert. Ein schockierender Roman über verbotene Lüste, die sich nicht mehr unterdrücken lassen.
Über Jorge Ricardo Gomez
Jorge Ricardo Gomez ist ein Pseudonym. Angeblich entstand der Roman vor fast 200 Jahren in Kolumbien. Die französische Fassung des Buches, die 1976 erschien, machte jedoch das Buch erst bekannt, ohne daß es bisher gelang, den wahren Verfasser zu ermitteln.
Inhaltsübersicht
«Die Moral führt zum Glück, wenn sie von der Religion genährt wird»
Seine Exzellenz Don Jaime Pardo de Guevara, Oberstgouverneur der Provinz, bat mich heute in den Palast, um mich davon zu unterrichten, daß morgen die Hinrichtung des vom Hohen Gericht verurteilten Don … vollzogen wird und daß ich ihm in seiner letzten Stunde Beistand leisten soll. Er beschrieb mir den Mann als ein Opfer seines Hochmuts und sprach die Bitte aus, ich möge versuchen, dieses verirrte Schaf wieder auf den Weg des Herrn zu führen.
Nach allem, was ich von seinen Missetaten gehört hatte, glaubte ich nicht, daß mir dies gelingen würde, aber Gottes Wille ist unerforschlich, und auch das verirrte Schaf wird manchmal in letzter Minute gerettet. Könnte ich doch diese Seele für Gott zurückgewinnen!
Ich begab mich in die Zelle des Verurteilten. Seine Jugend und der herzliche Empfang, den er mir zuteil werden ließ, überraschten mich. Er kniete nieder, küßte meinen Ring und dankte mir für mein Kommen. Hatte Reue ihn Demut gelehrt? Er bedürfe des Beistands der Religion, sagte er, denn sie habe allzeit sein Tun geleitet. «Vielleicht», bekannte er, «habe ich gegen Vorstellungen der Kirche von heute verstoßen, aber ich habe meine Inspiration aus der ewigen Kirche geschöpft. Ich habe versucht, alles, was ich tat, mit dem Wort Jesu Christi in Einklang zu bringen. Ich bin zu den Quellen zurückgekehrt. Meine Seele ist ganz und gar dem Höchsten zugewandt.»
Er hatte mit großer Begeisterung gesprochen, und seine Augen blitzten. An seinen ketzerischen Äußerungen erkannte ich, daß er vom Dämon besessen war. Daher der Hochmut, der ihn veranlaßt hatte, sich von den Lehren der Kirche loszusagen, sich gegen die Macht aufzulehnen, Unordnung in der Gesellschaft zu säen – jener Hochmut, der die Hauptsünde aller großen Häretiker ist.
Ich ermahnte ihn zur Demut und forderte ihn auf, mir anzuvertrauen, was ihn zu so finsteren Taten geführt habe.
Der Tag ging zur Neige in der Zelle, deren Boden mit Stroh bedeckt war. Ich setzte mich auf einen Schemel. Er lag vor mir auf den Knien, wie um zu beichten.
Und dies waren seine Worte.
Beichte
Die Bahn der Sonne näherte sich schon wieder der Erde, als ich den Paß erreichte. Ich war, trotz der Höhe, in Schweiß gebadet, wie auch mein Pferd und der Kammerdiener, der mir aus Europa gefolgt war. Mit pochendem Herzen sprang ich ab. Zu meinen Füßen erstreckte sich das Tal des Aroyaco. Am Boden dieser langen natürlichen Talmulde wand sich der Fluß wie eine Schlange, deren Haut zwischen den grünen, von dunklen Hainen unterbrochenen Wiesen in der Sonne aufleuchtete. Winzige Wolken schwammen über mir in der Luft, die mich mit ihrer vibrierenden Wärme umschmeichelte, und warfen ihre Schatten auf die von Bergen begrenzte Ebene. Etwa dreitausend Fuß weiter unten, auf der letzten Hügelkette – durch einen Felsvorsprung meinem Blick verborgen – mußte sich das Haus befinden, in dem ich meine Kindheit verbracht hatte. Ihr könnt Euch vorstellen, wie sehr ich bewegt war – ich war als Kind gegangen und kehrte nun als Mann zurück! Drei Jahre in Europa hatten mich zum Philosophen gemacht. Ich betrachtete alle Dinge, wie ich diese Ebene betrachtete: mit der Gelassenheit, die Überlegenheit und heitere Distanz verleiht. Zweitausend Meilen und viele Monate zu Schiff hatten mich von der Wiege meiner Kindheit getrennt. Ich hatte gelernt, das Ganze zu sehen. Die Lektüre Jean-Jacques Rousseaus hatte meine Sensibilität geschärft; und die Lektüre der Enzyklopädisten hatte mich zu einem Diener der Wissenschaft gemacht; Descartes hatte mich gelehrt, keine Vorstellung gutzuheißen, ehe mein Verstand sie im Sieb der Kritik gefiltert hatte; die französischen Revolutionäre hatten mich die Freiheit, die Gleichheit und die Brüderlichkeit gelehrt. Unter dem Sieb, das Steine und Schlacken zurückgehalten hatte, sammelte sich der goldene Sand der wahren Moral.
Ich glaubte, ich sei ein Weiser.
Und doch, der Anblick dieser Ebene, die ich so oft zu Pferde durchquert, dieses Flusses, in dem ich so oft gebadet, dieser Haine, in deren tiefen Schatten ich so oft gelegen hatte, um zu lesen, weckten andere Erinnerungen in mir: den Duft frischgebrannten Kaffees, feuchte Haut, Schweiß, der nicht verdunstet, die Freudenschreie der Sklaven, wenn am Samstag das Rind geschlachtet wird, die Schärfe der grünen, in hauchdünne Scheiben geschnittenen und in gepfeffertes Öl getauchten Mangofrucht, das Aufleuchten der Bäume, der Wiesen, der Tiere, der Menschen, wenn die Sonne hinter dem Gebirge zu versinken beginnt. Geruch, Gefühl, Gehör, Geschmack, Gesicht: die fünf Sinne fanden die Eindrücke wieder, die mein Wesen siebzehn Jahre lang geformt hatten. Die in diesem Land der Farben, der Gerüche, der Wärme lebendigen Eindrücke waren im kalten, grauen, freudlosen Europa eingeschlummert und erwachten jetzt wieder.
Mein französischer Kammerdiener, der mir treu gefolgt war, betrachtete seine neue Heimat stumm.
Ehe ich in den See der Erinnerung eintauchte, kannte ich schon die Wärme des Wassers, seine Liebkosungen gleichen Bewegungen, seinen Eukalyptusduft, seinen Zuckerrohrgeschmack. Angesichts dieser milden Natur spürte ich, daß mein ganzes Wesen weich wurde, daß die Entschlossenheit des jungen Weisen dahinschwand und daß mein Herz sich zusammenzog, wie von der Furcht gepackt, meine Familie tot, mein Haus verbrannt, meine Freunde zerstreut, meine Erinnerungen verdorrt zu finden. Wenn nun das Paradies meiner Kindheit, in das ich mich so oft in Gedanken geflüchtet hatte, wenn es in London regnete, in Paris schneite, wenn man sich in den Salons über meinen Akzent lustig machte, wenn mir eine junge, verführerisch dekolletierte Frau meinen Ernst vorwarf … wenn dieses Paradies meiner Kindheit – wie vielleicht jenes andere Paradies – nur ein buntes Bild war, das sich die Phantasie des Menschen ausmalt, um der mißtönenden, übelriechenden, bedrohlichen Wirklichkeit zu entrinnen?
Ich führte mein Pferd am Zügel, damit es ein wenig ausruhen konnte oder vielleicht auch, weil ich zu Fuß gehen wollte, und machte mich an den Abstieg.
Mir war seltsam beklommen zumute.
Der Nadelwald wurde lichter und ging allmählich in einen Wald von Bananenbäumen über. In dieser Zwischenzone, die wir gemäßigt nennen, mischte sich die Vegetation der warmen Regionen mit jener der kalten, wie sich in meiner Seele die Lehren Amerikas mit denen Europas mischten.
Die Steine auf dem Weg rollten unter meinen Schritten weg. Hinter mir hörte ich die Hufe des Pferdes auf dem Boden knirschen, und weiter hinten einen anderen Schritt, andere Hufe. Obwohl die Sonne sich ihrem abendlichen Ziel näherte, wurde die Hitze größer, je weiter wir nach unten kamen. Ich hatte meine Jacke über den Sattel geworfen. Mein Hemd war geöffnet, die Luft umschmeichelte meine Haut, die Sonne liebkoste zärtlich meine Stirn. Zwischen den Bäumen verbreiteten gelbe Blumen, deren Namen ich vergessen habe, ihren Glanz und verströmten einen leicht pfeffrigen Duft. Alle meine Sinne vibrierten wie ein Paradiesvogel in der Sonne, und doch wurde mein Herz von einer ungewissen Angst zusammengeschnürt. Ich bemühte mich, meine Unruhe zu vertreiben. Der letzte Brief meines Vaters hatte mich am Hafen begrüßt, desgleichen zwei Pferde, Geld und die Küsse der Meinen. Der Unabhängigkeitskrieg hatte nicht auf unser Gebiet übergegriffen; man schlug sich weiter im Norden, im Osten; dort kämpfte man noch immer; in unserem Tal hatte Ruhe geherrscht; der spanische Gouverneur war abgereist; einer der Unsrigen hatte seinen Platz eingenommen; alles war friedlich verlaufen. Unsere Sklaven, eine Zeitlang von Rädelsführern aufgestachelt, hatten sich beruhigt. Die Ernte war gut, die weißen Zebus gediehen und vermehrten sich, die Zuckermühle zerkleinerte ruhig das Rohr, die Kaffeebäume gaben ihre Früchte, die wir nach Europa sandten, der Brennkolben destillierte den besten aguardiente[*] der Gegend, meine Schwestern waren herangewachsen, es war an der Zeit, die ältere zu vermählen, unsere Hähne gewannen bei den Kämpfen, der alte Don Macondo lag im Sterben, und seine siebzehn Kinder waren bereit, uns seine finca[*] zu verkaufen, was unsere Güter beträchtlich vermehren würde. Der Brief meines Vaters war drei Tage vor meiner Ankunft im Hafen geschrieben worden; ich hatte zwei Tage für die Reise gebraucht – konnte das Unglück die Meinen in der kurzen Zeit heimgesucht haben?
Und doch war mein Herz so beklommen wie damals, als aus heiterem blauem Himmel plötzlich in der Ferne ein Donnerschlag ertönte, dessen Widerhall sich von Fels zu Fels, von Hügel zu Hügel, von Berg zu Berg fortpflanzte wie die gedämpften Trommelschläge, welche die Bestattung Seiner Exzellenz des Bischofs, Eures Vorgängers, begleiteten.
Der Abhang war steil; Steine rollten unter meinen Schritten bergab; hinter mir glitt das Pferd dann und wann geräuschvoll aus; obwohl die Sonne schon tief stand, wurde die Hitze mit abnehmender Höhe immer größer; die Feuchtigkeit nahm zu; mein Hemd war schweißgetränkt, und hätte nicht die Gefahr bestanden, Personen aus meiner Bekanntschaft zu treffen, hätte ich mich seiner entledigt.
Nach zwei Stunden des Gehens erreichte ich ziemlich erschöpft die Biegung des Weges, wo sich von einem Felsvorsprung, zwischen großen Angosturabäumen, ein weiter Ausblick auf das Tal eröffnet. Am Fuß des Berges begannen unsere Ländereien. Von dort aus würde ich das Haus sehen können.
Ich band mein Pferd an den Stamm eines von rosa Blüten übersäten Guarapobaums, befahl Fernand, dort zurückzubleiben, und ging allein zu dem von Anemonen, Akelei und Enzian bedeckten Felsvorsprung.
Trotz der lieblichen, bittersüßen Düfte, trotz der Anmut der zarten weißen Blumen, die sich neben veilchenblauen Büscheln wiegten, trotz der Zartheit der Fliederblüten, die ich zwischen den Fingerkuppen rollte, klopfte mein Herz zum Zerspringen. Ich fror und glühte zugleich, während ich auf das herrliche Panorama zuging, das sich mir mit jedem Schritt schöner darbot: die blaue Bergkette auf der anderen Seite des Tales, der Aroyaco mit seinen leuchtenden goldenen Windungen, die smaragdgrünen Wiesen, wo man jetzt die massigen weißen Zebus, die zitronenschimmernden Bambushaine, die ockerfarbenen Gehölze, die sattgrünen, einzeln stehenden Mandarinenbäume erkennen konnte. Ich sah die Straße, die dem Lauf des Tales folgt, das große Tor zum Gut, den Weg zu den Gebäuden, den Orangenhain unterhalb des Hauses, den Rasen, wo ich einst gespielt, endlich die roten Ziegel des Herrenhauses, die Strohdächer der Sklavenhütten, den Stall, die Scheuern, die Zuckermühle, die Brennerei, einige undeutliche menschliche Gestalten, die kamen und gingen; unter ihnen vielleicht mein Vater, meine Mutter, meine Schwestern. Wußten sie, daß der Blick des lieben Abwesenden jetzt auf ihnen ruhte?
Die Spannung, die meinen Körper ergriffen hatte, löste sich, hinterließ jedoch sonderbarerweise eine Spur von Unruhe in mir, die Vorahnung ich weiß nicht welchen wunderbaren oder grauenvollen Ereignisses, das mich erwartete.
Ich war zu Haus. Dies waren unsere Ländereien; sie lagen hier, weit von der Finca entfernt, noch brach. Der erste Sklave erschien, bekleidet mit einer einfachen, schmutzigen Kniehose. Er grüßte mich, wie er jeden Reisenden gegrüßt hätte. Ich hatte mir nach meinen Gesprächen mit dem Abbé Grégoire in Paris geschworen, meine Sklaven freizulassen; würde mein Vater zustimmen?
Als ich am Wasserfall vorbeiritt, wußte ich, daß ich noch etwa zwanzig Minuten vom Haus entfernt war. Ich hörte das Wasser hinter den Totumobäumen auf die Steine stürzen. Abermals ließ ich mein Pferd in Fernands Obhut. Mit Erstaunen sah ich unter den Bäumen zwei angebundene Pferde. Meine erwachende Neugier und das Verlangen, mich zu erfrischen, den Reisestaub ein wenig abzuwaschen, bevor ich das Haus erreichte, trieben mich weiter. Ich gelangte zu der felsigen Einfassung, die ein natürliches Becken umschließt. Dort, bei den Bayrumbäumen, hatte ich oft gebadet! Bis auf ein antpitta, das mit schwarzer Haube, mit orangefarbenen Wangen und weißgrau gestreiftem Bauch unbeweglich wie eine Blume auf dem langen Ast einer puya hockte, schien sich kein lebendes Wesen in der Nähe zu befinden. Ich sprang von einem Fels zum anderen. Jetzt konnte ich die Kaskade in ihrer ganzen Höhe sehen; ihr langer weißer Schweif brach sich auf einer Felsplatte, sprühte zu einer Schaumwolke hoch und senkte sich ins Becken, wo sie in einer ruhigen, klaren, durchsichtigen Woge auslief. Ein Dickicht aus Königsbambus beschattete das eine Ende des lieblichen Gewässers. Dort, angetan mit einem weißen Gewand, saß eine junge Negerin mit feinen Gesichtszügen. Und unter ihr spielte ein junges Mädchen im sanft gekräuselten Naß. Mein Herz hörte auf zu schlagen. Die Wasserfee! Ihr Gesicht konnte ich nicht sehen, aber wie ein Kontrapunkt zur Kaskade fiel langes, ebenholzschwarzes Haar über ihren Rücken, auf das Wasser, wellte sich in der Flut. Sie stand, nur mit einem kurzen weißen Leibchen bekleidet, im Wasser, und ihre Beine zeichneten sich weiß, wie von Götterhänden modelliert, in der durchsichtigen Flut ab. Sie wandte sich um, und ich erblickte ihr Gesicht: ein ebenmäßiges Oval, große schwarze Augen, Wimpern, die sich zur Stirn emporschwangen, eine winzige Nase mit bebenden Flügeln, ein rosenfarbener, eher großer als kleiner Mund, volle, wohlgeformte Lippen, Ohren … ich fühlte, wie mir die Sinne schwanden. Und da stieg sie aus dem Wasser; das Leibchen glitt hinab, entblößte eine Schulter, so weiß und rund wie ein Ei, und dann, sie hatte sich nach vorn gebeugt, um sich am Fels festzuhalten, glitt das Kleidungsstück noch weiter hinab, und ich sah den Ansatz eines himmlischen Runds, und … verzeiht mir, Exzellenz, aber das leichte, feuchte Gewebe schmiegte sich an ihren Körper und gewährte mir auch den Anblick der Zwillingsknospen, der Muschel des Bauches, der Hüften, der geschwungenen Kontur der Schenkel, und all diese anmutigen Linien schienen nur dazu da zu sein, um auf den Mittelpunkt zu weisen, ihn zu umrahmen, zu verherrlichen: einen dunklen Schatten, wie ein lauerndes Tier, garstig, geheimnisvoll, abstoßend, faszinierend.
Ich hatte noch nie eine nackte Frau gesehen.
Die Wasserfee setzte sich im Schatten der Bambusstauden auf einen Felsen vor die junge Negerin, und diese begann, ihr mit einem Tuch die Haare zu trocknen. Die braune Hand hielt das weiße Leinentuch, das Tuch glitt über das ebenholzschwarze Haar, das ebenholzschwarze Haar floß über die Elfenbeinschultern. Ich spürte die Weichheit des Haares, als sei es meine Hand, die es trocknete. Ich spürte die weiche Haut, als streiche meine Hand über den glatten Rücken. Mir stockte der Atem, mein Herz schlug wild, fast hätte ich das Bewußtsein verloren; ich mußte mich an einen Baum lehnen.
Sie wandte den Kopf. Ihr Gesicht drückte Reinheit und Melancholie aus. Das Wasserbecken schien zu schweben, wie eine Muschel zwischen den Wolken, und in ihm stand Venus und trocknete ihren Leib und ihr Haar, Venus, wie ich sie in Florenz gesehen habe, in einem ockerfarbenen Palazzo, Venus, die Frau, die man erträumt und die es nicht gibt, so schön, so rein, so fern, so unnahbar, daß man sich, stünde man ihr unvermutet in einem Traum gegenüber, auf die Knie werfen und ihre Füße küssen würde und nicht wagte, den Blick zu ihrer strahlenden, schrecklichen, unmenschlichen Nacktheit zu erheben.
Als ich wieder zu mir kam, als mein Blick wider meinen Willen zu dem Becken und seinen beiden Gästen zurückkehrte, stand das junge Mädchen, verhüllt nur von seinen Haaren, wie die Venus des Botticelli da. So lang, so dicht war das natürliche Gewand, daß es den ganzen Leib bedeckte. In ihrem Gesicht lag ein eigenartiges Lächeln, das ich unwillkürlich mit dem einer anderen gemalten Frau, der Gioconda eines gewissen Leonardo, verglich, dessen Werk ich in Paris gesehen hatte. Ihre weißen Arme waren erhoben und bewegten sich langsam wie die Flügel eines Schwans, und ihre herrlich gerundeten Hüften wiegten sich im Rhythmus einer Musik, die ich nicht hörte; die Negerin, die nun vor ihr kniete, trocknete behutsam ihre Knöchel, ihre Waden, dann, langsam steigend, die Knie, die Schenkel, und als das Leinentuch noch höher glitt, stützten sich die Arme auf die Schultern der Negerin, und der Kopf senkte sich ein wenig, während das eigenartige Lächeln ernst und feierlich wurde.
Ich konnte den Anblick nicht länger ertragen und floh.
Ich muß einen seltsamen Gesichtsausdruck gehabt haben, denn mein Kammerdiener fragte: «Was ist Euch widerfahren, Herr? Ihr seid ganz bleich.»
Ich konnte nicht antworten, und wir ritten weiter.
Wenige Augenblicke später durchquerte ich die Baumwollfelder; die kleinen weißen Bäusche waren wie Wolken am Himmel, und zwischen ihnen, bekleidet nur mit ihrem Haar, stand Venus in ihrer Muschelschale und tanzte. Das Bild verließ mich während des ganzen Weges nicht mehr: ich fühlte mich wie das Sinnbild des Mannes, der sein Ideal verfolgt und es niemals erreicht.
In der Allee, die von Pflaumenbäumen und Guarapobäumen gesäumt war, gingen jetzt mehrere Sklaven, die von den Baumwollfeldern, den Bananen- und den Kokosnußpflanzungen zurückkehrten; ihre Augen waren stumpf, ihre Blicke auf die Erde geheftet, auf der ihre nackten Füße schritten; sie gingen schleppend, wie von einer unsichtbaren Bürde niedergedrückt, und ich hätte ihnen gern gesagt, daß sie nur den Blick zu heben brauchten, um den Grund allen Lebens, das Motiv jeder Existenz, das Ziel jedes Wesens zu entdecken: die Liebe.
Was mich anging – ich hatte das Gefühl, zu schweben.
Und als ich das Haus erreichte, geschah es ohne Überraschung, ohne Freude, ohne Furcht. Ich sprang vom Pferd, wie ich es schon tausendmal getan, gestern, immer, ohne diesem Vorgang Bedeutung beizumessen. Zu meiner Verwunderung reagierte mein Körper wie sonst, ich brauchte ihm keine Befehle zu erteilen; meine Seele schaute ihm von ferne zu wie einem Fremden. Ich sah, wie ich meinen Vater umarmte und wie ich meine Mutter umarmte und wie ich Tränen vergoß, und wie ich Minimissa, meine jüngere Schwester, erblickte, die mir entgegenlief und dann vor mir stehenblieb, blaß, mit gesenktem Blick – wie die Jungfrau, die ihrem künftigen Gemahl vorgestellt wird. Ich erkannte sie kaum wieder; das Kind von zehn Jahren, das ich zurückgelassen hatte, war jetzt ein junges Mädchen, fast eine Frau, ganz Lilie und Rosen, mit tiefschwarzem, von einem Stirnband gehaltenen Haar. Sie duftete nach Zyklamen, und ihre Wange war kühl. Massimissa, meine ältere Schwester, weilte, so sagte man mir, auf einer Nachbarplantage, würde aber bald zurückkehren.
Man führte mich in mein Zimmer. Das hohe Bett aus geschnitztem Holz, in dem ich geschlafen hatte, die Vorhänge aus weißem Stoff, die mich vor den gegenes[*] schützten, der Arbeitstisch, in den mein Federmesser kleine Tiere geritzt hatte, meine Bücher, alle meine Bücher in dem Schrank mit den Glastüren, die Waschkommode mit der großen, weißen, blaugeblümten Schüssel und der Kanne, die mir so schwer schien, als ich noch ein Kind war, und die ich nie zerbrochen hatte … Ein Kind! Ich fühlte, wie ich wieder zum Kind wurde; als hätte ich dieses Zimmer, dieses Haus, meinen Vater, meine Mutter nie verlassen; als wäre das Leben weitergegangen, ruhig, jeder Tag wie der vorangegangene und der folgende; jeden Augenblick müßte mein Hauslehrer eintreten, sich über meine Aufgaben beugen, mich befragen, bis die Glocke zum Essen rief.
Ich war gewaschen und umgekleidet, als die Glocke ertönte. Ich schritt die Treppe mit den breiten Mahagonistufen hinab, das glatte Geländer glitt leicht unter meiner Hand dahin, ich war versucht, mich hinaufzuschwingen und hinunterzurutschen bis ins Vestibül, wo meine Amme, wie immer ganz in Himmelblau gekleidet, mit mir grollen würde.
Die Tür zum Salon war geöffnet. Die drei Kristallüster funkelten, die Dielen glänzten, die schweren Ledersessel schimmerten matt; vor den offenen Fenstern bauschten sich die weißen Vorhänge. Alles schien mich freudig empfangen zu wollen. Mein Vater war allein; er trug einen schwarzen Anzug, ein Spitzenhemd, weiße Strümpfe, Schuhe mit silbernen Schnallen und roten Absätzen; er rauchte eine Hirschhornpfeife. Trotz seines ergrauenden Backenbartes unter dem dichten, noch schwarzen Haupthaar fand ich, daß er jugendlich wirkte. Meine Mutter trat ein, begleitet von Minimissa. Sie trugen beide weite Gewänder aus weißer Rohseide, das die Schultern freiließ. Ihr schwarzes Haar wurde durch Schleifen zurückgehalten, bei meiner Mutter durch eine grüne, bei meiner Schwester durch eine rosa Schleife, genau wie die Schleifen, die ihre Taillen umgürteten und an der Seite der Gewänder in lange Bänder ausliefen.
«Massimissa», sagte meine Mutter, «ist spät heimgekommen und beendet gerade ihre Toilette.»
Ich hörte Schritte die Treppe herunterkommen, das Vestibül durchqueren. Ich wandte mich um. Meine Arme streckten sich ihr entgegen … SIE! Die Wände des Salons neigten sich … die Kerzen erloschen … die Dielen schwankten unter meinen Füßen … ich spürte, wie ich fiel, in einen Abgrund stürzte, ohne daß ich die geringste Anstrengung machte, mich festzuhalten. Ich tauchte in kaltes, schwärzliches Wasser, das meinen Mund, meine Lungen füllte. Mein Herz hörte auf zu schlagen …
Ich mußte tagelang das Bett hüten. Mein Körper brannte, mein Gesicht glühte, mein Kopf schmerzte, dann wieder fühlte ich ihn gar nicht, und meine Gliedmaßen waren ohne Kraft. Meine alte Amme wusch und erfrischte mich auf meinem Lager, das ich nicht verlassen konnte. Eine junge Sklavin brachte mir Speisen, die ich kaum anrührte. Oft kamen mein Vater und meine Mutter ins Zimmer, suchten nach Anzeichen der Besserung in meinem Gesicht und vergossen manche Träne, wenn ich leblos, stumm dalag und unfähig war, ihre Fragen zu beantworten. Meine Schwestern erschienen nicht: man fürchtete, ich könnte sie mit meinem merkwürdigen Leiden anstecken. Jeden Abend kam der Arzt aus der Stadt, verabreichte mir heilende Tränke, nahm mir Blut ab und überschüttete meine Eltern mit Diskursen voller lateinischer Ausdrücke. Der Schwall von Gesten und Vokabeln verbarg nur seine Unwissenheit.
Manchmal delirierte ich, wie man mir später sagte. Ich wälzte mich im Bett, streckte die Arme aus, rief eine Wassernymphe, richtete närrische Reden an sie und sank dann plötzlich in mich zusammen, als hätte man mich geschlagen.
Meine Mutter fragte mich eines Tages, was ich in jener Sekunde gefühlt habe, als ich im Salon in Ohnmacht gefallen sei. Ich konnte mich an nichts erinnern. Von dem Moment an, als ich im Hafen am Pazifik die Laufplanke betreten hatte, die von der hohen hölzernen Nußschale zur Landungsbrücke führte, waren meine Erinnerungen nur noch undeutlich – die Erinnerung an den langen Ritt durch die Kordilleren, an mein Eintreffen daheim, an den Empfang durch die Meinen. Als meine Mutter mir sagte, mir seien die Sinne in eben dem Augenblick geschwunden, als meine Schwester Massimissa erschien, bemühte ich mich, mir das Eintreten meiner Schwester ins Gedächtnis zurückzurufen, ich sah aber nur das Bild eines kleinen Mädchens mit langen Zöpfen, das hinter einem Reifen herlief.
Mein Vater und meine Mutter kamen abwechselnd, wenn ich nicht schlief, und setzten sich zu mir ans Bett, um mir vorzulesen. Obschon sie nur auf meine Bitte ein Werk vorlasen, das mich in Paris entzückt hatte, Die Abencerragen von Monsieur de Châteaubriand, schlief ich manchmal dabei ein … an den Ufern des Meschacebe. Die musikalische Prosa des großen Franzosen zog mich in sein Boot, auf stürmische Wasser, wo – wie auf unserem Aroyaco – Baumstämme, Blätterwerk und Blumenbüschel schwammen; wir kamen vorbei an indianischen Dörfern, wo uns junge blütengeschmückte Mädchen mit weichen Armen zuwinkten; aber als ich mich dem Ufer näherte, im Bug des kleinen Gefährtes stand und den freundlichen Geschöpfen, vor allem Céluta, der Tochter des Tahamica, die Arme entgegenstreckte, ergriff ein Strudel unser Boot, und ich stürzte in kaltes, schwärzliches Wasser, das meinen Mund, meine Lungen füllte. Mein Herz hörte auf zu schlagen …
Eines Abends, es war schwül im Zimmer, las meine Mutter mir das Kapitel vor, wo René den Fluß im Einbaum hinunterfährt und ein Mädchen beim Baden in einer schattigen Bucht überrascht, das er nach der Zahl seiner eifrigen Dienerinnen für die Tochter des Häuptlings hält. Kurz darauf erreicht er das Dorf, und seine Ankunft spricht sich herum. Der Häuptling begrüßt ihn mit einer Menge Umarmungen, schmeichelt ihm und bittet ihn in seine Hütte zu einem üppigen Mahl; er stellt ihm seine Frauen vor, die eine nach der anderen hereinkommen, dann seine Söhne, starke, schöne Jünglinge, und schließlich kündigt er ihm seine Töchter an. In dem Augenblick, als die erste erscheint, ertönt ein Donnerschlag, ein heftiger Windstoß durchfährt die Hütte, löscht die Fackeln …
Meine Mutter saß an meinem Bett und hielt meine Hand. Sie sah sehr besorgt aus. Es war Nacht, und es brannte nur eine Kerze auf dem Nachttisch; das Zimmer war in Halbdunkel getaucht; die weißen Tüllgardinen bauschten sich im Wind und schlugen sanft wie die Flügel eines ermatteten Vogels hin und her.
Als ich meiner Verwunderung Ausdruck gab, daß meine Mutter zu so später Stunde bei mir war, erklärte sie mir, ich hätte bei dem Donnerschlag einen lauten Schrei ausgestoßen, der durch das ganze Haus hallte, und sei dann entkräftet in die Kissen zurückgesunken. Sie sei sofort gelaufen, um meinen Vater zu holen, doch als sie wiedergekommen seien, hätte ich geschlafen wie ein Kind. Die gottesfürchtige Frau hielt meine Hand, weil sie mich zweifellos besänftigen wollte. Und ich war ganz ruhig, vielleicht wegen dieser Hand, die auf der meinen lag und deren einer Finger sanft meine Handfläche streichelte. Ich war, sagte ich, ganz ruhig, aber der Finger, der über meine Handfläche glitt, ließ eine kaum merkliche Vibration in mir aufsteigen, wie damals, als Kind, wenn ich an meinem Pult über einer griechischen oder lateinischen Übersetzung saß und spürte, wie meine Mutter kam, sich über mich, über Thukydides oder Plautus beugte und mir, ohne ein Wort zu sagen, die Hand auf den Kopf legte und mit den Fingern durchs Haar fuhr und voll Zärtlichkeit die Kopfhaut kraulte; auch damals fühlte ich einen elektrischen Strom in mir, der mich bis in die Fingerspitzen mit wollüstigen Empfindungen erfüllte, als hätte meine Mutter meine ganze Haut liebkost.
Es donnerte fürchterlich, die Scheiben zitterten, und das Zimmer war taghell erleuchtet. Ich sah das Gesicht meiner Mutter: sie schien wie vom Blitz getroffen, das Entsetzen hatte ihre schönen Züge verzerrt. Ihre Hand umklammerte die meine wie ein Ertrinkender seinen Retter; ihr Körper – sie hatte bisher auf dem Rand des Bettes gesessen – sank auf das Lager und drückte sich gegen mich. So blieb sie einige Augenblicke regungslos liegen, dann ließ die Spannung langsam nach, und ein schwaches Lächeln zeichnete sich auf ihrem Gesicht ab. «Weißt du», sagte sie, «ich habe eine Todesangst vor Gewittern. Es scheint mir, als ob mein Leib verbrenne; in solchen Momenten brauche ich Schutz. Vergib mir also, ich kehre jetzt zu deinem Vater zurück.» Als sie sich wieder gefaßt hatte, richtete sie sich auf und gab mir einen Kuß auf die Stirn. Sie entfernte sich, ihr weites Gewand aus weißem Musselin bauschte sich wie die Vorhänge, wie Schwanenflügel, als ein neuer Blitz das Zimmer erhellte und ein fürchterliches Krachen mich fürchten ließ, das Haus stürze ein. Im selben Augenblick war meine Mutter wieder bei mir; sie zog sich die Decke über den Kopf, klammerte sich an meinen Körper und zitterte am ganzen Leibe. Ich legte ihr die Hand auf die Stirn, die in kaltem Schweiß gebadet war, und liebkoste sie zärtlich.
Dann erst spürte ich die Last auf meiner Brust. Etwas Schweres und doch Süßes, etwas Schwellendes und doch Sanftes, Warmes und plötzlich Flammendes ruhte auf meinem Oberkörper. Die Röte stieg mir ins Gesicht, Schweiß perlte über meinen Rücken, eine seltsame Unruhe bemächtigte sich meiner. Und plötzlich ergriff mich ein heiliger Schrecken, als ich bemerkte – vergebt mir, Exzellenz –, daß die lebende Pflanze sich auf meinem Bauch aufrichtete und gegen den angezogenen Schenkel des Wesens drückte, dem ich meine Existenz verdanke.
Ich wagte jedoch nicht, mich zu bewegen, aus Furcht, sie erneut zu beunruhigen. Deshalb liebkoste ich ihre Stirn weiter, mechanisch jetzt, beunruhigt durch die Entdeckung jenes Lebens in mir, jenes eigenmächtigen Lebens, das gegen meinen Willen die heiligsten Bande entweihte.
Die auf meinen Hüften liegenden Hände haben sich inzwischen gelockert, die Fingernägel graben sich nicht mehr in mein Fleisch, die Fingerkuppen sind jetzt weich, und ihre Stirn, die sich von einer Seite zur anderen neigt, begleitet meine Liebkosungen mit einer sanften Bewegung.
Eine ihrer Hände verläßt meine Hüfte, ergreift meine Hand und preßt sie gegen ihre Brust. So dankt ein Sklave seinem Herrn. Ich möchte meine Unwürdigkeit laut herausschreien, aber meine Lippen bleiben stumm. In meiner Handfläche fühle ich ihr Herz schlagen, und über der Hand fühle ich die Schwere, die Weichheit und Wärme jener Rundung, die immer noch auf meiner Brust ruht. Bei dieser Berührung erhebt sich der Baum auf meinem Bauch so kraftvoll wie ein gezückter Dolch, so daß ich fürchte, er könnte den zarten Schenkel verletzen.
Dann ertönte ein neuer Donnerschlag; bei diesem Krachen krümmte sich der Leib meiner Mutter, ihre Hand umklammerte die meine, drückte sie mit aller Macht an ihren Busen, und ich spürte, wie sich eine kleine, bebende, brennende Spitze zwischen meinen Fingern aufrichtete; die in einer konvulsivischen Bewegung angezogenen Beine gleiten zwischen meine Schenkel, dabei schiebt ihr Knie mein Hemd hoch, stößt an meine Steifheit und hebt sie, bis sie sich gegen ihren Bauch stemmt. Ich flehe den Herrn an, mir Frieden zu bringen. Doch da legt sich eine Hand auf meinen Nacken und befiehlt meinem Kopf, sich in das Tal zu legen, so daß ich jetzt mit beiden Wangen feste Hügel berühre …
So blieben wir einen sehr langen Augenblick regungslos liegen – während das Zittern meiner Mutter inmitten dieser Reglosigkeit eine Vibration erzeugte, die mich in eine solche Spannung versetzte, daß ich fast barst.
Unter einer Haut, die weicher war als Seide, fühlten meine Lippen das Herz mit lauten, wilden Schlägen pochen; doch langsam beruhigten sich die Schläge ihres Herzens, das Zittern ihres Körpers hörte auf, der Druck ihrer Hand ließ nach.





























