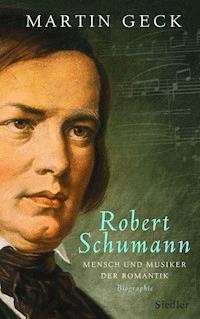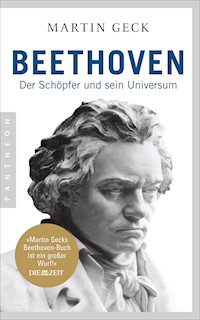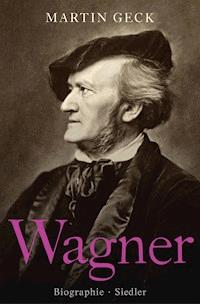19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Sein Abendlied »Der Mond ist aufgegangen« kennt noch heute jedes Kind, doch der Autor dieser Zeilen, der Dichter und Journalist Matthias Claudius, droht in Vergessenheit zu geraten. Dabei lohnt es sich, Claudius und seine Welt neu zu entdecken, wie uns Bestsellerautor Martin Geck in seiner großen Biographie eindrucksvoll zeigt.
Denn in Matthias Claudius, dem umtriebigen Redakteur des berühmten »Wandsbeker Boten«, spiegeln sich die widersprüchlichen Strömungen jener Ära zwischen Romantik und Aufklärung: Er war zugleich loyaler Untertan und Kämpfer gegen Fürstenwillkür, frommer Christ und Freimaurer, er schien wenig lebenstüchtig und gehörte doch zu den einflussreichsten und meistgelesenen Autoren des 18. Jahrhunderts.
In einer Epoche, in der vor allem Kopf und Vernunft zählten, appellierte er an Herz und Gefühl und schrieb stets mit einer scheinbar kindlichen Naivität. Das trug ihm zwar eine enorme Popularität bei seinen Lesern, mitunter aber auch die Herablassung seiner Zeitgenossen ein. Doch wie viel Kluges und Zeitkritisches in Claudius‘ vermeintlich naiven Zeilen steckt und warum es sich lohnt, diesen Dichter und sein Werk wiederzuentdecken, zeigt Martin Geck in seiner neuen Biographie – das Porträt eines Unzeitgemäßen und seiner Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Ähnliche
MARTIN GECK
Matthias Claudius
Biographie eines Unzeitgemäßen
Siedler
Erste Auflage
September 2014
Copyright © 2014 by Siedler Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg
Lektorat: Fritz Jensch, München
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
Notensatz: Georg Allescher, München
Reproduktionen: Aigner, Berlin
ISBN 978-3-641-13988-9
www.siedler-verlag.de
Der Löwin
Inhalt
Mein Claudius – damals
KAPITEL 1 –Von Reinfeld nach Wandsbek
KAPITEL 2 –Der Wandsbecker Bothe
KAPITEL 3 –Das kleine Wandsbek und die große Welt
KAPITEL 4 –Das Darmstädter Intermezzo
KAPITEL 5 –»…Verachtet, und verehret; hat Freude, und Gefahr …«
KAPITEL 6 –Die späten Wandsbeker Jahre
Mein Claudius – heute
ANHANG
Bibliographie
Werkregister
Personenregister
DER MOND IST AUFGEGANGEN
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar;
Der Wald steht schwarz und schweiget,
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar.
Wie ist die Welt so stille,
Und in der Dämmrung Hülle
So traulich und so hold!
Als eine stille Kammer,
Wo ihr des Tages Jammer
Verschlafen und vergessen sollt.
Seht ihr den Mond dort stehen? –
Er ist nur halb zu sehen,
Und ist doch rund und schön!
So sind wohl manche Sachen,
Die wir getrost belachen,
Weil unsre Augen sie nicht sehn.
Wir stolze Menschenkinder
Sind eitel arme Sünder,
Und wissen gar nicht viel;
Wir spinnen Luftgespinste,
Und suchen viele Künste,
Und kommen weiter von dem Ziel.
Gott, laß uns dein Heil schauen,
Auf nichts Vergänglichs trauen,
Nicht Eitelkeit uns freun!
Laß uns einfältig werden,
Und vor dir hier auf Erden
Wie Kinder fromm und fröhlich sein.
Wollst endlich sonder Grämen
Aus dieser Welt uns nehmen
Durch einen sanften Tod!
Und, wenn du uns genommen,
Laß uns in Himmel kommen,
Du unser Herr und unser Gott.
So legt euch denn, ihr Brüder,
In Gottes Namen nieder;
Kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns, Gott! mit Strafen,
Und laß uns ruhig schlafen!
Und unsern kranken Nachbar auch!1
1 Matthias Claudius, Sämtliche Werke, hg. v. Rolf Siebke und Hansjörg Platschek, 8. Aufl., Düsseldorf und Zürich 1996, S. 217f. (künftig: W)
Mein Claudius – damals
»’s ist Krieg!« – so beginnt ein Gedicht von Matthias Claudius; und Krieg herrschte auch, als ich in meiner Kindheit seinem »Abendlied« begegnete. Deshalb soll hier zunächst vom Krieg die Rede sein – also nicht von idyllischen Mondaufgängen, sondern von Bombennächten. Es geht um die ersten Jahre des Zweiten Weltkriegs, und ich erinnere mich gut daran, dass mein Vater vor dem Gutenachtkuss mit mir die Schlussstrophen aus Paul Gerhardts Abendlied »Nun ruhen alle Wälder« sang:
Breit aus die Flügel beide,
o Jesu, meine Freude,
und nimm dein Küchlein ein.
Will Satan mich verschlingen,
so laß die Englein singen:
»Dies Kind soll unverletzet sein.«
Auch euch, ihr meine Lieben,
soll heute nicht betrüben
kein Unfall noch Gefahr.
Gott laß euch selig schlafen,
stell euch die güldnen Waffen
ums Bett und seiner Engel Schar.
»Dies Kind soll unverletzet sein …« – das war damals ein höchst aktueller Wunsch. Denn oft genug kam es vor, dass ich, kaum eingeschlafen, von Sirenen jäh geweckt und von meinem Vater in aller Eile in den Luftschutzkeller unseres Recklinghäuser Pfarrhauses getragen wurde. Nach der »Entwarnung«, die durch einen langen Sirenenton angezeigt wurde, trat ich an der Hand meiner Mutter auf die nachtdunkle, nur hier und da vom Feuerschein erhellte Straße. Dort traf man auf die Nachbarn, die sich wechselseitig versicherten, noch am Leben zu sein, alsbald die Bombenschäden in der nächsten Umgebung besichtigten und womöglich beim Löschen halfen. Bis heute habe ich das brennende Haus des Lebensmittelhändlers Stute in unserer Straße vor Augen. Und bis heute erinnere ich mich an die bizarren Formen der fingerlangen, manchmal auch handtellergroßen Flaksplitter, die ich am Morgen danach in einer Zigarrenkiste von der Straße aufsammelte – das harmlose Vergnügen eines Fünf- bis Sechsjährigen, dessen große Brüder schon als Flakhelfer oder Soldat »Dienst« taten.
Ich sehe mich auch noch auf der kleinen Mauer vor dem Pfarrhaus sitzen und mit dem Finger auf Leute zeigen, die plötzlich mit einem gelben Stern auf ihrer Kleidung auf der Straße erschienen. »Was ist das?«, fragte ich mit der Penetranz des Fünfjährigen. An die Antwort der Erwachsenen erinnere ich mich nicht mehr, sicherlich war sie verdruckst. Dabei war mein Vater kein Freund des nationalsozialistischen Regimes, vielmehr als Mitglied der Bekennenden Kirche im Visier der Gestapo, die ihn mehrfach ins Polizeipräsidium bestellte und vermutlich das Telefon abhörte, das er bei wichtigen Gesprächen immer mit einem Kissen abdeckte. Er hatte mich bei meiner Taufe im Jahr 1936 nach Martin Niemöller genannt, also nach dem Kopf der Bekennenden Kirche. Aber auch nach Martin Luther, dessen Statement »Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir« er nacheiferte. Freilich war er auch ein Anhänger von Luthers Zwei-Reiche-Lehre: Er, der im Ersten Weltkrieg ein hochdekorierter Reserveoffizier gewesen war, wäre kaum auf die Idee gekommen, sich dem politischen Widerstand anzuschließen. Vielmehr kämpfte er allein mit den »güldnen Waffen« der Bekenntnistreue – das allerdings mit großer Entschiedenheit und mit dem Risiko, sein Amt zu verlieren und seiner Frau mit ihren fünf Söhnen nicht mehr als Ernährer zur Verfügung zu stehen.
Die Metapher von den »güldnen Waffen«, von denen Paul Gerhardt in seinem Abendlied spricht, ist mir durch das Gutenachtlied meines Vaters als »Geschmack auf der Zunge« geblieben. Mit dem Wort »gülden« assoziierte ich eine Art überirdischen Glanzes; und das ging mir ebenso, wenn meine Mutter mit uns beiden jüngeren, im Haus verbliebenen Kindern von der »güldnen Sonne« im gleichnamigen Lied Paul Gerhardts sang. Von ihr, die in ihrer Jugend eine Gesangsausbildung gehabt hatte und mich wie mein Vater zum Singen ermunterte, hörte ich auch zum ersten Mal des Matthias Claudius Abendlied »Der Mond ist aufgegangen, / Die güldnen Sternlein prangen / Am Himmel hell und klar«. Ja – sie sang von den »güldnen«, nicht von den »goldnen« Sternlein, denn sie hatte die entsprechende Strophe aus meinem Gutenachtlied »Nun ruhen alle Wälder« im Ohr:
Der Tag ist nun vergangen,
die güldnen Sternlein prangen
am blauen Himmelssaal.
Also werd ich auch stehen,
wann mich wird heißen gehen
mein Gott aus diesem Jammertal.
Ob es ihr bewusst gewesen ist, dass Matthias Claudius sein »Abendlied« in großer Selbstverständlichkeit demjenigen Paul Gerhardts nachgeschaffen hat? Die Reimschemata sind identisch, Naturbilder wie »schweigende Wälder« und »güldne Sternlein« sehr ähnlich. Darüber hinaus verweisen Paul Gerhardts Liedzeilen »Also werd ich auch stehen, / wann mich wird heißen gehen / mein Gott …« auf eine weitere Dichtung von Claudius mit dem Anfang:
Es stand ein Sternlein am Himmel,
Ein Sternlein guter Art;
Das tät so lieblich scheinen,
So lieblich und so zart!2
Claudius hat die Verse auf den frühen Tod seiner zweitältesten Tochter Christiane geschaffen, und meine Mutter mag sie gekannt haben, da sie angesichts ihrer berührenden Schlichtheit noch zu Lebzeiten des Dichters in die berühmte Volksliedsammlung Des Knaben Wunderhorn Aufnahme fanden und seitdem oft nachgedruckt wurden. Jedenfalls hätte sie Claudius’ Leid über den Tod seines Kindes im Innersten verstanden, da sie lebenslang die Trauer um ihren früh verstorbenen zweitältesten Sohn mit sich herumtrug.
Auch wenn sie »Der Mond ist aufgegangen« sang, lag meiner Erinnerung nach eine leichte Trauer in ihrer Stimme: Sie dachte dann wohl nicht nur an die Naturidyllik der ersten Zeilen, sondern auch an die weiteren Strophen, in denen der Dichter ein ganzes Christenleben »durchgeht« – mit allen Zweifeln und Hoffnungen. Als Fünfjähriger habe ich das Lied, ohne schon seinen Sinn zu verstehen, von vornherein nicht als Idylle, sondern im Kontext der beschriebenen »schweren Zeiten« aufgenommen.
Doch auch im Krieg gab es, zumindest bis Stalingrad, für Kinder ganz ungetrübte Freuden. Dazu gehörte der Ausflug der Kindergottesdienstgemeinde. In dem Sommer, bis zu dem meine Erinnerung zurückreicht, ging er in die nahe gelegene Haard; und ich entsinne mich an die Rückfahrt im Personenzug von Sinsen nach Recklinghausen. Sie kann kaum länger als zehn Minuten gedauert haben, erschien mir aber wie eine Ewigkeit – geteilt mit den anderen Kindern, mit den »großen Mädchen«, die als Helferinnen dabei waren, und mit Schwester Olga, die »Der Mond ist aufgegangen« anstimmte. Die »großen Mädchen« legten viel Gefühl in ihren Gesang – wer weiß, wohin ihre Fantasie vor dem Horizont von Liebe und Leid schweifte. Ich selbst beherrschte bestenfalls die erste Strophe; doch ich saß glücklich auf dem Schoß eines der »großen Mädchen« und schaute durch das Abteilfenster in die langsam vorüberziehende Landschaft mit dem aufsteigenden Mond am Himmel. Ich entsinne mich nicht, ob er – wie im Lied – »nur halb zu sehen« war; für mich war er jedenfalls »rund und schön« – wie alles an diesem Tag.
In meiner Wahrnehmung bilden Lieder wesentliche Brücken zur Kindheit. Dabei geht es nicht nur um die Möglichkeit, sich bestimmter Gefühle und Stimmungen, die sich in Worten gar nicht fassen ließen, zu vergewissern. Darüber hinaus stellt die Gattung Lied eine unverwechselbare Chance dar, ein Sinnganzes in allem Widersinn zu spüren, also Gutes und Böses, Süßes und Bitteres, Hartes und Weiches, mystische Anmutungen und alltägliches Hin und Her als Gesamtzusammenhang zu erfahren. Das half mir schon damals und hilft bis heute, eine von Kriegs- und Nachkriegswirren sowie vom frühen Tod meiner Mutter bestimmte Kindheit als gelungen zu erleben – als ein Stück Schöpfung, das so hat sein sollen, wie es geworden ist. Wo mich Lieder begleiten, habe ich die Vorstellung, dass ich mit dem Leben gehe und das Leben mit mir.
Die Schriftstellerin Janne Teller, die vor einigen Jahren mit ihrem preisgekrönten Jugendroman Nichts. Was im Leben wichtig ist hervorgetreten ist, hat in der Zeitschrift Lettre International kundgetan, was ihr Gedichte bedeuten: »Ich könnte endlos darüber sprechen, wie man den Glauben an die Menschlichkeit verlieren kann, aber ich möchte viel lieber darüber sprechen, wie er wiederhergestellt werden kann. Ich möchte viel lieber über das Wasser und das Salz sprechen, das ich zwischen den Zeilen der Gedichte gefunden habe, die ich jeden Tag in kleinen Stücken zu mir genommen [und auswendig gelernt] habe. Einige der Gedichte habe ich seither vergessen, aber an die meisten erinnere ich mich noch. Jedes ist zu einem kleinen unsichtbaren Lächeln in meiner Seele geworden, traurig oder freudig …«3
Ohne den damit skizzierten Hintergrund würde ich mein Buch über Matthias Claudius nicht schreiben wollen. Es ist, wie sich bald zeigen wird, kein Erbauungsbuch, vielmehr auch dem »launigen« Claudius gewidmet und zugleich an dem regen künstlerischen und intellektuellen Diskurs der Goethe-Claudius-Ära orientiert. Jedoch kann ich nur über Dinge schreiben, die durch mich hindurchgegangen sind. So habe ich es bei meinen vielen Büchern über Musik gehalten, so halte ich es auch diesmal: Was an Claudius nicht »Musik in meinen Ohren« wäre, würde unspezifisch bleiben. Diesmal liegt der Fokus meines Interesses jedoch nicht auf der Musik, obwohl Claudius sie liebte und pflegte, sondern auf seinem Lebens-Werk, das auch ein Stück Lebens-Kunst war. Zwar wollte und könnte ich nicht leben wie Claudius, spüre auch keine Versuchung, seinen Alltag zu idealisieren. Gleichwohl gibt es Züge, die mir Claudius zu einem Vorbild machen – zu einem wichtigeren, als es mir der bedeutendere Zeitgenosse Goethe sein könnte.
Damit bin ich wieder beim Lied »Der Mond ist aufgegangen«. Ich spiele es seit vielen Jahren jeden zweiten Abend auf dem Klavier. Das ist, sofern es zeitlich auskommt, als kleine, wortlose Hausandacht für mich und meine Frau gedacht. Doch ich singe das Lied auch gern mit den Gästen zum Abschluss unserer Abendeinladungen oder Hausmusiken; und ich meine, dass sich dadurch noch niemand ernstlich geniert gefühlt hat. Mich selbst aber freut es, der bunten, gar nicht nur christlich gesinnten Gästeschar nahegebracht zu haben, wofür ich stehe.
Natürlich hat das etwas Hausväterliches – passend zu einer Intention des Liedes, die von Claudius-Kennern gern beschworen wird: Man mag sich eine ländliche Familie vorstellen, die nach getaner Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes Feierabend macht und zur Ruhe kommt, indem sie in die nächtliche Landschaft schaut. Gleichwohl ist das Lied keine Idylle: Zwar mag man die vom Mond erhellte Landschaft als eine stille Kammer betrachten, in der sich des Tages Jammer vergessen lässt, jedoch ist in der Schlussstrophe von einem kalten Abendhauch die Rede; und wer seinen Claudius kennt, der spürt, dass er in seinem Gedicht von Anfang bis Ende die Gefährdung der menschlichen Existenz mitgedacht hat – bis hin zum Frösteln angesichts des Todes.4
Gibt sich die imaginierte Familie in den beiden Eingangsstrophen der Naturbetrachtung hin, so ergreift in den zwei folgenden Strophen – vielleicht auf die Frage eines Kindes hin – der Hausvater das Wort, um zu erklären, dass zu dem gerade aufgegangenen Halbmond eine unsichtbare zweite Hälfte gehöre. Daraus entwickelt er eine kleine Predigt über die Hybris des Menschen, der einerseits nur glaubt, was er sieht, und deshalb voreilig für unvollkommen hält, was an sich »rund und schön« ist; der sich aber andererseits zu allerlei Luftgespinsten und zweifelhaften Künsten versteigt.
Die letzten drei Strophen sind als Gebet zu verstehen: Der Hausvater bittet für sich und seine Familie um uneitel kindlichen Glauben, um einen sanften Tod und um Aufnahme in den Himmel. Wieder ganz in der Gegenwart, fügt er den Wunsch an, Gott möge die Hausgemeinschaft »ruhig schlafen« lassen, worauf – so erscheint es mir – ein anderes Stimmchen hinzufügt: »Und unsern kranken Nachbar auch!«
Gelegentlich ist dem Gedicht die »Reaktivierung« des »vorkopernikanischen Weltbildes«, mithin eine »explizite Wissenschaftskritik« und Aufklärungsfeindlichkeit vorgeworfen worden.5 In der Tat war Claudius kein Freund bornierter Aufklärung und weitreichender Wissenschaftsgläubigkeit. Wenn er sich in seinem Abendlied gegen die »Luftgespinste« und »vielen Künste« des Menschen wendet, so ist er jedoch nicht seinerseits borniert, vielmehr eher hellseherisch – jedenfalls im Blick auf das, was manche der Dutzende von Interpreten seinem »Abendlied« angetan haben.6
Zwar ist es nicht ohne Sinn, das Gedicht poetologisch abzuhorchen und etwa festzustellen, dass das Reimschema dem Modell der »Schweifreimstrophe« folgt, oder zu spekulieren, dass die Vokalreihen der einzelnen Zeilen absichtsvoll »komponiert« sein könnten. Auch kann man den Text daraufhin durchgehen, welche Aussagen lutherisch, pietistisch oder gar mystisch zu verstehen seien, was sich mit der Theologie der Aufklärung vereinbaren lasse oder ihr widerspreche. Man mag auch darüber nachdenken, wie sich Claudius’ Naturbilder zu denen des Ovid, des Frühaufklärers Brockes oder des Zeitgenossen Goethe verhalten. Da Claudius ein belesener Mensch war, wäre es geradezu ein Wunder, wenn seine Dichtungen nicht auch von reicher Bildung zeugten. Gleichwohl ist es ein Symptom der von ihm beschworenen Künsteleien und Luftgespinste, dass manche Experten nicht sehen wollen oder können, dass das Gedicht »Der Mond ist aufgegangen« keines wissenschaftlichen Gütesiegels bedarf.
Was zählt, lässt sich nicht aus Dichtungstheorien und theologischen Systemen zusammenrechnen, ist vielmehr die einfache »protestantische Erzählung«, die sich als solche nach 1780 geradezu in Windeseile durchgesetzt hat, weil man sie brauchte und als wahr empfand. Obwohl Claudius nicht von der Absicht geleitet war, ein Kirchenlied zu schaffen, konzentriert er in seinem »Abendlied« Jahrhunderte evangelischer Glaubenserfahrung. Zugleich vermittelt er ein Weltbild, das auch modernen Christen etwas bedeuten kann: Der Mensch ist ein »eitel armer Sünder« nicht wegen einzelner Fehltritte, sondern aufgrund eines Dünkels, der ihn alles machbar erscheinen lässt und doch die Welt kaum bessert. Und wenn Claudius wünscht, in den »Himmel« zu kommen, so malt er diesen nicht in reichen Farben, lässt vielmehr jeden das Seine darunter verstehen. Darin ist er bei aller Nähe zum Leben ein Stück weit Mystiker.
Während der Komponist Johann Abraham Peter Schulz seine bekannte Vertonung aus dem Jahr 1790 nicht von ungefähr innerhalb der Sammlung Lieder im Volkston präsentiert hat, lässt sich der Text selbst kaum unter einer solchen Rubrik einordnen, die ja ein wenig Herablassung signalisiert. Ergiebiger ist die Beobachtung, dass Claudius-Freund Johann Gottfried Herder das Gedicht schon bald nach Erscheinen im Vossischen Musenalmanach für das Jahr 1779 in seine Sammlung von »Volksliedern« aufgenommen hat, wo Beiträge noch lebender Autoren die große Ausnahme bilden. Und obwohl Herder zwei Strophen weglässt, hat er offenbar ein Gespür für die besondere Poesie des »Abendliedes«. Derlei »Poesie« preist er im Vorwort seiner Sammlung als »die Blume der Eigenheit eines Volks, seiner Sprache und seines Landes, seiner Geschäfte und Vorurtheile, seiner Leidenschaften und Anmassungen, seiner Musik und Seele«.7 Wenn man in Herders angenehm unprätentiöser Definition die »Blume der Eigenheit eines Volkes« durch die »Blume der Eigenheit evangelischer Frömmigkeit« ersetzt, trifft sie wichtige Momente des »Abendlieds« von Claudius.
Schauen wir pars pro toto auf das Wörtlein »auch«, das Claudius’ »Abendlied« ebenso beschließt wie Goethes berühmtes, wenige Jahre später entstandenes Gedicht »Wanderers Nachtlied«. Während das »auch« bei Goethe am Ende des Satzes »Warte nur, balde / Ruhest du auch« offenkundig höchst kunstvoll platziert ist, wirkt es in der Schlusszeile von Claudius’ »Abendlied« unvermittelt – wie denn die ganze Schlusssentenz »und unsern kranken Nachbar auch« an eine plötzlich einsetzende direkte Rede erinnert und damit womöglich die »ganze selbstgenügsame Harmonie des Liedes […] überraschend stört«.8 Doch das ist gewollt: Ich stelle mir – wie schon angedeutet – ein Kind vor, das mit dem Satz herausplatzt, um das Seine zum Abendgebet beizutragen, und damit das Schlusswort hat – unaufgefordert, aber wohlgelitten.
Für Fachleute mag es einen kleinen Affront darstellen: ein Gedicht, das formvollendet ist, ohne dass man dies bis ins Einzelne an kunstimmanenten Kriterien zeigen müsste und könnte. Und ein Dichter, der das Leben nicht zu Kunst sublimiert – anders als Goethe, der das »Über allen Gipfeln ist Ruh« an die Wand einer Berghütte schreibt, um dort seine Signatur als bedeutender Künstler zu hinterlassen. Ein Dichter vielmehr, dessen Kunst aus dem Leben erwächst und in das Leben hineinwirkt. Das Leben einer christlichen Familie, das zwischen Daseinslust und Alltagssorgen, zwischen Todesfurcht und Himmelssehnsucht pendelt – und die Vielfalt im Lied schön »auf die Reihe kriegt«: Im Zeichen des Mondes schlägt der Dichter eine Brücke zwischen Gott und Mensch, Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit. Verwirrtheiten und Brüche, die fast jedes Leben – auch das des Claudius – kennzeichnen, werden für einen Augenblick geheilt, der sich zugleich in die Ewigkeit verlängert.
Schillers Unterscheidung zwischen naiver und sentimentalischer Dichtung greift hier nicht: Weder ist Claudius »Natur« und somit »naiv«, noch sucht er die Natur nach Art des »sentimentalischen« Dichters. Denn natürlich hat er über seinem Gedicht gesessen, sich überlegt, was er sagen wollte, und dabei poetologische Regeln im Kopf gehabt. Insofern war er keine »Natur«. Doch ebenso wenig suchte er nach solcher »Natur«. Es gibt da etwas Drittes, nämlich einen kindlich-gläubigen Geist; Christen sprechen vom Heiligen Geist. Dessen Unmittelbarkeit hat man nicht von Geburt an, man kann sie auch nicht ohne Weiteres im Laufe seines Lebens erwerben; man bekommt sie – bei Gelegenheit und keineswegs für immer – geschenkt, wie andere ihr künstlerisches Genie zum Geschenk erhalten.
Da mag man von faulem Zauber sprechen, wie Wolfgang Koeppen es in einem kleinen Essay von 1958 mit dem Titel »Der Reinfelder Mond« getan hat. Als es den Dichter, welcher der deutschen Literatur nach 1945 wichtige Impulse gegeben hat, vorübergehend in das schleswig-holsteinische Städtchen Reinfeld verschlägt, notiert er: Dort »ist Matthias Claudius geboren, in dem Pfarrhaus aus moosverwachsenen Backsteinen, unter den hohen Linden, in ihrem Sommerduft, am Ufer der träumenden Teiche, und der Mond steht wie 1740 über der Gemeinde«.9 Koeppen lässt die bittere Feststellung folgen, dass die deutsche Innerlichkeit, die aus dem Gedicht von Claudius spricht und die sich in der idyllischen Fassade des Reinfelder Pfarrhauses spiegelt, an den Unmenschlichkeiten der neueren deutschen Geschichte nichts hat ändern können: »Hass, Gier, Neid, die Habsucht und die Herzensträgheit« regieren weiterhin die Welt.10
Kann man dafür Matthias Claudius verantwortlich machen, sollte man sein »Abendlied« deshalb nicht mehr singen? Ich kann die Bitterkeit Koeppens, der namentlich zur Zeit des Nationalsozialismus ein schweres Leben hatte, gut nachvollziehen. Ich denke an meine eigene Sympathie für die Studentenbewegung von 1968 und an ein Gedicht, das ich damals schätzte. Es nimmt die deutsche Innerlichkeit zwar nicht am Beispiel von Claudius’ »Abendlied«, jedoch anhand von »Wanderers Nachtlied« aufs Korn. Ich meine Bertolt Brechts »Liturgie vom Hauch« aus seiner Hauspostille von 1927. Die erste Strophe lautet:
Einst kam ein altes Weib einher
Die hatte kein Brot zum Essen mehr
Das Brot, das fraß das Militär
Da fiel sie in die Goss, die war kalte
Da hatte sie keinen Hunger mehr.
Darauf schwiegen die Vöglein im Walde
Über allen Wipfeln ist Ruh
In allen Gipfeln spürest du
Kaum einen Hauch …11
Es ehrt Menschen wie Koeppen und Brecht, dass sie die Welt, wie sie ist, nicht ertragen und sie keinesfalls zur Idylle verklären wollen. Doch Claudius malt keine Idylle: Ihm muss man nicht erklären, dass die Welt ein Jammertal ist; stattdessen legt er uns nahe, getrost in diesem Jammertal zu leben. »Getrost« – ein altmodisches Wort. Martin Luther liebte es; in seiner Bibelübersetzung erscheint es an die drei Dutzend Mal. So sagt Gott zu Josua (1, 9): »Siehe ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seiest.« Vor diesem Horizont bekommen die Zeilen des »Abendliedes«, »so sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen«, eine besondere Färbung: Man muss die Welt nicht bis ins Letzte ergründen wollen, darf sich vielmehr damit abfinden, »manche Sachen« nur getrost »belachen« zu können. Wer weiß es besser?
2 W 473
3 Janne Teller, »Zwischen den Zeilen«, in: Lettre International, Sommer 2012, S. 126–127, hier S. 126
4 vgl. Richard Alewyn, »Die Lust an der Angst«, in: ders., Probleme und Gestalten, Essays, Frankfurt a. M. 1974, S. 307–330
5Rainer Marx, »Unberührte Natur, christliche Hoffnung und menschliche Angst – Die Lehre des Hausvaters in Claudius’ Abendlied«, in: Karl Richter (Hg.), Gedichte und Interpretationen, Bd. 2, Stuttgart 1983, S. 341–355, hier S. 344
6 Eine ausführliche Übersicht bietet u. a. Albrecht Beutel, »›Jenseit des Monds ist alles unvergänglich‹. Das ›Abendlied‹ von Matthias Claudius«, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche, 87 (1990), S. 487–520
7 Johann Gottfried Herder, Volkslieder. Nebst untermischten andern Stücken, 2. Teil, Leipzig 1779, S. 4
8 Beutel 1990, S. 516
9 Wolfgang Koeppen, Nach Russland und anderswohin. Empfindsame Reisen, Stuttgart 1958, S. 7
10 Koeppen 1958, S. 8
11 Bertolt Brecht, Werke, Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Bd. 11, Weimar und Frankfurt a. M. 1988, S. 49f.
BIN AUCH AUF UNVERSTÄDTEN GEWESEN, und hab auch studiert. Ne, studiert hab ich nicht, aber auf Unverstädten bin ich gewesen, und weiß von allem Bescheid. Ich ward von ohngefähr mit einigen Studenten bekannt, und die haben mir die ganze Unverstädt gewiesen, und mich allenthalben mit hingenommen, auch ins Kollegium. Da sitzen die Herren Studenten alle neben’nander auf Bänken wie in der Kirch, und am Fenster steht eine Hittsche, darauf sitzt ’n Professor oder so etwas, und führt über dies und das allerlei Reden, und das heißen sie denn dozieren. Das auf der Hittschen saß, als ich drin war, das war ’n Magister, und hatt’ eine große krause Paruque auf’m Kopf, und die Studenten sagten, daß seine Gelehrsamkeit noch viel größer und krauser, und er unter der Hand ein so kapitaler Freigeist sei, als irgendeiner in Frankreich und England. Mochte wohl was dran sein, denn ’s ging ihm vom Maule weg als wenn’s aus ’m Mostschlauch gekommen wär; und demonstrieren konnt’ er, wie der Wind. Wenn er etwas vornahm, so fing er nur so eben ’n bißchen an, und, eh man sich umsah, da war’s demonstriert. So demonstriert’ er z. Ex. daß ’n Student ’n Student und kein Rhinozeros sei. Denn sagte er, ’n Student ist entweder ’n Student oder ’n Rhinozeros; nun ist aber ’n Student kein Rhinozeros, denn sonst müßt ’n Rhinozeros auch ’n Student sein; ’n Rhinozeros ist aber kein Student, also ist ’n Student ’n Student. Man sollte denken, das verstünd sich von selbst, aber unsereins weiß das nicht besser. Er sagte, das Ding »daß ’n Student kein Rhinozeros sondern ’n Student wäre« sei eine Hauptstütze der ganzen Philosophie, und die Magisters könnten den Rücken nicht fest genug gegenstemmen, daß sie nicht umkippe.12
12 W 19f.
KAPITEL 1
Von Reinfeld nach Wandsbek
1740–1770
Reinfeld ist ein zwischen Bad Oldesloe und Lübeck gelegenes Kleinstädtchen mit heute knapp 9000 Einwohnern. Wenn Wolfgang Koeppen in seinem Essay »Der Reinfelder Mond« glaubt, das »Pfarrhaus aus moosverwachsenen Backsteinen« als die Geburtsstätte von Matthias Claudius ausgemacht zu haben, unterliegt er einem kleinen Irrtum: In Wahrheit beschreibt er den Nachfolgebau von 1782, den der Dichter erst als Erwachsener kennengelernt hat. Geboren wurde Matthias Claudius am 15. August 1740 in dem alten Pastorat, das an gleicher Stelle gestanden hatte – auf einem Gartengelände zwischen Schloss und dem »Herrenteich«, in dem die Herrschaft die bis heute gerühmten Reinfelder Karpfen züchtete.
»Die Herrschaft« – das war für Vater Claudius, der von 1730 bis 1773 als Pastor auf der Reinfelder Kanzel stand, die im nahen Schloss residierende Herzogswitwe Dorothea Christina. Im weiteren Sinne war es auch ihr Sohn Friedrich Karl, regierender Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, einem Ländchen, dessen Größe im umgekehrten Verhältnis zur Länge des Namens stand.
Friedrich Karl hatte den Plöner Besitz 1729 als Folge dynastischer Verwicklungen gegen das ebenso kleine Herzogtum Norburg auf der Ostseeinsel Alsen eingetauscht. Für den Unterhalt von mindestens zwei Mätressen und das üppige Hofleben, das er im Plöner Schloss führte, dürften die Erträge des winzigen Herzogtums je länger, desto weniger ausgereicht haben. Jedoch half ihm der »Plönische Sukzessionstraktat«, dem zufolge er den dänischen König als Erben einsetzte. Im Gegenzug kam dieser für alle Schulden auf, die der holsteinische Duodezfürst bei Lebzeiten angehäuft haben würde.
Seinen Pastor Matthias Claudius den Älteren, den Vater des Dichters, hatte der Herzog von Alsen mitgebracht – vermutlich, weil er dessen Loyalität zu schätzen wusste. Das bis in die Reformationszeit zurückreichende Pfarrergeschlecht der Claudius stammte aus Nordschleswig. Dort wirkte von 1598 bis 1639 der Pastor Claus Paulsen in Emmerlev bei Tønder; nach humanistischer Sitte latinisierte er seinen Namen zu Claudius Pauli.
Auch einer seiner Nachkommen, ebenjener Matthias Claudius der Ältere, wirkte als Pastor in Nordschleswig, bevor er 1730 mit 26 Jahren sein Amt in Reinfeld antrat. Er heiratete, bekam zwei Söhne und war schon sieben Jahre später wieder Witwer. Nach Ablauf des Trauerjahres ehelichte er Maria Lorck, Tochter eines Flensburger Ratsherrn. Sie gebar ihm acht Kinder; Sohn Matthias kam an zweiter Stelle. Im Erwachsenenalter hat Matthias Claudius seine Eltern als fromm und liebevoll dargestellt, und wir haben keinen Grund, an dieser Erinnerung zu zweifeln.
Offensichtlich war der junge Matthias schon früh für den Beruf des Pfarrers vorgesehen. Jedenfalls unterrichtet ihn der Vater zusammen mit dem wenig älteren Bruder Josias nicht nur in den Grundschulfächern, sondern auch im Lateinischen; und der große Lehnsessel im Pfarrhaus wird zur »Kanzel«, von der aus schon das Kind zur Hausgemeinde »predigt«.13 Gleichwohl ist der junge Matthias augenscheinlich kein Stubenhocker: Er streift durch die Natur und entwirft eine abenteuerliche Seekarte,14 um mit dieser Navigations-»Hilfe« den »Herrenteich« zu befahren. Als das Boot bei einer dieser Expeditionen kentert, ist er nahe am Ertrinken: »Ich hatte schon alles aufgegeben, und dachte nur daran, wie mir der Tod schmecken und was meine arme Mutter sagen würde.«15 Das frühe Nahtoderlebnis hat sich in Claudius’ Gedächtnis ebenso tief eingegraben wie der Verlust zweier Geschwister und eines Halbbruders, den der Elfjährige binnen eines einzigen Jahres zu verkraften hat.
Die Matthias-Claudius-Kirche in Reinfeld heute. Hier wurde Claudius am 16. August 1740 von seinem Vater getauft, falls dies nicht im Haus geschehen ist.
© Kirchengemeinde Reinfeld (Dierk Topp)
Das 1782 errichtete Pastorat in Reinfeld, vom Herrenteich her gesehen. Es ersetzte Matthias Claudius’ Geburtshaus, das der auf einen Neubau bedachte Ortspfarrer als eine »verfallene, düsterne Hütte« bezeichnete, die »mehr finsteren und schmutzigen Viehställen als Wohnungsorten für Menschen« geglichen habe (Johannes Wolters, Aus Reinfelds Vergangenheit, Eckernförde 1920, S. 103). Ansichtskarte aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
© Privatarchiv Autor
Nach der Konfirmation schickt der Vater den Vierzehnjährigen zusammen mit Bruder Josias auf die Lateinschule in Plön. Da die Kinderschar inzwischen auf neun Köpfe angewachsen ist, wird er für Logis und Schulgeld kaum allein aufgekommen sein: Das Gehalt eines Dorfgeistlichen gibt dafür nicht genug her, selbst wenn zum Landpastorat traditionell eine Obstwiese und ein paar Kühe auf der Weide gehören. Vermutlich hat die Reinfelder Herzogswitwe mit Stipendien weitergeholfen, vielleicht auch der in Plön residierende Herzog selbst.
Zwischen einem Dorfpastor und seinem adeligen Patron herrscht in diesen Zeiten ein spezifisches Dienstverhältnis: Der Pastor ist oft der einzige Akademiker am Ort und deshalb bei Hof in der Regel wohlgelitten. Auch Pastor Claudius wird in Hofkreisen verkehrt haben; jedenfalls werden drei seiner Kinder zu Paten bei Mitgliedern des herzoglichen Hauses bestellt. Andererseits ist ein Pastor, sofern er nicht reich geheiratet hat, auf Gratifikationen unterschiedlicher Art angewiesen. Solche aber kommen vom Patron oder der Patronin, die als Gegenleistung absolute Loyalität erwarten. Das bedeutet de facto, dass der Pastor von der Kanzel und im Konfirmandenunterricht – in gut lutherischer Tradition – zum Gehorsam gegenüber der Obrigkeit aufzurufen hat, auch wenn eine innere Stimme ihm oftmals anderes nahegelegt haben mag. Sollte es zu Gewissenskonflikten kommen, gibt es eine spezifische Lösungsmöglichkeit. Diese besteht in dem Vorsatz, zwar nicht die Herrschaft zu kritisieren, jedoch als Pastor ein möglichst untadeliges Leben zu führen, dem einfachen Volk anteilnehmend zu begegnen und dem »kranken Nachbarn« nach Kräften zu helfen.
Im Leben des jungen Matthias Claudius scheint es einen Dreiklang von Natur-, Glaubens- und Patronatserfahrung gegeben zu haben, der auch seine weitere Existenz bestimmen wird. Schon früh erfährt dieser Akkord eine Eintrübung, die zwar nicht mit Schwermut gleichzusetzen ist, jedoch ein spezifisches Vorzeichen setzt: Bei allem Tun und Lassen hat Freund Hein ein Wort mitzureden. Die Auseinandersetzung mit dem Tod kultiviert nicht zuletzt das evangelische Pfarrhaus, welches zugleich den Nährboden für Claudius’ späteres Künstlertum abgibt.
Ein prunkliebender Landesherr: Herzog Friedrich Karl von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön im Kreis der Familie im Garten seines Lustschlosses Traventhal. Gemälde von Johann Heinrich Tischbein, 1759. Was mag der junge Claudius, Schüler des Plöner Gymnasiums, von dieser Pracht gehalten haben?
© The Museum of National History on Frederiksborg Castle
Andere Dichter haben diesen Hintergrund ebenfalls gehabt – Gryphius, Lenz, Lessing, Gellert, Jean Paul, Benn, Hesse –, auch Nietzsche. Es trifft da einiges aufeinander: Traditionsbewusstsein auf der einen Seite, bohrendes Fragen nach Gott, Welt und Mensch auf der anderen. Gleichwohl ist das Pfarrhaus nicht mehr als ein Nährboden. Was die Einzelnen daraus gemacht haben, hätte unterschiedlicher kaum sein können: Jeder hat auf seine Weise und in seiner Zeit versucht, mit diesem Erbe fertigzuwerden, jedem half sein persönlicher Genius.
Matthias Claudius ist noch auf der Suche, als er sich nach vierjährigem Besuch der Plöner Lateinschule im April 1759 gemeinsam mit dem Bruder an der Universität Jena einschreibt. Das thüringische Universitätsstädtchen ist zwar recht weit von Reinfeld entfernt, jedoch gibt es dort eine holsteinische Landsmannschaft mit den Farben Scharlachrot-Weiß. Vater Claudius warnt vorsorglich vor exzessivem Studentenleben und gibt in einem eigens dafür angelegten Heftchen entsprechende Winke: Die Brüder finden dort genaue Direktiven zum Besuch der Kollegien, Ratschläge zu Wohnung, Licht und Feuerung, Mahnungen zur Sparsamkeit, Warnungen vor Duellen. Zum Schluss gibt es ein fulminantes Resümee, das dem biblischen Buch Jesus Sirach entnommen ist: »Wein und Weiber betören die Weisen; und die sich an Huren hängen, werden wild und kriegen Motten und Würmer zum Lohn und verdorren, den andern zum merklichen Exempel.«16
Beide Brüder schreiben sich für ein Theologiestudium ein; Matthias wechselt jedoch schon nach einem Jahr in die juristische Fakultät, wo er vor allem Kameralwissenschaften studiert – modern gesprochen: Verwaltungsrecht und Wirtschaftswissenschaften. Einer ungesicherten Überlieferung zufolge ist der Wechsel durch ein Brustleiden bedingt, das ihn gelegentlich Blut spucken und für ein künftiges Predigtamt ungeeignet erscheinen lässt. Allerdings ist Claudius von den neuen Fächern offenbar nicht begeistert; seine Leidenschaft gilt jedenfalls der schönen Literatur: Er schließt sich der Jenaer Teutschen Gesellschaft an, die frischen Wind in Kunst und Wissenschaft bringen möchte. Diesem Ziel dienen Lese- und Diskussionszirkel, in denen man mit den Dichtungen von Hagedorn, Klopstock und Gleim in Berührung kommt – also mit all dem, was man Anakreontik, im weiteren Sinne auch Empfindsamkeit nennt.
Zwei Drucke zeugen von Claudius’ Eintauchen in diese ihm neue Welt. Zum einen veröffentlicht er Ende 1760 seine Leichenrede zur Erinnerung an den in Jena an Blattern verstorbenen Bruder Josias – ein eigentümliches Dokument, das an seinem Schmerz zwar keinen Zweifel lässt, das existenzielle Thema »Tod und Verlust eines geliebten Menschen« jedoch mit einem dichterischen, theologischen und philosophischen Aufwand angeht, der eines Mitglieds der Teutschen Gesellschaft würdig sein mag, einen Zwanzigjährigen jedoch intellektuell und emotional zu überfordern droht.
Titelblatt der von Matthias Claudius auf den Tod seines Bruders verfassten Trauerrede. Der Zwanzigjährige hielt sie »vor den Teilnehmern des akademischen Leichenzugs«. Die steife Argumentation und der barocke Stil wollen zu einem Mitglied der Teutschen Gesellschaft nur bedingt passen.
© Claudius, Matthias, Ob und wie weit Gott den Tod der Menschen bestimme, bey der Gruft seines geliebtesten Bruders Herrn Josias Claudius, der Gottesgelahrtheit rühmlichst Beflissenen welcher zu Jena den 19ten des Wintermonats 1760. seelig verschied von M. Claudius der teutschen Gesellschaft zu Jena ordentlichen Mittgliede, Jena 1760
Unausgegoren und von der gelehrten Kritik nicht grundlos gescholten ist der Inhalt eines 64 Seiten umfassenden Büchleins mit dem Titel Tändeleyen und Erzählungen, das Claudius im Herbst 1762 veröffentlicht. Wer will, mag zu filtern versuchen, was von den mehr oder weniger geglückten Versen – auch die »Erzählungen« sind gereimt – als bloße Fingerübung im »stile anacreontico« einzuschätzen ist und was schon bedeutungsvoll auf den späteren Claudius hinweist. Dieser hat lediglich eines der frühen Gedichte – »An eine Quelle« – in seine Sämmtlichen Werke aufgenommen.17 Interessanter erscheint die Frage, wie es zu einer zweiten, leicht veränderten Auflage der Tändeleyen hat kommen können und wie sie finanziert wurde. Hat womöglich der Widmungsträger Geld zugeschossen, der damals siebzehnjährige Friedrich Ludwig Graf von Moltke? Oder dessen Vater, Oberhofmarschall in dänischen Diensten? Denkbar, jedenfalls für die Zeit nicht ungewöhnlich wäre, dass Claudius sich als Begleiter auf der Cavalierstour empfehlen wollte, die der junge Graf wenig später antreten wird.18
Sollte diese Absicht bestanden haben, so ist nichts daraus geworden. Vielmehr verlässt Claudius die Universität Jena im Herbst 1762, um für ein gutes Jahr ins Elternhaus zurückzukehren. Einen akademischen Grad kann er dem Vater nicht vorweisen; doch das ist Conditio sine qua non nur für einen jungen Gelehrten, der an der Universität Karriere machen will. Das aber hat der junge Claudius beileibe nicht im Sinn. Vielmehr wird er schon wenig später in seiner Rolle als Asmus die hohen Schulen als »Unverstädten« verspotten (siehe Vorschub Kapitel 1)19 und generell kein gutes Haar an ihrer unproduktiven Gelehrsamkeit lassen. Schon die Tändeleyen und Erzählungen enthalten die Fabel über einen Gelehrten, der angesichts der Aufgabe, einen Stein auf einen Hügel zu tragen, bloß nutzlos zu schwadronieren weiß:
… Ich wills euch aus Begriffen sagen.
Der Stein ist schwehr, das seht ihr hier,
Doch wißt ihr nicht, warum? Ihr Ungelehrten ihr!
Drum müsst ihr die Gelehrten fragen;
Und ihr thut wohl. Ich dank es der Gelehrsamkeit,
Ohn’ welcher ich gewiß so tumm, wie ihr seyd, wäre,
Nur blos des Steines Dichtigkeit
Ist schuld an seiner grosen Schwehre,
wär er nur halb so dicht, das folget nun daher,
So wär er auch nur halb so schwehr. …20
Einer aus »der Philosophen Schaar, / Die, neben andern großen Gaben, / Nur Grillen in den Köpfen haben« will der junge Claudius nicht sein. Doch schwere Steine auf einen Berg zu tragen kann er auch nicht als Sinn des Lebens betrachten. Ebenso wenig mag er »nach Glückstadt gehen«, um »zu plädieren«,21 also Advokat werden. Stattdessen schaut er sich nach Stellen um, auf denen er zwar etwas Geld verdienen, zugleich aber seinen Horizont weiten kann. Er wendet sich diesbezüglich an den nur wenig älteren Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, dem er in Jena in der Teutschen Gesellschaft begegnet und mit dem Titel der Tändeleyen nacheifert. Der passionierte Dichter im Nebenberuf, inzwischen Offizier in dänischen Diensten, empfiehlt ihn an den Generalauditeur Caroc, Chef der militärischen Justizverwaltung. Doch lieber hätte Claudius »eine Sekretärstelle«; und vor der Hand genügt »das erste das beste, ich wollte gar zu gerne vom Hause«.22 Vermutlich durch die Vermittlung eines Onkels klappt es mit der »Sekretärstelle« im Frühjahr 1764 beim Grafen Ulrich Adolph von Holstein, der nach Kopenhagen in die königlich dänische Heeresverwaltung berufen worden ist. Doch bereits nach einem guten Jahr ist Claudius erneut stellungslos: Da hat der Chef sein Amt schon wieder aufgegeben.
Indessen nutzt Claudius das Kopenhagener Jahr zu zahlreichen Kontakten, welche die Jahrzehnte weitgehend überdauern werden. Zu einer seiner Leitfiguren wird der 16 Jahre ältere Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock, der auf Einladung König Friedrichs V. in der dänischen Hauptstadt weilt, um ohne materielle Sorgen an seinem großen Versepos Der Messias arbeiten zu können. Vermutlich ist Claudius nicht nur vom dichterischen Furor Klopstocks begeistert gewesen, sondern auch von dessen Geschick, Mäzene zu finden. Jedenfalls wird er im Laufe der Zeit versuchen, es Klopstock in diesem Punkt gleichzutun – wenngleich in weitaus bescheideneren Dimensionen. Schon der Passus aus einem Brief, den er im Sommer 1769 an den Freund Gottlob Friedrich Ernst Schönborn richtet, lässt in dieser Hinsicht tief blicken: »Die ökonomischen Angelegenheiten ziehen wie der Körper die Kräfte des Philosophen zur Erde und versengen die Fittiche seines Genies. Ha, ha, ha.«23
Claudius darf sich alsbald zum engeren Bekannten-, wenn nicht gar Freundeskreis Klopstocks zählen; er tut sich als Musikmeister hervor, fördert durch sein Klavierspiel die Geselligkeit und gefällt durch Wendigkeit beim Eislaufen, einer der Lieblingsbeschäftigungen des damals schon berühmten Dichters. Mit dem »Jüngling«, der in der 1764 entstandenen Ode »Der Eislauf« »den Wasserkothurn / Zu beseelen weiß und flüchtiger tanzt«,24 soll Claudius gemeint gewesen sein. Dieser intensiviert indes auch seine Beziehungen zu Gerstenberg, der sich prominente Vertonungen seiner Dichtungen wünscht und darüber mit Claudius noch über Jahre hinweg in regem Gedankenaustausch bleiben wird.
Von Sommer 1765 bis Mai 1768 muss Claudius wieder mit dem Reinfelder Elternhaus vorliebnehmen. Weitgehend mittellos, kann er oft nicht einmal das Porto für die Korrespondenz mit Freunden aufbringen. »Der pflügt, der drischt, der läßts sein, der ist krank, der traurig, der liebt, der fällt in den Schnee, der stirbt, der brennt ab – das würden meine Neuigkeiten sein«,25 teilt er Schönborn im Februar 1767 in der lakonischen Art mit, die er offenbar schon jetzt zu seinem Markenzeichen macht; und vermutlich ist er damals seinerseits darauf angewiesen, in der Landwirtschaft mitzuhelfen. Er wird auch das Orgelspiel betrieben haben, scheint sogar an der Organistenstelle einer Lübecker Kirche interessiert gewesen zu sein.
»Fragen Sie Wöldicke, wie er es gemacht hat, daß er Professor geworden, und machen Sie es ebenso und werden Sie auch Professor und laß es Dubois ebenso machen, so wird er auch Professor«,26 heißt es in einem späteren Brief an Freund Schönborn. Das klingt nicht unbedingt launig, eher ein wenig frustriert – vor allem im Kontext einer anderen Briefpassage: »Klopstock hat nicht geschrieben, schreibt nicht und wird wohl auch nicht schreiben.«27 Aber dann schreibt Klopstock doch und vermittelt sogar einen Posten: Claudius kommt bei den neu gegründeten, zweimal wöchentlich erscheinenden Hamburgischen Adreß-Comtoir-Nachrichten unter, die von Klopstocks Bruder herausgegeben werden. Man mag es Fügung oder Zufall nennen: Er hat damit einen vergleichsweise interessanten Job gefunden; denn Zeitungen, die mehrmals in der Woche erscheinen und um Aktualität bemüht sind, gelten im zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts noch als abenteuerliche Projekte.
Claudius assistiert also seit Mitte 1768 Wilhelm Dumpf, dem Redakteur der Adreß-Comtoir-Nachrichten, liefert jedoch schon in der Ausgabe vom 2. Juli den ersten eigenen Beitrag – in Gestalt eines fingierten Briefes, in dem sich ein gewisser Gustav Pfahl der Zeitung als Korrespondent anbietet. Neben einer reichlich skurrilen Angebotsliste empfiehlt sich dieser »Humorist«, wie Claudius ihn in seiner Rolle als Redakteur nennt, mit allgemeinen Vorstellungen zum Profil des Blattes: »Ein Adreß-Comtoir ist nur für eine große Stadt; hier soll es ein erhabner Ort sein, wo man überall sehen kann, ein Hör- und Sprach-Rohr zugleich, ein magischer Spiegel, auf dessen einer Seite jedermann sein Bedürfnis schreibt, und auf der andern die Antwort liest.«28
Eine solcher Anspruch – hinter dem sich natürlich Claudius’ eigene Vorstellungen verbergen – klingt geradezu modern, ist freilich auch arg idealistisch: Wie soll ihn ein achtseitiges Blatt einlösen, das man vor allem wegen seiner Geschäftsnachrichten, Schiffsmeldungen, Wetterberichte, Wechselkurse usw. abonniert? Doch gerade in der tendenziell pragmatischen Ausrichtung der Adreß-Comtoir-Nachrichten liegt für Claudius eine Chance: Er ist offenkundig vor allem für die Beiträge im locker gestalteten Schlussteil des Blattes zuständig; und dort lässt man ihn vorerst, so scheint es, unbehelligt schalten und walten. Und dies umso bereitwilliger, als das, was man wenig später Feuilleton nennen wird, noch in den Kinderschuhen steckt, sodass jede Zeitung hier Neuland betritt.
In etwa 30 Beiträgen nutzt Claudius die Gelegenheit, seine spezifischen Talente auszuprobieren – Talente, die er erst innerhalb der nachfolgenden Tätigkeit für den Wandsbecker Bothen ganz entfalten wird, jedoch schon in den Adreß-Comtoir-Nachrichten aufblitzen lässt. Da gibt es zum Beispiel die Korrespondenz zwischen Fritz, seinem Vater und seiner Tante. Eine aktuelle Hamburger Aufführung von Lessings Minna von Barnhelm,die der rührend naive, die Bühnenhandlung für bare Münze nehmende Jüngling besucht hat, bildet den Anlass zu Reflexionen über Moralität, Gefährlichkeit oder gar Sündhaftigkeit des Theaters; und Rolf Siebke, Herausgeber der aktuellen Claudius-Gesamtausgabe, geht wohl nicht fehl, wenn er in Fritzens bigotter Tante ein Widerbild des Hamburger Hauptpastors Johann Melchior Goeze sieht, der damals gegen das unsittliche Wesen der deutschen Bühne wettert – nicht zuletzt anlässlich besagter, höchst erfolgreicher Aufführung von Lessings Lustspiel durch die Ackermannsche Schauspieltruppe.29
Man kann die von Claudius präsentierte Mischung von Humor und Hintersinn oder – gemäß dem Titel einer Grabbe-Komödie – von »Scherz, Satire, Ironie und tieferer Bedeutung« kaum beschreiben. Man muss sie lesen. Als Beispiel abgedruckt sei hier ein kleines Gedicht, das für die Modernität einer Claudiusschen Moritat steht; es könnte auch von Peter Hacks stammen:
Grabschrift
Es lebte einst ein Ritter,
Bernhardus Parirot;
Er schmeckte süß und bitter,
Und wog viertausend Lot;
In einem Ungewitter
Schlug seine Frau ihn tot,
Und nun liegt hier der Ritter,
Bernhardus Parirot.30
Ein anderes Gedicht aus den Adreß-Comtoir-Nachrichten zählt zu den wenigen, die Claudius der Aufnahme in seine Sämmtlichen Werke für würdig befunden hat. Dort erscheint es in dieser Gestalt:
Ein Wiegenlied bei Mondschein zu singen
So schlafe nun du Kleine!
Was weinest du?
Sanft ist im Mondenscheine,
Und süß die Ruh.
Auch kommt der Schlaf geschwinder,
Und sonder Müh:
Der Mond freut sich der Kinder,
Und liebet sie.
Er liebt zwar auch die Knaben,
Doch Mädchen mehr,
Gießt freundlich schöne Gaben
Von oben her
Auf sie aus, wenn sie saugen,
Recht wunderbar;
Schenkt ihnen blaue Augen
Und blondes Haar.
Alt ist er wie ein Rabe,
Sieht manches Land;
Mein Vater hat als Knabe
Ihn schon gekannt.
Und bald nach ihren Wochen
Hat Mutter mal
Mit ihm von mir gesprochen:
Sie saß im Tal
In einer Abendstunde,
Den Busen bloß,
Ich lag mit offnem Munde
In ihrem Schoß.
Sie sah mich an, für Freude
Ein Tränchen lief,
Der Mond beschien uns beide,
Ich lag und schlief;
Da sprach sie! »Mond, oh! scheine,
Ich hab sie lieb,
Schein Glück für meine Kleine!«
Ihr Auge blieb
Noch lang am Monde kleben,
Und flehte mehr.
Der Mond fing an zu beben,
Als hörte er.
Und denkt nun immer wieder
An diesen Blick,
Und scheint von hoch hernieder
Mir lauter Glück.
Er schien mir unterm Kranze
Ins Brautgesicht,
Und bei dem Ehrentanze;
Du warst noch nicht.31
1764 entsteht Klopstocks »Willkommen, o silberner Mond, / schöner stiller Gefährt’ der Nacht!«; 1777 dichtet Goethe »Füllest wieder Busch und Tal / Still mit Nebelglanz«. In meinem Exemplar des »Echtermeyer« – dieser von einigen Schülergenerationen benutzten Anthologie deutscher Lyrik – sind diese beiden Gedichte mit Bleistiftanmerkungen übersät: Wir »besprachen« sie in der Oberstufe. Warum fehlt Claudius’ Wiegenlied?
Es mangelt ihm am »hohen Ton« der Allgemeingültigkeit: Die ästhetischen Maximen klassizistischer Kunst zielen auf Einheit, Vollkommenheit, Stimmigkeit, Konsequenz, Reinheit und Geschlossenheit; man will idealisieren, weder seinem Gegenstand noch dem Publikum zu nahe treten. Rein Stoffliches ist da ebenso fehl am Platz wie allzu Beziehungsreiches. Wie feinstens aus zart geädertem Marmor gehauen – so soll klassizistische Kunst wirken. Selbst für die Gattung der Idylle gilt Schillers Forderung: »In einem wahrhaft schönen Kunstwerk soll der Inhalt nichts, die Form aber alles thun; denn durch die Form allein wird auf das Ganze des Menschen, durch den Inhalt hingegen nur auf einzelne Kräfte gewirkt. […] Darinn also besteht das eigentliche Kunstgeheimniß des Meisters, daß er den Stoff durch die Form vertilgt.«32
Claudius, seinen Tändeleyen entwachsen, kann solche Maximen nicht verstehen – oder er versteht sie zu gut, um sich mit ihnen anfreunden zu können. Er hält nichts von dem leeren Idealisieren, dem noch zu seinen Lebzeiten auch ein Frühromantiker wie Friedrich von Schlegel widersprechen wird, ohne doch dem Bannkreis des Idealismus zu entkommen.
Ohne dass man dem »Wiegenlied« mangelnde Formschönheit oder aufdringliche Materialität vorwerfen könnte, will es nicht etwa Leben zu Kunst gerinnen lassen, sondern Lebens-Kunst vorstellen: Schlag dein Lebensbuch auf, lautet seine Einladung. Und die Vorstellung eines Lebensbuches erinnert mich an das dicke Album, das meiner Familie kontinuierlich dokumentiert, was an unserem Leben – bei allen Widersprüchen – liebens- und schätzenswert ist: Es gibt dort diverse Eintragungen von Gästen, Fotos, Programmzettel, Zeitungsausschnitte, Kinderzeichnungen, Geburts- und Todesanzeigen, den Ausdruck eines Elektrokardiogramms und als Eigengewächs viele skurrile Gedichte und Schüttelreime – eine Art Bricolage. An diesem Punkt ist mir Claudius sehr nahe.
Doch anstatt mich mit ihm messen zu wollen, vergleiche ich ihn lieber mit Mozart. Dessen Musik erlebe ich weit weg vom Weimarer Klassizismus und nahe an dem, was ich als »Harlequinade« beschrieben habe. Gemäß einer Definition des Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz war Harlequin allerdings keine dumme, komische Figur, sondern »Empereur de la Lune«, Beherrscher des Mondes. Als solcher verstand er sich auf die Kunst, das Schwierige angenehm und das Schwere leicht zu machen. Leibniz hat sich auch zum Wesen Harlequins geäußert: Man habe, als man ihn auf der Bühne entkleiden wollte, kein Ende finden können, weil unter jedem Gewand ein neues zum Vorschein gekommen sei; und das stehe für die unendlichen Entfaltungen des organischen Lebens.33 Das passt nicht schlecht auch auf Claudius, den der Theologe Wichmann von Meding unlängst einen »Narren am Hof der regierenden Aufklärung« genannt hat.34 Und schon Claudius’ Zeitgenossen wussten, wenn sie nicht gerade Goethe, Schiller oder Wilhelm von Humboldt hießen, was sie an diesem Harlequin oder Narren hatten.
Der Verleger der Adreß-Comtoir-Nachrichten weiß es offenbar nicht; jedenfalls bekommt Claudius nach zwei Jahren eine Abmahnung, worauf er von sich aus kündigt. Sein letzter, am 1. Oktober 1770 erscheinender Beitrag lässt noch einmal Gustav Pfahl zu Wort kommen – mit der rhetorischen Frage, wie man es dem verehrten Publikum denn wohl recht machen könne: Möchte es etwas vom Türkenkrieg erfahren, oder von »Amor«, oder vom Thema »Genie und Geschmack«, oder besser vom Nichts? Von Letzterem verstehe er, Gustav Pfahl, nämlich besonders viel. Claudius äußert sich somit zum Ende seiner Tätigkeit so hintergründig-skurril, wie er begonnen hat; und man hätte es den braven oder weniger braven Hamburger Handelsleuten, denen das Blatt ja gefallen sollte, kaum verübeln können, wenn sie da nicht immer mitgekommen wären.
Drei prominente Zeitgenossen, mit denen der junge Journalist Claudius verkehrte: der Musiker Carl Philipp Emanuel Bach, der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock sowie der Denker und Theatermann Gotthold Ephraim Lessing (von links).
© bpk | Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin (Staatsbibliothek zu Berlin/Ruth Schacht)
Aufs Erste ist es nun aus mit der Redakteurstätigkeit, die ohnehin so wenig abgeworfen hat, dass Claudius es mit der Lotterie versuchen35 und zunächst mit einer »Stube« vorliebnehmen muss, aus der er »täglich mit Lebensgefahr zu einem Nachtstuhl im Keller hinab[zu]sinken« genötigt ist.36 Doch gottlob hat er in den ersten Hamburger Jahren andere Partner als seine anonymen Leser; und wenn er in etwas geschickt ist, dann in der Kunst, prominente Bekanntschaften, wenn nicht gar Freundschaften zu schließen.