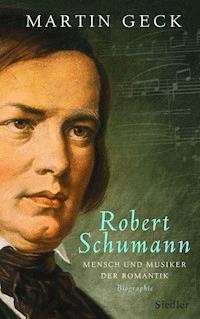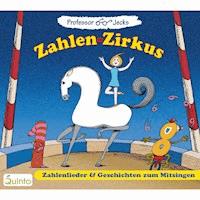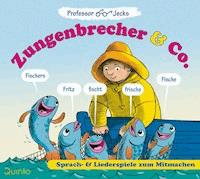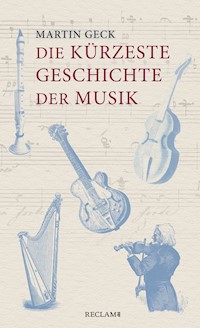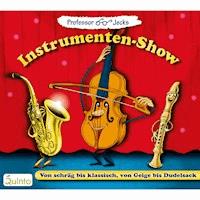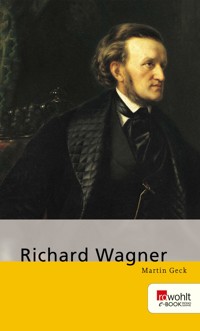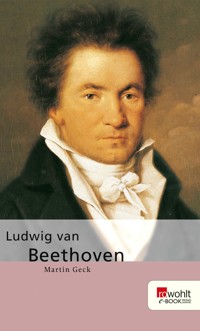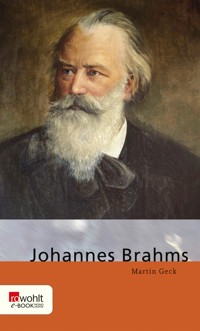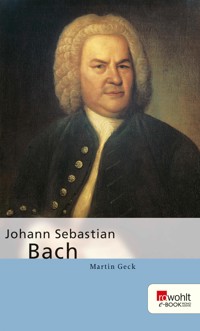
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Rowohlt E-Book Monographie Johann Sebastian Bach, der große schwierige Einzelgänger, bot lange genug Stoff für Mythen. Allmählich nimmt sein Bild deutliche Züge an: Bach bedient einerseits die gängigen Gattungen seiner Zeit wie Orgelchoral, Konzert, Kantate und Passion, andererseits ist er von einem autonomen Selbstwillen beseelt, dem alle Bereiche seines Komponierens unterworfen sind. In dieser kurzen Biographie erfährt der Leser alles Wichtige über Leben und Werk des großen Musikers. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Martin Geck
Johann Sebastian Bach
Über dieses Buch
Rowohlt E-Book Monographie
Johann Sebastian Bach, der große schwierige Einzelgänger, bot lange genug Stoff für Mythen. Allmählich nimmt sein Bild deutliche Züge an: Bach bedient einerseits die gängigen Gattungen seiner Zeit wie Orgelchoral, Konzert, Kantate und Passion, andererseits ist er von einem autonomen Selbstwillen beseelt, dem alle Bereiche seines Komponierens unterworfen sind.
In dieser kurzen Biographie erfährt der Leser alles Wichtige über Leben und Werk des großen Musikers.
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Vita
Martin Geck, 1936–2019. Studium der Musikwissenschaft, Theologie und Philosophie in Münster, Berlin und Kiel. 1962 Dr. phil., 1966 Gründungsredakteur der Richard-Wagner-Gesamtausgabe, 1970 Lektor in einem Schulbuchverlag, nachfolgend Autor zahlreicher Musiklehrwerke, 1974 Privatdozent, 1976 ordentlicher Professor für Musikwissenschaft an der Universität Dortmund. Seit 1996 Leiter der Internationalen Dortmunder Bach-Symposien.
2001 mit dem Gleim-Literaturpreis ausgezeichnet. Zahlreiche, in 15 Sprachen übersetzte Bücher zur deutschen Musik- und Kulturgeschichte des 17. bis 19. Jahrhunderts. Im Rowohlt Verlag sind von ihm erschienen: «Bach. Leben und Werk» (2000); «Von Beethoven bis Mahler. Leben und Werk der großen Komponisten des 19. Jahrhunderts» (2000); «Johann Sebastian Bach» (2000, rm 50637); «Ludwig van Beethoven» (2001, rm 50645); «Die Bach-Söhne» (2003, rm 50654); «Richard Wagner» (2004, rm 50661); «Mozart. Eine Biographie» (2005); «Wenn Papageno für Elise einen Feuervogel fängt» (2007); «Felix Mendelssohn Bartholdy» (2009, rm 50709); «Johannes Brahms» (2013, rm 50686). Ferner erschienen im Siedler Verlag: «Robert Schumann. Mensch und Musiker der Romantik» (2010); «Wagner. Biographie» (2012); «Matthias Claudius. Biographie eines Unzeitgemäßen» (2014); «Beethoven. Der Schöpfer und sein Universum» (2017); «Von den Wundern der klassischen Musik: 33 Variationen über ein Thema» (2017); im Olms Verlag: «Die Sinfonien Beethovens. Neun Wege zum Ideenkunstwerk» (2015); «B-A-C-H. Neue Essays zu Werk und Wirkung» (2016); im Metzler Verlag: «Beethoven-Bilder: Was Kunst- und Musikgeschichte (sich) zu erzählen haben» (2019, mit Werner Busch).
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2014
Copyright © 1993, 2000 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung Ivar Bläsi
Coverabbildung akg-images, Berlin
ISBN 978-3-644-51691-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Die Anfänge: Jugend und frühe Organistenjahre (1685–1708)
An der Person Johann Sebastian Bachs zeigt sich die ganze Nutzlosigkeit der Frage, ob «Musikalität» angeboren oder erworben sei. Der Stammbaum weist über Generationen hinweg Musiker, nichts als Musiker auf. Spricht das für die Existenz eines speziellen musikalischen Erbguts? Oder ist es die ganz von Musik geschwängerte Luft, die den kleinen Johann Sebastian von seinem ersten Atemzug an wissen läßt: In diesem Klima wirst du nur als Musiker überleben, gedeihen und gar berühmt werden?
Die Frage nach dem künstlerischen Genie Bachs läßt sich ohnehin weder auf die eine noch auf die andere Weise zureichend beantworten: Warum gibt es Menschen, die nicht nur eine bestimmte Möglichkeit menschlicher Erfahrung leidenschaftlicher und kompetenter als andere zu thematisieren vermögen, sondern dabei auch wie von selbst Nervenpunkte treffen, die über die Zeiten hinweg vielen Menschen gemeinsam sind?
Die Familie Bachs läßt sich von der männlichen Seite her lückenlos bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Als eine Art Stammvater gilt Veit (Vitus) Bach, der um 1545 vor den Protestantenverfolgungen aus Ungarn flüchten muß und als Bäcker in Wechmar bei Gotha eine neue Heimat findet. Begnügt Veit Bach sich damit, während des Kornmahlens das als Volksinstrument beliebte «Cithrinchen» zu zupfen, so wirkt sein Sohn Johannes, der trotz einer gründlichen musikalischen Ausbildung das väterliche Handwerk übernimmt, teilberuflich bereits als hier und da aushelfender «Spielmann». Für seine Söhne Johann, Christoph und Heinrich wird die Musik dann endgültig zum Hauptberuf: der älteste wird um 1635 Mitglied der Ratsmusik in Erfurt; die beiden jüngeren gehen einige Jahre später als Stadtmusiker und Organisten nach Arnstadt.
Von Johann und Heinrich Bach ist geistliche Vokal- und Orgelmusik erhalten, nicht so von Christoph Bach, dem drei Söhne geboren werden, darunter im Jahr 1645 das Zwillingspaar Johann Christoph und Johann Ambrosius. Ersterer lebt als Hof- und Stadtmusiker in Arnstadt, letzterer beginnt gleichfalls in Arnstadt, wird dann Ratsmusiker in Erfurt und später Hoftrompeter sowie Leiter des Stadtpfeifer-Kollegiums in Eisenach.
Noch in Erfurt hat Johann Ambrosius Bach Elisabeth Lämmerhirt, die Tochter eines in der Stadt angesehenen Kürschners, geheiratet. Sie schenkt ihm sechs Söhne und zwei Töchter. Johann Sebastian wird als jüngstes Kind am 21. März 1685 geboren und zwei Tage später in der Eisenacher Georgenkirche getauft; das Patenamt übernehmen der Musiker Sebastian Nagel aus Gotha und der Forstmann Johann Georg Koch aus Eisenach. Das Eisenacher Bachhaus am Frauenplan – heute vielbesuchte Bach-Gedenkstätte – kann inzwischen nicht mehr als Bachs Geburtshaus gelten; dieses stand möglicherweise auf dem Grundstück der heutigen Lutherstraße 35.
Das Schicksal der Geschwister Johann Sebastian Bachs läßt sich nur lückenhaft rekonstruieren. Der älteste überlebende Bruder Johann Christoph, später Organist, wird uns in Bachs Ohrdrufer Zeit wiederbegegnen, ebenso der Johann Sebastian im Alter am nächsten stehende Bruder Johann Jakob, Musiker in schwedischen Diensten. Marie Salome heiratete nach Erfurt. Johann Rudolf, Johann Balthasar, Johann Jonas und Johanna Juditha kamen über das Kindes- oder Jugendalter nicht hinaus.
Bedeutende Komponisten befinden sich in der hier nicht im einzelnen benannten weiteren Verwandtschaft. Johann Sebastian Bach hat ihre Werke zum Teil abgeschrieben und selbst aufgeführt, etwa solche der beiden Eisenacher Organisten Johann Christoph und Johann Bernhard, von Johann Nikolaus, Organist in Jena, und Johann Ludwig, Hofkapellmeister in Meiningen. Für Johann Sebastian Bachs Traditionsbewußtsein und Familiensinn spricht es, daß er im Jahr 1735 eine Chronik über den Ursprung der musicalisch-Bachischen Familie[1] mit Kurzbiographien zu 53 Familienmitgliedern anlegt, ohne die wir über die entsprechenden genealogischen Zusammenhänge weit spärlicher unterrichtet wären.
Man muß es als eine Fügung besonderer Art ansehen, daß Bach gerade in dem damals etwa 6000 Einwohner zählenden Eisenach geboren und bis zu seinem elften Lebensjahr aufgewachsen ist. Wie eine Puppenstube birgt die Stadt für den Jungen bis in Einzelheiten hinein all das, was dem Mann einmal über die Jahrzehnte hinweg zum Lebensinhalt werden wird: das als Stadtpfeiferei dienende, auch Gesellen und Lehrjungen beherbergende Elternhaus, die traditionsreiche Lateinschule im alten Dominikanerkloster, die Hauptkirche St. Georg mit Orgel und Figuralchor, das Rathaus mit den Turmbläsern, die «Currende» und schließlich die nahe Wartburg, Residenz des regierenden Herzogs von Sachsen-Eisenach, mit ihren höfischen Suiten, Konzerten, Sonaten und Kantaten.
So gesehen, ist Bach der «Urszene» Eisenach verhaftet geblieben, hat sie in seinem späteren Berufsleben lediglich produktiv ausgestaltet: Über den thüringisch-sächsischen Raum ist er nicht hinausgekommen, und seine Reisen haben ihn nicht weiter als nach Hamburg, Lübeck und Berlin im Norden, Karlsbad im Süden und Kassel im Westen geführt. Das ist ein ganz anderer Werdegang als der seines nur wenige Wochen zuvor im nicht weit entfernten Halle in eine wohlhabende, fast großbürgerliche Familie hineingeborenen Antipoden Georg Friedrich Händel: Ihn zieht es von Anfang an in die Ferne – nach Hamburg zum großen Experiment «deutsche Oper», nach Italien, wo er die moderne Musik an ihrer Quelle studiert und ausübt, und nach England, das ihn zum Nationalhelden macht und seinen sterblichen Resten einen Platz in Westminster Abbey gewährt.
Nein, Bach erinnert mehr an den jungen Martin Luther, der zwei Jahrhunderte zuvor genau die Lateinschule besucht hatte, deren Schüler Bach nunmehr – von 1693 bis 1695 – ist: Die Armut, die schon Luther zum Currendesingen vor den Häusern und an den Gräbern der Eisenacher Bürger zwang, wird auch ihm nicht fremd gewesen sein; und daß schon sein junges Leben aus Studium und Arbeit bestehen würde, dürfte ihm zumindest von dem Zeitpunkt an deutlich geworden sein, zu dem er Waise wird. Das ist in den Jahren 1694 und 1695, als innerhalb eines Dreivierteljahres Mutter und Vater sterben.
Johann Sebastian wird gemeinsam mit Johann Jakob in die Obhut des ältesten Bruders Johann Christoph gegeben, der 1690 Organist an der Michaeliskirche in dem auf halbem Weg zwischen Eisenach und Arnstadt gelegenen Ohrdruf geworden ist. Was mag der Zehnjährige von Eisenach mitgenommen haben? Die von früh bis spät an sein Ohr dringenden Klänge von Trompete oder Violine, Spinett oder Orgel mögen ihn in die unendliche Welt der Töne eingeführt, die Inhalte der gymnasialen Kernfächer Latein, Religion und Chorgesang ihm eine Vorstellung vom späteren Beruf des Kantors vermittelt und die von Zunftgesetzen und Standesregeln bestimmten kirchlichen, städtischen und höfischen Dienste seines Vaters eine Ahnung davon gegeben haben, mit wieviel Subordination und Alltagsfron dieser Beruf verbunden sein wird.
Vielleicht hat Bach darüber hinaus eine beiläufige Unterweisung im Violinspiel bei seinem Vater und erste Einblicke in die Kunst des Tonsatzes bei dessen am Ort wohnenden Vetter Johann Christoph erhalten, der ein nicht unbedeutender Komponist ist. Ein systematischer Unterricht scheint jedoch erst in Ohrdruf begonnen zu haben. Ohrdruf ist kleiner als Eisenach, bietet Johann Sebastian jedoch genügend Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Es gibt ein sechsklassiges, angesehenes Lyceum, aus dessen Prima man in die Universität entlassen werden kann, sofern man nicht vorzeitig das Lateinische und Griechische abwählt. Es gibt die Hauptkirche St. Michaelis mit einem «chorus musicus», der zu den Sonn- und Festtagen mit Motetten- und konzertanter Kirchenmusik aufwartet. Und es gibt den vierzehn Jahre älteren Bruder, den Michaelis-Organisten Johann Christoph, der gerade einen eigenen Hausstand gegründet hat.
Die äußeren Bedingungen sind für die Waise freilich wenig komfortabel: Das Einkommen des Bruders ist schmal, die Wohnung eng. Der junge Bach kann froh sein, am Lyceum eine Freistelle als Currendesänger zu bekommen, die ihm freilich schon in jungen Jahren nach dem Schulbesuch sommers wie winters vielerlei anstrengende Verpflichtungen auferlegt. Dem drei Jahre älteren Bruder Johann Jakob wäre gewiß dasselbe Leben zuteil geworden, wenn er nicht schon vor Ablauf des Jahres 1695 das Haus seines Bruders Johann Christoph wieder verlassen hätte, um in seiner Geburtsstadt eine Stadtpfeiferlehre beim Amtsnachfolger des Vaters zu beginnen. Einige Jahre später treibt es ihn als Militärmusiker in schwedischen Diensten über die Schlachtfelder Europas bis in die Türkei; in Stockholm findet er dann als Mitglied der Hofkapelle seine Lebensstellung.
Johann Sebastian ist noch zu jung, um dergestalt an äußere Selbständigkeit, ja Ungebundenheit denken zu können. Doch davon abgesehen, scheint er auch ein anderer Mensch gewesen zu sein: einer, der sich durchkämpft, der den sozialen und geistigen Raum, in den er gestellt worden ist, vollkommen ausmißt, um danach über ihn zu verfügen und als Künstler ihn zu sprengen, ohne ihn doch zu verlassen. So lernt er fleißig im Lyceum, ist zunächst Klassenerster und später immer unter den Besten.
Wichtiger wird ihm freilich sein Musikstudium gewesen sein, das er mit größtem Eifer bei seinem Bruder aufnimmt. Dieser vermittelt Johann Sebastian, wie es im Artikel «Bach» in Johann Gottfried Walthers «Musicalischem Lexicon» von 1732 heißt, «die ersten Principia auf dem Clavier», worunter nach damaligem Sprachgebrauch auch die Orgel zu verstehen ist. Wie sieht ein solcher Unterricht für jemanden aus, der über die allerersten Anfangsgründe hinweg ist? Bach lernt sicherlich nach Exempla, das heißt nach Stücken, die der Bruder in seinen handschriftlichen Notenbüchern niederschreibt, um selbst danach zu spielen. Gedruckte Noten waren damals eine Seltenheit; ein kundiger Organist stellt sich sein Repertoire selbst zusammen. Und der vierzehn Jahre ältere Bruder ist ein solch kundiger Organist: Sein Vater hat ihn nicht von ungefähr für drei lange Jahre zu dem berühmten Johann Pachelbel nach Erfurt in die Lehre geschickt.
So hat Johann Sebastian mit zunehmenden Fähigkeiten vermutlich manches von Pachelbel auswendig gelernt, kopiert und vielleicht in ein eigenes Musikbuch übertragen: Präludien, Fugen, fugierte Choralvorspiele, Klaviersuiten. Doch sein Interesse ist wohl schon damals über diesen engen Horizont hinausgegangen. Eine zeitgenössische Abschrift von Dietrich Buxtehudes «Präludium und Fuge g-moll» (Buxtehude-WV 148) zeigt neben der Handschrift Johann Christoph Bachs diejenige eines weiteren, augenscheinlich jugendlichen Schreibers.[2] Es wäre reizvoll, sich vorzustellen, daß Johann Sebastian seinem Bruder beim Kopieren geholfen und auf diese Weise Einblicke in die norddeutsche Orgelmusik genommen hätte.
Ist er bei der Aneignung neuer Werke vielleicht so besitzergreifend vorgegangen, daß der Bruder gelegentlich bremsen und auf seine eigenen Besitzrechte pochen zu müssen meinte? Ganz muß jene rührende Geschichte aus dem Nekrolog von 1754 ja nicht aus der Luft gegriffen sein[3], der zufolge der jüngere Bruder ein Notenheft mit Stücken der Klaviermeister Johann Jakob Froberger, Johann Kaspar Kerll und Johann Pachelbel, das ihm der Ältere noch nicht anvertrauen will, mit seinen kleinen Händen aus einem Gitterschrank entwendet und bei Mondlicht zum Schaden seiner Augen abschreibt! Wenngleich hier eine in Wirklichkeit vielleicht harmlosere Begebenheit zur Andekdote hochstilisiert worden sein dürfte, so wirft sie doch Licht auf einen wichtigen Charakterzug Bachs: seine auch später immer wieder anzutreffende Leidenschaft, ja Besessenheit, mit der er das Reich der Musik erobern und sich ganz zu eigen machen will. Die einen wollen ein Handwerk erlernen, die anderen berühmt werden – Bach dagegen will es wissen.
Die brüderliche Wohnung wird mit dem sich einstellenden Kindersegen immer enger; die Freiplätze am Ohrdrufer Lyceum bleiben rar. So trifft es sich gut, daß Bach, der eben fünfzehn Jahre alt geworden ist, jedoch nach begründeter Annahme der älteren Forschung noch immer seine Knabenstimme besitzt, von dem neuen Kantor des Lyceums an das Michaeliskloster in Lüneburg empfohlen wird, wo man nicht nur «Mettensänger» braucht, sondern auch Freistellen zur Verfügung hat. Vermutlich mit seinem Klassenkameraden Georg Erdmann macht sich Bach – nach Wanderburschenart wohl zu Fuß – auf den Weg nach Lüneburg, wo die beiden noch vor dem Osterfest des Jahres 1700 eintreffen.
Das Michaeliskloster ist schon lange kein Kloster im eigentlichen Sinne mehr, sondern eine reiche Stiftung, zu der die Kirche, die «Ritterakademie», das heißt ein Alumnat für adelige Jugend, die bürgerliche Lateinschule und das universitätsähnliche Collegium academicum gehören. Der Satzung nach gibt es Stipendien für etwa zwölf Knaben und einige ältere Sänger, die im «Mettenchor» bei Metten und Vespern singen – «de armen Sanckscholere» haben sie einstmals geheißen. Natürlich hat Bach nicht nur in den Nebengottesdiensten mitgewirkt, sondern auch im «Chorus symphoniacus» mitgesungen, der die Hauptgottesdienste an Sonn- und Feiertagen ausgestaltete. Da er indessen bald in den Stimmwechsel kommt, muß sich seine Tätigkeit, falls er nicht sehr bald mit einer Männerstimme hat aufwarten können, auf andere Dienste erstreckt haben – vielleicht auf die eines Aushilfsorganisten.
Die Studienmöglichkeiten, die sich Bach in Lüneburg bieten, sind günstig. Die Musikbibliothek des Michaelisklosters ist – namentlich im Blick auf die damals in der Musikpraxis vorrangige handschriftliche Überlieferung – eine der größten in Deutschland überhaupt. Bach kann hier die gesamte Tradition der evangelischen Kirchenmusik des 16. und 17. Jahrhunderts nachvollziehen; falls er für ein solches theoretisches Studium zu jung gewesen sein sollte, erhält er durch seine Mitwirkung an den sonn- und festtäglichen Aufführungen von Motetten, geistlichen Konzerten und Kantaten in der Michaeliskirche zumindest einen praktischen Einblick in die kirchenmusikalische Kultur Norddeutschlands.
Letzteres gilt auch für die Orgelmusik. In Lüneburg wirken damals zwei bedeutende Organisten: Georg Böhm und Johann Jakob Löwe. Zwar läßt sich nicht belegen, daß Bach sich um Orgelunterricht bei einem von beiden bemüht hat; doch ist dies keineswegs von der Hand zu weisen, wo doch der schon erwähnte Nekrolog von weit aufwendigeren Initiativen des Mettensängers Bach berichtet:
«Von Lüneburg aus reisete er zuweilen nach Hamburg, um den damals berühmten Organisten an der Catharinenkirche Johann Adam Reinken zu hören. Auch hatte er von hier aus Gelegenheit, sich durch öftere Anhörung einer damals berühmten Capelle, welche der Hertzog von Zelle unterhielt, und die mehrentheils aus Frantzosen bestand, im Frantzösischen Geschmacke … fest zu setzen.»[4]
Um «französischen Geschmack» zu studieren, muß Bach übrigens nicht unbedingt das benachbarte Celle aufsuchen, da die dortige Hofkapelle gelegentlich auch in Lüneburg musiziert und eines ihrer Mitglieder sogar mit ihm unter einem Dach wohnt: Thomas de la Selle, Geiger und Tanzmeister der Ritterakademie, die entsprechend ihrer Klientel weniger Wert auf die Vermittlung humanistischer Bildung als auf die Unterweisung in der französischen Konversation, auf die Kunst des Tanzens und der «Verfertigung netter Briefe»[5] legt.
Sollte Bach anläßlich seiner Reisen nach Hamburg den Besuch der 1678 gegründeten deutschen Oper auch versäumt haben, so hätte er in seinen Lüneburger Jahren Gelegenheit gehabt, das Musikleben seiner Zeit in großer Vielfalt zu studieren – abgesehen von der italienischen Musik: In diesem großen Bereich neuer Musik kommt Bachs prägendes Erlebnis erst später, in der Weimarer Zeit. Wir wissen nicht, welchen der sich ihm bietenden Anregungen Bach tatsächlich gefolgt ist. Sicher ist nur, daß er sich – wie auch immer – zu einem hervorragenden Organisten und Orgelexperten herangebildet hat; denn wie sonst hätte er wenige Jahre später seinen Orgeldienst in Arnstadt mit solcher Bravour versehen können?
Über seine Schulbildung können wir jedoch Genaueres sagen: Als Bach in Lüneburg in die Prima aufgenommen wird, stehen dort u.a. die folgenden Fächer auf dem Lehrplan: Latein mit der Vermittlung von Grammatik sowie der Lektüre von Ciceros Catilinarischen Reden und Vergils «Aeneis», Griechisch mit der Übersetzung des Neuen Testaments, Theologie nach Leonhard Hutters streng orthodoxem «Compendium locorum theologicorum», Logik nach Andreas Reyhers «Systema Logicum», Rhetorik nach einem Kompendium Heinrich Tolles, zudem Einführungen in die Philosophie und die Kunst des Versedichtens.[6]
Man kann zwar nur darüber spekulieren, inwieweit Bach sich in einzelnen Fächern engagiert und den Lehrstoff über bloßes Pauken hinaus zu eigen gemacht hat. Es duldet aber keinen Zweifel, daß auf den Lateinschulen von Ohrdruf und Lüneburg der Grund für eine humanistische und theologische Weltsicht gelegt worden ist, die vor allem den späteren Bach trotz fehlenden Universitätsstudiums zu einem im Sinne der Tradition gebildeten und überkommenen Werten verpflichteten «gelehrten» Komponisten («musicus doctus») hat werden lassen. Mit der entsprechenden Haltung kann er unter den – nicht unbedingt weniger, aber zum Teil anders gebildeten – Altersgenossen seinesgleichen suchen, und dem Zeitgeist stand er darin in späteren Jahren geradezu entgegen.
Zu Ostern des Jahres 1702 dürfte der siebzehnjährige Bach die Michaelisschule mit der Bestätigung der Universitätsreife in der Tasche verlassen haben. In der zweiten Hälfte des Jahres bewirbt er sich vergeblich um eine Organistenstelle an St. Jakobi in Sangerhausen, von März bis September 1703 wird er als «Laquey» – mit aller Wahrscheinlichkeit in der Stellung eines Geigers – in den Gehaltslisten des mitregierenden Herzogs Johann Ernst von Sachsen-Weimar geführt.
In dieser Zeit prüft Bach – vermutlich zum ersten, aber keineswegs zum letzten Mal in seinem Leben – eine neue Orgel: Er begutachtet für vier Taler das zweimanualige und dreiundzwanzigstimmige Orgelwerk der Neuen Kirche zu Arnstadt – ein recht ungewöhnlicher Vorgang! Zwar hat der Name Bach in der damals etwa 3800 Einwohner zählenden Stadt am Rande des Thüringer Waldes auf Grund des Wirkens zahlreicher anderer Familienvertreter einen guten Klang. Auch darf man annehmen, daß zum Zeitpunkt der «Orgelprobe» bereits feststeht, daß Johann Sebastian eine Orgel abnimmt, an der er vom darauffolgenden Monat an selbst seinen Platz haben wird. Dennoch ist Johann Sebastian mit achtzehn Jahren für eine solche Aufgabe außerordentlich jung. Ob somit Umstände oder Zufälle eine Rolle gespielt haben, von denen heute nichts mehr bekannt ist, sei dahingestellt. Jedenfalls beginnt Bach schon sehr früh eine Karriere, die ihn nach Aussage des Nekrologs zum «stärksten Orgel- und Clavierspieler, den man jemals gehabt hat»[7], und nach Meinung vieler Zeitgenossen zum größten Orgelkenner Europas machen soll.
Bachs erste Stellung ist bescheiden, denn die Neue Kirche steht in der Arnstädter Kirchenhierarchie an dritter und letzter Stelle und muß, was die Aufführung von Vokalwerken angeht, von den Brosamen leben, die vom Tisch der Hauptkirchen-Musik fallen. Indessen hat Bach, so scheint es, zum ersten Mal in seinem Leben freie Zeit. Als Organist muß er allein zum Hauptgottesdienst an Sonn- und Festtagen, zur Betstunde am Montag, zur Vesper am Mittwoch und zum Frühgottesdienst am Donnerstag erscheinen und – mit den jeweiligen Modifikationen – für ein Präludium und Postludium, Choralvorspiel und -begleitung sowie freies oder choralgebundenes Spiel unter der Kommunion sorgen. Ob er außerdem in Vertretung des Kantors mit den wenigen ihm zur Verfügung stehenden Schülern vokale Darbietungen kleineren Ausmaßes zu veranstalten hat, wird zum Streitpunkt gegenüber dem Konsistorium, seiner vorgesetzten Kirchenbehörde.
Die Erfahrung, aus dem streng geregelten und vermutlich restlos ausgefüllten Schulleben in die Freiheit entlassen worden zu sein, nutzt Bach einerseits zu intensivem Selbststudium; anders ist die rasche Entwicklung, die er als Komponist durchmacht, nicht zu erklären. Nicht von ungefähr schreibt Carl Philipp Emanuel über seinen Vater, «blos eigenes Nachsinnen» habe ihn schon in seiner Jugend «zum reinen und starcken Fugisten»[8] gemacht. Andererseits ist er offenbar alles andere als ein über seinen Noten grübelnder Stubenhocker; vielmehr mißt er durchaus seine sozialen und künstlerischen Spielräume aus. Auf der Straße zeigt er sich – vielleicht in Erinnerung an die Lüneburger Ritterakademie – mit dem Degen und greift auch eines Abends zu ihm, um sich den Schüler Geyersbach vom Leibe zu halten. Diesen hat er zuvor als Zippelfagottisten kritisiert und damit ein spezielles Ventil für seinen offenbar generellen Unmut darüber gefunden, daß die ihm zur Aufführung von Vokalmusik zugewiesenen Schüler für diese Aufgabe wenig qualifiziert sind. Da läßt er lieber, für damalige Zeiten ungewöhnlich, eine «frembde Jungfer» als Sängerin zu sich auf die Orgelempore.
Wegen solcher Affären wird Bach mehrfach vor das Konsistorium zitiert, welches ihm außerdem zum Vorwurf macht, ungenehmigten Urlaub genommen und die Gemeinde durch sein Orgelspiel irritiert zu haben. Hier das Konsistorialprotokoll[9] (mit Übersetzung einiger lateinischer Wörter und Auflösung von Kürzeln):
«Actum den 21. Februar 1706
Wird der Organist in der Neuen Kirchen Bach vernommen, wo er unlängst so lange geweßen, und bey wem er deßen verlaub genommen?
Jener: Er sey zu Lübeck geweßen umb daselbst ein und anderes in seiner Kunst zu begreiffen, habe aber zu vorher von dem Herrn Superintendenten verlaubnüß gebethen.
Superintendent: Er habe nur auf 4. Wochen solche gebethen, sey aber wohl 4. mahl so lange außenblieben.
Jener: Hoffe das orgelschlagen würde unterdeßen von deme, welchen er hiezu bestellet, dergestalt seyn versehen worden, daß deßwegen keine Klage geführet werden können.
Wir: Halthen Ihm vor daß er bißher in dem Choral viele wunderliche variationes gemachet, viele frembde Thone mit eingemischet, daß die Gemeinde drüber confundiret [verwirrt] worden. Er habe ins künfftige wann er ja einen tonum peregrinum mit einbringen [vermutlich: in eine entlegene Tonart ausweichen] wolte, selbigen auch außzuhalthen, und nicht zu geschwinde auf etwas anders zu fallen, oder wie er bißher im brauch gehabt, gar einen Tonum contrarium [vermutlich: einen dissonanten Begleitakkord] zu spiehlen. Nechst deme sey gar befrembdlich, daß bißher gar nichts musiciret worden, deßen Ursach er geweßen …
Schüler Rambach: Der Organist Bach habe bißhero etwas gar zu lang gespiehlet, nachdem ihm aber vom Herrn Superintendenten deswegen anzeige beschehen, währe er gleich auf das andere extremum gefallen, und hätte es zu kurtz gemachet.»
Das ist gleich eine ganze Liste von Vorhaltungen. Immer noch nicht hat Bach mit den Schülern vocaliter musiziert; dafür hat er sich statt auf vier Wochen gleich für vier Monate in Lübeck aufgehalten, um «den dasigen berühmten Organisten an der Marienkirche Diedrich Buxtehuden, zu behorchen», wie es im Nekrolog[10] heißt. Nachdem man ihn generell wegen zu langer Orgelvorträge gerügt hat, macht er es nunmehr aus Trotz besonders kurz. Und damit nicht genug: Mit nicht ganz eindeutigen, aber durchaus sachkundigen Formulierungen weiß das Konsistorium darzutun, daß Bach den Gemeindechoral alles andere als moderat, vielmehr übertrieben kunstvoll begleite. Vernimmt man – beispielsweise – Bachs Harmonisierung des Kirchenliedes «Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’» in dem mit großer Wahrscheinlichkeit aus dieser Zeit stammenden Orgelchoral BWV 726, so kann man dem Konsistorium kaum unrecht geben: Da spielt Bach – wie ein verfrüht erschienener Max Reger – mit den chromatischen Möglichkeiten eines vierstimmigen Satzes auf eine Art, die vom Cantus firmus mehr ablenkt, als daß sie ihn verdeutlicht.
Der Feuerkopf Bach versteht den alten, von seinem neuen Lehrmeister Buxtehude einem seiner gelehrten Kanons vorangestellten Sinnspruch «Non hominibus, sed deo» («Nicht den Menschen, sondern Gott») auf seine Weise: Er betreibt seine Profession nicht, um einer trägen Gemeinde oder einer Konventionen verhafteten Obrigkeit zu Diensten zu sein, sondern um das Höchstmögliche aus seiner Kunst zu machen. Da läßt er sich auch als kaum Zwanzigjähriger nicht hineinreden und nimmt lieber das Risiko einer Kündigung auf sich, als daß er von seiner beschwerlichen Fußreise nach Lübeck zurückkehrt, ehe er die berühmten Abendmusiken mitbekommen hat, die eben leider erst im Advent jeden Jahres stattfinden.
Man kennt die beruflichen Kämpfe der Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Wagner, Mahler. Sind Philosophen wie Leibniz, Kant, Hegel, Schopenhauer ähnlich oft angeeckt, oder sind Musiker-Genies besonders selbstbewußt, rechthaberisch oder verletzlich? Zwar ist die Musik die flüchtigste aller Künste; doch der Musiker ist wie kein anderer ein Herrscher: über Töne, Klangmassen, Chöre und Orchester. Für Elias Canetti gibt es «keinen anschaulicheren Ausdruck von Macht als die Tätigkeit des Dirigenten» (Elias Canetti: Masse und Macht, Bd. 2).
Bach nutzt die Bewegungsfreiheit, die er hat oder sich nehmen zu können meint, weidlich aus. Nachdem er in Ohrdruf vor allem die mittel- und süddeutschen Orgelmeister studiert hat, zieht es ihn nunmehr – ungeachtet dessen, was er in Lüneburg und Hamburg gehört und gelernt haben mag – zu dem berühmtesten Meister des norddeutschen Orgelstils. Und im Zeitraum eines guten Vierteljahrs wird er nicht nur mitbekommen haben, was ihm der für damalige Verhältnisse mit fast siebzig Jahren greise Meister auf der Orgel anzubieten hat, sondern auch, wie sein Vokalschaffen geartet ist – von der empfindsam, frühpietistisch angehauchten Solokantate bis zur großbesetzten, prunkvollen Abendmusik «von allen Chören und Orgeln».
Die Studienreise nach Lübeck dient freilich keineswegs nur dem Komponisten Buxtehude, sondern ebenso dem Virtuosen. Gerade dessen Orgelmusik steht und fällt ja mit dem Grad der souveränen Nutzung spezifischer Klangmöglichkeiten der norddeutschen Orgel in puncto Volumen, Vielfalt an Soloregistern, Kontrastreichtum der einzelnen Manuale und mächtigem Pedalwerk. Hier zeichnet sich ein Moment in Bachs Lebensgang ab, das seine Zeitgenossen und Söhne vielleicht über-, spätere Biographen jedoch eher unterschätzt haben: Bach hat am Anfang seiner Karriere offenbar mehr die Laufbahn eines – nach dem Brauch der Zeit seine Stücke selbst schreibenden – Klavier- und Orgelvirtuosen angestrebt als die eines gelehrten Komponisten. Von der Weimarer Konzertmeisterzeit an überschneiden sich dann beide Momente, doch noch in Köthen versteht sich Bach durchaus als Klaviermeister. Erst in Leipzig siegt allmählich der gelehrte Komponist. Die Mutwilligkeiten, die Bachs Orgelspiel ausgezeichnet haben, sind somit mehr als jugendliches Ungestüm: Sie dienen der Grundlegung einer Virtuosenlaufbahn.
Von einem so beweglichen Menschen, wie es Bach damals ist, wird man nicht erwarten, daß er es allzulange an ein und demselben Platz aushält. In der Tat kann man den Zweiundzwanzigjährigen zu Ostern 1707 beim Probespiel in der Kirche Divi Blasii zu Mühlhausen in Thüringen vernehmen. Am 14. Juni trägt er den verantwortlichen Kirchenvertretern seine Forderungen vor: das gleiche Gehalt wie in Arnstadt nebst den Naturalien, die sein ohnehin geringer besoldeter Vorgänger erhalten hat. Nach tags darauf erfolgter Bestallung heiratet er am 17. Oktober in Dornheim bei Arnstadt seine ein halbes Jahr ältere Base Maria Barbara Bach, jüngste Tochter des verstorbenen Johann Michael Bach, zuletzt Organist und Stadtschreiber in Gehren bei Arnstadt und von Bach in seiner Genealogie als ein habiler Componist bezeichnet. Vielleicht ist die «frembde Jungfer», die Bach im Jahr zuvor auf die Orgelempore genommen hatte, mit ihr identisch.
Bachs Übersiedelung in das nordwestlich von Arnstadt gelegene Mühlhausen als Nachfolger des vor allem als Liederkomponist namhaften Johann Georg Ahle muß als ein Aufstieg betrachtet werden. Seine Geltung in der traditionsreichen Stadt, deren Bedeutung freilich von Generation zu Generation gesunken ist, belegt ein rasch erteilter offizieller Auftrag: Für den Ratswechsel im Februar 1708 komponiert er die Kantate BWV