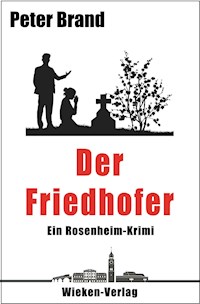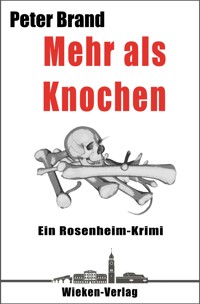
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wieken-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Auch ein Detektiv braucht Urlaub. Michael Warthens und seine Lebensgefährtin Conny Linden unternehmen eine Bahnreise nach Portugal. Vor der Tür der Zugtoilette hört Conny, wie ein Mann über einen ominösen Fund im Keferwald bei Rosenheim spricht. Dieser Fund könnte dem Mann und seinem Gesprächspartner Ärger bereiten. Conny und Michael sind alarmiert. Derweil grübelt Kommissar Kreutz in Rosenheim über Knochen, die ein Junge im Wald gefunden hat. Kurz darauf wird in der Nähe der ersten Fundstelle im Waldboden ein verborgener Behälter mit brisantem Inhalt aufgespürt. Das veranlasst die Polizei zur Fahndung nach dem Mann im Zug. Doch Michael kommt den internationalen Beamten zuvor. Viele Spuren in diesem Fall führen in die DDR zur Wendezeit. Warum wurden damals eine Leiche und ein Giftfass im Wald bei Rosenheim vergraben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr als Knochen
—
Ein Rosenheim-Krimi
Peter Brand
Wieken-Verlag
Die Deutsche Nationale Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie;Detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.Bilder (c): Cover: FUGE Freiburg; Wolfgang Eckert — pixabay.com; Trennbild: Foo na (Kolben) pixabay, Elisa Riva (Knochen), pixabayTitelgestaltung: Martina Sevecke-PohlenWieken-Verlag Martina Sevecke-PohlenFenderstr. 1, 26817 Rhauderfehninfo@ wieken-service.comAll Rights reserved.ISBN E-Book EPUB 978-3-943621-89-1ISBN Taschenbuch Buchhandel 978-3-943621-92-1ISBN gebundene Ausgabe 978-3-943621-93-8(c) 2023
Inhalt
Titelseite
Impressum
Inhalt
Dies ist eine fiktive Geschichte
Motto
1990 — Frühsommer
Heute. Mittwoch, 13. April, vor der Reise.
1989 — November
Jetzt. Mittwoch, 13. April.
1990 — Januar
Samstag, 23. April, im Zug — ab Lyon-Part-Dieu (Teil 1)
Vier Tage zuvor, Rosenheim, Dienstag, 19. April
23. April, im Zug — im Zug ab Lyon-Part-Dieu (Teil 2)
Keferwald, Dienstag, 19. April
23. April, im Zug entlang der Rhone
19. April, draußen im Wald
23. April, im Zug—Bistro
Mittwoch, 20. April in Rosenheim
23. April, im Zug—gen Süden
Drei Tage zuvor, Polizeifrust am Mittwoch
23. April, im Zug—ein Anruf
Zwei Tage zuvor, Donnerstag, 21. April in Rosenheim
23. April, im Zug Richtung Barcelona
Samstag, dahoam in Rosenheim
23. April, im Zug—kurz vor Barcelona
Samstags im Modehaus
Sonntag, 24. April, im Zug—Madrid
Zurück im Kriminalbüro
9. Mai, im Wald
Portugal, dritte Woche. 13. Mai.
Zwei Tage zuvor, Mittwoch, 11. Mai in Rosenheim
Freitag, 13. Mai. Alcochete, PT.
Freitag, 13. Mai. Der Name.
Montag, 16. Mai. Wieder dahoam.
Montag, 16. Mai. Das Fazit des KTI.
Montag, 16. Mai. Ludwigsplatz 40, Rosenheim
Zwischenbilanz am Montagabend
Nachgedacht, am Dienstagvormittag, 17. Mai
Im Modehaus am Dienstag
Dienstag, Berti telefoniert
Richard Wetzer
Dienstagnachmittag. Im Auto mit Berti
Dienstagnachmittag, nach Berti
Ein langer Mittwochabend.
Donnerstag auf dem Revier.
Büro Warthens
Wald von oben
Anruf aus dem Osten
Schuldgeständnis, Donnerstagnachmittag
Telefonitis am späten Donnerstagnachmittag
Donnerstagnachmittag, bei der Polizei
Was am Freitag zu tun ist
Freitag, später Vormittag
Ein Abend in der Klinik
Samstagsdienst
Samstag, vor 10.00 Uhr
Viele Fragen, wenig Antworten
Im schattigen Innenhof
Ein Käfer, und eine Apotheke
Schluss mit lustig in der Inspektion
Es wurde Wald
Rico und die anderen zwei, in Verhörraum eins, zwei, drei
Was bleibt
Ein Zuhause
Waldleben
Epilog — Notizen
Rezepte
Über Peter Brand
Bücher und E-Books von Peter Brand im Wieken-Verlag
Dies ist eine fiktive Geschichte. Handlung und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten zu lebenden oder verstorbenen Personen oder zu realen Ereignissen sind zufällig.
Der eine Teufel hat ihn verlassen, aber es sind dafür sieben andere in ihn gefahren.(Gotthold Ephraim Lessing)
1990 — Frühsommer
Das Loch im Waldboden verströmt den Geruch nach abgestorbenen Pilzen und verrottendem Holz. Butterweich lässt sich der Spaten einstechen. Nur ein paar dünne Fadenwurzeln reißen dabei durch. Schaben und kleine Käfer krabbeln aufgeregt umher.
Die beiden Männer wechseln sich mit dem Graben ab. Das Loch muss breiter, länger und tiefer werden, damit alles darin Platz hat, versenkt für immer. Oder wenigstens für die nächsten Jahrzehnte, von denen niemand wissen kann, was sie bringen werden. Vor einem halben Jahr fiel die Mauer. Es wird sich einiges ändern im Land.
Es mag Leute geben, die ihren alltäglichen Hausmüll in den Wald werfen, offen liegen lassen und denken, dass sie nicht entdeckt werden. Geht meistens schief. Es ist zwar riskant, so lange zu graben, ohne aufzufallen. Doch nichts darf oben bleiben. Ist ja kein Hausmüll. Die Stelle hier etwas abseits der hohen Fichten wird von dichtem Gestrüpp und schwächelndem Nadelholz gesäumt. Wie entsorgte Weihnachtsbäume vom Vorjahr sehen die dürren Kümmerer aus. Der Ort ist bestens getarnt. Die Männer bauen darauf, dass das so bleibt.
Heute. Mittwoch, 13. April, vor der Reise.
„Das ist ja kompliziert!“ Michael Warthens fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. „Könnten wir nicht ganz normal fliegen?“
Conny Linden blieb eisern: „Nix da. Wir haben’s ausgemacht, also ziehen wir’s durch.“
Mit seiner Jugendliebe Conny hatte Michael zu Beginn seiner Karriere als Privatdetektiv aufs Neue zusammengefunden. Seitdem verband sie die, wie Michael es immer empfunden hatte, tollste Freundschaft der Welt. Mit der Zeit hatte er sich mit dem Gedanken angefreundet, die weiteren Jahre seines Lebens mit Conny zu verbringen. Die Gelegenheit, es ihr zu sagen, hatte er mangels passender Momente dennoch immer wieder verschoben. Bis Conny nach seinem letzten Fall ihn sanft, aber bestimmt darauf aufmerksam gemacht hatte, dass zwischen ihnen mehr war als freundschaftliche Zuneigung. Damit war sie ihm zuvorgekommen. Jetzt stand ihr erster gemeinsamer Urlaub an, eine Bahnreise nach Portugal.
„Da sind wir ja tagelang unterwegs!“, schimpfte Michael. Ein wenig hoffte er, Conny würde es sich doch anders überlegen.
„Mike, du selbst hast gefragt, wie wir den Urlaub ökologisch gestalten könnten.“ Conny legte ihm die Hand auf die Schulter und starrte mit großen Augen auf die Fahrpläne am Monitor seines Büro-Rechners. „Klar, ich seh’ schon, das geht über Karlsruhe, Bern und Lyon, und erst ab da im Schlaf- oder Liegewagen bis Lissabon. Dort müssen wir dann schauen, wie wir zum Hotel kommen.“
„Ferienhaus, Conny, kein Hotel.“
„Schon gut, es dauert demnach knapp drei Tage, bis wir am Atlantik sind. Da sag’ ich nur: Der Weg ist das Ziel.“
Michael gab sich geschlagen: „Auch wieder wahr. Sind aber viele Ziele“, merkte er mit Blick auf die Umsteige-Tabelle an. Insgesamt elfmal war ein Zugwechsel vorgesehen. Mindestens. Egal, irgendwie mussten sie nach Portugal kommen. Das Ferienhaus in Zambujeira do Mar hatten sie am Tag zuvor verbindlich gebucht.
1989 — November
Der Mann sieht fern. Westfernsehen ist mit einem Mal gefahrlos zu schauen. Oder träumt er das nur? Er kann rüber. Einfach so. Niemand würde ihn aufhalten. Wer weiß schon, was passiert, bis er hier alles geregelt bekommt. Bleibt die Zeit dafür? Was, wenn doch wieder dicht gemacht wird? Nein, lange darf er nicht mehr warten. Der Staat kümmerte sich bis jetzt um jeden Scheiß. Von heute auf morgen wird sich da nichts ändern. Also wird auch er sich keinerlei Vorwürfe einhandeln und muss sich keine Sorgen machen. Die Stimmung im Land ist euphorisch, der Zeitpunkt ideal.
Ja, vielleicht würde er sein bisheriges Leben vermissen. Aber das geht vorbei. Einen klaren Schnitt muss er wagen, alles zurücklassen.
Sein Nacken schmerzt noch immer nach der OP. Man wird ihm dort helfen, wo er hingeht. Er weiß genau, in welche Richtung.
Jetzt. Mittwoch, 13. April.
Die Bahn-Tickets und Reservierungen für Conny und Michael waren in dieser Sekunde per Kreditkarte bezahlt. Der Drucker spuckte soeben das letzte Blatt aus. Die mehr als drei Seiten Infos über den Reiseverlauf brachten Michael dazu, zum Telefon zu greifen.
„Ich ruf’ lieber gleich Tante Berti an“, ließ er Conny wissen. Er wählte die Nummer seiner letzten leiblichen Verwandten. „Ich sollte ihr Bescheid sagen, wann genau wir fahren … ach, grüß dich, Tanterl.“ Er wusste natürlich, dass die ehemalige Sennerin in ihrer Wohnung, einem Apartment mit betreutem Wohnen, auf seinen Anruf gewartet hatte. Tanterl hörte sie nicht gern, aber Michael konnte es nicht lassen, die 84-jährige Berti zu tratzen. „Ja, am Freitag, am 22. April geht’s los.“
„Und ihr bleibt’s wirklich drei Wocha?“
„Ja, das ist nach den Osterferien, und wie ich ghört hab, soll’s da am schönsten sein in Portugal.“
„Und? Wie kommt’s da hin? Net fliegn, oder? Oder gar mit ’m Schiff? Weil, Luft und Wasser haben keine Balken, dös woaßt fei scho!“
Michael grinste Conny an und legte die Hand übers Smartphone.
„Sie hat Angst, dass wir fliegen.“ Als wüsste Berti nicht, dass er erst zwei Jahre zuvor das Drachenfliegen aufgegeben hatte.
„Mensch Mike, dann sag’s ihr schon.“ Conny schüttelte den Kopf über Michaels Art, seine Tante zu necken. Aber Michael wusste, dass Berti genau das von ihm erwartete. Dann konnte sie ihm wenigstens Contra geben.
„Koa Angst, wir nutzen die Elektromobilität.“
„Seit wann hast du so ein Elektroauto? Da soll man ja ned weit kommen.“
„Ach geh, nein, wir fahren mit der Bahn,“ klärte Michael seine Tante auf. „Die ist elektrisch, gell. Wie findst denn das?“
„Auch ned besser – aber fahrt ’s nur zu, von mir aus. Die drei Wochen werd i auch ohne euch überlebn. Für was zahl’ i denn einen Haufen Geld fürs Betreute da herin.“
Michael durchschaute seine Tante. Sie tat halt ein wenig beleidigt, aber er wusste doch, wie sehr sie sich über die späte Liebe ihres nicht mehr ganz jungen Neffen freute. Den Urlaub gönnte sie ihm und Conny zweifellos von Herzen.
1990 — Januar
Das mit der Euphorie nach der Maueröffnung bewahrheitet sich. Zumindest für ihn hat es die Merkmale eines unaufhörlichen Hochgefühls. Wenn da nicht das Gewissen wäre, das sich von Zeit zu Zeit meldet. Aber Verdrängen hat er gelernt, all die Jahre drüben. Nichts zulassen, was vom Weg abweicht, stramm geradeaus, dem Ziel entgegen. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ha, ha. So, wie er diesen Spruch umsetzt, hat der Vorsitzende des Staatsrats das sicher nicht gemeint.
Alles liegt hinter ihm. Alles und alle. Sogar … und da ist es wieder, dieses Nagen und Zerren von ganz innen. Nicht nachdenken! Vorwärts. Aufwärts.
Er hat es gut erwischt, genau, wie er es sich wenige Wochen zuvor vorstellte. Wegen seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten haben sie seiner Bitte entsprochen, bei eventuellen Nachfragen, ihn vorerst nicht zu verraten. Die ersten Monate arbeitet er „schwarz“. Bis ihm einfällt, wie er vielleicht wieder alles geradebiegen kann, braucht er Abstand. So unendlich viel Abstand.
Samstag, 23. April, im Zug ab Lyon-Part-Dieu (Teil 1)
Im Halbschlaf puzzelte sich die Wirklichkeit wieder zusammen. Michael wartete absichtlich lange, bis er seine Augen zu öffnen wagte. Erstmal alles auf die Reihe bekommen, Gedanken ordnen.
Er, der Privatdetektiv und die Lebensberaterin, beide über sechzig, lebten seit kurzem zusammen. Michael war zu Conny ins Haus gezogen. Für eine allein sei es zu groß, hatte Conny zugegeben.
Vor acht Jahren war ihr Sohn zum Lehramt-Studium nach München gependelt, später an die Uni Tübingen gewechselt. Dann hatte es sich ihr Sohnemann wieder anders überlegt und sich für vier Semester Meeresbiologie an der Uni in Rostock eingeschrieben. Seit seinem Abschluss mit „Master of Science“ tingelte er als Spezialist für Marine Biotechnologie in der Weltgeschichte herum. Connys Haus war sturmfrei.
Mit der anstehenden Reise zogen Michael und Conny so etwas wie Flitterwochen vor, obwohl beide keine Eile zum Heiraten an den Tag legten. Endgültig ausschließen wollte zumindest Conny eine Ehe mit Michael nicht. Seit ihrer Entscheidung, den Rest ihres Lebens mit Michael zu verbringen, hatte sie das ihm gegenüber durchblicken lassen. Michael hatte sich bis jetzt nicht dazu geäußert.
Gut möglich, sagte er sich, dass sie die Reise benötigten, um Klarheit in dieser Frage zu bekommen. Mit Conny zusammen zu sein, mit ihr den Alltag zu teilen, ja, das gefiel ihm. Doch mussten sie in ihrem Alter gleich heiraten? Erst einmal in Urlaub fahren — und das im wahrsten Sinne des Wortes. Mit der Bahn nach Portugal.
Während der Zug gefühlt eine Ewigkeit stand, hatten sie wie im Prospekt beschrieben die Sitz- in Liegeplätze umgewandelt. Die Enge in der Nische behagte ihm überhaupt nicht. Doch ein luxuriöseres Abteil mit Waschgelegenheit und WC hätte die Fahrt noch teurer werden lassen, als sie sowieso schon war. Am späten Abend waren sie von Rosenheim losgefahren. Über Nacht und morgens waren sie inzwischen fünfmal umgestiegen, zuletzt in Bern und dann von Genf zu diesem Zug in Lyon, einem französischen TGV. Er war hundemüde gewesen. Nun, am Nachmittag, hätte ihm ein Schläfchen wahrlich gutgetan. Michael hatte hartnäckig versucht einzuschlafen, was ihm nach ein paar Minuten fast gelungen war. Von wegen.
Michael spürte plötzlich eine Hand an seinem Oberarm. Er öffnete ein Auge. Nicht nur der Zug ruckelte beim Anfahren aus dem Bahnhof von Lyon. Conny langte ordentlich zu, um ihn wachzubekommen.
„Was ist denn?“
Conny schaute ihn aufgeregt an. Gut, wenn sie nicht schlafen wollte, konnte sie sich doch wenigstens auf ihrem Schlafplatz gegenüber ausruhen.
„Mike, ich wollte eigentlich gerade zur Toilette, aber die ließ sich nicht öffnen.“
„Ja“, hörte Michael sich sagen, „weil wir in einem Bahnhof stehen.“ In welchem, das hatte er eben erst aus den Untiefen seines Bewusstseins gekramt. Wie lange hatte er denn geschlafen? Fünf Minuten? Fünf Stunden?
„Wir fahren schon wieder. Ich dachte zunächst dasselbe. Dass es wegen der Standzeit ist. Dann hörte ich eine Stimme aus der Toilette. Jemand telefonierte, ein Mann, der versuchte, nicht allzu laut zu sprechen, aber ich hab’ supergute Ohren, wie du weißt. Du glaubst nicht, was ich dabei gehört habe!“
Vier Tage zuvor, Rosenheim, Dienstag, 19. April
„Wo, sagten Sie, wurden die Teile gefunden?“ Kriminalkommissar Kreutz ärgerte sich über die nuschelnde Aussprache des Beamten am Telefon. „Und welche Käfer?“
„Nicht Käfer, Kefer. Im Keferwald draußen, Sie wissen schon …“
Nein, wusste er nicht. Oder doch: dieser Wald westlich von Rosenheim, der seit kurzem von der sogenannten Westtangente, einer Umgehungsstraße für die Stadt, durchschnitten wurde.
„Und wo genau?“
„Ungefähr zwischen dem Ortsteil Fürstätt und den Fußball- und Tennisplätzen an der Bahnstrecke dort. Ein Junge …“
Kreutz ließ ihn nicht ausreden: „Nicht ungefähr! Wo genau?“
„Das ist schwierig zu sagen, mitten im Wald halt, eine Art Sumpf …“
Kreutz schnaubte durch die Nase. Das Netz entpuppte sich als äußerst instabil. Der Beamte, Polizeiobermeister Jason Morris, stand offenkundig buchstäblich im Wald.
In seinem Büro, das sich der Kommissar sonst mit vier anderen Beamten teilte, arbeitete im Moment lediglich Polizeihauptmeisterin Nadine Sedlmeier am Computer.
„Nadine“, begann Kreutz mit der Befehlskette für einen Leichenfund, „verständigen Sie Doktor Baumgartner und die Leute von der Tatortsicherung. Ich weiß zwar nicht, ob es einen Tatort gibt, aber Leichenteile vielleicht.“
PHM Sedlmeier griff zum Telefon.
„Das können Sie unterwegs machen“, stoppte sie der Kommissar. „Wir fahren in den Wald.“
Er erntete einen fragenden Blick.
„Ja“, bekräftigte Kreutz, „wir zwei suchen jetzt den Platz, wo POM Morris glaubt, Leichenteile gefunden zu haben, oder besser, wo ihn jemand hingeführt hat, wie ich mir vorstellen kann. Faselte was von einem Sumpf, oder so.“ Er sah auf die Uhr. „Was tut der im Wald? Der müsste eigentlich vor einer Stunde seinen Dienst angetreten haben.“
Über die Freisprechanlage im Polizei-SUV erledigte Nadine Sedlmeier die nötigen Anrufe. Kreutz räumte ein, diesen Wald kaum zu kennen, und fragte Nadine, ob sie sich vorstellen könne, wo POM Morris dort steckte.
„Keine Ahnung“, gestand Nadine. Sie stoppte an der nächsten Ampel der Küpferlingstraße, die an den westlichen Stadtrand führte. „Wenn Obermeister Morris sagte, zwischen Fürstätt und den Sportplätzen, dann ist das ein ganz schön großes Gebiet. Wissen Sie, als Kind war ich oft mit Freunden da draußen. Von meiner Oma weiß ich, wie sich der Wald verändert hat.“
„Dieser Keferwald, wieso heißt der eigentlich so?“, gab sich Kreutz interessiert. „Hab ich mich bis jetzt nie gefragt.“
Am Blick von PHM Sedlmeier bemerkte er ein gewisses Erstaunen über seine Frage. Dennoch gab die gebürtige Rosenheimerin, deren Vorfahren seit Generationen hier lebten, bereitwillig Auskunft. Zumindest, was sie von dem Wald im Westen Rosenheim sagen konnte. Möglicherweise erleichterte das Wissen über das Gebiet die Suche nach ihrem Kollegen.
„Die Rosenheimer nennen den Wald Keferwald nach einer Ausflugsgaststätte, die am Waldrand im Stadtteil Egarten betrieben wurde: Der Kefer eben“, erklärte Nadine. „Die Wirtschaft ist inzwischen abgerissen worden, und Wohnhäuser stehen jetzt dort, wo es früher einen schattigen Biergarten mit Kastanien gab. Schauen Sie mal auf den Stadtplan. Die Straße am Waldrand dort hat man tatsächlich in Beim Kefer umbenannt. Eine Zeit lang war früher hinter dem Wirtsgebäude die Squash-Halle.“
Kreutz kam ins Grübeln.
„Ja, das Squash-Center, das kenne ich. Als Jugendlicher, habe ich dort mal gespielt.“
„Gibt’s ebenfalls nicht mehr. Aber der Wald, der dahinter beginnt, das war und ist der Keferwald. Meine Oma hat mir gesagt, das Geheimnis dieses Waldes läge darin, dass er gar kein richtiger Wald sei, also kein natürlich gewachsener. Vor vielen Jahren seien Fichten dort angepflanzt worden. Sie sagte da so einen Spruch von Bauern: Willst du deinen Wald vernichten, pflanze Fichten, nichts als Fichten. Ganz früher gab es dort keinen Wald, sondern ein Moor. Das Gebiet wurde durch zahlreiche Gräben entwässert und war einer Holzplantage gewichen. Dann kam irgendwann so ein Borkenkäfer-Befall. Die Leute lästerten, man wisse jetzt, warum der Wald ja schon immer Käferwald hieße—mit ä.“
Kreutz sah Nadine von der Seite an und meinte strohtrocken: „Dacht’ ich mir doch, dass der Name mit Käfern zu tun haben muss.“
Nadine fiel darauf herein und schüttelte den Kopf.
„Eben nicht, wie gesagt. Aber was dann folgte, weiß ich nicht von meiner Oma, sondern von meinem Vater, der damals im Forstamt als Forstwirtschaftsmeister angestellt war.“ Nicht ohne Stolz über ihr Wissen erklärte sie ihrem Chef: „Wegen der Käferplage mussten hunderte Bäume gefällt werden. Weite Lücken sind dadurch entstanden, Lichtungen, die man wieder aufzuforsten versuchte, aber Torfmoos und Wollgras haben sich die Lichtungen zurückerobert. Als einzige Bäume wuchsen junge Moorbirken auf dem kargen, sauren Boden. Stellenweise siedelte sich sogar der fleischfressende Sonnentau an. Einzelne, manchmal fußballfeldgroße Flächen mit schwammartigem Untergrund haben sich erstaunlich schnell wieder rückentwickelt. Der eine oder andere moorartige Bereich war nur kurz in Erscheinung getreten und nach mehreren schneearmen Wintern und heißen Sommern wieder ausgetrocknet. Andere blieben bis heute.“
„Und wie hilft uns das jetzt weiter?“, raunzte Kreutz nach Nadines Bericht.
„Na ja, Sie sagten doch, Morris stehe in einem Sumpf, oder so ähnlich.“
Die Bahnunterführung am Ende der Küpferlingstraße hatten sie hinter sich gelassen und waren dann rechts abgebogen. Nadine hielt an und ließ den Motor laufen.
„Das ist die Pürstlingstraße“, unterrichtete sie ihren Chef.
Die Straße führte parallel zur Münchener Bahnstrecke zu den Sportplätzen des Sportbunds/DJK und des Tennisclubs TC 1860 Rosenheim. Eine Lärmschutzwand dämmte den Krach eines vorbeidonnernden Güterzugs einigermaßen ein.
„Ich ruf nochmal Morris an“, entschied Nadine. Sie wählte und nickte nach ein paar Sekunden zufrieden.
„Hi, Kollege, wie ist die Verbindung?“
„Super, aber es rauscht.“
„Das ist ein Zug.“ Sie wartete, bis sie nur das Säuseln ihres Dienstwagens hörte. „Was ist los? Vor allem, wo bist du?“
„Ich war schon auf dem Weg zum Dienst, da hat mich der Herr Rietschel, wir kennen uns vom Sehen aus der Nachbarschaft, also der hat mich angehalten und hierhergeführt. Da sind, wie ich vermute, menschliche Knochen. Eine Hand, sicher nicht von einem Tier. Habt ihr den Doc schon informiert?“
„Ja, klar. Aber du musst uns sagen, wo genau du bist.“
POM Morris blieb für einen Moment stumm.
„Hallo?“
Nadine stutzte. Das war nicht ihr Kollege.
„Hallo, wer sind Sie?“
Eine ruhige, sonore Stimme stellte ihren Besitzer vor: „Mein Name ist Christian Rietschel. Ich bin der Vater von Daniel, der das hier gefunden hat. Sie fahren jetzt südlich von den Tennisplätzen an den Waldrand, dahin, wo es links nach Alt-Fürstätt geht, und rechts nimmer weiter …“
„Wie bitte?“
„Ja, Mensch, hat die Polizei keine Navis? Schauen S’ halt auf eine Karte oder aufs Handy. Dann, wenn es rechts nimmer weiter geht mit ’m Auto, dann gehen Sie oberhalb von den Tennisplätzen den Weg links hinauf. Das ist so eine Art Hohlweg. Oben kommen Sie an ein ziemlich verwildertes Waldstück. Da ist rechts vom schmalen Weg zwar ein alter Zaun, aber dahinter wächst alle mögliche, nur kein Wald. Und da stehen wir. Schreien S’ halt, wenn S’ da sind.“
Da Nadine auf laut gestellt hatte, bekam Kreutz die Beschreibung mit.
„Jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus.“
„Aber ich!“ Nadine legte den ersten Gang ein.
Samstag, 23. April, im Zug ab Lyon-Part-Dieu (Teil 2)
Michael rieb sich die Augen und sah aus dem Abteil-Fenster. Dass sie längst durch Frankreich fuhren, war nicht zu übersehen. Schicke Villen, Michael ordnete sie einem Lyoner Vorort zu, zogen gemächlich vorbei. Er schätzte, um die feinen Leute darin nicht zu erschrecken, durfte der Lokführer bis zu freiem Gelände nicht vollends Zunder geben.
Bevor Conny ihn aufgeweckt hatte, hatte er selig geschlafen. Jetzt fühlte er sich wie gerädert. Leute, die mitten am Tag diese kurzen Katzen-Schläfchen fertigbrachten, und anschließend fit wie vollgetankte Neuwagen loslegten, hatte er immer beneidet. Um das Schwummerige im Kopf nach dem Mittagsschläfchen zu vermeiden, machte er nie eines.
Ganz kapiert hatte er nicht, was Conny ihm wegen der Bordtoilette mitteilen wollte.
„Was ist los?“
Conny strich sich mit der Hand über ihre extra für die Reise praktisch kurz geschnittenen Haare. Im intensiven Sonnenlicht, das durchs Fenster ins Abteil fiel, schimmerten sie fast blond. An sich besaßen sie eine natürliche, helle Röte, die für Conny, genau wie ihre zarten Sommersprossen, so typisch war. Sie wirkte fassungslos, was Michael schneller wach werden ließ als jeder Espresso. Er setzte sich auf, nahm ihre Hände und riet ihr: „Setz dich doch. Das Bett ist ganz weich.“
Conny folgte seinem Rat. Sie schüttelte den Kopf, als könne sie nicht glauben, was sie erlebt hatte.
„Ich steh da an dem Klo, lehne mich an die Wand gegenüber und warte, bis sich die Tür entsperrt. Da hör ich von drinnen eine Stimme, männlich. Jemand telefonierte.“
„Das ist ja nicht verboten.“ Michael probierte ein Lächeln. Connys grimmiger Blick zerstörte es. „Weißt du Mike, wir sind hier zwar in Frankreich, und dass jemand in diesem Zug, obwohl er aus Paris kommt, Deutsch spricht, ist sicher nicht mal was Besonderes.“
„Aber?“ Michael war inzwischen hellwach.
Conny sah ihm direkt in die Augen.
„Nicht nur Deutsch. Der redete von Rosenheim, vom Keferwald, stell dir vor. Wir wohnen in Fürstätt, und ausgerechnet hier, fast tausend Kilometer entfernt, höre ich Rosenheim, Keferwald. Ich konnte gar nicht anders, als genauer hinhören. Er hätte auf der Website eines lokalen Nachrichtensenders gelesen, dass man in der Gegend — er sagte: du weißt schon wo, etwas gefunden habe.“
„Vielleicht hat er da was verloren, kann schon sein.“
„Von wegen verloren“, blaffte Conny. „Ich hörte was von Knochen. Der oder die andere solle gefälligst selbst nachlesen. Es muss ja nicht genau die Stelle sein, sagte er zwar gedämpft, aber nicht genug für mich. Wenn doch, seien sie — entschuldige, der sagte das halt so — am Arsch.“
„Hast du den Herrn gesehen, als er dann aus dem Klo kam?“
„So lang hab ich nicht gewartet. Ich bin doch gleich hierher zurück. Und irgendwie muss ich jetzt gar nicht mehr.“
Keferwald, Dienstag, 19. April
PHM Nadine Sedlmeier steuerte den Einsatzwagen bis ans Ende der Brunecker Straße und bog rechts ab. Nach wenigen Metern endete der asphaltierte Weg. Ein weißer Sprinter mit der Aufschrift einer Sanitär-Installationsfirma, C. Rietschel, parkte etwas versetzt vor dem dort beginnenden Feldweg — und direkt neben einem Halteverbotsschild. Nadine stellte den Polizei-SUV hinter dem Heck des Transporters ab.
„Endstation“, sagte sie und stieg aus. Um den ignoranten Falschparker würden sie sich später kümmern.
Kreutz folgte ihr über den Fußweg. Von hier aus überblickten sie die unterhalb des Hügels liegenden Tennisplätze. Vom am Waldrand vorbeiführenden Feldweg zweigte nach links ein Ableger in den Wald ab. Etwa fünfzig Meter verlief die Strecke zwischen dicken Fichtenstämmen steil bergauf. Wieder flacher werdend, verengte sich der Weg zu einem matschigen Pfad.
Die glatten Schuhsohlen des Kommissars passten zwar zu seinem Anzug. Für einen Waldmarsch waren sie weniger geeignet. Das falsche Schuhwerk ließ Kreutz mehrmals stolpern. Aber er hielt sich wacker aufrecht.
Hier kannte Nadine sich aus. Ein Stück weit links vom Waldweg verlief der sogenannte Distelgraben. Nachdem sie und Kommissar Kreutz den Anstieg hinter sich gelassen hatten, ließ sie ihren Vorgesetzten wissen, dass der Wald über einige solcher Gräben verfügte. Zum Beispiel gab es einen Holzer- oder Schustergraben. Sie seien natürliche, jetzt oft ausgetrocknete Bachgräben, wobei man einst zur Entwässerung des Moores zusätzlich viele künstliche Rinnen angelegt hatte.
„Hier irgendwo muss Morris’ Standort sein.“
Eine mit dünnen, krummen Birken, mannshohem Gestrüpp und kümmerlichem Nadelgehölz bewachsene Fläche war mit einem Drahtgeflecht vom Weg abgetrennt worden. Ein Grund für diesen notdürftigen Zaun durfte an dem Versuch liegen, hier erneut Fichten anzupflanzen, und um Wildverbiss zu vermeiden.
„Jason!“, rief sie laut nach ihrem Kollegen.
Kommissar Kreutz drückte POM Morris’ Nummer auf seinem Handy.
„Hier ist wirklich ein bescheidenes Netz“, fluchte er. Dennoch blieb der Erfolg nicht aus. Unweit entfernt stimmte ein Klingelton an.
Nadine rief erneut nach Jason Morris.
„Der Chef und ich sind auf dem Weg am Zaun! Wo bist du?“
„Ihr müsst weiter am Zaun entlang und dann nach rechts“, kam laut vernehmbar zurück. „Da könnt ihr durch!“
Jason Morris stellte Christian Rietschel vor. Dessen Sohn habe die Knochen entdeckt. Zusammen mit dem Polizeibeamten hatte Rietschel Senior Zweige und Äste zu einem provisorischen Pfad über den nassen Boden zusammengetragen. Die feuchte Luft an dieser Stelle roch modrig nach verrottenden Pflanzen.
„Daniel streift hier oft alleine herum“, erklärte Christian Rietschel den beiden neu angekommenen Beamten. „Wissen Sie, er ist dreizehn, aber ein ziemlicher Eigenbrötler. Es zieht ihn lieber in den Wald, als mit Freunden was zu unternehmen. Er hat hier etwas gesehen, was ihm merkwürdig vorkam, und er vermutete eine interessante Pflanze. Mein Junge ist ziemlich gewieft. Mit Reisig streute er sich einen halbwegs begehbaren Weg zu den festeren Stellen, und dann hat er das gefunden.“
Er zeigte auf längliche Knochen im Morast. Ein Handskelett war eindeutig einem Menschen zuzuordnen. Die Teile in dem schmutzig-nassen, etwa drei Meter langen und zwei Meter breiten Sumpfloch sahen künstlich aus.
„Als wären sie aus Kunststoff“, bemerkte Nadine. Sie ging, ebenso wie der Kommissar, in die Hocke, um die Fundstücke näher zu betrachten. Wasserblasen blubberten zwischen den Zweigen unter ihren Füßen auf und verstärkten den modrigen Geruch der feuchtwarmen Umgebungsluft.
Kreutz schüttelte den Kopf.
„Ich fürchte, dass das keine Scherzartikel sind. Wir sollten hier nicht länger herumwaten und auf den Doktor warten.“
Ein merkwürdiges Summen lag für einen Moment in der Luft, gleichmäßig wie ein sanfter Wind, der über einen Metallzaun streift und ihn zum Singen bringt. Alle vier sahen nach oben. Doch dort schimmerte nur ein milchiger Aprilhimmel.
23. April, im Zug entlang der Rhone
Was Conny an der Bordtoilette gehört hatte, war zwar eindeutig. Sie fürchtete dennoch, Michael könnte daran zweifeln.
„Ich hoffe, du hältst mich jetzt nicht für durchgedreht, Mike.“
„Freilich nicht!“ Connys aufrichtige Art war ihm vertraut. Es gab überhaupt keinen Grund, sie nicht ernst zu nehmen oder gar für übernervös zu halten. Verständlicherweise war sie jetzt angespannt.
Sie versicherte sich ein zweites Mal: „Glaubst du, dass ich das überbewerte?“
„Auf gar keinen Fall! Du hast dich sicher nicht verhört. Wir sollten herausfinden, wer da telefoniert hat, und was es damit auf sich hat.“ Er überlegte kurz. „Würdest du die Stimme wiedererkennen?“
„Aber ja.“
Draußen, auf der rechten Seite in Fahrtrichtung, sah Michael den Fluss vorbeiziehen. Das blaugrüne Wasser der Rhone floss träge dahin und erinnerte ihn an den Inn zu Hause.
„Ich glaube, wir könnten jetzt einen Kaffee und etwas zu Essen vertragen“, schlug Michael vor. Er beugte sich zu Conny hinüber, nahm ihre Hände in seine und lächelte sie an. „Und danach ruhen wir uns erstmal richtig aus. Wir fahren ja noch fast neun Stunden bis Barcelona.“ Er rechnete sich eine beträchtliche Chance aus, im womöglich üppig frequentierten Speisewagen dem geheimnisvollen Telefonierer zu begegnen.
Sie durchschaute ihn sofort: „Und ich soll mich umhören, ob ich dort die Stimme wiedererkenne, oder? Ich bin ja nicht blöd.“
Ihre Aufregung hatte Conny soweit abgelegt, dass sie wieder klar denken konnte. So schnell hatte er ihr das nicht zugetraut. Ein wenig beschämt darüber lächelte er sie an. „Sorry, Conny. Und? Wollen wir?“
„Na logisch.“
Nicht an jedem TGV stellte die SCNF, die staatliche Eisenbahngesellschaft Frankreichs, ein Bordrestaurant zur Verfügung, oft aber mobilen Service, bei dem Essen und Getränke im Abteil serviert wurden.
Dieser TGV, (Michael sprach es Teeschöwäh aus, was Conny jedes Mal zum Lachen brachte), war vor Stunden in Paris gestartet, und ein Bord-Bistro mit praktisch-schlichter Einrichtung war leicht zu finden. Häufig war Michael nicht mit einem Zug unterwegs gewesen. Aber von einer längeren Bahnfahrt vor vielen Jahren kannte er den Unterschied zwischen einem Bord-Restaurant und einem Bord-Bistro. Das hier war eine Mischung aus beidem, mit Sitzplätzen wie im Restaurant, statt Bistro-Stehtischchen. Im hinteren Teil gab es eine kleine Küche mit Bedienungstheke und einem Automaten für Süßwaren.
Conny, die einst Französisch als Wahlfach hatte, übernahm die Bestellung beim feschen Service-Mann hinter der Theke.
„Sie dürfen gerne Deutsch spreschen“, schlug der junge Mann mit charmantem Akzent vor. Connys Aussprache hatte ihm verraten, dass er es mit Allemands zu tun hatte. Während er die Kaffeemaschine bediente, fragte er über die Schulter. „Möschten Sie etwas dazu essen?“
Michael nickte und deutete auf ein längliches Brötchen hinter der Glasscheibe.
„Ein Sandwich mit Käse und eine Portion Pommes, bitte.“
Conny nahm ein Stück Obstkuchen.
„Zum Cappuccino schmeckt das sicher besser als Pommes.“
Der Service-Mann hantierte grinsend und routiniert an den Küchengeräten.
„D’accord. Pommes frites dauern ein wenig. Setzen Sie sich doch. Isch bringe sie Ihnen. Nebenbei, Sie dürfen das nächste Mal gerne unseren W-Lan-Service nutzen und von Ihrem Abteil aus online vorbestellen. Ist sischer schneller.“
„Merci“, lächelte Conny zurück und hob die Schultern. „Zu spät.“
Anders als Michael erwartet hatte, waren die Tische kaum besetzt. An einem saß ein turtelndes junges Pärchen. Zwei Tische daneben arbeitete, seinem streng konzentrierten Blick nach zu urteilen, ein Geschäftsreisender an einem Laptop. Im gesamten Zug gab es störungsfreies W-Lan und ein mit mehreren Steckdosen ausgestattetes Bord-Büro, das im Vergleich zum Bistro voll besetzt war, wie Michael beim Durchgehen bemerkt hatte. Einige Business-Reisende wechselten deshalb womöglich in den Bistro-Wagen.
Conny und Michael nahmen gleich neben der Küchentheke Platz. Michael saß Conny in Fahrtrichtung gegenüber. Die Landschaft draußen flog förmlich vorbei. Allmählich machte sich die südeuropäische Vegetation bemerkbar. Zwischen den zahlreichen Feldern, die beiderseits der Rhone von Landwirtschaft zeugten, ragten schlanke Zypressen in den blauen Himmel. Erste Lavendelreihen tauchten auf. Sie bildeten einen angenehmen, farblichen Kontrast zu den Äckern mit noch kurzem, zartgelbem Weizen. An den Hängen des Rhonetals grünten Weingärten.
Michael bereute nicht, diese Reise mit dem Zug angetreten zu haben. Conny hatte schon Recht mit dem Weg, der das Ziel sei.
„Vielleicht ist das der Mann, der da mit dem Laptop?“, flüsterte Michael über den Tisch gebeugt Conny zu. Im Hintergrund zischte die Kaffeemaschine für den zweiten Cappuccino.
Conny hob die Schultern und schüttelte den Kopf.
„Ich hab’ ihn ja nur gehört.“
„Okay“, ergab sich Michael. Er stand auf und holte das Tablett mit den beiden Tassen, dem Sandwich und Connys Kuchen von der Theke. Die Pommes wurden nicht in einer Fritteuse zubereitet, sondern in einer Art Pizzaofen trocken aufgebacken. Der Service-Mann im SCNF-Shirt war fortwährend damit beschäftigt und rüttelte eifrig an einem kleinen Backblech.
Conny rührte in ihrer Tasse und starrte hinein.
In diesem Moment schob jemand die Tür zum Bistro zur Seite. Ein älterer Herr mit grauem Haar und cremefarbiger Windjacke sah sich nach einem freien Tisch um.
Wie viele Fahrgäste in diesem Zug waren, konnte Michael nur schätzen. Es bedurfte schon eines gigantischen Zufalls, wenn der akzentfrei deutschsprechende Mann aus der Toilette Conny ein zweites Mal über den Weg laufen sollte und obendrein dabei redete.
Der Herr an der Waggontür drehte sich um und rief etwas nach hinten. Französisch. Gleich darauf wirbelte ein etwa zehnjähriger Junge an ihm vorbei und krallte sich einen Platz an einem Zweiertisch.
„C’est bon ici, grand-père!“, plärrte er lauthals.
Michael schaute Conny fragend an.
Sie wagte einen Blick nach hinten.
„Er sagt, dass es ihm an dem Platz gefällt. Das ist sein Opa.“
Nach dem ersten Schluck aus der Tasse holte Michael sein Smartphone aus der Brusttasche seines Hemds und tappte eifrig darauf herum.
„Was schaust du denn?“, fragte Conny. Sie legte ihre Hände um die Tasse, als müsste sie sie wegen der klimatisierten Temperatur im Waggon wärmen.
„Was ich schon längst machen wollte. Ich suche einen Artikel über einen Knochenfund in Stadtnews24. Ah, tatsächlich, da ist einer. Von gestern. Am Neunzehnten, also am Dienstag, da hat man menschliche Knochen gefunden. Sie schreiben, in einem Wald zwischen Fürstätt und Egarten. Das kann ja nur der Keferwald sein.“
„Siehst du, Mike.“
Der Service-Mann brachte die Pommes und legte zwei Portionstütchen dazu, eines mit Ketchup, eines mit Mayo.
„Bon appétit.“
Michael verteilte den Inhalt beider Tütchen über die staubtrockenen Kartoffelstäbchen. Er schob sich zwei Pommes zwischen die Zähne, kaute einmal und schluckte. Den Pressebericht über einen Knochenfund und die in dem Zusammenhang von Conny belauschte Unterhaltung konnte er nicht ignorieren.
„Wenn da einer im Zug ist, der damit zu tun hat, dann schnappen wir uns den“, raunte er Conny leise zu, damit es niemand in der Nähe hören konnte. „Nicht wörtlich. Aber zuhause gibt es da jemand, den das brennend interessieren dürfte.“ Energisch spießte er eine Ladung Pommes auf und schob sie sich in den Mund.
Conny nippte an ihrer Tasse. Sie verschluckte sich so plötzlich, dass sie in den Cappuccino hustete, bevor sie ihn in Sicherheit bringen konnte. Ein paar Tropfen Milchschaum schossen auf die davor liegende Serviette.
Michael erfasste sofort den Grund für ihren Schreck: Sie hatte soeben die Stimme des Mannes aus dem Klo wiedererkannt. Er war an ihnen vorbei zur Theke gegangen und hatte schroff ein Sandwich mit Huhn und ein großes Bier bestellt.
„Das Hendl ist hoffentlich ohne Knochen?“
19. April, draußen im Wald
Dr. Gideon Baumgartner und die Tatortgruppe trafen keine zehn Minuten nach dem Kommissar und PHM Sedlmeier an der Fundstelle ein.
„Habt ihr ohne Umwege hierher gefunden?“, fragte POM Morris Oberkommissar Klaus Reiter mit einem Seitenhieb auf Kreutz’ und Nadines Odyssee. Reiters weißer Einmalanzug knisterte, als er den Kopf hob und kurz nach oben schaute, als gäbe es dort etwas zu sehen.
„Habt ihr die Drohne gar nicht mitbekommen, die ich unten vom Parkplatz losgeschickt habe? Kamera von oben, Handybild unten, und schon wart ihr geortet wie ein Rudel versteckter Rehe.“ Der Leiter des Kriminaltechnischen Instituts hatte drei Beamte seines Teams mitgebracht, die einmütig grinsten.
Der dunkelhäutige Polizeiobermeister Morris räusperte sich.
„Ach das war das Geräusch vorhin. Wir haben nix gesehen. War wohl gleich wieder weg das Ding.“
„Na, wir haben euch ja auch schnell gefunden“, lästerte Reiter, der es sich nicht nehmen ließ, Außeneinsätze ab und zu selbst zu bestreiten. Er stellte eine Tasche mit Utensilien zur Bergung von Tatortgegenständen neben sich auf eine der trockenen Inseln aus grünen Zweigen.
Bevor Reiter und seine Kollegen die halb aus dem Morast ragenden Knochen berührten, begutachtete Dr. Baumgartner die sichtbaren Körperteile in Hockstellung.
„Moor, hm“, brummte der sportlich-schlanke Gerichtsmediziner, der seine langen Haare wie immer im Nacken zusammengebunden hatte und sie vor Ort in den Kragen steckte. „Würde mal nicht sagen, dass das hier ein neuerer Tat- oder Ablageort ist.“
„Wieso nicht?“, rutschte Kreutz eine Spur patziger heraus als angemessen. „Klar sind das nur Knochen. Aber ein Mensch doch sicher, oder? Ich meine, selbst wenn die Dinger so komisch aussehen.“
„Wie löchriges Plastik, gell?“ Der Doktor grinste souverän. „Mein erster Eindruck ist, dass es keine antiken Knochen sind. Hätte ja sein können, nicht wahr. Der niedrige pH-Wert eines Moorbodens zersetzt das Calcium in den Knochen schneller als Böden mit basischen pH-Werten. Andererseits, hätte der Moorflecken hier bereits zum Zeitpunkt des Todes bestanden, hätten wir nun eine Moorleiche, eine Mumie mit Lederhaut, und keine Knochen.“
Nadine sah den Doktor mit großen Augen an.
„Sie wissen, dass hier lange Zeit ein Moor war?“
„Na sicher. Das ist eine spannende Entwicklung, dass sich Teile eines kommerziell genutzten Waldgebiets wieder in ursprüngliche Hoch- oder Niedermoore zurückverwandeln.“ Fältchen auf seiner Stirn bildeten sich. „Gerade jetzt“, fügte er hinzu, „denn ein Hochmoor nährt sich ausschließlich von Regenwasser, da es keine Bäche oder andere Zuläufe gibt. Pflanzenreste bauen sich auf, wachsen nach oben. Später vertorfen sie unter bestimmten Bedingungen — egal. Der Wald hier wird nie wieder ein zusammenhängendes Moor-Torfgebiet. Aber die wenigen traurigen Wiederkehrer hier zeigen ein letztes Aufbäumen der Natur, nachdem der Mensch eingriff.“
Nadine riss sich zusammen, den Arzt für den Moment nicht zu offensichtlich anzuschmachten. Der kannte sich aus und interessierte sich für seine Heimat. Mit seinen gut vierzig Jahren war er aber nicht alt genug, dass er persönlich die lange Entwicklung des Keferwaldes miterlebt haben konnte. Nadine fragte ihn: „Wie kommt das denn, dass hier, obwohl Moor, doch Knochen zu finden sind?“
„Wie gesagt, Frau Sedlmeier, in einem richtigen Moor gibt es durch Sauerstoffmangel und niedrigem pH-Wert keine Bakterien und andere Mikroorganismen, die organisches Material wie menschliches Fleisch zersetzen. Hier existierte vor über hundert Jahren ein Moor. Wenn der Leichnam damals hier versunken wäre, oder wie auch immer hierherkam, hätten wir besagte Moor-Mumie. Nein, der oder die hier liegt keine fünfzig Jahre an dieser Stelle. Damals war da weicher Waldboden, umgeben von Fichten und Unterholz. Die Leiche, vermutlich in Erde unter der Oberfläche liegend, wurde bis auf die Knochen wiederverwendet.“ Er grinste und sah in die staunende Runde. „Vom großen bis zum kleinsten Waldgetier recycelt eben. Das kann in einem Wald schnell gehen. Es gibt Studien, dass ein Reh innerhalb eines Monats skelettiert ist, wenn es in einem verhältnismäßig naturbelassenen Wald verendet. Hier wurde dagegen gründlich abgeholzt wegen des Borkenkäferbefalls. Ein paar der Baumstümpfe sieht man ja bis heute.“
Alle sahen sich um. Man hatte die dicken Baumstümpfe der gefällten Bäume und deren Wurzelwerk im Boden belassen, die im feuchten Morast vergeblich versuchten zu verrotten. Niemand hatte während der Abholzaktion unter der Erde nachgesehen, sonst hätte man die Leiche schon damals entdeckt.
„Jahrhunderte lang waren hier also Moore“, führte der Doktor wiederholt aus, „auch Torfmoore, oder wie sie in Bayern heißen, sogenannte Filzen. Feuchtgebiete halt.“ Jemand aus dem Kreis der Tatorttruppe lachte auf. „Ja, genau“, fuhr Dr. Baumgartner wenig amüsiert, aber konzentriert fort. „Vor mehr als hundert Jahren wurde die Gegend nach und nach entwässert, um Platz für den Ausbau der Holzwirtschaft zu schaffen. Die kerzengeraden Fichtenreihen sieht man ja in den einzelnen Waldabschnitten. Irgendwann, während hier schon längst Fichten wuchsen, ist unser Kamerad oder die Kameradin da unter den Waldboden geraten. Vor wenigen Jahrzehnten fielen Segmente dieser Monokultur dem Borkenkäfer zum Opfer. Das Ergebnis ist: Eines von wenigen, renaturierten, auf lange Sicht wohl chancenlosen Feuchtgebieten — und wenn jetzt noch einmal jemand lacht, hör ich auf.“ In die entstehende Pause prustete niemand hinein. „Die im vormals Waldboden gelegene, mittlerweile skelettierte Leiche machte die Wald-Metamorphose mit und wurde erst als Knochengerüst zur Moorleiche. Jedenfalls würden diese Knochen nicht mehr so aussehen, wenn sie allzu lang in dem sauren Milieu gelegen hätten“, fuhr Dr. Baumgartner fort. „Dass manche wie bräunliches, poröses Plastik wirken, liegt daran, dass die Säure erst begonnen hat, sie aufzulösen. Nochmal zum Verständnis“, holte Dr. Baumgartner aus, „aber ich mach’s kurz …“ Er erntete mehrstimmiges Hüsteln. „Ja, da müsst ihr jetzt durch. Sonst fragt ihr doch auch immer gleich, was ich alles schon vor einer Obduktion über Leichen sagen kann. Nun, in einem Moor löst sich das Calcium eines Skeletts wegen der Säure, normal mit einem pH-Wert von 2 bis 6, nahezu komplett auf. Das mit dem pH-Wert ist klar? Wisst ihr noch aus der Schule? Die pH-Skala geht von 0 bis 14. 7 ist neutral, drüber ist’s basisch, also Lauge, je weiter unter 7, umso saurer, also Säure. Hier ist die Säure aufgrund der kurzen Entstehungszeit wahrscheinlich noch schwach ausgeprägt, eher so 6 bis 5. Deshalb sind die Knochen ein wenig angefressen, aber vorhanden. In spätestens zehn Jahren wäre davon nichts mehr übrig. Glück gehabt.“
„Von wegen“, schnaubte Kreutz. „Man kann also mit Sicherheit sagen, dass hier eine Leiche zunächst in einem normalen Waldboden wie viele Jahre, sagten Sie, begraben lag?“
„Genaueres kann ich erst im Labor feststellen. Aber ich schätze mal keinesfalls mehr als vierzig, fünfzig, nicht weniger als zwanzig Jahre.“ Er wandte sich an Klaus Reiter, bat ihn um eine Boden-Probe zur späteren, genauen pH-Wert-Bestimmung und erklärte anschließend Kommissar Kreutz. „Eine fachgerechte Ausgrabung für die forensische Archäologie wird demnach nicht nötig sein. Ich fürchte aber, eine fachgerechte Bergung dieser menschlichen Überreste für die Abteilung Ungeklärte Todesfälle.“
23. April, im Zug — Bistro
Michaels Pommes verschwanden, bevor Conny die Gabel einmal in ihren Kuchen stach. So oder so nahm Essen im Moment nur den zweiten Platz in ihrem Prioritäten-Ranking ein. Auf Platz eins hatte es der Herr geschafft, zu dem die Stimme aus der Zugtoilette gehörte.
Nachdem der Mann sein „Hendl-Sandwich“ bezahlt hatte, setzte er sich an einen Platz am Eingang zum Bistro. Michael konnte ihn, ohne sich umzudrehen, nicht mehr unter die Lupe nehmen. Conny, mit dem Rücken zur Theke, umso mehr.
Der Mann war gut und gerne an die fünfzig, trug Jeans, ein weißes T-Shirt und ein dezent blau-kariertes Sportsakko. Er machte überhaupt einen sportlichen Eindruck, schlank und ungefähr so groß wie Michael, eins achtzig. Seine Haare mit beginnenden Geheimratsecken waren an den Seiten kurz geschnitten und besaßen dieselbe Farbe wie sein Dreitagebart, mit deutlich cremeweißen Strähnen durchsetztes Grau. Die Konturen seines Unterkiefers setzten sich scharf vom Übergang zum Hals ab, und seine Wangen wirkten ein wenig eingefallen. Beides verlieh seinem Gesicht etwas Kantiges, Hartes. Eine leichte Apostasie, abstehende Ohren, milderten den Eindruck ein wenig. Auf die Entfernung über sieben Tischreihen konnte Conny die Augenfarbe nicht erkennen. Dafür beobachtete sie unauffällig aus den Augenwinkeln, wie er sein Hühnchen-Sandwich in die Hand nahm und wie ausgehungert ein großes Stück abbiss. Mit Bier spülte er nach und wiederholte das Ganze.
Nachdem er mit dem Sandwich rasch fertig war, wischte er sich die schmalen Lippen mit einer Papierserviette ab. Fahrig holte er ein Handy aus der Innentasche seines Sakkos und legte es auf den Tisch. Er tippte eifrig darauf herum.
Einmal drehte er für einen Moment seinen Kopf zu dem Opa mit dessen Enkel, den Jungen, den man als einzigen im Waggon laut plappern hörte. Der Kleine störte ihn offenbar beim Schreiben von Nachrichten. Sein Blick war nicht gerade freundlich. Conny hatte das Gefühl, dass er zwar verärgert zum Nachbartisch hinüberschaute, aber keineswegs bösartig, wie sie aus einer ersten Intuition heraus angenommen hatte. Durch ihre Erfahrung als Lebensberaterin wusste sie, dass die erste Wahrnehmung nicht immer hundertprozentig stimmen musste. Es kam darauf an, wie und wo ein Eindruck stattfand. Und bei diesem Herrn war das nun mal die Stimme gewesen, die sie gehört hatte. Eine verborgene Schwingung darin, mit unterschwelliger Angst, bei etwas ertappt worden zu sein, das gänzlich falsch war. Was hatte dieser Mann getan, vor dessen Entdeckung er selbst Angst bekam?
Conny schloss ihre Augen und rief sich das Telefonat dieses Mannes ins Gedächtnis zurück, das sie belauscht hatte. Ja, da schwang dieses Verschwörerische mit, das ihr noch immer so großes Unbehagen verursachte.
Michael hatte die Pressemitteilung über den Knochenfund im Wald ebenso im Internet entdeckt wie dieser Mann, hatte er doch am Telefon extra darauf hingewiesen. Dass der Typ damit zu tun hatte, dessen war sich Conny sicher. Aufgeflogen seien sie, er und der oder die andere. Hatten diese Leute einen Menschen im Wald vergraben? Und nur noch Knochen waren übrig? Dann musste das doch sehr lange her sein.
„Mike“, flüsterte sie so leise, dass Michael sich über das leere Pommes-Körbchen und sein Käsesandwich beugen musste, um ihre Worte zu verstehen, „ich glaube ganz bestimmt, dass der Kerl da hinten — dreh dich bloß nicht zu ihm um — dass der mit dem Knochenfund zu tun hat. Wir sollten die Polizei verständigen.“
Sie sah Michael an, wie sehr er sich zusammenreißen musste, um seinen Kopf stillzuhalten.
„Ja, wahrscheinlich hast du Recht“, flüsterte Michael zurück. „Aber wir müssen mehr darüber erfahren. Es ist schließlich mein Job, krumme Dinge herauszukriegen.“
Er wickelte sein Käsesandwich in die Serviette und stand auf.
„Das esse ich später.“
Conny fürchtete, er würde direkt auf den Mann zugehen und ihn zur Rede stellen. Doch Michael machte nur die wenigen Schritte zur Theke.
„Ich würde gerne zahlen, Monsieur.“ Er zückte seine Geldbörse.
„Bon, macht siebzehn achtzisch.“
Michael zuckte sichtlich zusammen und zahlte mit einem Zwanziger. Bestimmt hatte er sich dazu durchgerungen, mit Anstand „stimmt so“ zu sagen.
Conny hoffte, er würde sich gleich wieder zu ihr setzen. Stattdessen steuerte er auf den Mann im Sportsakko zu.
Was er zu ihm sagte, konnte Conny nicht genau hören. Sie dachte nur: Der spinnt doch!
Mittwoch, 20. April in Rosenheim
In Dr. Baumgartners Labor roch es scharf antiseptisch. Das kalte, aber taghelle Licht von LEDs spiegelte sich im Glasrahmen eines lateinischen Spruchs, der wie in den meisten Sälen dieser Art die Wände zierte und übersetzt etwa so lautete: Dies ist das Haus, in dem sich der Tod freut, den Lebenden beizustehen.
Kommissar Kreutz musterte die sortierten Knochen auf dem Seziertisch. Wo kleinere Knöchelchen wie etwa die von ein paar Zehen oder Fingergliedern fehlten, hatte der Doktor passende Lücken gelassen. So entstand der Eindruck eines vollständigen menschlichen Skeletts.
„Sie haben angekündigt, heute Genaueres zu wissen, Doktor?“
Gideon Baumgartner stand dem Kommissar gegenüber an der Längsseite des Tisches.
„Genaueres ist gut“, sagte er trocken. „Wie Sie sehen, haben die Leute der Tatorttruppe gute Arbeit geleistet und das alles hier sorgfältig geborgen. Ein paar Kleinigkeiten fehlen zwar — wenn ich ihn wiederherstellen könnte, würde er ziemlich krumm durchs Leben laufen — aber es ist alles da, um ihn einzuordnen.“
„Ihn?“
„Ja, die Überreste sind eindeutig männlich. Dass der Schädel vorhanden ist, ist natürlich hilfreich.“ Er beugte sich über den gespenstisch anmutenden Totenkopf. „Ich meine, wer braucht schon ein Schlüsselbein, wenn er Kopf und Zähne hat. Was ich jetzt bereits sagen kann, ist, dass der Mensch hier zum Zeitpunkt seines Ablebens zwischen fünfunddreißig und fünfundvierzig Jahre alt war. Seinen Zahnzustand könnte man höchstens als halbwegs gut bezeichnen. Hätte er länger gelebt, dann wären bald mal Dritte angesagt gewesen. Über seine Parodontitis kann ich nicht viel sagen.“ Der Doktor grinste breit wegen seines Witzchens über das fehlende Zahnfleisch „Aber wahrscheinlich litt er darunter, denn die meisten Zahnhälse sind ziemlich angegriffen. Außerdem hat er allein im Oberkiefer sieben Amalgam-Füllungen. Die Beißer im Unterkiefer sind nicht viel besser.“
Dr. Baumgartner zippte prüfend an seinem Latexhandschuh, als wollte er sehen, ob der richtig saß. Er legte den losen, zweiteiligen Unterkiefer auf seine Handfläche und hielt ihn Kreutz unter die Nase.
„Na, was sehen Sie?“
„Ein paar Lücken?“, fragte Kreutz zurück, der nicht wusste, auf was Dr. Baumgartner hinauswollte.
„Eben“, bestätigte der Doktor, „und diese Bruchstelle hier?“
Kreutz bat ihn, er solle mit dem Ratespiel doch Schluss machen.
„Herr Kommissar, diesen Kieferbruch fing er sich nicht postmortal ein, sondern ante mortem.“
„Dem wurde zu Lebzeiten der Kiefer gebrochen?“
„Genau. Die Ursache des Bruchs, ein heftiger Schlag oder Hieb mit einem Gegenstand, erschüttert den Schädel dermaßen, dass Gehirn-Einblutungen entstehen. Das war vermutlich die Todesursache. Der Kiefer brach kurz vor seinem Ableben, erkennbar am ausgetretenen, kaum mehr vorhandenen Knochenmark in den Markhöhlen zwischen den Bälkchen der Spongiosa. Das ist allerdings nur unter dem Mikroskop zu sehen.“
Kreutz schüttelte den Kopf.
„Jetzt mal langsam, so dass ich es verstehe, Doktor.“
„Ist ja für Sie nicht so wichtig, aber: Stellen Sie sich das Innere des Kieferknochens wie ein Mini-Fachwerk vor. Die Balken, also die Spongiosa-Bälkchen, geben dem Knochen Halt bei relativ wenig Gewicht. In den Höhlen zwischen den Bälkchen befindet sich Knochenmark. Beim Bruch tritt es aus. Wäre der Kiefer nach seinem Tod oder beim Vergraben gebrochen, hätte ich winzige Reste von Erde in der Bruchstelle und den leeren Markhöhlen gefunden. Da der Kopf aber mit einer Art von Plastiktüte umhüllt gewesen war, ist er längere Zeit relativ sauber geblieben, wenn ich das so sagen darf.“
„Plastiktüte?“, wiederholte Kreutz überrascht. Letzte Zweifel an der Zuständigkeit seiner Abteilung für den Fall zerplatzten im künstlichen Licht über dem Seziertisch wie Luftballons über Kerzenflammen. Eine im Wald vergrabene Leiche musste ja nicht unbedingt umgebracht worden sein. Eine mit gebrochenem Kiefer als Todesfolge und mit Plastiktüte über dem Kopf schon. Ein Tötungsdelikt, definitiv. „Davon wusste ich nichts.“
„Dafür bin ich ja da. Jedenfalls stellte ich nur Spuren von Moorwasser in den Markhöhlen fest, was darauf hindeutet, dass die Kunststoffhülle sich erst dann fast vollständig zersetzt hat, als es an der Fundstelle moorig zu werden begann. Vorher, im Waldboden, hatten sich bereits die üblichen Verdächtigen, kleine Erdgeister wie Würmer, Maden, Käfer und noch winzigeres Getier durch das Plastik gearbeitet und den Schädel entfleischt. Das Gehirn soll denen ja besonders schmecken. Später drang in die leeren Schädelhöhlen Flüssigkeit ein. Aber beim Kieferbruch tippe ich auf einen rechten Haken, oder er wurde mit einem Gegenstand verursacht.“
Kommissar Kreutz atmete tief durch.
„Der allseits beliebte stumpfe, oder? Was ist mit der Plastiktüte?“
Dr. Baumgartner griff zu einer Pinzette und klemmte damit einen winzigen Fetzen schwarzen Kunststoffs ein, der in einem Schälchen am Seziertisch lagerte.
„Bitteschön. Nur Reste von dem dünnen, polymeren Stoff sind übrig, so wie es aussieht von der leicht sauren Umgebung zersetzt. Fragen Sie mich nicht, von welchem Discounter oder Supermarkt die Überbleibsel stammen. Ich tippe eher auf die Kategorie Müllbeutel. Alles bisher von mir Gesagte ist übrigens vorläufig und hat weitreichend etwas mit Mutmaßungen zu tun, die auf meiner Erfahrung beruhen.“
Kreutz betrachtete die Knochen und fragte: „Kleidungsreste?“
„Bis jetzt keine Spur. Soviel ich weiß, fand das Spurenteam am Fundort nichts in der Richtung. Entweder fehlte jegliche Kleidung, also war er nackt, oder er hatte so wenig an, dass nichts mehr übrigblieb. Kunststofffasern, Knöpfe oder Reißverschlüsse hätten vielleicht nachweisbar sein können, aber wie bei der besagten dünnen Plastiktüte, nada, niente, nix. Natürliche Stoffe, falls vorhanden gewesen, gingen den Weg alles Irdischen durch Tiere und Zersetzung.“
Da Kreutz sich gegenwärtig über einige Feinheiten bestens informiert fühlte, blieb ihm als einzige Frage die nach der möglichen Liegezeit.
„Tja“, machte der Doktor, „das ist wegen der unterschiedlichen Umgebung, in der sich der Kamerad da befand, nach wie vor schwer zu sagen. Aber ich grenze den Zeitraum auf um die dreißig Jahre ein.“
„Gut“, gab sich Kreutz zufrieden, „also Anfang Mitte neunziger Jahre?“
„Da muss ich Sie enttäuschen, Kommissar. Plus, minus zehn Jahre können es durchaus sein.“
Für eine Überprüfung der Vermisstendateien schien der Zeitraum 1990 bis 1995 möglich und geeignet, für den von 1980 bis 2000 freilich komplizierter. Kreutz’ Blick verfinsterte sich.
„Na dann, danke, Doc.“
23. April, im Zug gen Süden
Der Mann sah erst auf, als Michaels Schatten ihn erreichte. Mit einer Prise Gereiztheit in seinem Blick, sagte er: „Bitte?“
Michael lächelte so freundlich, wie es die ungewisse Situation zuließ.
„Entschuldigen Sie die Störung, aber ich hab’ vorhin gehört, dass Sie Deutsch sprechen.“
„Na und?“ Der Mann im Sportsakko sah zu Michael auf, als wäre der nicht ganz dicht. „Sonst noch was?“
„Na ja, ich mein’, freilich ist das keine große Sache. Aber Sie bestellten Ihr Essen vorhin mit einem leicht bairischen Einschlag. Hendl, Sie wissen schon. Ich komme aus Rosenheim, und es heißt doch, egal wohin es dich auf der Welt verschlägt, du triffst immer auf jemand aus Rosenheim.“ Er grinste breit.
„Na dann.“ Überrumpelt von Michaels Direktheit gab der Mann sich geschlagen. „Stimmt.“ Er verzog keine Miene. „Ungefähr wenigstens“, fügte er hinzu.
Michael hatte erreicht, was er wollte. Dem Fremden blieb kaum etwas anderes übrig, außer das Spielchen mitzumachen.
„Sehen Sie“, tat Michael erfreut, „ich bin der Michi.“
„Richard“, stellte sich der Mann vor und versuchte gleichzeitig, den Störenfried abzuwimmeln: „Ich müsste jetzt ein paar dringende Nachrichten schreiben.“
„Sorry, ich will Sie natürlich nicht lange aufhalten“, versicherte Michael und tat es doch: „Wo geht’s denn hin? Urlaub?“
„Ja und nein. Ich muss nach Madrid und Lissabon.“
„Oh, das ist ja spannend“, gab sich Michael interessiert.
„Wohl weniger. Ich bin geschäftlich unterwegs.“
„Geschäftlich“, wiederholte Michael. Er forderte die Gesprächsbereitschaft dieses Richards weiter heraus: „Interessant! Nach Lissabon?“
Die blauen Augen seines Gegenübers sahen Michael mit einem Mal scharf an. Sie entdeckten offenbar nichts, dem er misstraute.
„Unter anderem. Kennen Sie das Alcochete Outlet?“
„Ähm, nein.“
„Ein Outlet Center in Alcochete auf der Südseite der Tejo-Mündung bei Lissabon. Sollten Sie mal hinfahren. Tolle Läden.“
„Na dann, gute Geschäfte, Richard. Immobilien, oder?“, riet Michael ins Blaue. Richard schüttelte den Kopf und lächelte für einen winzigen Moment.
„Knapp vorbei“, sagte er und klärte seine Ironie sofort auf: „Mode, Bekleidung. Wir Deutschen haben’s ein wenig schwer, gerade in Spanien und Portugal ins Geschäft zu kommen. Die haben selbst eine recht gute und kostengünstige Bekleidungsindustrie. Aber wenn man’s nicht probiert …“
„Genau“, stimmte Michael zu. „Reisen Sie aus ökologischen Überlegungen mit der Bahn?“
Wieder zeigte Richard ein Lächeln. Dieses Mal wirkte es wie von Schmerzen erzeugt: „Sicher nicht. Es ist — Flugangst. Eine Therapie hat nur bewirkt, dass ich sie wenigstens zugeben kann. Fürs G’schäft ist es natürlich nicht so prickelnd. Der Zeitaufwand, Sie verstehen — ähm, Michael, sagten Sie?“
Der kann ja doch gesprächig sein, fand Michael. Etwas Gekünsteltes an Richards bairischer Aussprache störte ihn. Es klang gelernt. Gebürtiger Rosenheimer oder Bayer war er sicher nicht, obwohl er ab und zu ein bairisches Wort einstreute. Michael wollte den Kontakt aber nicht überreizen.
„Na, vielleicht sehen wir uns ja nochmal in dem Dings, Outlet Center. Weiterhin gute Reise. Ich bin dann mal wieder bei meiner Frau“, flunkerte er. Das kam ihm einfacher vor, als lang und breit zu erklären, mit seiner langjährigen Freundin unterwegs zu sein, und es sei ihr erster Urlaub und bla, bla, bla. Nicht, dass dieser Richard auf die Idee kam, er könnte allzu neugierig werden. Michael hatte ohnehin schon überzogen.
„Ja“, sagte Richard knapp. Er wandte sich wieder seinem Handy zu und gab Michael damit zu verstehen, dass er sich nicht weiter für ihn und dessen „Frau“ interessierte. Hastig nahm er ein Laptop aus einem Transportköfferchen vom Nebenstuhl und klappte es auf. Hatten die Handy-Nachrichten nichts mit seinen Geschäften zu tun gehabt?
Drei Tage zuvor, Polizeifrust am Mittwoch
Auf Anweisung von Kommissar Kreutz nahm Nadine Sedlmeier Kontakt zum Bundeskriminalamt auf. Das BKA bearbeitete zentral alle gemeldeten Vermisstenfälle. Da es sich bei dem Skelett aus dem Wald um einen erwachsenen Mann handelte, konnte man Frauen und Kinder ausschließen. Abgesehen davon blieben für den Zeitraum 1980 bis 2000 immer noch zehntausende Fälle übrig. Zwei- bis dreihundert Menschen würden laut Bundeskriminalamt täglich und im Durchschnitt alleine in Deutschland vermisst gemeldet. Die Hintergründe von vielen vermeintlich Verschwundenen klärten sich zwar auf. Sie würden im Laufe der Zeit aus den Dateien wieder entfernt. Dennoch bliebe eine Menge an Vermisstenfällen ungelöst.
„Der Kollege vom BKA“, unterrichtete Nadine ihren Chef, „fragte, ob wir das ernst meinen mit dem Zeitraum.“
„Wieso?“ Der Kommissar schaute hinter seinem Monitor zu Nadine hinüber, die gut drei Meter entfernt an ihrem eigenen Bildschirm arbeitete.
„Weil das faktisch und praktisch unmöglich sei, einen Personenkreis in den Vermissten-Dateien ohne weitere Angaben und für die Dauer von mehr als zwanzig Jahren auch nur annähernd einzugrenzen.“
Kreutz schniefte auf.
„Schön gesagt, hilft uns aber nicht weiter. Die beim BKA werden doch was unternehmen?“
„Ortsangaben habe ich durchgegeben. Also ja, da es sich um keinen akuten Fall handelt, sondern um eine unbekannte Leiche, bekommen wir Zugriff über unser bayerisches Landeskriminalamt, und zwar auf die Datei Vermisste/Unbekannte Tote.“ Sie klickte auf die vom BKA gesendete Mail. „Die Datei heißt Vermi/Utot. Die wurde aber erst 1992 in Betrieb genommen. Wenn wir es also mit jemand zu tun haben, der davor verschwand, haben wir da keine Anhaltspunkte.“
„Na super“, ließ Kreutz missgelaunt hören. „Sonst noch etwas, was uns nicht weiterhilft?“
Nadine überging den sarkastischen Tonfall ihres Chefs: „Ja. Wir wissen nicht, ob es sich um eine ausländische Person handelt. Wenn ausländische Behörden in Deutschland ersuchen, nach einer vermissten Person zu fahnden, ist ebenfalls das BKA die zuständige Polizeidienststelle. Na, das wissen Sie ja, Chef. Die leiten die Suchmaßnahmen ein, und wenn das Ergebnis negativ ist, kommt das zu Interpol. INPOL notiert dann den Vermisstenfall und wird im Ausland tätig. Immer vorausgesetzt natürlich, dass die Person überhaupt als vermisst gemeldet wurde. Aber eine Möglichkeit gäbe es, wo man ansetzen könnte.“
Kreutz sah plötzlich hellwach aus.
„Na, lassen Sie schon hören!“
„DNA! Wenn wir da etwas zu bieten hätten, hat der Kollege gesagt. Vor allem aber betonte er noch einmal, dass der Vermisstenstatus gegeben sein muss, und damit der Zeitraum …“
„Jetzt hören Sie schon auf mit diesem verfluchten Zeitraum!“, wurde Kreutz ungehalten und laut. „DNA! Zeitraum! Vielleicht noch die Lieblingsfarbe der Socken, oder was! Ich kann auch nichts für Doc Baumgartners dürftige Angaben.“
Nadine schluckte kurz, fing sich aber schnell wieder.
„Wo sollen wir denn sonst ansetzen? Die Dateien aller Mord- und unklaren Todesfälle in Stadt- und Landkreis bin ich durch. Da ist alles archiviert. Die Österreicher müsste ich allerdings …“
Kreutz unterbrach sie erneut: „Das hilft nix. Ich muss also dem Doc Feuer unterm Hintern machen. Und wenn der endlich diesen leidigen Zeitrahmen des Todes unseres Findelkinds weiter eingrenzen kann, machen wir einen Aufruf an die Bevölkerung, ob sie sich an ungewöhnliche Vorgänge damals erinnern.“ Er schnaubte aus wie ein Pferd nach einem Trabrennen. „Vielleicht geben wir den Fall ja an diese Fahndungssendung im Fernsehen. Aktenzeichen. Das hat schon öfter was gebracht.“
23. April, im Zug — ein Anruf
Michael kehrte zu Conny an den Tisch zurück. Er rechnete mit einer spitzen Bemerkung über sein spontanes Vorpreschen. Da kam er ihr doch lieber mal zuvor und verkündete Conny: „Stell dir vor, der heißt Richard, kommt aus der Gegend um Rosenheim und hat etwas mit Mode oder so zu tun, deshalb fährt er geschäftlich nach Portugal.“
„Geschäftlich?“, fragte Conny zweifelnd zurück. „Mit der Bahn?“
„Ja. Das erklärt er mit Flugangst.“ Michael verzog skeptisch den Mund. Ganz sicher war er sich nicht, ob er diesem Richard glauben sollte. Dafür wusste er zu wenig über ihn. Connys vager Verdacht konnte sich als fataler Irrtum herausstellen. „Wir denken gleich an ein Verbrechen, weil du das aus dem Gespräch herausgehört hast. In der Pressemeldung steht aber nichts davon. Es könnten ja sowas wie antike Knochen sein.“
Das kam nicht besonders an bei Conny: „Ja, ja, weil du schon mal mit so einem archäologischen Fall zu tun gehabt hast. Warum nimmst du mich nicht ernst? Was ich gehört habe, halte ich — also ich wenigstens — für höchst brisant!“ Der letzte Satz platzte eindeutig zu laut aus ihrem Mund. Sogar der Opa und sein lebhafter Enkel sahen zu Conny und Michael herüber. „Du kannst ja mal Kommissar Kreutz anrufen“, schlug Conny mit sanfter Spitze vor. „Vielleicht ist dein Freund von der Kripo mit diesem Fund befasst.“
„Also gut“, ergab sich Michael. Er wusste genau, dass Conny meistens Recht hatte, wenn sie mit ihrer Intuition daherkam. Dagegen hatte er keine Chance. „Wir gehen jetzt zurück in unser Abteil und ich rufe Kreutz an. Im Übrigen ist der schon mal gar nicht mein Freund. Nach unserem letzten Fall ist er höchstens ein guter Bekannter.“
Beim Verlassen des Bistros mussten sie an Richard vorbei. Michael bemerkte, wie Conny ihn für einen ausführlichen Moment musterte, zu lange für sein Gefühl. Vielleicht dadurch ließ sich Richard von seiner Arbeit am Laptop ablenken und nickte zuerst Michael und dann Conny maskenhaft und flüchtig zu. Nur seine stahlblauen Augen blinzelten dabei, als blende ihn ein Licht. Michael stutzte. Hatte Conny sich doch getäuscht? Wegen eines beiläufigen, kaum mehr als pflichtgemäßen Grußes? Wohl kaum.
Im Liegeabteil setzten sich beide auf ihre Betten und atmeten erst einmal tief durch.
„Ich weiß“, begann Conny, „was du gedacht hast, als dieser Richard uns beim Rausgehen zugenickt hat.“
„Was?“
„Na, dass der doch ganz in Ordnung sein könnte, oder?“
„Keinen Moment, Conny. Keinen Moment.“ Er widmete sich seinem Handy. Kreutz’ Nummer hatte er nie gelöscht.
Es dauerte gefühlt eine Ewigkeit, bis es am anderen Ende zu Klingeln anfing.
„Kommissar Kreutz?“
„Warthens!“ Die Überraschung klang echt. Anscheinend hatte der Kommissar Michaels Nummer mit seinem Namen ebenfalls noch auf der Liste und erschien bei ihm auf dem Display.
„Was gibt’s?“
„Ich bin gerade unterwegs, deshalb mach ich’s so kurz wie möglich. Es ist wegen der Knochen, die im Keferwald …“
„Okay“, unterbrach ihn Kreutz prompt, „schießen Sie los!“
Michael erklärte haarklein, was Conny gehört hatte. Er versäumte es aber, Kreutz darüber aufzuklären, dass sie im Moment als Fahrgäste der französischen Bahngesellschaft auf Reisen waren.
„Ein Zusammenhang mit dem Fund im Wald könnte also bestehen, Kommissar.“
Lange Sekunden hörte Michael nur Atmen aus dem Smartphone. Inzwischen stellte er auf laut.
„Warthens, können Sie und Frau Linden in die Inspektion kommen?“
„Das wird umständlich. Wir befinden uns im Zug …“ Er schaute aus dem Abteilfenster und sah einen Pinienwald vorbeiziehen, „… in Südfrankreich und fahren über Barcelona und Madrid nach Lissabon. Der Mann mit Vornamen Richard übrigens auch.“
„Gut, Warthens. Oder eher nicht gut. Was machen Sie eigentlich da in Dings, in Lissabon?“
„Urlaub, Kommissar, Ferien. Und das soll auch so bleiben. Ich hab’ Sie informiert, weil Frau Linden und ich das als unsere Pflicht ansehen.“
Conny verdrehte sprachlos die Augen. Endlich musste sie Michaels Bedenken nicht mehr zerstreuen.
Er ließ sich von Connys Mimik nicht ablenken: „Sie sagten mir noch nicht, um welche Knochen es sich eigentlich handelt, Herr Kommissar.“ Er betonte Herr absichtlich, weil er wusste, dass Kreutz sich gerade von Michael dadurch eher geschmeichelt fühlte. Bedachte der ihn doch meistens ohne geschlechtsspezifische, höfliche Anrede.