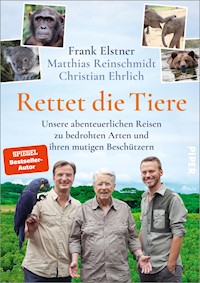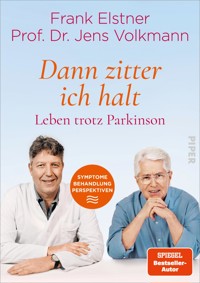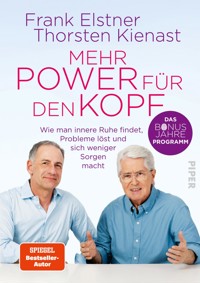
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Unser Wohlbefinden hängt nicht nur von ausreichend Bewegung und einer gesunden Ernährung ab – die mentale Seite ist der entscheidende Schlüssel für die Gestaltung unseres Lebens! Frank Elstner und der Psychotherapeut und Mediziner Thorsten Kienast zeigen in diesem Buch, wie man - mentale Kraft aufbaut, - Stress effektiv abbaut, - Probleme löst und zu innerer Ruhe findet, - wie man aufhört, sich unnötige Sorgen zu machen, - mit Ängsten umgeht und sich nicht länger selbst im Wege steht.Wir können uns jederzeit positiv verändern und unseren Alltag in Eigenregie kraftvoll bewältigen – wenn wir es nur wollen und die richtige Methode haben. Mit zahlreichen Beispielen, Übungen und Tipps! Dieses Buch zeigt einen sehr praxiserprobten Weg auf, wie jeder an sich arbeiten kann, um sich einfach (wieder) wohlzufühlen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
www.piper.de© Piper Verlag GmbH, München 2020Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: Sonja Bell (Foto); FinePic®, MünchenDatenkonvertierung: XXXXSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Einleitung
1 Verstehen, wie die persönliche Psyche funktioniert, und darüber zu Gelassenheit finden
1 Warum wir unsere Denkmaschine updaten müssen (Perspektive I)
2 Wie wir uns vor »mentalen Viren« schützen können (Perspektive II)
3 Warum unsere Herkunft uns immer noch im Griff hat (Perspektive III)
2 Wie wir mentale Fesseln erkennen, überwinden und neue Wege gehen
1 Wie die klassische Konditionierung Körper und Geist »verklebt« (Erstes Gesetz)
2 Welches Lernen die Kreativität raubt (Zweites Gesetz)
3 Wie tolle Zufälle kluge Innovationen verhindern (Drittes Gesetz)
4 Wie Lernen viral wird und unserem Gehirn den Atem raubt (Viertes Gesetz)
5 Warum wir anderen mehr nachmachen, als wir glauben (Fünftes Gesetz)
6 Wie gefährlich Bezugsrahmen sein können (Sechstes Gesetz)
3 Was uns antreibt – Motivation, Obsession, Gier und Sucht
1 Was Motivation ist
2 Wie wir Motivation entstehen lassen können
3 Was der »innere Schweinehund« ist und wie er besiegt wird
4 Wie wir mit unseren Gehirnregionen spazieren gehen können
4 Wie wir die Macht über unsere Gefühle bekommen
1 Was Emotionen sind und wofür sie gut sind
2 Wie wir Ordnung in den Gefühlsdschungel bringen
3 Wo uns Gefühle »auf die Nerven« gehen
4 Wie wir unsere Emotionen bändigen können
5 Wie wir die Macht über unsere Gedanken bekommen
1 Was der Verstand so alles macht
2 Welche Strategien hinter unserem Denken stehen können
3 Welche Denkfallen es gibt
4 Welche Tricks und Kniffe wir für einen kreativen Gedankenflow nutzen können
5 Wie wir aufdringliche Gedanken und lästiges Grübeln loswerden
6 Wie wir Energiequellen erschließen, Kraft bekommen und uns neu erfinden
1 Warum wir uns verändern müssen, um uns treu zu bleiben
2 Wie ein Lebenskompass zur Quelle des Neuanfangs wird
3 Wie mentale Ressourcen entdeckt und erschlossen werden
7 Wie wir zu innerer Ruhe und Gelassenheit finden, ohne den Anschluss zu verlieren
1 Wie wir echte Gelassenheit erkennen
2 Wie Stress im Körper entsteht und wie wir ihn beherrschen können
3 Wie wir unsere persönlichen Strategien gegen Stress finden
4 Was eigentlich Burn-out ist
8 Welche Persönlichkeitstypen es gibt und wie wir mit ihnen umgehen können
1 Was »Persönlichkeit« ist
2 Die zehn Persönlichkeitsstile kennenlernen und was wir mit diesem Wissen alles erreichen können
Ausklang
Sonderteil: Orientierungshilfe für gutes Krisenmanagement
Ein starkes Rückgrat bilden, indem Sie die fünf Bausteine psychologischen Krisenmanagements beherrschen!
Dos und Don’ts für Krisenmanager
Psychologische Tricks und Wissenswertes für ein gutes Krisenmanagement
Eine Lösung des Neun-Punkte-Rätsels von S. 155
Dank
Literatur
Einleitung
Frank Elstner
In unserer »Bonusjahre-Reihe« haben wir uns anfänglich mit dem großen Nutzen der richtigen Bewegung befasst (Bonusjahre), danach mit dem aktuellen Stand der Forschung zur Ernährung (Leben geht durch den Magen). Mein Freund und Fachmann bei den »Bonusjahren«, Prof. Gerd Schnack, ist nach einem langen und sehr erfüllten Leben im März 2020 verstorben. Bis zuletzt war er voller Pläne und Ideen, und ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihm dieses gemeinsame Projekt habe durchführen können.
Der dritte Teil dieser Reihe beschäftigt sich nun also mit dem Kopf – die ursprüngliche Intention ist allerdings geblieben, nämlich praktische Anleitungen zu liefern, die es den Lesern ermöglichen, ihren Alltag in Eigenregie kraftvoller zu bewältigen, auch und gerade wenn die ein oder andere gesundheitliche Herausforderung ihren Tribut fordert. Er fällt auch in eine Zeit, in der die Folgen der Corona-Pandemie unerwartete Herausforderungen an viele von uns stellt und noch stellen wird. Hierfür und für die Bewältigung vieler anderer Krisensituationen, die das Leben bringen kann, werden Sie in diesem Buch eine Fülle von Tricks und Kniffen aus der Psychologie vorfinden, die es Ihnen ermöglichen, auf effektive Weise Kraft zu tanken und zügig einen kühlen Kopf für gute Entscheidungen zu bekommen. Für einen besonders schnellen Zugriff auf Schlüsselstrategien zum Krisenmanagement haben wir in diesem Zusammenhang am Ende auch eine Orientierungshilfe eingebaut.
Dieses Buch richtet sich aber gleichermaßen auch an junge Menschen, die wissen wollen, wie sie ohne großen Aufwand effektiver arbeiten und leben können, wie ihnen ein gezieltes Training dabei hilft, entspannter und freudiger den oft stressigen Alltag zu bewältigen – oder auch neue Lösungen zu finden, wenn sie in schwierigen Phasen vor scheinbar unüberwindbare Hürden gestellt werden, bei deren Bewältigung sich durchaus Lebensläufe in verschiedene Richtungen entwickeln können. Und nein, es wird leider keinen Schalter geben, den man einfach umlegt, damit alles leichtfällt. Das kann dieses Buch nicht leisten – aber, mit Verlaub, auch kein anderes! Es wird jedoch zahlreiche hilfreiche Informationen und erprobte Übungen bieten, die dabei helfen, den eigenen psychischen Muskel deutlich leistungsfähiger zu machen. Als Zugabe bekommen Sie quasi ganz nebenbei viele erstaunliche psychologische Erkenntnisse in Bezug auf die menschliche Psyche vermittelt. Im thematischen Aufbau folgt dieses Buch im Übrigen einem klassischen Lehrbuch der Psychologie, aber eben pfiffig zusammengestellt und sehr gut lesbar – für Neugierige, die schon immer wissen wollten, wie andere Menschen und sie selber ticken.
Ich habe in meiner langen Tätigkeit in den Medien zahlreiche kluge, interessante Köpfe kennengelernt: Visionäre, die gegen gewaltige Widerstände große Projekte riskiert und geschultert haben, die sich nicht unterkriegen ließen von Zweiflern, nicht einmal von zahlreichen und oft bitteren Rückschlägen. Aber natürlich auch Menschen, die grandios gescheitert sind. Fernsehproduktionen – und vor allem Kinofilme – sind immer extrem teure und riskante Unternehmen, bei denen Siege und Niederlagen meist nahe beieinanderliegen. Immer wieder habe ich mir die Frage gestellt: Was unterscheidet letztendlich die Gewinner von den Verlierern? Welche Eigenschaften haben sie, um ihre Vorstellungen durchzusetzen und ein entspanntes und dadurch auch glückliches Leben zu führen? Und wie bekommen sie die dunklen Mächte unter Kontrolle, die sie von ihren Wegen abbringen wollen?
Ich habe häufig das Glück gehabt, als Kreativer mit anderen Kreativen zu arbeiten. Einer von ihnen ist André Heller, den ich schon in den Sechzigerjahren kennengelernt habe. Wir haben damals einige sehr beliebte Radiosendungen zusammen gemacht, danach habe ich seine unglaubliche Karriere beobachtet und mich über seine großen Erfolge über die Jahrzehnte hinweg sehr gefreut. André Heller hat immer nahezu Unmögliches versucht und geschafft, er hat den Zirkus neu definiert, mit afrikanischen und asiatischen Akrobaten gearbeitet, sensationelle Feuerspektakel veranstaltet und Zaubergärten am Gardasee und in Marrakesch initiiert. Er hat auch viel beachtete Lieder geschrieben, eines davon heißt: Die wahren Abenteuer sind im Kopf.
Darüber rede ich mit Prof. Dr. Thorsten Kienast, der sehr genau weiß, was in unserem Kopf vor sich geht. Der uns zeigt, wie wir diese Mindmaschine »Gehirn« optimal einsetzen und an welchen Stellschrauben wir dafür drehen müssen. Der uns auch warnen kann vor den Fallen, in die wir oft rennen, wenn einige Teile dieser Schaltzentrale unter unserer Schädeldecke gegeneinander arbeiten. Wir werden auch lernen, wie wir dieses Gewirr aus Nervenbahnen und chemischen Reaktionen optimal programmieren, um unsere Ziele zu erreichen – und dass wir diese erst einmal definieren müssen, wenn wir Erfolg haben wollen.
Lieber Thorsten, hat André Heller recht, wenn er sagt, »Die wahren Abenteuer sind im Kopf. Und sind sie nicht im Kopf – dann sind sie nirgendwo«?
Thorsten Kienast
Thorsten Kienast: Ja, hat er. Und wir können uns ja mal auf die Suche machen.
1Verstehen, wie die persönliche Psyche funktioniert, und darüber zu Gelassenheit finden
Hier erfahren Sie:
1Warum wir unsere Denkmaschine updaten müssen (Perspektive I)
Frank Elstner
Elstner: Ich habe im Laufe der Jahrzehnte viele interessante Biografien gelesen, viele spannende Künstler kennengelernt, viele von ihnen sind auch kommerziell sehr erfolgreich. Einige allerdings haben ihren Ruhm nicht verkraftet – oder auch die Tatsache, dass ihr Können irgendwann nicht mehr so gefragt war. Gelegentlich haben uns dann die Agenturen gesagt, dass ein ehemals bekannter Showstar nicht mehr vorzeigbar ist. »Der tickt nicht mehr richtig«, erfuhren wir dann unter der Hand. Aber wir sehen auch, dass eine Krise, die viele Menschen betrifft, wie die Corona-Krise, dafür sorgt, dass sich viele mit einem Mal komplett anders verhalten als vorher. Einige laufen zu Höchstform auf, andere verfallen in eine Lähmung. Was können wir tun, dass wir immer »richtig ticken«?
Thorsten Kienast
Kienast: Nun, da gibt es viele Wege …
Elstner: Hast du eine Anleitung, so etwas wie »Richtig ticken für Dummies«?
Kienast: Probieren wir es mal. Erste Voraussetzung ist, dass wir zunächst einmal herausfinden, wie wir ticken, also erkennen, was unser Denken und Fühlen beeinflusst und uns bei unseren Entscheidungen hilft. Ich mache das jetzt mal mit dir. Erzähl doch einmal: Wie hast du es eigentlich geschafft, so erfolgreich in der Medienbranche zu werden? Wie sahen deine ersten Schritte aus?
Elstner: Ich bin da natürlich etwas erblich vorbelastet. Meine Eltern waren beide Schauspieler, wir sind häufig umgezogen – je nach Engagement. Und so kamen wir nach Baden-Baden, wo mein Vater am Theater gastierte und meine Mutter beim damaligen Südwestfunk arbeitete. Der hat schon früh eifrig Hörspiele produziert, und eines Tages suchten sie einen Jungen, der Hochdeutsch spricht. Und da kam ich ins Spiel. Ich konnte mir ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Spätestens, als ich bei dem Hörspiel Bambi die »Hauptrolle« bekam, war meine Leidenschaft für dieses Medium geboren. Einerseits, weil ich spürte, dass diese Tätigkeit Spaß macht, andererseits auch, weil ich finanziell etwas zur Familienkasse beisteuern konnte – die war nicht sehr üppig bestückt, wir hatten eigentlich keinen finanziellen Spielraum.
Kienast: Glaubst du, du hättest auch so viel im Studio gearbeitet, wenn deine Eltern mehr Geld gehabt hätten?
Elstner: Wahrscheinlich nicht. Dafür bin ich zu gerne draußen gewesen. Allerdings bin ich beim Fußballspielen bei der Wahl der Teammitglieder immer als Letzter übrig geblieben und hatte daher auch so ein bisschen den Drang, mich anderswo zu beweisen. Es ist kein wirklich gutes Gefühl, bei der Mannschaftszusammenstellung immer bis zum Schluss stehen bleiben zu müssen, weil dich keiner in seiner Gruppe haben möchte. Aber ich habe auch noch andere Sachen gemacht. Kennst du den »Hungerberg« in Baden-Baden?
Kienast: Ja, an dem sind wir vor einiger Zeit entlanggefahren.
Elstner: Dort habe ich als Schüler eine größere Anzahl von Bäumen gesetzt und immer wieder bei der Pflege geholfen. Solche Sachen habe ich sehr gerne gemacht. Auch mit Freunden. Und von solchen Arbeiten gab es hier im Schwarzwald eine ganze Menge. Wenn ich nicht immer den Gedanken gehabt hätte, meine Familie mit meinem Job zu unterstützen, wäre ich allerdings nicht so eifrig dabeigeblieben.
Kienast: Okay, das hat dir also Freude gemacht, das behalte ich jetzt einmal im Hinterkopf. Kommen wir aber nun noch einmal zurück zum Fußball: Warum bist du da so oft als Letzter übrig geblieben?
Elstner: Ganz einfach – ich habe grottenschlecht gespielt! Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, dass ich nur eingeschränkt sehen kann. Du weißt doch, dass eines meiner Augen von Geburt an verkümmert ist. Für mich ist das kein Problem, denn ich kenne es nicht anders. Aber einige Dinge gehen dann eben nicht ganz so gut. Und dazu gehört räumliches Sehen. Das hat dazu geführt, dass ich beim Fußball nicht der Held gewesen bin, obwohl ich das Spiel selbst sehr mag und ein großer Fan bin.
Kienast: Also, kurz gesagt: Weil du weniger frustrierende Erfahrungen beim Fußballspielen machen wolltest, bist du lieber ins Studio gegangen und hast die Tage dort verbracht?
Elstner: Ja. Es hat mich auch zunehmend interessiert, was die Leute dort machen, und ich fand es toll, dass man die Ergebnisse alle später im Radio und Fernsehen hören oder sehen konnte. Und man hat eben Geld verdienen können. Eine komplett neue Welt, in der ich aufgegangen bin. Nebenbei – beim Radio hat es naturgemäß niemanden interessiert, wie ich aussah oder ob ich räumlich sehen konnte, da war nur wichtig, dass ich über Sprache gute Stimmung verbreiten konnte …
Kienast: Lass mich noch eine weitere Frage stellen: Du hättest ja auch eifriger trainieren können, um beim Fußball zu punkten. Warum hast du das nicht gemacht?
Elstner: Na ja, durch mein Handicap waren die langfristigen Erfolgsaussichten nicht besonders gut. Und ich wollte vor allem auch nicht verantwortlich gemacht werden, wenn meine Mannschaft verliert. Es fiel mir auch schwer, immer mitzuhalten – im Studio ist mir dagegen alles sehr leichtgefallen. Außerdem: Der Ton auf dem Fußballplatz war mir oft zu rau, zu laut. Im Studio dagegen herrschte Stille!
Kienast: Fassen wir doch diese ersten Erkenntnisse einmal zusammen: Obwohl das ja nicht immer ein Zuckerschlecken war beim Sender, bist du dabeigeblieben, weil die Leute dich talentiert fanden und du Chancen und Anerkennung bekommen und dabei auch noch Geld verdient hast. Mit dem kleinen Einkommen konntest du deine Eltern entlasten und indirekt auch deinen eigenen Wert erhöhen. Außerdem kam es zu dem glücklichen Umstand, dass dein Sehdefizit keine Rolle spielte und sich niemand daran störte. All das – und ein Quäntchen Glück – hat letztlich dazu beigetragen, dass deine Laufbahn so ihren Anfang genommen hat. Die Tatsache, dass du deine Aufgaben auch immer erfolgreich zu Ende gebracht hast, hat dir zusätzlich die nötige Kraft gegeben, den damit verbundenen Stress auf Dauer durchzuhalten. Das ist wichtig zu wissen: Nicht nur das bloße Talent oder die Freude an deiner Arbeit hat dir geholfen, sondern auch das Gefühl, genau das Richtige zu tun. Du hast also eine Erfahrung gemacht und gelernt. Darauf hat sich dein weiteres Planen und Handeln aufgebaut. Neudeutsch würden wir sagen: Du hast dir eine »App« in deiner Psyche zusammengebastelt, die dich mehr oder weniger automatisch in eine bestimmte Richtung gelenkt hat – deine Arbeit beim Rundfunk.
Elstner: Ich wusste anfangs natürlich nicht, wohin das Ganze führt. Aber was du sagst, trifft zu. Ich vermute mal, das ist bei den meisten Menschen so, dass sich der Lebensweg einerseits aus Zufällen und andererseits aus den gemachten Erfahrungen und auftauchenden Chancen zusammensetzt.
Kienast: Nun versuche ich einmal zu verstehen, warum du dich für deine Talente entschieden hast, viele Menschen arbeiten ja ein Leben lang eher gegen ihre Talente an. Also: Was man oft hört, wenn über dich gesprochen wird, sind Beschreibungen wie »freundlich«, »höflich«, »liebenswert«. Aber manchmal hast du dich doch sicher auch aufgeregt, hast vielleicht jemanden beleidigt oder angemeckert. Wie bist du mit Gästen umgegangen, mit denen du nun gar nichts anfangen konntest?
Elstner: Na ja, ich hatte meist eine komfortable Situation: Da ich ja immer derjenige war, der die Fragen stellte, war es mir auch jederzeit möglich, das Gespräch zu gestalten. Wenn ich also den Eindruck hatte, dass es todlangweilig war, was da inhaltlich rüberkam – weil der Interviewpartner beispielsweise vorgefertigte Statements abgab –, habe ich versucht, verstärkt nach den Gründen für sein Handeln zu suchen, nicht nur nach den Ergebnissen. Und da versteckten sich oft die interessanteren Geschichten.
Wichtig ist übrigens auch das richtige Maß an Vorbereitung. Wenn man von seinem Gegenüber zu viel weiß und schon alle Antworten kennt, ist man als Interviewer nicht mehr neugierig. Wenn man aber zu wenig weiß, merkt der Gesprächspartner, dass der Interviewer keine Ahnung hat, und ist eventuell beleidigt. Wenn man es schafft, hier die richtige Balance zu finden, spiegelt sich das auch in den Einschaltquoten wider, von denen wir letztlich abhängig sind.
Kienast: Das ist auch ein bisschen so in meinem Job. Wir Verhaltenswissenschaftler und Psychotherapeuten haben jedoch in den Verhaltenstrainings keine Zuschauer, die wir unterhalten müssen. In diesem Unterschied steckt auch eine weitere deiner Eigenschaften, die viele Menschen sehr zu schätzen wissen: die Fähigkeit, aus einem Gespräch heraus gute Unterhaltung zu formen! Dieser »Entertainment-Faktor« ist bei uns an der Uni auch gefragt – allerdings nur von den Studenten in der Vorlesung.
Elstner: Zugegeben, es ist recht schwierig, über sich selbst zu lachen, wenn man gerade durch unsichere Zeiten geht. Das gilt wohl für prominente Interviewpartner genauso wie für jeden anderen Menschen auch.
Kienast: Vom verkannten Fußballspieler zur Showlegende – warum hast du das so gut hinbekommen?
Elstner: Gute Frage. Übung?
Kienast: Bestimmt. Aber ist das alles wirklich nur Übung? Oder steckt da noch etwas anderes dahinter?
Elstner: Du meinst, vielleicht so etwas wie ein angeborenes »Zuhörergen?«
Kienast: Gute Idee! In jedem Fall würde ich bei dir ein oder mehrere angeborene Talente für den Umgang mit Menschen annehmen. Deine Offenheit und Wertschätzung und vor allem deine Neugier sind die Triebkräfte. Wir nennen diese Talente Traits, das sind Persönlichkeitseigenschaften, die schon sehr früh im Leben eines Menschen zum Tragen kommen. Der Trait der Aufgeschlossenheit passt bei dir wie ein fehlendes Puzzlestück. Damit ist schon einmal eine sehr gute Konstellation erreicht. Zur Info: Andere sehr bekannte und wissenschaftlich sogar messbare Traits wären zum Beispiel: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit – aber auch viele andere mehr. Damit sich ein solcher Trait nun richtig entfalten kann, benötigt er allerdings noch einen weiteren Faktor, der ihn aktiviert, einen Zünder sozusagen.
Elstner: Was könnte dieser »Psychozünder« sein?
Kienast: Eine »Grundannahme«, wie die Psychologen sagen. Oder einfacher ausgedrückt: ein Leitsatz! Das ist die erste Perspektive in unserem Kapitel »Wie wir ticken«. Kennt man seine eigenen Leitsätze, kann man fast schon vorhersagen, wie man in bestimmten Situationen reagieren wird. Leitsätze sind automatische Auslöser für bestimmte Verhaltensweisen – und auch Motivatoren, die uns wie von Geisterhand immer in ähnliche Situationen drängen, also immer dieselben Perspektiven vorschlagen, aus denen heraus wir Situationen betrachten. Meist haben Menschen, deren Leitsätze eine sehr starke Wirkung entfalten, irgendwann in ihrer Lebensgeschichte über längere Zeit die Erfahrung gemacht, dass sie damit sehr gut fahren. Und diese Erfahrungen haben sie geprägt! Was, denkst du, ist dein Leitsatz?
Elstner: Da gibt es einige, beispielsweise: »Der andere könnte recht haben.« Diese hilfreiche Erkenntnis ist allerdings nicht von mir, sondern stammt von dem bekannten Philosophen Hans-Georg Gadamer.
Kienast: Ich bin jetzt mal mutig und schließe aus dem, was ich von dir kenne, das Folgende: Du bist durch diesen Leitsatz darauf »konditioniert«, abzuwarten, was die anderen sagen, zuzuhören, die empfangene Information durch deinen Kopf laufen zu lassen und dann erst zu bewerten.
Elstner: Stimmt.
Kienast: Das macht nicht jeder so. Einigen Menschen ist völlig egal, was der andere sagt. Die gehören dann nicht gerade zu den besten Moderatoren im Showbusiness. Du hast jedoch immer im Blick, dass viele unterschiedliche Wege möglich sind, um ein Ziel zu erreichen. Und du bist neugierig, weil du überzeugt bist, dass die Art und Weise, wie dein Gesprächspartner denkt und vorgeht, dich und die Zuschauer bereichern könnte – gerade, wenn er etwas anders tickt als andere Menschen. Ein Leitsatz wie »Der andere könnte recht haben« verhilft einem zu einer guten Mischung aus Geduld und Neugier, verbunden mit einer souveränen Zurückhaltung. Wenn man interessiert zuhört, was das Gegenüber mitteilt, kann man sich auch in aller Ruhe eine clevere Reaktion zurechtlegen. Solche Erfahrungen trainieren Gelassenheit, Geduld und Empathie. Und gerade Empathie ist das stärkste Instrument der sozialen Intelligenz: feine, aber mächtige Antennen des zwischenmenschlichen Miteinanders, die es ermöglichen, immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Ein solcher Leitsatz zündet die passenden Traits, und die wiederum lassen deine »Psycho-App« erfolgreich laufen. Jeder hat zwischen einem und drei solcher Kernleitsätze. Selten mehr. Sie sind wenig flexibel, aber sichern den eigenen Persönlichkeitsstil. Unsere ganz persönliche Marke.
Elstner: Das bedeutet, unser Gehirn greift auf unsere Erfahrungen zurück und entscheidet dann, wie wir denken, handeln – ja, wie wir »ticken«? Und lässt sich dabei durch solche Leitsätze tatsächlich recht einfach beeinflussen?
Kienast: Genau. Und das in einem dramatischen Ausmaß. Unsere wichtigsten Lernerfahrungen nennt man nicht umsonst Prägungen. Also – du machst auf irgendeinem Gebiet eine neue Erfahrung, probierst etwas aus. Je nach Ergebnis leitet unser Gehirn ganz reflektorisch Regeln ab, die den kommenden Erfahrungen sofort einen Stempel aufdrücken, indem sie diese, grob gesagt, als gut oder schlecht definieren, also in eine Schublade stecken. Der Begriff des Stempels ist sehr wichtig für das Verstehen. Stempel sind Prägungen, Regeln und Erfahrungen, die – zusammen mit einem stereotypen Handlungsmuster – verpackt, verschnürt und wie ein Computerprogramm auf einer Festplatte im Unterbewusstsein abgelegt werden. Passiert nun ein ähnliches Ereignis wie das abgelegte, startet die App automatisch, und wir greifen ohne Umweg oder intensives Nachdenken auf dieses abgelegte Muster zurück. Wir handeln, ohne uns aber tatsächlich an die neue Situation anzupassen, was oftmals eigentlich notwendig wäre. Man könnte auch sagen, wir reagieren dann stumpf, weil unsere Handlung genauso unüberlegt abläuft, wie es die vorprogrammierte App verlangt. Und von solchen ursprünglich einmal erlernten, mittlerweile aber automatisch ablaufenden Handlungsmustern haben wir jede Menge, weil sie sich natürlich im Rahmen unserer Lebensgeschichte als gezogene Lehren aus verschiedenen Lebenssituationen ansammeln. Die Biografie als Lehrmeister. Die so programmierten Handlungsmuster sind in jedem Moment startbereit und warten treu darauf, zum Einsatz zu kommen. Sie sind es, die uns oft die Entscheidung abnehmen, wie wir uns verhalten sollen. Sie machen uns zu der Person, als die wir gesehen werden.
Elstner: Also eine Reihe von Autopilot-Programmen, die uns viel Alltagsarbeit abnehmen.
Kienast: Und im Grunde ist das auch alles gut so. Denn das ist ja der Sinn von Lernen: dass wir Lehren, also Regeln, aus dem Gelernten ableiten und nicht jedes Mal von Neuem nachdenken müssen, wie wir uns verhalten sollen. Stell dir vor, du braust mit dem Auto bei Rot über die Ampel, wirst geblitzt, musst eine ordentliche Strafe bezahlen und bekommst noch einen Punkt als Zugabe. Diese Erfahrung bekommt den Stempel: »Auf alle Fälle künftig verhindern.« Beim nächsten Mal wirst du, ohne groß darüber nachzudenken, schon bei Gelb rechtzeitig auf die Bremse treten, damit sich die schlechte Erfahrung nicht wiederholt. Zumindest passiert das bei den meisten so. Regeln oder Stempel geben einem den Impuls, bekannte Situationen schnell einzuordnen. Aber sie haben einen Nachteil: Sie können das eigene Denken auch einengen, weil man geneigt ist, künftig immer nach Schema F vorzugehen. Man wird manchen Situationen gegenüber unsensibler und weniger empathisch und merkt es nicht mehr, wenn sich wichtige Parameter verändern. Schema F halt. Solche Stempel können uns ganz plötzlich, aber auch schleichend ihre Prägung aufdrücken. Bei einem überwältigenden Phänomen geht es sehr schnell, bei einem schwachen, aber über eine lange Zeit regelmäßig eintretenden Erlebnis geht es Schritt für Schritt. Um nicht immer wieder in dieselbe Falle zu tappen, muss man Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und Feingefühl trainieren. Denn dadurch bekommt die Prägungs-App die Möglichkeit, sich ein Update, eine Version 3.0 oder 4.0, zu ziehen und auf dem »Psycho-Prozessor« wieder gut zu laufen. Wenn man das nicht tut, läuft man Gefahr, in einem veralteten Betriebssystem stecken zu bleiben – wenn wir in der Computersprache bleiben wollen. Oder anders ausgedrückt: in das Raster »Old School«, »unbelehrbar« oder »seltsamer Typ« zu fallen.
Elstner: Das sollte man vermeiden. Woher kommt denn dieser Ausdruck Schema F eigentlich?
Kienast: Das geht auf das preußische Militär zurück. Das hat im Jahr 1861 begonnen, Berichte über die aktuelle Truppenstärke einzufordern. Dafür wurde eine Vorlage erstellt, die immer nach dem gleichen Muster ausgefüllt werden musste. Diese Vorlage hieß »Frontrapport«, daher das F. Wichtig für uns – es ist hilfreich, unsere Stempel kennenzulernen. Denn dadurch können wir begreifen, warum wir uns in bestimmten Situationen immer ähnlich verhalten. Und wenn darunter Situationen sind, die uns immer wieder Probleme bereiten, können wir versuchen, durch das bewusste Verändern dieser Prägungen unser Verhalten zu beeinflussen! Das geht mit etwas Training leichter, als man denkt.
PRÄGUNGEN, STEMPELUNDPSYCHO-APPs
Besondere lebensgeschichtliche Lernerfahrungen nennen wir »Prägungen«. Die daraus abgeleiteten Lektionen nennen wir »Stempel«. Ein solcher Stempel prägt das Verhalten der betroffenen Person in ihrem heutigen Alltag klar erkennbar und wird so sichtbar.
Beispiel: Wird eine Person durch ein Umfeld geprägt, in dem immer eine hohe Leistung eingefordert wird, könnte der Stempel beispielsweise lauten: »Ohne Fleiß kein Preis.«
Aufgabe Teil 1:
Nehmen Sie sich hierfür eine Stunde Zeit. Forschen Sie nach sechs Personen oder erlebten Situationen in Ihrem Leben, die einen solchen Stempel hinterlassen haben. Notieren Sie diesen Stempel auf einem Blatt Papier.
Beispiele: Person X: »Jungs weinen nicht«, Lehrer: »Wer nicht lernt, braucht überhaupt nicht erst anzutreten«, Person Y: »Die anderen sind alle Aufschneider.«
Aufgabe Teil 2:
Versuchen Sie nun, die vergangenen zwei Wochen vor Ihrem inneren Auge gründlich durchzugehen, und schauen Sie, wann und in welchen Situationen jeder einzelne dieser Stempel Ihren Blick, Ihr Verhalten, Ihre Gedanken, Ihre Gefühle oder Ihre Entscheidungen beeinflusst hat. Damit erkennen Sie Ihre persönlichen Apps, die sich aus dieser Prägung und diesen Stempeln gebildet haben. Geben Sie jeder App einen für Sie griffigen Namen, und zählen Sie, wie viele Apps Ihr Alltagsgeschehen beeinflussen.
Beispiele für Namen: »Gollum«, »Sturmtief Nobody«, »Bernd«, »Clown«, »Schneeflocke« usw.
Aufgabe Teil 2 – alternativ:
Wenn Sie keine aktivierten Apps aus den letzten zwei Wochen aufspüren können oder Spaß an der obigen Übung bekommen haben: Beobachten Sie in den nächsten zwei Tagen genau, ob, wann und wie einer der sechs Stempel aktiviert wird und wie Ihr Verhalten, Ihr Gefühl, Ihre Gedanken und Entscheidungen dadurch beeinflusst werden. Letzteres sind Ihre »Alltags-Apps«, die zwar automatisch und besonders schnell, leider aber wenig flexibel Ihr Leben bestimmen.
2 Wie wir uns vor »mentalen Viren« schützen können (Perspektive II)
Elstner: Es ist natürlich nicht sonderlich überraschend, dass die Vergangenheit solch einen Einfluss auf unser Leben und unsere Entscheidungen hat. Aber gut zu wissen, dass wir es in der Hand haben, vorgegebene Muster zu korrigieren, wenn wir das wollen. Allerdings prägt sich ja nun nicht jede Erfahrung unauslöschlich ein.
Kienast: Richtig, und genau deshalb ist es auch so hilfreich zu wissen, wann diese Stempel aktiv werden. Denn sie geben eine Richtung vor, können Kraft geben – andererseits aber auch die Flexibilität rauben, die wir vielleicht in diesem Moment benötigen würden. Wem die obige Übung nicht reicht, dem empfehle ich sehr, sich einen enorm effizienten neuropsychologischen Mechanismus anzuschauen, der viel zu unserer inneren Programmierung beiträgt. Das ist die zweite Perspektive in diesem Kapitel, die es uns ermöglicht, noch einmal auf eine andere Weise herauszubekommen, wie wir ticken. Das läuft über das sogenannte »symbolische Lernen« – also die Fähigkeit des Gehirns, aus erzählten Geschichten Schlussfolgerungen zu ziehen und daraus eine »gefühlte« Wirklichkeit zu machen. Wohlgemerkt: Wir sprechen jetzt über eine einzelne ganz spezielle und folgenreiche Fähigkeit, die das Organ »Gehirn« besitzt. Eine Fähigkeit, die wir alle haben und die ganz automatisch, ungefragt anspringt! – Ein Trick der Evolution in unserem Kopf, und mit dem Ergebnis müssen wir dann wohl oder übel zurechtkommen. Ein Beispiel: Ein Junge hört von seinem Vater: »Das kannst du ja hervorragend. Aus dir wird bestimmt einmal ein guter Programmierer.« Symbolisch ausgedrückt, würde das heißen: Ich = guter Programmierer. In diesem Fall besteht ein positiver Bezug, der durch das Symbol »=« gekennzeichnet ist, nämlich das Gleichheitszeichen. Einmal gelernt, wird dieser Bezug auch in Zukunft immer positiv eingeschätzt werden.
Derartige Programmierungen funktionieren aber auch in der anderen Richtung, wenn es zum Beispiel heißt: »Ich glaube, du hast für Sprachen keine Begabung.« In der symbolischen Lernsprache ausgedrückt, würde es sich so lesen: »Ich ≠ Sprachen.« In diesem Fall gilt »≠« als Symbol für eine Beziehung, die auch zukünftig negative Auswirkungen vorhersagt. Es gibt viele Zeichen, die verschiedene Satzteile miteinander in einen Bezug setzen, Worte wie mehr (»>«), weniger (»<«), besser (»>«), schlechter (»<«), schneller (»>«), weiter (»>«), ähnlich (»=«) und so weiter. Meistens beeinflussen einen die negativen Formeln stärker.
Elstner: Ich verdränge solche negativen Äußerungen eigentlich sehr effektiv. Beispielsweise schlechte Kritiken, weil ich ja die Hintergründe kenne und weiß, ob etwas gut oder schlecht funktioniert hat, und deshalb einen anderen Schwerpunkt setze als die Kritiker.
Kienast: Genau. Es hängt von der Person und der Situation ab, in der einem so etwas gesagt wird. Wenn sich Kritik potenziert und mehrfach vorkommt oder von wichtigen Personen kommt, dann werden solche Äußerungen bedeutsam, dann brennen sie sich in die Psyche ein. Wie Viren oder Trojaner in einem Computerprogramm. Dann können sie hoch viral werden und sich in alle Lebensbereiche ausbreiten, die emotionale Hintergrundmusik unseres Handelns, Denkens und Empfindens bestimmen und unsere Entscheidungen dominieren. Ob wir überwiegend fleißig sind aus Angst vor Misserfolg (»<«) oder aus Freude am Thema (»>«). Ob wir Wissenschaft zur Selbstwertrettung betreiben (»<«) oder aus Interesse (»>«) und so weiter. Beide Auslöser sind jeweils legitim, aber das Lebensgefühl und die Folgen fühlen sich jedes Mal komplett anders an. Bei dem einen greift die »Entwicklungsmotivation«, bei dem anderen eine »Vermeidungsmotivation.«
Elstner: Im Leben dominiert sicher immer mal die eine oder die andere Version.
Kienast: Wobei die Vermeidungsmotivation einfach viel mehr Energie verbraucht und die Lebensqualität senkt. Das geht lange gut, kann sich aber irgendwann so anstrengend anfühlen, wie wenn man versucht, über eine lange Strecke im zweiten Gang mit achtzig Stundenkilometern über die Autobahn zu rollen, weil man sich nicht traut, in höhere Gänge zu schalten. Da fragt man sich manchmal: »Warum bin ich so?« Jetzt wissen wir: Unsere Bezugnahmen beziehungsweise das symbolische Lernen sind die Ursache für diesen selbst auferlegten Stress. Verrennen wir uns in eine Tätigkeit, die wir eigentlich nicht wollen und/oder nicht adäquat beherrschen, befinden wir uns in einem falschen »Bezugsrahmen«.
Elstner: Wie ist denn dein Bezugsrahmen? Wo erkennst du, dass du etwas nicht kannst?
Kienast: Beispielsweise wenn ich in der Küche stehe und meinen Gästen, meist meinen Kindern, aber auch oft meinen Freunden, etwas wirklich Gutes bieten möchte. Ich gebe mir die größte Mühe, vertraue auf meine Kreativität und koche … Spaghetti mit Tomatensoße. Das ist für mich dann schon großes »Koch-Kino« – riesiger Topf, frische Kräuter und italienisches Flair … so gut ich das eben hinbekomme. Aber meine Kinder haben längst komplett durchschaut, dass diese Inszenierung ein bloßes Ablenkungsmanöver davon ist, dass sie in kulinarischer Hinsicht nicht viel von mir erwarten können. Meine Frau schmunzelt liebevoll und kann damit gut umgehen. Ihr obligatorischer Stempel für mein Bemühen, also ihr symbolischer Satz, verkündet: »Thorsten << alle anderen Personen, die wir kennen in der Kochkunst.«
Wenn ich nach Abschluss des Essens frage, wie es denn geschmeckt hat, lenken meine Freunde in der Beurteilung geschickt von der eigentlichen Mahlzeit ab und loben stattdessen einfach die tolle, entspannte Atmosphäre, die bei uns herrscht, wenn ich koche – weil sie nett zu mir sein wollen und den entscheidenden Mangel meiner recht monotonen Speisekarte diplomatisch umschiffen möchten.
In meiner Studentenzeit habe ich den gut gemeinten Rat bekommen, mal einen Kochkurs zu besuchen. In meiner Zeit als Assistenzarzt habe ich dann sogar Kochbücher geschenkt bekommen – ein massiver Wink mit dem Zaunpfahl. Alles schon frühe Anzeichen dafür, dass ich kochtechnisch noch Luft nach oben habe. Allerdings habe ich mich in dieser Hinsicht dennoch nicht weiterentwickelt, woran du auch erkennst, dass man sich über sämtliche negative Anzeichen hinwegsetzen kann. Trotz aller gefühlten Fehlschläge koche ich nach wie vor mit der gleichen – leider immer noch ungeteilten – Leidenschaft.
Elstner: Ich habe nach einigen dokumentierten Unfällen in der Küche meine diesbezüglichen Bemühungen eingestellt …
Kienast: Ich nicht, man findet mich nach wie vor am Herd. Wenn Not am Mann ist und der Hunger grassiert, bin ich gerne mit Spaghetti Napoli zur Stelle. Und meine Vollkornpfannkuchen sind berüchtigt. Daran siehst du jedenfalls, dass man die meisten Bezüge wie »Das liegt dir nicht« oder »Das schaffst du sowieso nicht« problemlos übergehen kann. Sie sind einfach nicht wichtig, wenn wir es schaffen, ihnen einfach keine Bedeutung beizumessen.
Elstner: Aber manchmal wirken sie nach – so im tiefen Inneren …
Kienast: Genau. Man kann nicht alle Formen dieser Bezugnahmen so gut überspielen. Und so kommt es, dass jeder von uns ein, zwei oder drei solcher Stempel verinnerlicht hat, die die mächtige Fähigkeit besitzen, uns je nach Situation kraftvolle Flügel zu verleihen oder aber uns bösartig auszubremsen. Und das sind eben diese kleinen, aber entscheidenden Leitsätze oder Grundannahmen. Ein Informatiker würde sagen, es sind Mikroprogramme, die – wie ein Trojanisches Pferd getarnt – die Fähigkeit haben, unsere großen Standardprogramme immer wieder stören, falsch lenken und sogar zum Absturz bringen zu können. Während die Apps aus Perspektive I fast immer auf die gemachten Erfahrungen zurückzuführen sind, sind die Mikroprogramme in dieser Perspektive Verhaltensweisen, die sich aufgrund der Fähigkeit des Gehirns, symbolisch zu denken, verselbstständigt haben. Deshalb ist es hier schwieriger herauszufinden, wo die eigentlichen Ursachen zu finden sind.
Die Folgen, die es hat, wenn wir auf diese Grundannahmen hören, können grundsätzlich positiv oder negativ sein, bilden aber fast nie die Wahrheit realistisch ab. Wohl dem, der hier das eine vom andern unterscheiden kann! Zusammengefasst und anhand einer weiteren Informatikmetapher formuliert: Aktivierte Trojaner täuschen unser Fühlen, Denken und Verhalten wie ein Kartenspieler, der mit gezinkten Karten spielt, während wir selbst treudoof davon ausgehen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Jedenfalls ist es so, dass solche Grundannahmen einen ganz schön in die Irre führen können – oder zu Höchstleistungen treiben! Man kann viel Geld verdienen, wenn man fleißig ist, man kann aber auch viel verlieren, weil man fleißig ist.
Elstner: In Sachen Höchstleistungen fällt mir ein Sportler ein, der etwas geschafft hat, was ihm niemand zutraute. Erinnerst du dich noch an Eddie The Eagle?
Kienast: Dieser englische Skispringer? Der so halsbrecherisch die Schanzen heruntergesprungen ist?
Elstner: Der sah als Junge im Fernsehen die Olympischen Winterspiele, und so war der Wunsch geboren, später selbst einmal Olympiasieger zu werden. Seine Grundannahme könnte also gewesen sein: »Ich schaffe das, mir kann nichts passieren.« Die Haltung aller anderen Menschen auf der Welt: »Der hat sie nicht mehr alle.« Jeder riet ihm von weiteren Bemühungen ab, weil er sportlich nur wenig Begabung zeigte, das heißt, seine tatsächlichen Fähigkeiten blieben gravierend hinter seinen Erwartungen zurück. Bei keiner Sportart, die er ausprobierte, kam er auch nur annähernd in die Nähe der vorderen Plätze, die ihn für die Olympischen Spiele qualifiziert hätten – außer beim Skispringen, da war er nämlich der einzige englische Athlet! Er wurde nicht Olympiasieger, aber immerhin berühmt. Doch so liebenswert sein Vorgehen auch war, objektiv betrachtet, war das Ganze für ihn immer lebensgefährlich.
Kienast: Michael Edwards – so lautet sein bürgerlicher Name – hat seine Entscheidung derart konsequent getroffen, dass man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass seine Grundannahme eine entscheidende Rolle gespielt hat. Sie war es, die ihm letztlich die Flügel verliehen hat, mit denen er die wagemutigen Sprünge entgegen der Vernunft absolvieren konnte. Trotz aller gut gemeinten Ratschläge von Fachleuten, die ihn von diesem Selbstmordkommando abhalten wollten. Hätte er seiner Grundannahme nicht getraut, hätte er sich das Skispringen lediglich im Fernsehen oder vielleicht noch vor Ort angeschaut – und sich möglicherweise ein paar Knochenbrüche erspart.
Elstner: Aber wir hätten auf eine der kuriosesten Geschichten der Olympischen Spiele verzichten müssen …
Kienast: Das war gewissermaßen – weil es glimpflich ausgegangen ist – die Abteilung »Grundannahmen lassen einen über sich hinauswachsen«. Aber Grundannahmen können auch bremsen und dadurch Erfolge verhindern. Du wärst vielleicht ein toller Fußballtrainer geworden, wenn du deine Fußballambitionen ernsthaft weiterbetrieben hättest. Oder ein begehrter Charakterdarsteller, wenn du nicht nach ersten ernüchternden Erlebnissen beim Theater die diesbezüglichen Anstrengungen eingestellt hättest, wer weiß? Die Entscheidung, etwas zu tun oder eben nicht zu tun, kann auf vernünftigen Abwägungen beruhen – oder auch auf hemmenden Grundannahmen, die objektiv gar nicht richtig sind.
DASCATCH-22-PHÄNOMEN
Das Catch-22-Phänomen bezieht sich auf ein Problem, das nicht lösbar ist! Beispielsweise die Situation des berühmten Hauptmanns von Köpenick. Der bekam keine Arbeit, weil er keinen Pass hatte, und keinen Pass, weil er keine Arbeit hatte. In Joseph Hellers Buch Catch-22 will jemand den Kriegsdienst verweigern, er beruft sich darauf, dass er geisteskrank sei und deswegen Angst vor einem Krieg hätte. Da es aber normal ist, dass man Angst vor einem Krieg hat, kann der Antragsteller nicht geisteskrank sein. Der Antrag wird »folgerichtig« abgelehnt.
Elstner: Das erinnert mich an einen sehr bekannten Autor, den ich einmal zu Gast hatte. Er hat viele Bücher geschrieben, die in über dreißig Sprachen übersetzt worden sind. Es sind sehr philosophische Bücher, auf einem sehr hohen Niveau, aber immer so geschrieben, dass die Leser gut mitgenommen werden und eine reelle Chance haben, den Text und die Gedankengänge nachzuvollziehen. Denn genau das war auch sein Erfolgsrezept.
Kienast: Und von wem hat er das Talent geerbt?
Elstner: Offensichtlich von niemandem. Er kommt aus einer Familie, für die Leistung immer sehr wichtig war. Sein Vater verhalf als Vorstandschef einem internationalen Konzern in den Fünfzigerjahren zu großem Erfolg. Dieser Erfolg dauert bis heute an, jedes Kind kennt den Konzern, die Erwachsenen ohnehin. Die Mutter des Autors war eine sehr fürsorgliche Frau und kam auch aus einem Hause, in dem Leistung viel gezählt hatte.
Kienast: Haben die Eltern viel gelesen und mit ihm über Philosophie gesprochen?
Elstner: Nein, wohl nicht. Im Gegenteil. Den Vater hätte er kaum zu Gesicht bekommen, aber die Mutter habe ihm gegenüber immer wieder erwähnt, was für ein toller, fleißiger Mann der Vater sei. Alle gingen davon aus, dass er auch einmal ein guter Unternehmensleiter würde. Und der Vater ließ keine Chance aus, ihn schon früh mit einflussreichen Personen zusammenzubringen.
Kienast: Aber anscheinend musste das Unternehmen letztlich doch auf den potenziellen Nachfolger verzichten?
Elstner: Weil der überhaupt kein Interesse in diesem Bereich hatte und zunehmend darunter litt, im Schatten des übermächtigen Vaters zu stehen. Er hatte zwar anfangs noch versucht, ihm nachzueifern, war aber nicht in der Lage, mehr als mittelmäßige Ergebnisse zu erzielen, weil er immer den Gedanken hatte, dass seine Leistung ohnehin nicht ausreichen würde, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Je mehr er erreichen wollte, desto schlechter wurden seine Leistungen in Schule und Hochschule. Bis er eines Tages alles hinwarf – er fühlte sich wie ein Versager.
Kienast: Er könnte vielleicht den blockierenden Gedankentrojaner »Ich bin ein Versager« haben. Der hat ihn so zermürbt, dass er allem Fleiß zum Trotz nicht gut genug geworden ist. Und das unabhängig von seinen wirklichen Fähigkeiten. Reine Blockade. Und vielleicht hat er noch einen zweiten Trojaner: »Ohne Leistung zu bringen, bin ich nichts wert.« Letzterer hat ihm womöglich dabei geholfen, sich aus dem tiefsten Inneren hochzukämpfen. Gegen alle Widerstände. Auf einem neuen Territorium – seinem eigenen! Er ist jedenfalls ein Beispiel dafür, dass diese Grundannahme aus seiner Lebensgeschichte zu erklären ist. Der daraus entstandene Trojaner ist also auch mit Perspektive I zu erklären.
Elstner: O. K. Also – wenn wir ein Verhalten durch Erlebnisse in der Vergangenheit erklären können, beziehen wir uns auf die App aus Perspektive I, wenn nicht, dann auf Perspektive II?
Kienast: Ja.
Elstner: Und die Geschichte geht noch weiter: Zu Hause ahnte lange niemand etwas von seinen eigentlichen Interessen. Auch nicht die Mutter oder seine Geschwister. Und er wiederum ahnte nichts von seinen treibenden Grundannahmen. Sein »Philosophie-Coming-out« lief komplett verdeckt. Sein Vater war über diese Entwicklung natürlich sehr enttäuscht und strich die Unterstützung für das mittlerweile schon recht lange andauernde Studium. In der Familie war reine Gedankenarbeit nichts wert. Geldarbeit stand oben. Es folgten daher einige Jahre, in denen unser Autor – ohne zu wissen, was er mit sich anfangen könne – in den Tag hineinlebte, ohne jede Idee, was er mit seinen Fähigkeiten anfangen könnte. Bis er bei den geisteswissenschaftlichen Instituten seiner Hochschule Anschluss und Förderung fand und die Professoren überrascht feststellten, dass er in einigen Bereichen extrem begabt war – zum Beispiel in Philosophie. Zu ihr ist er übrigens gekommen, weil er über viele Jahre Tagebuch geschrieben und so gelernt hatte, sein Leben zu reflektieren. Seine Erkenntnisse, seine Gefühle, seine Fragen und mögliche Antworten hat er dann in den Mittelpunkt seiner Arbeit gerückt. Dazu kamen seine Leidenschaft für Musik, Literatur und die Diskussionen mit Personen, die außergewöhnliche Visionen hatten und deren Gedanken sich nicht immer nur um ein Thema drehten wie bei ihm daheim.
Kienast: Hast du ihn fragen können, wie er sich in diesen Jahren selbst eingeschätzt hatte?
Elstner: Wie gesagt, er war fest davon überzeugt, als der Versager der Familie zu gelten – was ja auch aus der Perspektive der prägenden Familie der Fall war. Seinen Fleiß und das Engagement hat er dann aber doch aus dem Antrieb gezogen, seinem Vater zu zeigen, dass er sehr wohl etwas erreichen kann; die Lektion »Ohne Fleiß keinen Preis« hatte er in seiner Familie ja gut verinnerlicht. Der Wille zum Durchhalten war also vorbereitet, es fehlten lediglich das passende Ziel und die entsprechende Prise Glück, um zum richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. In unserem Gespräch hat er es selbst so formuliert: »Da habe ich wohl Glück gehabt. Das hätte auch völlig anders laufen können.«
Kienast: Ich fasse einmal psychologisch zusammen. Erstens: Er hat Lernerfahrungen gemacht, die ihn zu einem durchhaltefähigen, arbeitsamen, aber auch verwundbaren Mann mit einem exzellenten literarischen Stil gemacht haben – seine biografische Prägung hat sozusagen eine Leistungs-App installiert. Das ist der erste Teil seines Erfolges.
Zweitens: Er hat immer wieder erlebt, die Erwartungen seines Vaters nicht erfüllen zu können. Sehr wahrscheinlich hat er sich an seinem Platz am Esstisch neben dem Patriarchen nicht wohlgefühlt und aus dessen Verhalten automatisch gedeutet, dass er den Platz am Tisch nicht verdient habe. Genau hier greift wieder die Grundannahme, ein Versager zu sein. Und hier kommen wir an den entscheidenden Punkt: Wie entscheidet er sich? Gibt er auf und resigniert, oder spornt ihn der Gedanke, »dem Vater genügen zu wollen«, erst recht zu Höchstleistungen an? Die beispielhafte Szenerie am Esstisch erzeugt in diesem Fall symbolisches Lernen. Die symbolische Gleichung seiner ursprünglichen Erfahrung lautet: »Ich verfehle (≠) die Erwartungen der Familie.« Ergebnis sind Gefühle von Scham, Schuld und vielleicht sogar auch der Eindruck einer eigenen Minderwertigkeit. Diese wiederum sind starke Antreiber dafür, etwas zu leisten, um sich aus der Falle zu befreien. Scham ist nichts anderes als eine Form von Angst, und Angst kann bekanntlich Flügel verleihen. Und Schuld löst den Handlungsimpuls zur Wiedergutmachung aus. Und Minderwertigkeit erzeugt entweder Lähmung und Zurückhaltung oder aber eine äußerst hohe Leistungs- und Leidensfähigkeit. Und das alles nur, um diese Gefühle weniger quälend erleben zu müssen. So entsteht aus solchen inneren Glaubenssätzen nicht selten viel Ansporn und führt zu Ergebnissen, die sich sehen lassen können.
MENTALETROJANERUNDVIREN
Sammeln Sie allgemeingültige Aussagen, die Ihr Leben stark beeinflussen, von denen Sie sich aber nicht erklären können, woher sie kommen (also nicht Apps aus Perspektive I). Solche Aussagen können jedoch ähnlich wie in Perspektive I lauten, zum Beispiel: »Ich bin ein unsicherer Mensch«, »Die Welt ist kalt und abweisend«, »Ein Indianer kennt keinen Schmerz«, »Gefühle zeigen heißt, Schwäche zeigen« usw. In dieser Perspektive II brauchen Sie sich aber nicht mehr bemühen, Gründe dafür zu finden, warum Sie so sind. (Ursachen sind hier sehr wahrscheinlich mangelnde Erinnerungsfähigkeit oder symbolisches Lernen.)
Fassen Sie die Liste der von Ihnen gefundenen Aussagen zu 1 bis maximal 3 übergeordneten Prinzipien zusammen. Diese sind Ihre mentalen Trojaner bzw. Viren.
Beobachten Sie nun in den nächsten drei Tagen, wie oft diese Trojaner Ihr Verhalten lenken, und unterscheiden Sie, welche davon hilfreich sind und welche nicht.
3 Warum unsere Herkunft uns immer noch im Griff hat (Perspektive III)
Elstner: Halten wir noch einmal fest: Die Erfahrungen, die wir machen, und unsere Leitsätze beziehungsweise Grundannahmen prägen unser Verhalten.
Kienast: Genau! Aber dabei sind diese Leitsätze meist die Folge direkter Lehren, die wir aus einzelnen Lebensereignissen gezogen haben – was wir hier Perspektive I nennen. Dagegen haben wir die Folge viralen symbolischen Lernens, dessen Ursache nicht mehr gefunden werden kann, als Perspektive II bezeichnet. Diese Sätze sind in unserem Gehirn quasi in Stein gemeißelt, wirken absolut überzeugend, selbst dann noch, wenn wir mittlerweile eine Fülle von Gegenbeweisen gesammelt haben und Erfahrungen machen mussten, die ganz anders waren, als uns diese Sätze weismachen wollten. Da sind wir fast unbelehrbar. Nimm zum Beispiel einen Unternehmer, der bis ins hohe Alter jeden Morgen ab Punkt 7 Uhr im Büro sitzt. Zu Beginn seiner Karriere war das sicher angebracht, aber mit 75 sollte er sich eher schonen und seine Anstrengungen zurückfahren. Doch sein alter Leitsatz »Morgenstund hat Gold im Mund« triumphiert über seinen Verstand. Außerdem hat er irgendwann einmal die Erfahrung gemacht, dass er vormittags am besten verhandeln kann. Beides – die Prägung durch unsere Leitsätze wie auch die Prägung durch Erfahrung – sind ungeheuer starke Motoren, die unser Denken, Fühlen, Verhalten und unsere Entscheidungen mit enormer Wucht beeinflussen. Im Guten wie im Schlechten. Das Problem ist, diese Prägungen tauchen oft ungefragt auf und fühlen sich durch und durch überzeugend an – so ticken wir eben. Obwohl unser Kopf manchmal sogar erkennt, dass das Verhalten, zu dem wir gedrängt werden, ein Fehler ist, korrigieren wir es nicht. Außenstehende können das verständlicherweise meist nicht nachvollziehen und glauben, dass wir nicht mehr richtig ticken.
Elstner: So weit verstanden. Aber was kommt nun noch hinzu? Was leitet uns noch?
Kienast: Jetzt kommt der dritte wichtige Teil, der dem Leben vieler Menschen eine Richtung gibt: Der Auftrag, der uns – ausgesprochen oder unausgesprochen – von unseren Familien oder den Personen, mit denen wir aufgewachsen sind, erteilt wird. – Diesen Blickwinkel nennen wir hier Perspektive III. In unserem Fachjargon bezeichnen wir das als unsere ganz persönliche »systemische Prägung«. Diese dritte Perspektive sollten wir uns unbedingt noch anschauen, wenn es darum geht, verstehen zu lernen, wie unsere persönliche Psyche funktioniert.
Elstner: Du meinst die Rolle, die man in seiner eigenen Familie einnimmt?
Kienast: Ja. In der Familie oder aber auch in prägenden Gruppen außerhalb der Familie, mit denen man sich verbunden fühlt. Ob gewollt oder aufgedrängt, ob bewusst oder unbewusst erlernt. Bei Familien gibt es ja die unterschiedlichsten Modelle. Vielleicht ein bekanntes Beispiel: Bei Landwirten bestimmter Regionen war es früher so, dass von vornherein klar war, dass der erstgeborene Sohn den Hof übernehmen wird. Gefragt wurde der zukünftige Hofbesitzer meist nicht. Er wurde da »hineinerzogen«. Damit war sein Schicksal besiegelt, da gab es selten Alternativen.
Elstner: Manchmal gibt es in den Familien große Widerstände, wenn der Hoferbe ganz andere Pläne hat …
Kienast: Genau – sich solche Ausnahmen von ausgesprochenen oder unausgesprochenen Regeln zu erlauben, ohne dabei in einen Konflikt zu geraten, ist innerhalb eines Systems, hier der Familie, oft nicht leicht. Und zwar für alle Beteiligten. Eine Regel gebrochen und damit bestimmten Erwartungen nicht entsprochen zu haben führt in den allermeisten Fällen zu Schuldgefühlen und Enttäuschung. Kurz: Bei der »schuldigen« Person entsteht für gewöhnlich der machtvolle Gedanke »Ich bin nicht okay«, denn sie enttäuscht dabei ihre engsten Menschen und steht vielleicht sogar als Sippenverräter da. Allein und schuldig. Ich habe die Bilder gerade mal etwas stark gezeichnet, damit das Dilemma deutlich wird.
Elstner: Ich denke, solche Konflikte waren früher sicher deutlich ausgeprägter als heute.
Kienast: Weil derjenige, der aus seiner Rolle ausbrechen wollte, selten die Wahl hatte, das auch zu tun. Das ist heute anders, wir befinden uns in einer Zeit, in der die Gefühle eines Einzelnen eine immer höhere Bedeutung erlangen und gleichzeitig der Pragmatismus zurücktritt. So etwas erzeugt große Spannungen in Systemen, und das kann sich eine Einzelperson nur leisten, wenn für die Grundbedürfnisse der meisten Gesellschaftsmitglieder gut gesorgt ist. In Familien trifft man übrigens oft auf dieselben Strukturen wie in den großen Unternehmen, auch in Großfamilien findet man Positionen wie den Boss, den Beirat, die aufopferungsvolle Seele, den Außenminister, natürlich den Narren, Faulpelz, Abenteurer und so weiter.
Elstner: Und die vakanten Positionen werden an den Nachwuchs weitergegeben?
Kienast: Meist unausgesprochen. Die Kinder wachsen da hinein – der Sohn hilft dem Vater, die Tochter der Mutter. Ein geduldiges, ausdauerndes und aufmerksames Kind neigt eher dazu, nach einem kranken Haustier zu schauen, als ein ungestümes, wildes und abenteuerlustiges Kind, das im Herbst mit dem Onkel im Wald Bruchholz einholt. Und mit dem Älterwerden wachsen die Aufgaben. Aus der Tierpflege wird später die von der Familie dann schon erwartete Fürsorge für die Großeltern, aus dem Bruchholzholen wird die von der Familie erwartete ehrenamtliche Tätigkeit bei der freiwilligen Feuerwehr und bei sämtlichen Umbauarbeiten am Haus, die über die Jahre so anfallen.
Elstner: Also wird nicht mehr hinterfragt, wer was macht, sondern es passiert automatisch. Die eigentlichen Talente gehen dabei vielleicht unter, weil man den Nachwuchs nur über die vorgesehene Rolle definiert – die ja meistens das verlangt, was der Familie nützt.
Kienast: Genau. Und damit werden auch andere Dinge automatisch übernommen, die meist ebenso wenig hinterfragt werden. In Systemen, in denen die Frauen das Sagen haben, lernen die Jungs, sich unterzuordnen, und warten immer darauf, dass es Anweisungen durch die Frauen gibt. In einer Umgebung, in der versucht wird, Probleme mit Alkohol zu lösen, lernen sie genau das. Es ist die systemische Prägung, die später so vieles selbstverständlich werden und automatisch ablaufen lässt, auch wenn es schon längst nicht mehr ins Leben passt.
Elstner: Und was ist mit den wirklichen Talenten und Wünschen?
Kienast: Viel wird verschüttet, aber deswegen ist das Ausziehen von zu Hause auch so wichtig. Um den Kopf frei zu bekommen, etwas anderes zu erleben, Verantwortung zu übernehmen, sich ausleben …
Elstner: Und dann ein selbstbestimmtes Leben führen?
Kienast: Ja, aber das klappt nicht immer. Viele der jungen Erwachsenen wiederholen – nachdem sie sich in scheinbarer Selbstbestimmtheit ausgetobt haben – völlig reflexartig die alten Muster. Statt ihren tatsächlichen Neigungen zu folgen, übernehmen sie das, was sie aus ihrem Elternhaus kennen: Sie reagieren intuitiv auf die Rolle, die sie bereits im Rahmen ihrer systemischen Prägung eingenommen haben, und übertragen die alten Lebensweisheiten, Tätigkeiten und das eingeübte Rollenverhalten auf ihr neues Leben. Nicht selten eben auch, obwohl es nicht passt.
Elstner: Also sollte man deswegen ruhig einmal die Gepflogenheiten, Erwartungen und Rollenverteilungen in der Familie thematisieren?
Kienast: Das ist eine exzellente Idee. Denn sonst verwechseln die Menschen die aufoktroyierte Rolle, das aufgezwungene Denken mit dem, was sie wirklich wollen und können. Perspektive III einnehmen bedeutet also, dass sie den Einfluss ihres prägenden Systems auf ihr Selbstbild erkennen. Und dadurch vielleicht plötzlich verstehen, warum sie ticken, wie sie ticken …
Elstner: Fazit: Nur weil wir es gewohnt sind, dass etwas so gemacht wird, heißt es noch lange nicht, dass es auch so gemacht werden muss. Und nur weil eine Person durch eine bestimmte Rolle in einer Familie oder einem System geprägt worden ist, heißt das noch lange nicht, dass sie diese Rolle auch später noch freudig einnehmen wird und ihren Begabungen und Neigungen entspricht.
Kienast: Ja. Aber genau durch das Wissen über diesen Zusammenhang entsteht Power für den Kopf, weil man darüber mehr gedankliche Ruhe schaffen kann. Plötzlich erkennt die Person, dass sie eine Wahl für ihr Verhalten hat und nicht nur reflexartig den tatsächlichen oder scheinbaren Wünschen anderer folgen muss. Und das hat einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität!
MEINESYSTEMISCHEPRÄGUNG
Ende der Leseprobe